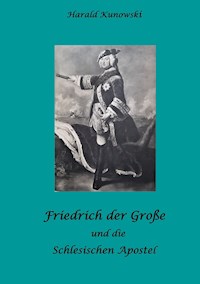
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Zuge der Gegenreformation wurden die Protestanten Schlesiens ihrer Kirchen beraubt. Durch das Verbot von Gottesdiensten und die Vertreibung ihrer Geistlichen wurden sie an der freien Ausübung ihres Glaubens behindert. Fast neunzig Jahre dauerte dieser beklagenswerte Zustand an, bis Friedrich des Große im Jahre 1740 mit dem Ziel der Befriedigung alter Gebietsansprüche in Schlesien einmarschierte und den notleidenden Protestanten zur Wiedererlangung ihrer kirchlichen Rechte verhalf. Zu Beginn seines siegreichen Feldzugs startete er unmittelbar nach seinem Grenzübertritt, beeindruckt von der Not der Protestanten, ein Hilfsprogramm. Er befahl Johann Gustav Reinbeck, zuständig für die Rekrutierung preußischer Pfarrer, als erste Maßnahme zwölf Brandenburgische Geistliche nach Schlesien zu entsenden. Sie gingen als die zwölf schlesischen Apostel in die Geschichte ein. Der König ließ weitere Prediger folgen, bis die meisten schlesischen Gemeinden nach etwa 1 ½ Jahren über einen protestantischen Pfarrer verfügten. In der vorliegenden Schrift wird das teilweise von schwierigen Umständen geprägte Leben und Wirken dieser Pfarrer in ihren Gemeinden beschrieben, die nach fast 90 Jahren Entbehrung ihre kirchlichen Rechte wiedererlangt hatten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Geschichtlicher Vorspann
1.1. Der preußische Winteroffensive 1740/41
1.2. Die Unterdrückung der schlesischen Protestanten
1.3. Erste Maßnahmen zur Wiedergewinnung ihrer kirchlichen Rechte
2. Die zwölf schlesischen Apostel
2.1. Ihre Rekrutierung und Ordinierung in Berlin
2.2. Die Entsendung nach Schlesien und Vokation in Rauschwitz
2.3. Der Abschluß ihrer Mission
2.4. Ihr Leben und Wirken in den schlesischen Gemeinden
2.4.1. M. George Sigismund Kunowski
2.4.2. Martin Friedrich Frisch
2.4.3. Gottlieb Weinreich
2.4.4. Nikolaus Scholze
2.4.5. Justus Andreas Grentzel
2.4.6. M. Heinrich Otto Kegel
2.4.7. Carl Wilhelm Thiele
2.4.8. Johann Gottlieb Pitschky
2.4.9. Samuel Benedikt Carstedt
2.4.10. Johann Heinrich Prasuhn
2.4.11 Johann Siegmund Steinbart
2.4.12. M. Ernst Carl Wiegand
3. Die Rekrutierung weiterer Pfarramtsanwärter in Schlesien
3.1. Die Ordinierungen vom 9. Feb. 1741 (Nr. 13-22)
3.2. Die Entsendung 10 weiterer Pfarrer am 23. Feb. 1741 (Nr. 23-32)
3.3. Die Prüfung weiterer 18 Kandidaten am 23. Feb.1741
3.3.1. Die Predigerkandidaten 33- 42
3.3.2. Die Predigerkandidaten 43- 50
4. Auf dem Wege zur preußischen Vorherrschaft in Schlesien
4.1. Militärische Erfolge der preußischen Armee
4.2. Die Huldigungen der schlesischen Stände und Bürgerschaften
5. Die Einführung einer preußischen Verwaltungs- und Kirchenreform
5.1. Neuordnung des schlesischen Kirchenwesens
5.2. Die neue Presbyterialordnung
5.3. Die Ordnung der kirchlichen Gebühren
5.4. Die Genehmigung und Errichtung von evangelischen Bet- und Pfarrhäusern
5.5. Die Ausdehnung der protestantischen Rechte im öffentlichen Leben
6. Die Ordinierung weiterer evangelischer Pfarrer
6.1. Ordinierungen in Breslau
6.2. Ordinierungen in Glogau
6.3. Ordinierungen in Berlin-Cölln
7. Die neuen evangelischen Pfarrer in ihrem Arbeitsumfeld
7.1. Dankes-Predigten und Gebete für Friedrich II.
7.2. Ungeregelte Zuständigkeiten
7.3. Vergütungsprobleme der neuen Pfarrer
7.4. Streitigkeiten um die Kirchengebühren (Taxa Stolae)
7.4.1. Die Benachteiligung evangelischen Lebens
7.4.2. Beschwerden über die Mißachtung der bestehenden Gebührenordnung
7.5. Verordnungen zum toleranten Umgang mit anderen Konfessionen
7.5.1. Verketzerung durch den katholischen Klerus
7.5.2. Die Achtung der katholischen Religion durch die neuen evangelischen Pfarrer
7.6. Sonst. Verordnungen
7.6.1. Dienstanwesenheit der neuen evangelischen Pfarrer
7.6.2 Wider das Führen von Rechtsstreiten
8. Literaturverzeichnis
9. Anlagen
9.1.Schlesische Pfarrer
9.2. Ev. Gemeinden
Vorwort
Bereits zu Lebzeiten des großen preußischen Königs häuften sich die literarischen Neuerscheinungen über sein Leben und seine Taten in dem Maße, dass verschiedene Literaten zu Beginn ihrer Ausführungen um Nachsicht baten, der Leserschaft ein weiteres Werk über Friedrich II. vorzulegen.
Die damaligen Autoren ahnten nicht, dass in der Folgezeit bis zum heutigen Tage die Flut von Veröffentlichungen weiter zunehmen würde, besonders in der Zeit des zweihundertjährigen Gedenkens seines Todestages und des dreihundertsten Geburtstages im Jahre 2013. Der Stand der Forschungen um die Person Friedrichs II. hat heute einen beachtlichen Stand erreicht.
Einen der ersten Themenschwerpunkte um den jungen Monarchen bildete schon in der damaligen Literatur die Annexion Schlesiens. Wesentliches Gewicht lag auf der Beschreibung der militärischen Operationen der preußischen Armee mit dem Ziel die angeblich legitimen Gebietsansprüche einzulösen. Weniger breiten Raum nimmt die seit Jahrzehnten anhaltende religiöse Unterdrückung der Schlesischen Protestanten durch die katholische Minderheit ein.
Bei seinem Einmarsch in Schlesien konnte sich Friedrich II. hierüber gewissermaßen aus erster Hand ein Bild verschaffen. Eine seiner ersten Maßnahmen zur Behebung der allergrößten Not war die Entsendung der sog. „Schlesischen Apostel" an die evangelischen Gemeinden in zunächst Nieder-, dann Oberschlesien. Hierbei handelte es sich um zwölf Prediger aus der Mark Brandenburg, die innerhalb von wenigen Wochen vor Ort zur Verfügung standen, um die ersten evangelischen Gottesdienste abzuhalten. Sehr schnell stellte sich heraus, das diese Maßnahme wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirkte. Es kam zur Rekrutierung weiteren Pfarrpersonals im Preußischen Feldlager, zeitweise von militärischen Feldzügen unterbrochen.
Ca. 18 Monate gingen ins Land, bis der Bedarf an Pfarrern in den Gemeinden hinreichend gedeckt war und der Bau von Bethäusern abgeschlossen bzw. in die Wege geleitet war. Begleitet wurden die von Friedrich dem Großen eingeleiteten Maßnahmen von einer Vielzahl neuer Regelungen nach überwiegend preußischem Muster mit dem Ziel der Normalisierung des interkonfessionellen Lebens und damit verbundenen Gleichberechtigung der verschiedenen Religionen.
Die neuen evangelischen Pfarrer haben mit ihrem Pioniergeist und einer zielgerichteten Beharrlichkeit zur erfolgreichen Umsetzung und der Wiederherstellung eines erquicklichen Gemeindelebens wesentlich mit beigetragen. Informationen über das Leben und Wirken nicht nur der 12 Apostel, sondern der mehr als 120 neu installierten Pfarrrer waren bisher nur schwer zugänglich. Vor allem durch die Digitalisierung alter Schriften in Deutschland wie in Polen hat sich die Verfügbarkeit entsprechender Informationsquelle in den zurückliegenden Jahren deutlich verbessert.
Damit waren wesentliche Voraussetzungen erfüllt mit der vorliegenden Schrift den Versuch einer in sich geschlossenen Darstellung der von Friedrich dem Großen in die Wege geleiteten Hilfsmaßnahmen zugunsten der Schlesischen Gemeinden einschließlich der in diesem Zusammenhang erlassenen Dekrete einerseits sowie dem Leben und beruflichen Wirken der neuen Pfarrer in ihren Gemeinden zu unternehmen.
1. Geschichtlicher Vorspann:
Im sechzehnten Jahrhundert fanden die lutherischen Lehren in Schlesien großen Anklang und veranlassten die überwiegende Zahl der Anhänger christlicher Konfession aus allen Bevölkerungsschichten zur Konvertierung zum protestantischen Glauben. Die damaligen Bischöfe ließen es zu, dass sich ihre Untertanen zur Augsburger Konfession bekannten und mahnten zur Toleranz gegenüber denen, die, weitaus in der Mehrheit, ihre Konfessionszugehörigkeit wechselten. Sie blieben selbstverständlich in ihren Kirchen, in denen nunmehr auch protestantischer Gottesdienst abgehalten wurde. Die evangelischen Söhne wurden als Erben ihrer katholischen Väter angesehen. Keiner kam auf die Idee, dass man mit Änderung seiner Konfession sein Erbrecht auf die Kirche und die jeweiligen Kirchengüter verlieren und sie eines Tages die ehemaligen (katholischen) Besitzer zurückverlangen würden, auch wenn die Gläubigen, die diese Kirche einst aufgesucht haben, nicht mehr existieren. Diesen Gedanken griff die Gegenreformation auf und drängte auf eine Wiederherstellung der alten Verhältnisse, in der der Protestantismus keinerlei Rechte auf ein unter Katholiken aufgebauten Kirche sowie deren Einrichtung hatte.1
Im Jahre 1609 bestätigte Kaiser Rudolph II. die Toleranz unter den Religionen und die Freiheit in der Ausübung des evangelischen Glaubens für Schlesien in seinem sog. Majestätsbrief. Dieser beinhaltete zugleich die Freiheit Kirchen zu bauen sowie eine durchgehende protestantische Kirchenorganisation zu schaffen, was in erster Linie auf Drängen der evangelischen Stände zustande kam. Rudolf konnte dieses Gebot nicht lange aufrecht erhalten, denn die Kräfte der Gegenreformation gewannen immer mehr die Oberhand. In Österreich hatte man bereits gegen Ende des sechzehnten Jh. damit begonnen von evangelischen Gläubigen genutzte Kirchen zu schließen und deren Pfarrer ihres Amtes zu entheben und zu vertreiben. Zum Zeichen der Ablehnung des Protestantismus ließ der 1619 an die Macht gekommene Nachfolger Ferdinand II., in jesuitischer Erziehung herangewachsen, den Majestätsbrief seines Vorgängers 1620 zerschneiden. Der schlesische Adel, die konvertierten Grundherrn sowie von ihnen unterhaltenen Bauern wurden gezwungen sich zum Katholizismus zu bekennen. Die Rekatholisierungsbemühungen Ferdinands II. in allen Ländern unter Habsburger Einfluss stießen auf Widerstand auf evangelischer Seite und und führten schließlich zum dreißigjährigen Krieg, in der die katholische Seite zwar geschwächt aber noch immer die Unterdrückung der Protestanten als religionspolitisches Ziel verfolgte. So kam es u.a. im Glogauschen, eine der am härtesten betroffenen Regionen, im Jahre 1657 zur kompletten Schließung aller evangelischen Kirchen, zur Vertreibung der Pastoren und dem Verbot der Ausübung evangelischer Gottesdienste. Die Jesuiten als verlängerter Arm des Kaisers halfen dabei die Kirchen in katholischen Besitz zu überführen, und ließen sie danach ungenutzt, zumal sie sie mit dem geringen katholischen Bevölkerungsanteil nicht annähernd füllen konnten. Von da an war die evangelische Bevölkerung aller offizieller gottesdienstlicher Aktivitäten beraubt und die evangelischen Gotteshäuser dem zunehmenden Verfall ausgesetzt.
Über Jahrzehnte war keine Besserung der prekären Lage in Sicht. Die Habsburger Unterdrückungspolitik gegenüber nicht-katholischen Konfessionen hielt über mehrere Generationen von österreichischen Kaisern gleichermaßen als politisches Erbe fortgeführt und unterstützt durch die zu allen Zeiten ausgeübten unseligen jesuitischen Unterdrückungsmaßnahmen an. Eine geringfügige Verbesserung trat für die evangelische Bevölkerung ein, als Kaiser Josef I. in der Altranstädter Konvention von 1707 sich von dem schwedischen König Karl XII. eine Vereinbarung abringen ließ, die:
1. eine Rückgabe von 126 Kirchen in den früher von protestantischen Fürsten regierten Teilstaaten Breslau (4), Brieg (60), Liegnitz (32), Wohlau (16), Oels (5) und Münsterberg (9) beinhaltete2 und
2. zuließ, dass die bisher als Bethäuser errichteten Friedenskirchen Schweidnitz, Jauer und Glogau jeweils einen Glockenturm und ein Glockenspiel erhalten sollten.
3. Genehmigung des Kaisers Joseph I. zum Bau von sechs evangelischen sog. Gnaden-Kirchen in den schlesischen Städten Freystadt, Hirschberg, Landeshut, Militsch, Sagan und Teschen in den Jahren 1709 bis um 1714. Vier von ihnen waren Fachwerkbauten, die mit einem Glockenturm ausgestattet werden und zusätzlich einen freistehenden Turm erhalten durften. Die Gnadenkirchen in Hirschberg und Landeshut waren getreue Kopien der Stockholmer Katharinenkirche, was auch die Dankbarkeit der Bevölkerung gegenüber dem schwedischen König ausdrücken sollte.
Als fünfter Kaiser nach Leopold I, dem Bruder Josef I., folgte Karl VI., der in den eigenen Reihen Anhänger des lutherischen Glaubens duldete und auf sie angewiesen war, ihnen jedoch keine weiteren Rechte während seiner bis 1740 währenden Amtszeit einräumte. Einer seiner engsten Vertrauten war Prinz Eugen von Savoyen, der das Habsburger Reich 1716 in einer entscheidenden Schlacht in Serbien erneut vor den Türken bewahrte. Dieser war zugleich ein bekennender Anhänger der protestantischen Aufklärungstheologie von Johann Gustav Reinbeck.3 Dieser sorgte später auf Befehl Friedrich des Großen dafür, dass nach fast neunzig Jahren die ersten evangelischen Prediger auf schlesischem Boden wieder das Wort Gottes verkünden konnten.
Noch in den dreißiger Jahren des 18. Jh. spielten sich verschiedene Unterdrückungsdramen unter Karl VI. in Böhmen und im Salzburger Land ab, wo mehr als Zehntausende evangelischer Bewohner durch die katholischen Verfolger höchster Lebensgefahr ausgesetzt waren und unter Aufgabe von Hab und Gut ihr Land verlassen mussten. Friedrich Wilhelm I., seit 1713 König in Preußen, nahm weit über zehntausend Protestanten aus dem Salzburgischen auf und siedelte sie Anfang der dreißiger Jahre in und um Berlin und sowie in Nordpreußen an. Noch ein Jahr vor seiner Machtübernahme bereiste der Kronprinz Friedrich mit seinem Vater die neu erschlossenen und mit Flüchtlingen vor allem aus Polen-Litauen besiedelten Gebiete in Nordpreußen und äußerte sich in einigen Briefen an Voltaire beeindruckt über die erfolgreiche Besiedlungspolitik seines Vaters4. Der Kronprinz Friedrich begleitete den Vater auf seinen Reisen und und zeigte sich beeindruckt von den väterlichen Besiedlungsmaßnahmen.
1.1. Der preußische Winteroffensive 1740/1741
Kaum hatte Friedrich II sein Amt angetreten, als wenige Wochen später der Habsburger Kaiser Karl VI., einer der Hauptkontrahenten Preußens unerwartet am 20. Oktober im Alter von 55 Jahren ohne männliche Thronfolge starb. Nicht nur im Habsburgischen Einflussbereich herrschte Entsetzen und große Trauer. Karl VI. stand hoch im Ansehen, er galt als gütiger Herrscher, denn „er hatte in seinem Leben mit Gerechtigkeit, Gnade und Huld regiert"5. Die unterdrückten Protestanten hatten ihrer Majestät ihre Lage nie zur Last gelegt, weil seine Befehle zu keiner Zeit gegen sie gerichtet waren, sondern die für ihre Lage Verantwortlichen unter den katholischen Geistlichen und Kirchen-Ministerien zu suchen waren, die am Wiener Hofe politischen Einfluss, gesteuert durch die römische Kurie gegen die evangelische Bevölkerung im Habsburger Reich, ausübten. Als Karl VI starb, erschraken die Schlesier „von Herzen", aus Trauer und wohl ebenso aufgrund der Ungewissheit darüber, wie es weitergehen werde, denn der Kaiser starb ohne männlichen Erben. Es bestanden überwiegend Zweifel daran, dass eine weibliche Monarchin in der Lage sei, seine Nachfolge von Erfolg gekrönt anzutreten. Einige Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit hatten diese Bedenken eindrucksvoll belegt, wie etwa Anne Stewart, Königin von England.
Der preußische Monarch nutzte das eingetretene Machtvakuum, um eine alte Rechnung zu begleichen. Aus dem Jahre 1537 gab es noch verbriefte Erbansprüche Preußens gegenüber Schlesien, die Friedrich II. kurzer Hand beschloss in dieser Situation geltend zu machen.
Er zögerte nicht, die aus seiner Sicht rechtmäßigen Ansprüche einzulösen, und setzte sich dabei auch hinweg über die von seinem Vater im politischen Testament von 1722 postulierte kriegerische Enthaltsamkeit, ausgenommen den gerechten Krieg, den Friedrich II. in der gegebenen Situation zu führen entschlossen war. Er konnte auf eine durch seinen Vater geschaffene gutgeordnete schlagkräftige Militärmacht blicken6, mit der er ein derartiges Vorhaben in die Tat umsetzen konnte.
Bis heute hat sich die Literatur mit der Frage auseinandergesetzt, warum Friedrich II, der sich vor dem Tod seines Vater in der Abgeschiedenheit des Rheinsberger Schlosses mit philosophischen Themen befasste und für machtpolitische Fragen, die seinen Vater beschäftigten, kein ausgeprägtes Verständnis zeigte, in eine militärische Konfrontation mit dem Hause Habsburg eintreten konnte. Mit seiner Veröffentlichung des Antimacchiaveil, in dem er dem Macchiavellischen Bild des despotischen skrupellosen Herrschers in der Ausübung seiner Macht7 das Ideal des Herrschers entgegensetzte, der sich an Recht und Ordnung hält und als erster Diener seines Staates versteht, trug er zu einem Persönlichkeitsbild bei, das ihn als idealen verständnisvollen Herrscher darstellte. Umso mehr war die Öffentlichkeit überrascht, dass Friedrich II. bei seinem Einmarsch zu ähnlichen Mitteln griff, die er in seiner Schrift gegen Macchiavell verurteilte, so wie er etwa zum Beginn der Mobilmachung mehrere irreführende Verlautbarungen durch den Grafen Podelwils verbreiten ließ.
Genau acht Tage nach dem Tod von Karl VI. begann der junge Monarch mit der Mobilmachung. Er teilte seinen Entschluss zur Besetzung Schlesiens seinem obersten Heerführer und General-Feldmarschall Kurt Christoph Graf von Schwerin sowie dem Staats- und Kriegsminister Heinrich Graf von Podewils mit. Von Rheinsberg aus beorderte Friedrich II. verschiedene ranghohe Offiziere mit besonderen Aufgaben, wie etwa Oberst Lestwitzaus dem Infanterie-Regiment des Generals von Jeetze, einen Schlesienkenner sowie den Generalquartiermeister de Moulin, der für die Unterbringung der Truppen sowie deren Versorgung in Schlesien zuständig sein sollte.8
Anfang November erging der Befehl alle Vorbereitungen zu treffen, um die Truppen in einen marschfertigen Zustand zu versetzen. Friedrich II. war darum bemüht die Öffentlichkeit von seinem Vorhaben abzulenken und verfasste eine entsprechende Ordre an Graf Podewils:
„Ich habe den zum Marsche bestimmten Regimentern befohlen, Pferde anzukaufen und sich marschfertig zu halten. Verbreiten Sie in Berlin, ich hätte die Nachricht erhalten, der Kurfürst von der Pfalz litte an Ohnmachten und man fürchte um sein Leben."9 Eine Woche später folgt eine weitere Nachricht an Podewils: „Ich habe den Berliner Regimentern eine falsche auf Halberstadt lautende Marschordre zugehen lassen, (...) Wir müssen alle möglichen Mittel anwenden, um die Leute ungewiß und ihre sämtlichen Vermutungen haltlos zu machen. Ich hoffe, dass mein Mittel wesentlich dazu beitragen wird. Unterdessen arbeiten wir hier eifrig, und, ist uns der Himmel nicht absolut feindlich, so haben wir das schönste Spiel von der Welt. Meine heutige Marschordre wird hoffentlich viele Couriere in Bewegung setzen. Ich denke, meinen Schlag am achten Dezember auszuführen und damit das kühnste, schnellste und größte Unternehmen zu beginnen, dessen sich ein Fürst meines Hauses jemals unterfangen hat. Leben Sie wohl. Mein Herz weissagt mir und meinen Truppen einen glücklichen Erfolg."10
In der Mitte des Novembers erhielten insgesamt 30.000 Mann den Befehl, in drei Wochen marfchfertig zu fein. Am 20. November kamen sog. Preußifche Proviant-Commiffare in Croffen an der Oder an, die alle Scheunen um die Stadt räumen ließen, damit von den Dorfschaften des Fürftenthums Proviant und Futtermittel für die Pferde hereingefchafft werden könnte, auch die Backöfen in der Stadt Croflen und den umliegenden Dörfern wurden revidiert, die fchadhaften repariret, damit darin beftändig Brot gebacken werden konnte. Sechs Infanterie-Regimenter, ein Cavallerie-Regiment und 300 Hufaren brachen am 24. November aus Berlin auf und kamen in wenig Tagen in Croffen an. Diefe Nachricht wurde dem öfterreichifchen Kommandanten in der Feftung Glogau, Grafen von Wallis, zugetragen, daß er sich eiligst nach Croffen begab, um die Lage vor Ort zu sondieren und mit geeigneten Gegenmaßnahmen zu reagieren.11
Der König warb in einem „Patent wegen des Einmarsches Sr. Königl. Maj. in Preußen Truppen in Schlesien" vom 1. Dezember 1740 für Verständnis bei der schlesischen Bevölkerung:
„Wir, Friedrich von Gottes Gnaden, König in Preußen, entbieten denen sämtlichen Einwohnern des Herzogthums Schlesiens und dessen incorporirte Fürstenthümer und Landen, wes Standes Sie seyn, Unsern gnädigen Gruß und geneigten Willen zuvor."12
In dem Manifest begründete er den Einmarsch nach Schlesien und ließ die Nachricht verbreiten, er lasse seine Truppen in Schlesien einrücken, da durch den Tod des österreichischen Kaisers im Lande eine große Unsicherheit herrsche. Er käme damit möglichen Angriffen Dritter zuvor, die auch sein, des Königs Lande gefährden könne. Im Übrigen verfolge er mit dieser Aktion friedliche und auf Schutz des Landes gerichtete Absichten, wobei er sich auch wegen der alten Ansprüche mit der Königin von Ungarn freundschaftlich vergleichen wolle.
Am 13. Dezember 1740 war der König selbst von Berlin aus gestartet, um sich an die Spitze der Armee unter dem Kommando des Grafen von Schwerin zu stellen. Er kam am 14. Dezember in Crossen an, der letzten Etappe auf preußischen Boden vor seinem Einmarsch nach Schlesien. Hier suchte der Monarch die Gelegenheit mit den schlesischen Landesständen der an Preußen angrenzenden Gebieten zusammenzutreffen und ihnen seine friedlichen Absichten zu erklären, die mit dem preußischen Einmarsch nach Schlesien verbunden waren: Er traf am Mittwoch Mittag, dem 14ten „gewiffe wichtige Perfonen, namentlich zwei von Grünberg, der nächften fchlefifchen Stadt, abgeordnete Edelleute, die in Gefchäften über die Grenze gekommen find, haben die Ehre mit ihm zu fpeifen. Diefen zeigt er flch munter und leutfelig, aufgeräumt, wie wenn keine Laft auf feinem Gemüthe läge. Das Gefchäft diefer zwei fchlefifchen Edelleute, der Eine ift ein Baron von Hocke13, ein Baron von Kestlitz der Andere, war: von Seiten der Stadt und des Amtes Grünberg feierlichen Protest gegen die beabfichtigte Verletzung des fchlefifchen Bodens einzulegen ,wie dies ihnen von der Regierung zu Breslau felber anbefohlen worden. Der Proteft ward in gehöriger Form eingereicht, Friedrich blieb höflich, wie dies feine Art ift und fortwährend auf diefem Marfche bleibt, in oder auf den Proteft; reicht ihn fchweigend einem Pagen oder Secretair. um ihn in das gehörige Fach, oder den Papierkorb zu legen; und ladet die zwei fchlesifchen Herren zur Tafel, eine Ehre die fie annehmen:
„Er wohnt alfo in Grünberg, mein Herr von Hocke?"
„Ganz nahe dabei, Ihro Majeftät, Mein geringes Haus, Schloß Deutfch-Kaffel ift drei Meilen von hier; Ihro Majeftät gehorfamft zu Befehl, falls der Marfch doch unvermeidlich und diefes Weges gehen follte!"14
Bis zum 15. Dezember rückten die Truppen heran, bestehend aus 2 Hauptcorps mit 10 Infanterie-, 1. Curassier- und 2 Dragoner-Regimentern sowie mehreren Bataillonen und Schwadronen.
Unmittelbar vor dem Einmarsch nach Schlesien erging ein Cabinets-Befehl an den Etats-Minister Brandt und den Präsidenten Reichenbach. Krossen 1740, December 16., geschrieben von Eichel, eine kirchliche Fürbitte wegen des schlesischen Unternehmens:
„Nachdem S. K. M. in Preußen, unser allergnädigster Herr, bei denen jetzigen weit aussehenden Zeitläuften aus gerechten Ursachen bewogen und 1740 genöthiget worden , mit einem Theil Dero Truppen einen Marsch anhero Dec. 16 anzutreten, als wollen und befehlen Höchstdieselbe, dass Dero Etats-Minister v. Brandt und Dero Präsident v. Reichenbach sofort die nöthige Verfügung zu machen , damit in denen sämtlichen Kirchen Dero Landen des Allerhöchsten Segen zu dieser zur Erhaltung der Wohlfahrt des teutschen Reiches und zum Besten der bedrängeten evangelischen Kirchen unternommenen Expedition erbeten werden möge."15
Am 16. Dezember schreibt der junge König an Podewils: „Ich habe den Rubikon überschritten mit fliegenden Fahnen und Trommelschlag."16 Friedrich II. überquerte mit seinen Truppen die Grenze nach Schlesien und zog durch das Dorf Läsgen. Noch am selben Tag speiste er zu Mittag auf dessen Einladung hin bei Baron von Hocke und „verbrachte diefelbe Nacht beim Baron von Keftlitz in Schweinitz, welches ein Dorf eine Meile von Grünberg ift." Auf Befehl des Königs- wurde das königl. Manifest durch den Husaren-Obristen Wurm am ersten öffentlichen Gerichtsort angeschlagen und der Bevölkerung gleichlautende Mitteilungen über die friedlichen Absichten des Einmarschs ausgehändigt.
Am 17. Dezember marschierte Friedrich II. mit dem Jäger-Corps in Weichau im Freyftädtifchen Kreise ein. Das dort gelegene Schloß gehörte dem damals noch lebenden alten Grafen von Räder. „Als Se. Majeftät der König dahin kamen, und niemanden von der Herrfchaft, auch keine Meubles allda gefunden, haben Sie solches fehr ungnädig aufgenommen. Denn Sie ftunden in der Meinung, diefes Schloß würde öffentlich bewohnet, und man hätte nur aus Furcht daffelbe verlaffen, auch die Meubles anderswohin in Sicherheit gebracht, als welches Ihro Majeft. nirgends gerne gefehen, ja der König wolte durchaus nicht haben, daß jemand vor ihm flöhe."17
Der junge Monarch rückte unter ungünstigsten Witterungsbedingungen weiter nach Glogau vor und bezog sein Quartier im nahegelegenen Schloss Nieder-Herrndorf, wo er über die Weihnachtstage blieb und sich auf einem Erkundungsritt versuchte ein Bild von Glogau zu verschaffen. Am 26. Dezember hielt der evangelische Geistliche aus Glogau, Johann Friedrich Neumann eine Predigt auf dem Schloss. „Er hatte die Gnade von Sr. Kgl. Majestät beordert zu werden, dass er am dritten Christtage 1740 den Gottesdienst auf dem Schloss zu Niederherrndorf, wo Ihre kgl. Majest. logierten, halten musste. Er war diesem Befehl gefolgt und wurde, nach gehaltener Predigt, besonderer königl. Gnade gewürdigt"18 Obwohl er bei jeder Gelegenheit seine friedlichen Absichten bekundete, war die Bevölkerung, Protestanten wie Katholiken, in höchstem Maße beunruhigt. Insbesondere war die evangelische Gemeinde Glogaus in Schrecken versetzt, denn der Kommandant der Festung Graf Wallis hatte angekündigt, dass die evangelische Kirche vor den Toren Glogaus niedergebrannt werden müsse, da sie die Verteidigung Glogaus behindere. Am Tage vor den preußischen Einmarsch wurde bereits das große Wirthaus vor der Stadt, die Ziegelscheunen und die benachbarte Ertel'sche Mühle in Brand gesteckt und man fürchtete ein Übergreifen der Flammen auf die Kirche, aus der man bereits wichtige Teile des Interieurs in Sicherheit zu bringen begann.19
Der protestantische Graf Logau auf Reithau leistete bei der Kommandantur Fürbitte für die Erhaltung der Kirche, jedoch umsonst. Daraufhin reiste der Graf von Logau Friedrich II. auf seinem Einmarsch entgegen, um das Schlimmste zu verhüten. Es gelang ihm dem König seine Bitte um Verschonung der Kirche vorzutragen, der ihr mit den Worten entsprach: „Ihr seid die ersten Schlesier, die um eine Gnade bitten; sie soll euch auch gewährt werden." Er fertigte ein entsprechendes Handschreiben an den Kommandanten an, in dem er sein königliches Wort gab, dass die Kirche niemals zum Nachteil der Festung gebraucht werden solle, im übrigen käme er nicht als Feind sondern als Freund ins Land. Diese Versicherung konnte unter Mühen noch vor Ablauf der Frist in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember zugestellt werden. Darauf hin nahm Wallis davon Abstand die Kirche niederzubrennen20; „....und dadurch wurde diese Kirche sowol als der Dohm conservirt. Wiewol der König nachhero, als er den 23. Dezember. selbst die Festung recognoscirt, und dabey die Kirche in allerhöchsten Augenschein genommen, gesagt haben soll, daß es nicht schade gewesen wäre, wenn die Kirche abgebrennet worden, weil ohnedem nöthig seyn würde, eine bessere aufzubauen."21
Ohne die Katholiken kränken zu wollen, verabsäumte es der König doch auch nicht, die lang unterdrückten evangelischen Glaubensgenossen nicht im Zweifel über seine Gesinnung zu lassen. Schon am 17. Dez. 1740 befahl er zu Wichau die katholische Kirche seinen Truppen zum protestantischen Gottesdienste zu öffnen; dasselbe geschah auch an anderen Orten. Dagegen gab er bei Jesuiten, auf deren Schlosse Milkau in der Herrschaft Beuthen er den 19. sein Quartier nahm, die Zusicherung, daß Sie an ihm, sofern sie sich auf Kirche und Schule beschränken würden, einen Beschützer finden sollten. Er zog einige von ihnen zur Tafel und sie fühlten sich nicht wenig geehrt, von dem Könige den Titel: Ihro Hochwürden zu erhalten.
Unterdessen marschierte die preußische Armee nach Glogau und belagerte die Festung und die Stadt unter der Führung des jungen Prinzen von Anhalt. Die preußischen Truppen rückten während der letzten Tage des Jahres 1740 weiter nach Breslau vor. Hier sorgte die Nachricht vom Einmarsch Friedrich II. am 16. Dez. 1740 für Beunruhigung. Vor allem unter den Katholiken, besonders unter der Geistlichkeit, war man bestürzt und fürchtete die feindselige Gesinnung der überwiegend protestantischen Bürgerschaft, die auf ein Ende ihrer Unterdrückung hoffte und daher mehr oder weniger offen für Friedrich II. sympathisierte. Viele katholische Amtsträger verließen Breslau und gingen mitsamt ihren Vermögenswerten nach Wien.
Vor den ersten Kontakten mit den Schlesiern erhielten die Soldaten die höchste Order die Bevölkerung zu schonen und unter Strafe von Plünderungen abzusehen. Am 1. Januar 1741 belagerte Friedrich II. die Vorstädte rund um Breslau, ohne dass er auf nennenswerten Widerstand stieß. Er ließ die Nachricht verbreiten, dass er den Breslauern nicht als Feind entgegentreten wolle. In einer Neutralitäts-Vereinbarung wurde festgelegt, dass seine Maj., der König, solange die gegenwärtigen „Konjunkturen" anhalten, den Bürgern und Einwohnern jedes Standes und Religion, auch in den Vororten einschließlich den umliegenden Klöstern eine vollkommene Neutralität, d.h. dass von ihnen keine Huldigung, keine Contribution oder Anlage verlangt werden wird.22
Am 3. Jan. öffneten sich die Tore Breslaus, Friedrich zog mit einer „auserlesenen" Mannschaft ein und bezog im Gräflich Schlegelbergischen Hause Quartier. Die preußischen Truppen zogen weiter, teilweise in ganzen Kompanien durch die Stadt. Friedrich zeigte sich gegenüber der gesamten Bürgerschaft sehr gnädig. Man organisierte für ihn am 5. Jan. 1741 einen öffentlichen Ball. Tags darauf brach er nach Ohlau auf. Hier stieß die preußische Armee auf Widerstand, der am 10. Jan. mit der Kapitulation der Stadt beendet wurde. Die preußischen Truppen zogen weiter nach Neisse, wo sie auf heftige Abwehr stießen. Es kam zu heftigen Bombardements zwischen den Fronten, die nach wenigen Tagen zugunsten der Preußischen Seite beendet wurden. Am 21. Jan. wies Friedrich II. die Regimenter an ihre Winterquartiere zu beziehen. Sie bildeten vier Gruppen vor Glogau, Brieg und Neisse sowie in der Umgebung von Troppau und Jägerndorf.23 Am 25. Jan. verließ Friedrich II. seine Armeen, um sich für mehrere Wochen nach Berlin zu begeben.
1.2. Die Unterdrückung der schlesischen Protestanten
Trotz der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den preußischen Truppen und der vom Hause Habsburg gesteuerten Armee fasste die unterdrückte evangelische Bevölkerung, die zum Beginn des Einmarschs ebenso wie ihre katholischen Mitbewohner beunruhigt waren, zunehmend Vertrauen zu dem „Eindringling".
Die Besitzergreifung vollzog sich bei den meisten schlesischen Städten, ausgenommen die Festungen, ohne Widerstand der Einwohner. Die protestantische Mehrheit der Bevölkerung hatte von vornherein ein gewisses Maß an entgegenkommender Sympathie gegenüber dem evangelisch-reformierten preußischen Herrscher gezeigt, wodurch die Gewinnung des Landes erheblich erleichtert worden ist. Mit der Sympathie einher ging die stille Erwartung Friedrich II. werde sich für die Wiedergewinnung ihrer religiösen Rechte und Bedürfnisse einsetzen.
Die katholische Bevölkerung hingegen sah ihre seit dem Ende des dreißigjährigen Krieges unter der Habsburgischen Führung errungenen kirchlichen Privilegien durch den ungehinderten Vormarsch Friedrich II. in Gefahr. Sie erhoffte sich von der designierten Thronfolgerin Maria Theresia durch ihre energische Gegenwehr eine baldige Korrektur von Veränderungen, die ihre seit mehreren Generationen mithilfe des Habsburger Hauses erreichten Privilegien schmälerten. Erst in einem Manifest vom 24. März 1741 gab die Habsburger Monarchin zum Ausdruck, sie könne den preußischen Vorstoß in keinem Falle akzeptieren und wolle nicht das Geringste von Schlesien abtreten. Außer einer derartigen Erklärung setzte Maria Theresia dem preußischen Monarchen bis zu diesem Zeitpunkt nichts Ernsthaftes entgegen.
Die nach Schlesien vorrückenden Soldaten der preußischen Armeen erfuhren bei zufälligen Kontakten mit der Bevölkerung von den ihnen bis dahin unbekannten Schrecken der von den Jesuiten aktiv betriebenen Gegenreformation. Ein Zeitgenosse berichtete: „Die Königlich Preußischen Herren Offiziere, die solches vorher kaum gewusst oder geglaubt hatten, mussten doch mit großer Verwunderung vor den Ohren ihres huldreichen Königs davon sprechen, wie wunderlich ihnen die bisherige schlesische Kircheneinrichtung an soviel hundert Orten vorkäme, da in manchen 1000 und 3000, ja mehr lutherische Einwohner, die Kirche aber in katholischen Händen zu finden, worin am Sonntag Niemand anders zum Gottesdienste kommen konnte, wenn gleich mit allen Glocken geläutet wurde, auch nicht in Friedenszeiten, seit 90 Jahren ihrer Wegnehmung, (...) kaum dass unter 1000 Einwohnen eines Ortes sich noch 10 oder 20 Katholische befänden: diese Geistlichen müssten reichlich von dem evangelischen Volke erhalten werden und wären ihnen doch mit ihrem ganzen Amte gar nichts am Orte nütze."24 Diesem Nothstande abzuhelfen und die von der Bevölkerung gewünschte konfessionelle Gleichstellung wieder zu erlangen. erklärte sich der König schnell bereit.
1.3. Erste Maßnahmen zur Wiedergewinnung ihrer kirchlichen Rechte
Die schlesische Bevölkerung lebte nach wie vor mit der Sorge, dass sich neben dem militärischen Konflikt auch konfessionelle Auseinandersetzungen bis hin zum Religionskrieg entwickeln könnten. Besonders in der katholische Kirche kam es zu solchen Befürchtungen. Hier gab es erste Überlegungen über mögliche Zugeständnisse gegenüber der unterdrückten Konfession im Interesse einer Konfliktvermeidung. Der König trat jedoch allen Spekulationen, er wolle einen Religionskonflikt austragen, energisch entgegen. Auch ein Akt der Katholiken mit dem Ziel einer partiellen Überlassung ihrer Einrichtungen passte nicht in sein konfessionspolitisches Konzept.
In einem in Berlin verfassten Rescript vom 21. Januar 1741 befahl er seinem Gesandten von Pollmann überall bekannt zu machen:
„Man kennt mich übrigens ganz nicht recht, wenn man mir einen Geift der Verfolgung beimiffet, aller maßen Niemand fo fehr als ich zur Toleranz geneigt, und die katholifchen dürfen fich vor mir weniger, als vor einem proteftantifchen Fürften, welcher es immer fei, fürchten. Daher könnet ihr kühnlich alle Minifter der katholifchen Fürften auch diefes verfichern, daß ich niemals weder in meinen eigenen Staaten, noch in den ganzen übrigen Theilen vom Reiche als dem, was im Weftphälifchen Frieden zum Beften der drei geduldeten und etablirten Religionen im Reiche ftipuliret, den mindeften Eintrag thun werde."25
Friedrich II. trennte klar zwischen Staat und Kirche. Aus politischer Sicht sei ein Volk der Protestanten leicht zu führen. "Die katholifche Religion hingegen etablirt in dem weltlichen Staate einen geiftlichen, allmächtigen Staat; denn die Priefter, welche die Gewiffen beherrfchen und nur den Papft als Oberherren erkennen, find Herren über das Volk, mehr, als deffen Regent." An die Adresse der katholischen Bevölkerung gerichtet, erließ er eine entsprechende Cabinetts-Ordre vom 26. Mai 1742:
„Was im Lande verordnet wird, dessen können sich die darin wohnenden Katholiken nicht entziehen. Es sollen meine katholischen Untertanen frei bleiben, Gott nach Ihrer Art frei zu dienen; sie müssen aber nicht affektiren, vor den Evangelischen in General-Landessachen etwas voraus zu haben..."26
Neben dem Verlust der von ihnen genutzten Kirchen durch die Gegenreformation beklagten die protestantischen Gemeinden vor allem den Verzicht auf Gottesdienste und seelsorgerische Betreuung, die von der katholischer Seite verhindert wurden. Die evangelischen Schlesier baten den preußischen Monarchen, ihnen die Wiedererlangung ihrer religiösen Gleichberechtigung zu ermöglichen. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür war die Wiedereinsetzung evangelischer Geistlicher, die Genehmigung der seit langer Zeit verbotenen Gottesdienste in ihren jeweiligen Gemeinden, und die Rückgabe ihrer ehemaligen Gotteshäuser, die sich bis auf wenige Ausnahmen in der Hand der Katholiken befanden.
Um in Schlesien wirklich Fuß zu fassen und als neuer Herrscher Akzeptanz zu finden, musste Friedrich II. die gesamte schlesische Bevölkerung für sich und seine gerechte Sache gewinnen. Die Wahrung der Besitzstände war hierfür ebenso Voraussetzung wie die freie Meinungsbildung und Religionsausübung. Den Wünschen der evangelischen Bevölkerung, die sich eine Rückgewinnung der einst entwendeten Kirchen und sonstigen Einrichtung zu Lasten der katholischen Bevölkerung erhofft hatte, konnte er somit nicht entsprechen, wollte jedoch nicht ausschließen, dass er den Protestanten den Bau neuer Kirchen genehmigen würde. Uneingeschränkt folgte er ihrem Wunsche nach einer freien Ausübung ihrer religiösen Gebräuche. Hierzu aber fehlte es weit und breit an Geistlichen, die nach rund 85 Jahren wieder das Wort Gottes verkünden sollten. Mit Freude wurde die Bereitschaft des Königs aufgenommen, hier sofort Abhilfe zu schaffen und möglichst umgehend Pfarrer aus dem benachbarten Preußen in angemessener Anzahl nach Schlesien abzuordnen. Die ersten, die sich mit der Bitte an den preußischen Monarchen wandten, waren die Städte und Gemeinden im Glogauischen, wie etwa Primkenau, Neustädtel, Grünberg, Beuthen, Polkwitz und Sprottau.
1 Worbs, Johann Gottlob, Die Rechte der evangelischen Gemeinden in Schlesien an denen ihnen im 17. Jahrhundert gewalttätig genommenen Kirchen und Gemeinden, Sorau 1825, S. 5
2 Ein Einzelauflistung der zurückgegebenen Kirchen findet sich bei : Berg, Julius, Die Geschichte der schwersten Prüfungszeit der evangelischen Kirche Schlesiens und der Oberlausitz, d.i. der Zeit von Einführung der Reformation bis zur Besitznahme durch König Friedrich den Großen...,Beilage F, Jauer 1857, S. 409 ff.
3 Wagemann, Julius August, Allgemeine Deutsche Biografie, 1889, Johann Gustav Reinbeck
4 Brief Friedrich II. an Voltaire, Insterburg vom 27.07.1739, Oeuvre XXI, S. 307
5 Hensel,, Johann Adam, Protestantische Kirchengeschichte in Schlesien, Leipzig 1768,, S. 693
6 Friedrich II. militaire depuis son institution jusqu'a la fin du régne de frédéric guillaume lér
7 Macchiavelli, Niccolo, Il Principe – Der Fürst, 1513
8 Die Besetzung von Schlesien und die Winterquartiere, Zweiter Abschnitt, S. 2
9 Brief Friedrich der Große vom 8. November 1740 an Graf von Podewils
10 Brief Friedrich der Große vom 15. November 1740 an Graf von Podewils
11 Unbekannt, Der Einmarsch der Preußischen Truppen in Schlesien im Jahre 1740 (Ein Fragment), in: Militärwochenblatt, Nr. 996, Sonnabend, den 25sten Juli 1835, S. 598 ff.
12 Gesamlete Nachrichten und Documente, den gegenwärtigen Zustand des Herzogthums Schlesien betreffend, erstes Stück, Anno 1741, S. 6 f.
13 Graf Hans Nicolaus von Hocke auf Schellendorf und Alt-Wohlau, und erster Freiherr seines Geschlechts in Deutschlässel bei Grünberg
14 Carlyle, Thomas, Geschichte Friedrichs des II., genannt der Große, Band III, Berlin, 1863, S. 148 f.
15 Lehmann, Max, Preußen und die katholische Kirche seit 1640, Bd. 2,1740-1747, S. 12 f.
16 Brief Friedrich der Große vom 16. Dez. 1740 an Podewils
17 Helden-, Staats- und Lebensgeschichte des allerdurchlauchtigsten und Durchlauchtigsten Fürsten und Herrns, Herrn Friedrich II, des Anderen aus ächten Urkunden, Das 3. Buch vom ersten Schlesischen Kriege, Schaffhausen, S. 426 f.
18 Ehrhardt, Siegismund, Presbyterologie des evangelischen Schlesiens, Theil 1, Abschnitt 1, Groß-Glogau, S. 121
19 Worbs, Johann Gottlob, Die Rechte der evangelischen Gemeinden in Schlesien, Sorau, 1825, S. 228 f.
20 Klopsch, Christian, David, Geschichte der evangelischen Gemeinde zu Groß-Glogau, S. 50
21 Acta Ecclesiae, Bd. 6, 31. bis 36 ,Theil, S. 203
22 Gesamlete Nachrichten, Teil I, S. 132 ff.
23 Großer Generalstab. Die Kriege Friedrichs des Großen, 2. Abschnitt: Die Besetzung von Schlesien und die Winterquartiere, 16ter 1740 bis 2ter 1741, S. 285
24 Grünhagen, Colmar, Schlesien unter Friedrich II., Bd. 2, S. 469
25 Weigelt, Carl. Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, Bd. 23, S. 131
26 Lehmann, Preußen und die katholische Kirche, Leipzig 1878, Bd. 2, S. 140
2. Die zwölf Schlesischen Apostel
2.1. Ihre Rekrutierung und Ordinierung in Berlin
Der König übertrug noch im Dezember des Jahres 1740 dem Berliner Propst Johann Gustav Reinbeck, zuständig für Besetzung von Pfarrstellen in Preußen, durch königliche Order die Aufgabe der unverzüglichen Beschaffung und Übersendung von evangelischen Pfarrern nach Schlesien. Der Monarch ließ zunächst 12 Geistliche für die Besetzung von Pfarrstellen bei den Gemeinden anfordern, die den dringendsten
Abb. 1 27Johann Gustav Reinbeck
Bedarf angemeldet hatten. Bei seiner Recherche für geeignetes Personal griff Reinbeck in erster Linie auf junge unverheiratete Theologen zu, die ihr Studium gerade beendet hatten, z.T. als Hauslehrer in Berlin tätig auf ihre Anstellung in einer Pfarrei warteten. Welchen Kriterien für Reinbeck bei der Auswahl der Kandidaten wesentlich waren, ist nicht näher bekannt. Die ausgewählten stammten alle aus dem Märkischen und waren damit ihren künftigen Einsatzorten räumlich am nächsten. Dies schien für den Fall von Vorteil, dass das preußische Unternehmen fehlschlagen sollte.
Reinbeck empfing die Pfarramts-Kandidaten für Schlesien in Berlin und prüfte sie auf Tauglichkeit und Eignung für ihre späteren Aufgaben. Er empfing sie an verschiedenen Orten zu Probepredigten. Nachdem er sich von ihrer Eignung überzeugt hatte und mit Ihnen Einzelheiten ihrer neuen Aufgabe verhandelt hatte, erhielten die Kandidaten für noch nicht benannte Pfarrstellen in Schlesien ihre Ordinationsurkunden, ausgestellt auf den 16. 01.1741. Sie waren in Lateinisch abgefasst, eine Sprache, die die Pfarrer in jener Zeit für die Ausübung ihres Berufs beherrschen mussten.
Reinbeck selbst hat es als einer der bedeutenden Vertreter der Frühaufklärung, der die "alten Sprachen" einschließlich Hebräisch angeblich fließend beherrschte, vorgezogen, das Wort Gottes in deutscher Sprache zu verkünden, um für jeden seiner Zuhörer klar und verständlich zu sein. Bis auf seine ersten Schriften, hat er deshalb so gut wie alle seiner gedruckten Werke in deutscher Sprache veröffentlicht.28 Die originäre lateinische Fassung der Ordinationsurkunde29 liest sich Im deutschen Wortlaut wie folgt:
wünscht
Johann Gustav Reinbeck,
Consistorial-Rath zu Berlin, Pastor zu
St. Petri und Vorgesetzter des Synodi, wie auch
Inspector des Cöllnischen Gymnasii, in seinem
und seiner Collegen Namen,
Alles Wohlergehen aus dem Brunnquell
alles Heils.
Zweierlei ist es, welches billig und mit Recht von
einem Diener des Wortes Gottes gefordert wird:
Wissenschaft nämlich und ein gutes Gewissen. Die
Wissenschaft ist ihm deshalb nötig, dass er vor allen
Dingen in der Heiligen Schrift wohl erfahren sei. Denn
gewiss deswegen hält der Apostel seinem Timotheum für
würdig, dass er einem geistlichen Amte vorstehe, wenn
er 2. Thimoth. 3, Vers 15.16.17. angezeiget, wie von einem
jedweden Diener der Kirche erfordert werde, dass er eine
zulängliche Wissenschaft der Heilige Schrift habe. Da
aber diese ohne Kenntnis der Grund-Sprachen unmöglich
zu erlangen, so ist es eine offenbare Wahrheit, dass
ein Diener des Wortes im geringsten nicht die Wissenschaft
besagter Sprachen, soweit als solche erforderlich,
entbehren könne, damit er nicht gezwungen sey,
nur mit fremden Augen zu sehen, sondern vielmehr den
wahren Sinn der Schrift selbst zu untersuchen, sich an
gelegen sein lasse. Der wahre Sinn der H. Schrift
enthält und begreift himmlische Wahrheiten in sich;
Daher ist von nöthen, daß er solche auch also erkannt
habe, dass er dieselben nicht nur mit einer Freudigkeit
und Überzeugung lehren, sondern auch wider dieVerdrehungen
der Feinde verteidigen, und sie gegen alle
oftmals sehr scheinbare Einwürfe behaupten könne.
Tit. 1, Vers 9.1130. Dieses ist auch so nötig, dass keiner,
welcher sich einen Diener des Wortes Gottes nennt,
ohne solche Wissenschaft, jemals den Namen eines
Gottes-Gelehrten verdienen kann. Jedoch auch diese
Wissenschaft alleine reicht nicht aus, und ein jeder,
welcher die Sachen nach ihrem Wert zu beurteilen
gewohnt ist, wird leicht zugestehen, dass er zu keiner
rechten Fertigkeit darin wird gelangen können, sofern
er auch nicht andere Wissenschaft erlerne, welche
aber gegenwärtig zu erzählen, überflüssig sein würde.
Wir lernen nur an dem Beispiel jenes heidnischen
Apostels, des Hl. Pauli, dass er der Person eines
Dieners der Kirchen im geringsten nicht unanständig
sei, die freien Künste treulich zu erlernen, und
auch in denen natürlichen Wahrheiten, wie nicht weniger
in den Schriften der Heiden, desgleichen auch
noch in den Rechten und Gewohnheiten derer Völker,
kein bloßer Fremdling zu sein. Obwohl nichts
desto weniger alle diese Gelehrsamkeit, so groß sie auch
sei, wo sie alleine ist, keinen wahrhaften Gottesgelehrten
ausmacht, wie ihn selbst die Schrift verlangt.
Denn das bloße und eitle Wissen bläst das Gemüt
auf, nach dem Bekenntnis des Apostels 1 Cor.
VIII 131. Ein Lehrer der Kirche aber soll, nach der
Lehre eben diese Apostels weder aufgeblasen noch
furchtsam sein I. Tim. II. 6.. Daher muss ein Diener
des Worts Gottes hauptsächlich auch sich eines
guten Gewissens befleißigen. Aus diesem Grunde
will der Apostel, dass derjenige, welcher ein geistliches
Amt führt, das Geheimnis des Glaubens in reinem
guten Gewissen befleißigen. Aus diesem Grunde
will der Apostel, dass derjenige, der ein geistliches
Amt führt, das Geheimnis des Glaubens in reinem
Gewissen habe. 1. Tim. III.932. Gleichwie er selbst
von sich bezeugt, dass er all seine Kräfte aufgewendet
habe, mit allem guten Gewissen vor Gott und denen
Menschen zu wandeln. Act. XXIII. I. XXIV. 14.16.
Denn wie will jemand die gewissen anderer unterweisen,
und sie recht leiten, oder ihnen raten, welcher
nach seiner eigenen Seele nichts fragt? Dies ist demnach
der Zweck, welchen ein Diener des Worts sich
vorgesetzt sein lassen soll, dieses soll sein Ziel sein, dass
er zugleich mit andern, welche ihn hören, auch sich selbst
fertig macht, I. Tim IV. 1633.
Und diese ist es nun, worauf wir gesehen haben,
nachdem wir
Martin Kegel 34
Auf Allergnädigsten Befehl Ihro Königl.
Majestät von Preußen
Durch öffentliche Auflegung der Hände in den Orden
des Ministerii auf- und anzunehmen, welches
wir hiermit öffentlich bekräftigen, durch gegenwärtigen
offenen Brief, mit unserm beigefügten Kirchensiegel,
und Unterschrift unserer Namen. Es ist uns nichts
bekannt, sowohl in Ansehung seiner Wissenschaften,
als auch seines vorher geführten Lebenswandels,
welches ihn des Amts eines geistlichen Kirchendieners
hätte unwürdig machen können. Indessen haben wir
aber ernstlich erinnert, und wollen ihn nochmals
ermahnt haben, dass er nicht allein die Studie nicht
hintansetzte, welches sehr viel, sobald sie eine Stelle
erhalten, zu tun gewohnt sind; Sondern, was das
meiste ist, dass er vor sein Gewissen und seine Seele
also Sorge trägt, dass er sich selbst je mehr und mehr der
Gemeinschaft Gottes genieße, und seine Zuhörer nach
dem Beispiel Johannes I Ep I, 5.6.7. in eben diese
Gemeinschaft mit Gott, nach all seinem Vermögen
zu leiten, sich angelegen sein lasse.
Gegeben zu Cölln an der Spree,
im Jahr des wiedererlangten Heils.
1741, den 16. Januar
(L.S.)
Johann Gustav Reinbeck
Christian Campe, Inspect. und Archidiaconus bei St. Petri
Friedrich Griese, Diakonus zu S. Petri
Joh. Nie. KüntzeI, Diac. Extraord. bei S. Petri
Die 12 Kandidaten für die Pfarrämter in Schlesien erhielten noch die folgenden zwei Bibeltexte für ihre Anzugpredigten vor der jeweiligen Gemeinde, die ihnen erst in Schlesien zugewiesen wurden.35
1. Aus dem 5. Buch Mos. Cap. 20, Vers 10.11.12.
„Wenn du vor eine Stadt ziehst, sie zu bestreiten, so sollst du ihr den Frieden anbieten. Antwortet sie Dir friedlich, und tut Dir ihre Tore auf, so soll alle das Volk, das darin gefunden wird, dir zinsbar und untertan sein. Will sie aber nicht friedlich mit dir handeln, und will sie mit dir Krieg führen, so belagere sie" und
2. Aus dem 1. Buch der Maccabaer, Cap. 15, Vers 33. 34.
„Das Land, das wir erobert haben, ist unser väterlich Erbe, und gehöret sonst niemand, unsere Feinde aber haben es eine Zeit mit Gewalt und Unrecht innegehabt, darum haben wir jetzt das unsere wieder zu uns gebracht, und niemand das seine genommen."
Die Predigten sollen an verschiedenen Orten gehalten worden sein. Wo im einzelnen gepredigt wurde, konnte nicht festgestellt werden.
2.2. Die Entsendung nach Schlesien und Vokation in Rauschwitz
Zwischen der Anforderung der preußischen Prediger durch Friedrich II. und der geplanten Entsendung durch Reinbeck blieben nur wenige Wochen. Innerhalb dieser Zeitspanne mussten sich die künftigen Pfarraspiranten entscheiden, in einem für sie unbekannten und durch konfessionelle Spannungen gekennzeichneten Umfeld ihr privates und berufliches Leben neu zu organisieren, anstatt den üblichen und bequemeren Weg zu gehen und im Rahmen der Generationenfolge in eine der bestehenden preußischen Pfarreien nachzurücken. Hinzu kam das Risiko eines Scheiterns des schlesischen Einmarsches.
Es gelang Reinbeck, über den Jahreswechsel 1740/1 die gewünschte Anzahl von Kandidaten für das Vorhaben zu gewinnen und zu nominieren. Man kann davon ausgehen, dass mit jedem von ihnen für den Abbruch der Mission gleich aus welchen Gründen, eine akzeptable Auffanglösung vereinbart wurde. Reinbeck führte die Kandidaten bereits am 2. Epiphanias-Sonntag, dem 16. Januar 1741, in das Predigtamt ein. Wenige Tage später wurden sie als die „Zwölf Schlesischen Apostel" nach Rauschwitz in Schlesien in das Hauptquartier des Erbprinzen Leopold von Anhalt bei Glogau beordert. Noch am selben Tage meldete Reinbeck den Vollzug der Order an Friedrich II. Auf dessen Bericht antwortete der König:
„Würdiger, lieber Getreuer.
Es ist Mir lieb gewesen, aus eurem Schreiben vom 16ten (Januar 1741) dieses zu ersehen, daß ihr die 12 Candidaten nach der Schlesie gesandt, und zweifle Ich nicht, ihr werdet solche an den General-Llieutenant Prinz Leopold Liebden bei Glogau adressiret haben. Die 200 Thaler, welche zu den Reisekosten erfordert worden, werdet ihr allem Vermuthen nach erhalten haben, und werde Ich übrigens diese Leute hier emploiren. Ich bin Ew wohlaffectionirter König Friedrich Haupt-Quartier Ottmachow, den 23. Jan. 1741"
Auf dem Wege nach Rauschwitz übernachteten die Geistlichen am 19. Januar in Grünberg/Niederschlesien. Am 20. Januar kamen sie im Hauptquartier der Königlich Preußifchen Armee zu Rauschwitz an. Hier erhielten sie ihre ersten Instruktionen über ihre Mission vor Ort durch den Herrn Feld-Prediger, Heinrich Friedrich Abel, (vormals Prediger in Magdeburg) in Anwesenheit des Prinzen Leopold von Anhalt-Deffau, weiterhin des Prinzen Friedrich, Brandenburgifcher Marggraff zu Schwedt, und Prinz,Carl, Brandenburgifcher Marggraff zu Sonnenburg, Heer-Meifter, durch den auf Ihro Majeftät Befehl. Alle Anwesenden hatten sich versammelt in der Stube des Herrn Franz Ignaz Lerches, Assessor des Fürftlich Bifchöflichen Commiffariats, und damals wie jetzt Katholifchen Herrn Pfarrers zu Jaitschau und Bruftau. über der Thüre des Pfarr-Hofs das Bildnis des guten Hirten ftand, mit der Inschrift:
JESU! unsre Seelen - Ruh,
Führ die andren Schäflein zu,
Mach sie Sünd und Irrthum frey,
daß ein Hirt und Heerde sey;
Am Tage nach der Ankunft wurden die 12 Geistlichen in einen langen Raum gerufen, in dem sie sich auf der einen Seite aufstellten und die hochrangigen Vertreter der jeweiligen Schlesischen Gemeinden, die nach einem Prediger verlangt hatten, auf der anderen Seite ihnen gegenüberstanden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten nur neun Gemeinden einen Prediger angefordert, drei weniger, als Kandidaten zur Verfügung standen. Der für das aus Halle verlegte Regiment zuständige Prinz Leopold II. von Dessau ließ die Prediger per Los ermitteln. Die jeweiligen 12 Kandidaten und die Orte, denen sie zugeteilt werden sollten, wurden jeweils auf 12 Zettel geschrieben.
Für die Orte, die ihre Meldung noch nicht abgegeben hatten, wurden drei leere Zettel ausgegeben. Diese wurden jeweils in die Hüte von zwei Adjutanten von Leopold, u.a. einem Lieutnant von Gauder geworfen. Aus dem einen Hut wurde der Name des Kandidaten gezogen, aus dem anderen der Name der Gemeinde.
Am Ende des Tages, des 21.01.1741, waren die 12 bereits in Berlin examinierten und ordinierten Prediger, genannt „die zwölf Apostel" in Rauschwitz designiert, d.h. ihrem Bestimmungsort zugewiesen. Die Abgesandten der Gemeinden, die sich um einen Prediger beworben hatten, waren zum Teil in der Erwartung nach Rauschwitz gekommen, sie könnten ihn gleich mit nach Hause nehmen. Da aber keiner von ihnen das Predigtamt ohne ordentliche Vokation oder Berufung (statum publicum ecclesiasticum) führen sollte, mussten diese neuen schlesischen apostolischen Lehrer noch damit versehen werden.
Statt der üblichen Vokation durch den König wurde diese ersatzweise im Auftrage des Königs von Leopold von Anhalt jedem einzelnen „Apostel" wie folgt (am Beispiel des Georg Sigismund Kunowski) erteilt:
„Auf seiner Königlichen Majestät in Preußen allergnädigsten Befehl soll der Prediger Kunowsky zu Beuthen an der Oder und in den da herumliegenden Dörfern in großen Sälen oder Gemächern den Gottesdienst halten und alle actus ministeriales verrichten, übrigens aber den Catholischen keinen Eingriff tun. Wonach sich ein jeder, wes Standes er sey, zu achten. Gegeben im Haupt-Quartier, Rauschwitz bey Glogau, den 22. Januar 1741,
Seiner KönigI. Majest. in Preussen General Lieutenant und
Commandeur des 2ten Corps der Armee von Glogau.
Leopold von Anhalt"36
Nach Abschluss des Prozederes und dem endgültigen Eingang der Bedarfsmeldungen der anfordernden Gemeinden gab Prinz Leopold die durch Los ermittelten Namen der ausgewählten Kandidaten für die jeweiligen Gemeinden bekannt37
1. George Sigismund Kunowsky nach Beuthen
2. Martin Frisch nach Grünberg
3. Gottlieb Weinreich nach Sprottau
4. Nikolaus SchoIze nach Polkwitz
5. Justus Andreas GrentzeI nach Neustädtel
6. Heinrich Otto Kegel nach Primkenau
7. Carl Wilhelm Thiele nach Quaritz
8. Johann Gottlieb Pitschky nach Schönau
9. Samuel Benedikt Carstedt nach Gramschütz,
10. Johann Heinrich Prasuhn nach Brustau
11. Johann Siegmund Steinbart nach Zerbe
12. Ernst Carl Wiegand nach NN
2.3. Der Abschluß ihrer Mission
Am 1. Febr. 1741 erstattete der Feldprediger des Markgraf Carl'schen Regiments und zugleich für den Einsatz der neuen Prediger im Schlesien zuständige Heinrich Friedrich AbeI, an Johann Gustav Reinbeck nach Berlin folgenden Bericht:
„Hochwürdiger Hochgelehrter Herr Consistorialrath,
Hochgeneigter Gönner!
Ich halte es für meine gehorsamste Schuldigkeit, Ew. Hochwürden, von dem hiesigen Zustande einige Nachrichten zu überschicken, und einer gewissen Angelegenheit mir Dero Gutachten zu übermitteln. Es sind die in Berlin ordinierte Candidaten hier vor einiger Zeit angelanget, anfangs sah es schlecht um sie aus, in dem sie in dem Hauptquartier zu Rauschwitz bey Glogau alle in einer Stube ohne Betten logiren mussten. Die Landstände waren auch zu furchtsam, auf ihre evangelischen Dörfer jemanden aus ihrer Anzahl hinzunehmen. Ihro Durchl. der Prinz Leopold setzte also selbst einige auf die hiesigen benachbarten Dörfer, zumal auf diejenige, wo die 5 Bataillons-Grenadiers von dem hiesigen Chor der Armee ohne Prediger stehen. Da nun der Anfang gemacht worden, so kamen gleich aus allen Orten Deputirte und baten sich Prediger aus, mit dem Erbieten sie zu unterhalten. Und so wurden sie gleich hie und da vertheilet. Als aber Ihro KönigI. Maj. hier durchreiseten, so mussten noch 5 am selbigen Tage nach Oberschlesien aufbrechen.
Das Los traf:
1. Herrn Wiegand ,
2. Herrn Garstedt,
3. Herrn Stein barten,
4. Herrn Prasuhn ,
5. Herrn Schulzen.
Die übrigen sind hier also vertheilet:
1. Herr Frisch nach Grünberg,
2. Herr Weinreich nach Sprottau,
3. Herr Grenzel nach Neustädtel,
4. Herr Pitschky nach Schönau,
5. Herr Thiele nach Quaritz,
6. Herr Kegel nach Primkenau, und
7. Herr Kunowsky nach Beuthen.
der es neben Herrn Weinreich am besten getroffen. Zugleich nun, da Ihro Majestät hier waren, traten unterschiedene Deputierte Dieselben an, und baten um mehrere Prediger, erhielten auch das Versprechen, daß mit dem ersten noch 12 ankommen sollten. Nach des Königs Anreise sind Ihro Durchl. der Prinz Leopold inständigst gebeten worden, noch auf mehrere Örter Prediger von Ihro Maj. auszubitten, und wenn alle diese Städte und Dörfer mit den evangelischen Predigern sollen versehen werden, die sich solche ausgebeten, so werden zum wenigsten noch über 100 müssen hierher kommen; die jetzt angekommenen können nun inzwischen bey ihren Gemeinden noch nicht das heil. Abendmahl austheilen, weil es Ihnen an den nöthigen Kirchengeräten fehlet, und sie dieselbige hier nicht sogleich können verfertigt bekommen. Anfangs mussten sie auch ohne Mantel und Kragen predigen, weil die wenigsten damit versehen werden, in dem sie geglaubt, sie würden runde Kragen tragen müssen: welche aber nirgends als in Breslau getragen werden. Aus dieser Nachricht werden Ew. Hochwürden gütigst zu ersehen belieben, wie oben genannte Kandidaten hier aufgenommen worden.
Hieneben habe auch die Ehre, Ew. Hochwürden zu melden, daß Ihro Hochfürstl. Durchl. von Dessau mich hat wissen lassen, wie mit Zustimmung Ihro Maj. mehrere Kandidaten würden hieher gesandt werden; und hätten Ihro Maj. Allergnädigst befohlen, es sollten zu denselben einige hier befindliche Landeskinder gezogen, dieselben aber von mir nebst Zuziehung einiger evangelischen Prediger (deren 2 aus Glogau sich vor der Belagerung aufs Land begeben) allhier im Hauptquartier examiniret und ordiniert werden.
Ich kann fast nicht glauben, dass diejenigen Candidaten, die aus Berlin hieher gesandt werden, erstlich in hiesgen Landen sollten ordiniret werden, und glaube demnach, daß es ein Misverständniß sein müsse. Schlesische Kandidaten weiß bis jetzo nur 2, die sich hier aufhalten. Und wäre von solchen nicht eher zu glauben, dass dieselbe, um ihnen die Reisekosten zu ersparen, hier ordiniret werde sollten?
Weil aber Ihre Durchl. Der Prinz Leopold darauf bestehen, daß dies die Meynung Ihro Königl. Maj. sey, so habe nicht ermangeln sollen, solches Ew. Hochwürden zu melden, und dabey gehorsamt anzufragen, ob nicht, im Fall einige Kandidaten allhier auf Befehl Ihro Maj. ordinieret werden müssen, dieselben ein Testimonium Ordinationis unter dem gewöhnlichen Siegel des Consistorii haben müssen? Und wann solches nöthig, so bitte mir mit der ersten Post einige gehorsamst aus; da ich denn die Namen der ordinirten Kandidaten auch nachgehends an den Herrn Inspektor Campen überschicken will; damit ein hochlöbliches evang. Ministerium wisse, welche es seyn. Ich habe sonsten, da vordem in Küstrin eine zeitlang als Prediger gestanden, unterschiedliche Kandidaten mit ordinieret, und werde also in dem ritu alles gehörige beobachten. Finden aber EW. Hochwürden für nöthig mir eine andere Instruction zu ertheilen, so nehme dieselbe mit dem verbundensten Danke an, und werde mich in allem Dero Befehlen gemäß verhalten.
Ich bin im übrigen mit der größten Consideration
EW Hochwürden
Meines Hochzuehrenden Herrn
Consistorialraths
Im Hauptquartier zu Rauschwitz
treu=gehorsamster Diener
bey Glogau den 1. Febr. 1741
H. F. Abel
Feldprediger des Carlschen
Regiments"
38
Zwei Tage später informierte auch Prinz Leopold den König über die erfolgreiche Entsendung der preußischen Pfarrer:
„Anbey melde ich Ew. KönigI. Maj. daß von dem Probst Reinbeck sind von Berlin zwölf ordinirte Candidatos hieher geschicket worden, und werden Ew. K.M. aus den beigefügten Listen gnädigst ersehen, wie zehn davon im Lande distribuiret habe. Die übrigen zwei, welche noch hier sind, werde, wenn sich noch einige Örter, Prediger zu haben, melden sollten, auch alsdenn da abschicken. Ich habe denn solchen Predigers den Befehl gegeben, dass sie in Häusern und großen Sälen predigen, alle actus ministeriales verrichten, sonsten aber mit den Catholischen wohl vertragen und ihnen nicht den allergeringsten Ingriff tun sollten."
Der oberen kirchlichen Instanz der Katholiken, dem Jesuiten-Pater Guarini hatten die Gesandten von Finckenstein und Ammon bereits eine derartige Zusage übermittelt:
„»Nous avons été aussi ensemble chez le père Guarini, auquel nous avons donné des assurances, que Votre Maj. ne ferait en Silésie aucun changement préjudiciable à la religion catholique et que de même que dans ses autres États Elle en permettrait le libre exercice et la favoriserait. Il nous a paru, que cette assurance lui faisait plaisir, et il nous a répondu, qu'il s'était toujours bien imaginé, que les ecclésiastiques de la Silésie avaient pris l'alarme mal à propos et qu'ils n'auraient rien à craindre de la part de Votre Maj."39
Alle zwölf ordinierten Pfarrer waren zunächst für den Raum Glogau bestimmt, in dem die preußische Armee die Oberhand gewinnen sollte. Die Planung einer weiteren von der evangelischen Bevölkerung gewünschten Entsendung von Predigern war davon abhängig, wie sich der Vormarsch Friedrichs II. mit seinen Truppen und deren Ausbreitung in die anderen Fürstentümer Schlesiens entwickeln würde,
Die evangelische Bevölkerung in den Glogauer Gemeinden bereitete ihren neuen Pfarrern einen begeisterten Empfang. "So war nun diefer Sonntag ein für Schieden recht merkwürdiger Tag, weil in diefen glogauifchen Städten die alten Arbeiter am Evangelio von den Catholifchen 1654 den Feyerabend bekommen und mit fchlechtem Lohne fortgefchickt wurden, jetzt aber nach 87 Jahren kamen neue Arbeiter in den Weinberg um zu arbeiten, der es nach fo langer Zeit verwildert höchft nöthig hatte. Denn obgleich bey dem glogauifchen und freyftädtifchen Kirchenbefuch treue Arbeiter gefunden und gehöret worden, fo waren ihrer doch viel zu wenig, und die Erndte war zu groß, und wo blieben die Kinder und armen Alten? So fchlecht aber der Anfang war in Abficht der Bequemlichkeit zum Gottesdienft, indem man Säle, Rathhäufer, alte Schlöffer, groffe Bauernftuben, Reitfchulen, ja Scheuren zum predigen und Austheilung des Abendmahls erwählen mufte, fo fehr hat es fich im der Zeit gebeffert, indem man itzo an allen diefen Oertern die fchönften neuen Bethäufer als öffentliche Kirchen liehet, welche an Zierde und Anfehen die alten catholifchen Kirchen und Tempel übertreffen. Damals aber mufte man wohl mit folchen fchlechten Plätzen zufrieden feyn, weil der Ausgang der Sachen im Kriege noch ungewiß war, und man fich doch durch folche actus gefchwinde in Poffeßion fetzen wolte; im Frieden aber hat es geheiffen: concordia res parvae crefcunt! durch den Frieden ftehen in Schlefien groffe und fchöne Bethhäufer zur Ehre Gottes."40
Friedrich II. hatte unterdessen im Januar 1741 den Vormarsch nach Schlesien in Richtung Osten zügig fortgesetzt, um möglichst noch im Winter vor der Mobilmachung der österreichischen Truppen entscheidende Geländegewinne zu machen. Nachdem es in Niederschlesien gelungen war, die ersten evangelischen Gemeinden mit Predigern aus Preußen zu versorgen und diese mit großer Freude aufgenommen wurden, stellte der preußische König auf dem Wege nach Oberschlesien fest, dass hier der Mangel an Predigern weitaus größer war. Da unmittelbar keine weiteren zusätzlichen Prediger aus Preußen zur Verfügung standen, gab er die Order, einige der in Niederschlesien eingesetzten Apostel, namentlich die aus
Polkwitz (4. Nicolaus Schulze) und
Gramfchütz (9. Samuel Garstedt),
Brufte (10. Pfarrer Prasuhn),
Zerbe (11. Pfarrer Steinbart),
NN (12. Pfarrer Wiegand)
nach Oberfchlefien weiterzuleiten. Die für Bruste und Zerbe vorgesehenen und nach Oberschlesien abgezogenen Pfarrer wurden nach einer mit Friedrich II. abgestimmten Entscheidung nicht ersetzt, denn sie befanden sich in der Nähe der großen, in der Mitte des 17. Jahrhunderts errichteten Kirche von Glogau. Die evangelischen Gläubigen hatten in diesem Falle die Möglichkeit den dort abgehaltenen Gottesdiensten beizuwohnen. Immerhin verfügte die Friedenskirche in Glogau über vier Geistliche. Deren Gemeinden aber erhielten die Verficherung, dass im Falle der Unzumutbarkeit erneut Abhilfe durch neue Pfarrer geschaffen werde; was teilweise auf wenig Verständnis bei den einschließlich der neu ernannten traf, wenn eine Gemeinde, welche sie zu ihrem Kirchspiele rechneten, sich kirchlich selbständig machen wollte.
Nur zwei der nach Oberschlesien abgezogenen Pfarrer wurden am selben Ort ersetzt. In
Polkwitz folgte Herr Sorke (16) auf Nicolaus Scholze (4) und in
Gramschütz folgte Herr Christian Scobel (24) auf Samuel Carstedt (9).
Abb. 2:
Friedenskirche Glogau 41
2.4. Ihr Leben und Wirken in den schlesischen Gemeinden
Die zwölf schlesischen Apostel konnten bereits Anfang Februar 1741 ihr Predigtamt antreten. Sie hatten sehr unterschiedliche Startbedingungen, was ihr persönliches Umfeld sowie die Ausstattung der Gemeinden mit passenden Räumlichkeiten und sonstigem Gerät betraf. Obwohl sie innerhalb der Gemeinden höchst willkommen waren, wurden häufig Vorbehalte seitens der Standesherrschaft, insbesondere, wenn sie der katholischen Konfession angehörte entgegengebracht. Im folgenden Kapitel wird das Leben und Wirken der aus Preußen abgesandten zwölf Apostel in ihren Gemeinden anhand verfügbarer Aufzeichnungen dargestellt.
2.4.1. M. George Sigismund Kunowski 42
war bestimmt für Beuthen, eine Stadt im glogauischen Fürstenthum, dem Fürsten von Carolath zugeordnet.
Er wurde am 15. Juni 1715 als zweiter Sohn aus der ersten Ehe des Pastors Samuel Kunowsky43 in Blindow bei Prenzlau in der Uckermark geboren. Zusammen mit seinem ein Jahr älteren Bruder Samuel Christian erhielt er häuslichen Unterricht. Danach wechselte er an die Trivialschule (Lateinschule) in Neubrandenburg und wurde dort u.a. vom Rektor Adolf Gideon Bartholdi, der hier ab 1716 tätig war44





























