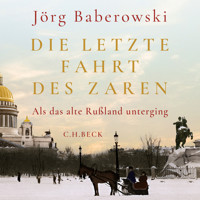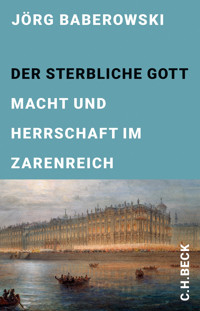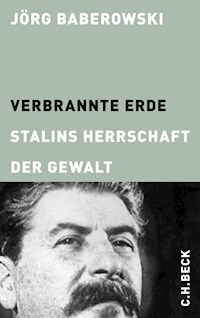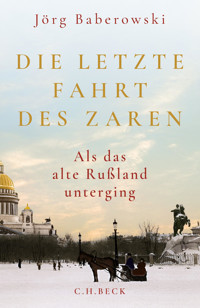
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ende Februar 1917: In den Palästen Petrograds wird getanzt und in den Opern gesungen, während sich auf den Straßen die Proteste ausweiten und die staatliche Ordnung in Bedrängnis gerät. Doch weil der Innenminister glaubt, alles im Griff zu haben, verlässt der Zar mit seinem glamourösen Hofzug die Hauptstadt. Er sollte sie nie wieder betreten, denn jetzt beschleunigen sich die Ereignisse. In einem alles mitreißenden Strudel geht das Zarenreich unter und mit ihm alle Alternativen, die Rußland in eine andere Zukunft geführt hätten. Manchmal verdichtet sich die Weltgeschichte in wenigen Tagen und einzelnen Personen. So war es im Februar 1917, als Zar Nikolaus II. in den Zug stieg und in Petrograd die Revolution ausbrach. Jörg Baberowski ist ein großartiger Erzähler, der diesen welthistorischen Moment in einzigartiger Weise nacherlebbar macht: die letzte Woche des Zarenreichs so lebensnah, als säße man im Kino. Das Buch fängt die Dynamik des Moments grandios ein und zeigt, wie eine scheinbar festgefügte Ordnung in wenigen Tagen in sich zusammenfallen kann, wenn die handelnden Personen nicht mehr wissen, was sie tun. Baberowski zeichnet bestechende Porträts und schildert die Ereignisse so, als wäre man mitten im Geschehen. Deutlich wird aber auch, dass alles anders hätte kommen können, wenn der Zar, seine Minister und Generäle verstanden hätten, was um sie herum geschah. So ist dieses berührende Buch auch eine Reflexion über die Grundlagen der Macht und die Herrschaft des Zufalls.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Jörg Baberowski
Die letzte Fahrt des Zaren
Als das alte Rußland unterging
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Karte
Vorwort
I. Vor dem Sturm
II. Der Zar fährt ins Hauptquartier – Mittwoch, 22. Februar 1917
III. Der Protest beginnt – Donnerstag, 23. Februar 1917
IV. Der Aufruhr erreicht die Innenstadt – Freitag, 24. Februar 1917
V. Die Gewalt eskaliert – Samstag, 25. Februar 1917
VI. Der Zar läßt schießen – Sonntag, 26. Februar 1917
VII. Meuterei – Montag, 27. Februar 1917
VIII. Über den Rubikon – Dienstag, 28. Februar 1917
IX. Die Irrfahrt des Zaren – Mittwoch, 1. März 1917
X. Eine neue Regierung – Mittwoch/Donnerstag, 1./2. März 1917
XI. Die Abdankung – Donnerstag, 2. März 1917
XII. Das Ende – Freitag, 3. März 1917
XIII. Abschied von der alten Ordnung – Freitag, 3. März, bis Donnerstag, 9. März 1917
XIV. Dem Abgrund entgegen
XV. Abspann – Was danach geschieht
Anmerkungen
Vorwort
I. Vor dem Sturm
II. Der Zar fährt ins Hauptquartier
Mittwoch, 22. Februar 1917
III. Der Protest beginnt
Donnerstag, 23. Februar 1917
IV. Der Aufruhr erreicht die Innenstadt
Freitag, 24. Februar 1917
V. Die Gewalt eskaliert
Samstag, 25. Februar 1917
VI. Der Zar läßt schießen
Sonntag, 26. Februar 1917
VII. Meuterei
Montag, 27. Februar 1917
VIII. Über den Rubikon
Dienstag, 28. Februar 1917
IX. Die Irrfahrt des Zaren
Mittwoch, 1. März 1917
X. Eine neue Regierung
Mittwoch/Donnerstag, 1./2. März 1917
XI. Die Abdankung
Donnerstag, 2. März 1917
XII. Das Ende
Freitag, 3. März 1917
XIII. Abschied von der alten Ordnung
Freitag, 3. März, bis Donnerstag, 9. März 1917
XIV. Dem Abgrund entgegen
XV. Abspann
Was danach geschieht
Bildnachweis
Personenregister
Ortsregister
Literaturverzeichnis
Quellen
Sekundärliteratur
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für Manfred Hildermeier
Karte
«Die innere Zersetzung der Staatsmacht macht Revolutionen möglich; sie sind keineswegs eine notwendige, errechenbare Folge. Die Geschichte kennt zahllose Beispiele von völlig ohnmächtigen Staaten, die über lange Zeiträume fortbestehen konnten. Entweder gab es niemanden, der die bestehende Macht auch nur auf die Probe stellte, oder das Regime hatte das Glück, in keinen Krieg verwickelt zu werden und keine Niederlage zu erleiden. Denn Machtzerfall wird häufig nur manifest in direkter Konfrontation; und selbst dann, wenn die Macht schon auf der Straße liegt, bedarf es immer noch einer Gruppe von Menschen, die auf diese Eventualität vorbereitet und daher bereit ist, die Macht zu ergreifen und die Verantwortung zu übernehmen.»
(Hannah Arendt, Macht und Gewalt, München 2008, 18. Aufl., S. 50.)
«Aber wo war der Zarismus? Es gab ihn nicht mehr. Er zerfiel im Nu. In drei Jahrhunderten wurde er errichtet, in drei Tagen verschwand er.»
(Nikolaj Suchanov, Zapiski o revoljucii, Bd. 1, Moskva 1991, S. 126.)
Vorwort
Wer glaubt, das menschliche Leben werde vom Verstand gesteuert, sagt Lew Tolstoi, vernichte die Möglichkeit von Leben.[1] Es besteht vielmehr aus einer Reihe von Augenblicken, Momenten, in denen etwas geschieht, was wir nicht in unserer Hand haben. Alle Menschen sind in diesem flackernden Stromkreis des Lebens gefangen. Nur in den Erzählungen, die den historischen Menschen sprechen lassen, kann es gelingen, die Phänomene in ihrem Selbstsein zu zeigen. Dieses Buch ist der bescheidene Versuch, bloß in Geschichten zu fassen, was eigentlich einer theoretischen Erörterung bedürfte.
Ich glaube, daß man bekannten Ereignisfolgen erzählerisch immer noch eine Wendung geben kann, in der sich das Geschehen der Vergangenheit in anderem Licht zeigt. Irgendetwas geschieht, womit man nicht gerechnet hat, was nicht erwartbar war. Nun wird die Gewißheit erschüttert, das Leben sei in scheinbar immerwährendem Recht verankert. Heute halten die Machthaber ihre Untertanen noch in Schach, morgen fürchten sie schon selbst um Leib und Leben. Wir wissen, daß wir sterben werden, aber wir glauben es nicht. Es ist das Unvorhergesehene, das nicht Erwartbare, was allem Leben seine Spannung verleiht. Deshalb muß man dem Wunder und dem Zufall in der Geschichtsschreibung wieder zu ihrem Recht verhelfen. Der Leser mag selbst entscheiden, ob er sich davon berühren läßt. Wenn er sich nicht langweilt, ist eigentlich schon alles erreicht, was ein Autor sich von seinem Buch versprechen darf.
Ohne die Anregungen all der Denker, die in diesem Buch nicht genannt werden, aber stets präsent sind, wäre ich gar nicht erst vorangekommen. Ich habe den gelassenen Skeptikern unter den Philosophen viel zu verdanken. Sie haben mich nicht nur gelehrt, Texte so zu lesen, daß sie ihre eigenen Wahrheiten ausspielen können, sondern mir auch die Augen für die Fragwürdigkeit aller Letztbegründungen geöffnet. Die Geschichtsphilosophen hätten die Welt nur verschieden verändert, schrieb Odo Marquard, es komme jedoch darauf an, sie zu verschonen.[2]
Als ich vor nunmehr vierzig Jahren an der Universität Göttingen damit begann, Geschichte und Philosophie zu studieren, ahnte ich noch nicht, daß es im Betrieb der Wissenschaft nicht um die Wahrheit schlechthin, sondern um Wahrhaftigkeit geht, nicht um die Bestätigung der eigenen Vormeinungen, sondern um das Verstehen fremder Lebensäußerungen, die ein Recht auf Existenz haben. Von Manfred Hildermeier habe ich als Student gelernt, daß man sich nichts vergibt, wenn man versucht, die Welt mit den Augen jener Menschen zu sehen, deren Auffassungen man nicht teilt. Sein Oberseminar war eine Schule gediegener Gelehrsamkeit, eine wöchentliche Übung in gelassener Abwägung und Toleranz. Das ist mir Jahre später erst recht bewußt geworden. Dafür bin ich heute noch dankbar. Ihm, dem Historiker der russischen Revolution, ist dieses Buch gewidmet.
I.
Vor dem Sturm
In den letzten Januartagen des Jahres 1917 reist der junge Sergei Prokofjew, das Wunderkind der russischen Musik, nach Saratow, einer Provinzhauptstadt an der Wolga. Er spielt vor großem Publikum, und, wie stets, berauscht er sich an seinem eigenen Auftritt, den er auch jetzt wieder für unerreicht hält. Überhaupt interessiert sich der exzentrische Komponist nur für die Welt der Musik, das Alltagsgeschehen nimmt er nicht wahr. Was geht ihn die Politik an, die in diesen Tagen so viele Menschen beschäftigt? Warum soll er sich mit Fragen befassen, von denen er nichts versteht, die ihn nichts angehen, die ihn doch nur davon abhalten, seiner Leidenschaft für die Musik freien Lauf zu lassen? Jedes Regime, das ihn in Ruhe lasse, wird er später einmal sagen, sei ihm recht, solange er komponieren könne, was er wolle. Prokofjew ist ein Künstler, der für nichts anderes lebt als für die Musik. Aber er teilt diese Einstellung zum Leben mit Millionen anderer Menschen, die nichts anderes im Sinn haben, als ihr Leben in der Balance zu halten. Sie wissen von den Ereignissen an der Front, von der monströsen Gewalt, die millionenfach erlitten wird, sie spüren, daß sich die Lebensbedingungen verschlechtern und die Stimmung sich verdüstert. Aber sie versuchen, die dunklen Seiten des Lebens zu verdrängen. An eine Revolution denken sie ebenso wenig wie der junge Komponist, der von keinem anderen Gedanken getrieben ist, als so schnell wie möglich nach Moskau und von dort nach Petrograd zu gelangen. Denn sein Publikum wartet auch dort schon auf ihn. Wenn doch nur dieser lästige Schneefall nicht wäre, der nicht aufhören will und der die Schienenwege verstopft, auf denen er durch Rußland reist![1]
Der Schneefall ist nicht die einzige Sorge, die Rußland in Atem hält. Maurice Paléologue, der französische Botschafter, meldet in diesen Tagen nach Paris, daß in Petrograd, der Hauptstadt des Zarenreiches, die vor dem Krieg noch Sankt Petersburg hieß, eine Versorgungskrise ausgebrochen sei, weil die Eisenbahn den Belastungen nicht mehr gewachsen ist, die die Witterung ihr auferlegt. Aus der weit entfernten Ukraine muß das Getreide in den Norden des Landes geschafft werden. Das aber scheint nicht mehr zu gelingen, obgleich die Regierung die Anweisung erteilt hat, Lokomotiven und Waggons zu requirieren. Selbst in den Dörfern lassen sich keine Männer mehr finden, die Schienenwege von den Schneemassen befreien. Das Verkehrsnetz ist überlastet, viele Züge fallen aus oder bleiben liegen. Die Hauptstadt wird schon seit Tagen nicht mehr mit Getreide, Mehl und Fleisch beliefert, in vielen Bäckereien fallen die Öfen aus, weil der Brennstoff zur Neige geht. Der Botschafter wundert sich über die Gleichgültigkeit der herrschenden Eliten. Sehen sie denn nicht, daß sich die Auslagen in den Geschäften leeren, spüren sich nicht, was auf dem Spiel steht? Wie soll man mit solchen Verbündeten einen Krieg gewinnen?[2]
Auf den Straßen der Hauptstadt stehen Frauen in langen Schlangen vor den Bäckereien. Es sind die Armen, die besonders unter der Krise zu leiden haben. Sie können es sich nicht leisten, Dienstboten damit zu beauftragen, für sie einzukaufen, wie es in den wohlhabenden Familien üblich ist. Die Stimmung verdüstert sich, aufgestaute Wut drängt zur Entladung, überall ist diese Atmosphäre nun zu spüren. Alexander Rittich, der Landwirtschaftsminister, steht unter den Abgeordneten des Parlaments im Ruf, ein kluger und umsichtiger Mann zu sein. Er tut, was er kann, aber er trifft auch eine verhängnisvolle Entscheidung. Als er die Depots anweist, den Bäckereien nur eine bestimmte Menge Mehl zuzuteilen, unterläßt er es, diese Anordnung mit der Einführung von Lebensmittelmarken zu verbinden. Und so löst er den Ansturm auf die Läden erst aus, den er eigentlich unterbinden will.[3] Die Geheimpolizei ist über den Unmut, der auf den Straßen herrscht, sehr gut unterrichtet. Gerüchte verbreiten sich in den Schlangen, die sich vor den Läden gebildet haben. Die einen erwarten eine Revolution, die anderen fürchten, die Regierung könne eine Terrorherrschaft errichten. Konstantin Globatschow, der Leiter der Ochrana in Petrograd, warnt den Innenminister am 26. Januar vor den liberalen Politikern, die sich bereits darauf vorbereiteten, die Ministersessel in Besitz zu nehmen. Im Februar, unmittelbar vor dem Ausbruch der Unruhen, berichten die Agenten der Ochrana auch über die Wut, die sich auf den Straßen entlädt. Ein kleiner Funke werde genügen, teilen die Informanten mit, um alles in Brand zu setzen.[4]
Schlange vor einer Bäckerei in Petrograd, Februar 1917
Davon aber will Alexander Protopopow, der Innenminister, ein schlanker Mann mit feinen Gesichtszügen und einem an den Enden gezwirbelten Schnurrbart, nichts hören. Seit September 1916 ist er, ein Abgeordneter, der sich der rechtsliberalen Fraktion der Oktobristen im Parlament verbunden fühlt, im Amt. Die liberalen Abgeordneten verstehen die Ernennung Protopopows, der einmal einer der Ihren war, als Kampfansage des Herrscherhauses. Der Minister gilt ihnen als psychisch instabil und eitel, als einer, der nur auf seinen Ruhm bedacht ist. Mit ihm wollen sie nicht kooperieren.[5] Und bald schon stellt sich heraus, wie recht sie mit ihrer Vermutung haben. Der Minister erscheint in der Uniform eines Gendarmerie-Generals in der Duma, trägt Stiefel mit Sporen und heftet sich ein Komthur-Kreuz an den Kragen. Auch sonst verhält sich Protopopow auffällig, umgibt sich mit Spiritisten und Kartenlesern, die ihm die Zukunft vorhersagen. Manche sagen, er leide an den Spätfolgen einer Syphilis, die er sich vor Jahren zugezogen hat. Eine Witzfigur als Hüter des Gesetzes.[6] Zar Nikolai II. aber hält an seinem Innenminister fest, dessen Höflichkeit und Stilsicherheit auf höfischem Parkett ihm gefällt und weil auch Alexandra, seine Ehefrau, ihm dazu rät. Ihr hat er noch nie widersprochen.
So verhält er sich auch gegenüber den Vorsitzenden des Ministerrates, die zwar nur die Rolle von Conférenciers am Kabinettstisch spielen, aber immerhin die Regierung vertreten und direkten Zugang zum Hof haben. Im Januar beruft der Zar den 67-jährigen Fürsten Nikolai Golizyn auf diesen Posten, einen Mann aus altem Adel, der, wie der Dichter und Chronist der Revolution Alexander Blok süffisant bemerkt, nur davon träumt, sich zu «erholen». Als der Zar ihm eröffnet, daß er ihn zum Regierungschef ernennen wolle, gibt Golizyn zu bedenken, daß er von der Verwaltung der Staatsangelegenheiten nichts verstehe. Aber er wagt es nicht, dem Herrscher zu widersprechen, auch wenn ihm der Gedanke zuwider ist, seine Zeit damit zu verbringen, den «Pöbel» zu regieren, wie er das Volk verächtlich nennt. Nikolai hat für die Besetzung dieses Postens auch den ehemaligen Verkehrsminister Sergei Ruchlow in Erwägung gezogen. Nur spreche der Minister nicht Französisch, wie er zu Golizyn sagt. «Deshalb fiel meine Wahl auf Sie.»[7]
In der Umgebung des Zaren geben Schmeichler und Intriganten den Ton an: der vornehme, exzentrische Minister des Hofes, Graf Woldemar von Fredericks (eigentlich Graf Adolf Andreas Woldemar von Fréedéricksz), ein Aristokrat des 19. Jahrhunderts, der das Parlament für eine geschmacklose Verirrung anmaßender Parvenus hält, der eitle und korrupte Chef der Palastwache, Wladimir Wojejkow, der ein eigenes Mineralwasser vertreibt und sich schamlos bereichert, die Adjutanten Graf Alexander Grabbe und Konstantin Nilow, ein ehemaliger Admiral, Grobian und Alkoholiker, die den Zaren auf Schritt und Tritt begleiten, ihn von der Außenwelt abschirmen und ihm alle Informationen vorenthalten, die ihn beunruhigen könnten. In den letzten Jahren hat sich der Zar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und im Alexander-Palast von Zarskoje Selo außerhalb Petrograds Zuflucht gesucht, um dort ein abgeschiedenes Privatleben als Familienvater zu führen. Aber die Abschottung erzeugt erst die Intrigen, denen er aus dem Weg gehen will. Denn die Minister sind nur dem Zaren gegenüber verantwortlich. Es gibt weder einen Ministerpräsidenten mit Richtlinienkompetenz noch Kabinettsdisziplin. Jeder verfährt in seinem Ressort, wie es ihm gefällt und kein Reformvorhaben passiert die gesetzgebenden Institutionen ohne die Zustimmung des Herrschers. Wer sein Ohr nicht erreicht, wird es kaum weit bringen.[8]
In den letzten Jahren vor dem Ausbruch des Weltkrieges aber hat sich der Korridor zum Machthaber verengt, kaum noch jemand wird zu ihm vorgelassen. Nur unter diesen Bedingungen konnte es einem Scharlatan wie dem Wunderheiler Grigori Rasputin und all den Schmeichlern und Intriganten überhaupt gelingen, sich am Hof Gehör zu verschaffen und Einfluß auf die Regierungsgeschäfte zu nehmen. Nikolai II. ist willenlos, entscheidungsschwach, stets ordnet er sich seiner Frau und seinen Verwandten unter. Nicht auf Argumente kommt es an, um ihn zu überzeugen, sondern auf den Zeitpunkt, an dem sie vorgetragen werden. Denn immer wieder stimmt der Zar dem zuletzt Gesagten zu. Er glaubt, das Vermächtnis seines resoluten und starken Vaters erfüllen zu müssen, aber für die Rolle des Autokraten ist er nicht gemacht. Und wenn er einmal eine Entscheidung trifft, richtet er Unheil an. Gegen den Rat seiner Minister und seiner Mutter übernimmt er im August 1915 den Oberbefehl über die Streitkräfte, und er schickt den bisherigen Oberkommandierenden, seinen energischen Onkel, Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, als Statthalter nach Tiflis. Nun wird er selbst für alle Niederlagen verantwortlich gemacht, die russische Armeen noch erleiden müssen. Auf dem Thron des Selbstherrschers ist der weltabgewandte, höfliche und schüchterne Mann eine Fehlbesetzung.[9]
Seit August 1914 befindet sich das Zarenreich in einem Krieg, auf den es nicht vorbereitet und dem es nicht gewachsen ist. Hunderttausende Soldaten sind in den Schlachten gegen Deutsche, Österreicher und Türken sinnlos geopfert worden, weil die Generäle sich nur auf den Frontalangriff verstehen, ihre Soldaten rücksichtslos in den Tod schicken. Hunderttausende sind in Gefangenschaft geraten. Schon im zweiten Kriegsjahr ist das Offizierskorps nicht mehr wiederzuerkennen. Die adligen Berufssoldaten sind gefallen, ihr Nachwuchs rekrutiert sich aus bäuerlichem Aufsteigermilieu. Es sind die desillusionierten Unteroffiziere und Fähnriche, die der Revolution jenen Rückenwind geben werden, den sie braucht, um sich durchzusetzen. Auch erschüttern Unruhen und Pogrome das Imperium. Denn die Generäle, denen der Zar auch die zivile Befehlsgewalt über alle Territorien westlich des Dnjepr übertragen hat, verwandeln die Frontgebiete in staatenloses Niemandsland, in dem sie nach Belieben schalten und walten. Juden und Deutsche werden aus ihren Dörfern in der Ukraine vertrieben, hunderttausende Bauern fluten mit den geschlagenen Armeen nach Osten. Bevor die Soldaten abziehen, vernichten sie Felder und Dörfer, hinterlassen verbrannte Erde. In den Städten drängen sich Arbeiter und Flüchtlinge, die um Wohnraum und Lebensmittel miteinander konkurrieren, die Inflation verschlingt das Vermögen der Wohlhabenden, die Armen hungern, weil die Versorgung der Armee Vorrang vor den Bedürfnissen der städtischen Bevölkerung hat.[10]
Im Herbst 1915 erteilt Kriegsminister Alexei Poliwanow die verhängnisvolle Anordnung, hunderttausende Reservisten in den Kasernen der großen Städte zu konzentrieren, um sie von dort aus gefechtsbereit an die Front zu schicken. Mehr als 100.000 Soldaten befinden sich im Februar in Petrograd und warten auf ihren Einsatz an der Front.[11] Untätig sitzen die Soldaten auf den Pritschen in ihren Stuben, wo die Offiziere sie dem Trübsinn des Kasernenlebens überlassen. Man weiß nicht, was schlimmer ist: das Leben in der Etappe oder der Kugelhagel, der einen erwartet, wenn man an die Front geschickt wird. Die Reservisten beschäftigt nur ein Gedanke: wie sie es anstellen können, so schnell wie möglich wieder nach Hause geschickt zu werden, und sie werden von Aufrührern, die sich Zugang zu den Soldaten verschaffen, ermuntert, ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen.[12] Im Angesicht der kolossalen Verluste, die die russischen Armeen an der Front erleiden, klingt der Patriotismus der Dumapolitiker wie Hohn in den Ohren der Soldaten. Der Stumpfsinn des Kasernenlebens und die Furcht vor dem sinnlosen Tod in den Schützengräben nimmt die Soldaten mehr für die Revolte ein als das Gerede über verlorene Schlachten und den angeblichen Verrat der Minister an der Heimat, über den im Parlament unentwegt gesprochen wird. Denn es ist nicht ihr Krieg, der auf den Schlachtfeldern Galiziens und Weißrußlands ausgefochten wird. Sie haben ihn nicht gewollt. Sollen die Offiziere doch selbst erleiden, was sie ihren Soldaten abverlangen![13]
Am 3. Februar 1917, drei Wochen vor dem Ausbruch der Unruhen, die der Revolution die Tür öffnen, entzieht Protopopow dem Oberbefehlshaber der Nordfront, General Nikolai Russki, das Kommando über die Hauptstadt und legt es in die Hände Sergei Chabalows, eines Schreibtischoffiziers aus Ossetien, der an der Akademie des Generalstabs lehrt. Protopopow ist eifersüchtig, er gönnt den Frontgenerälen keinen Triumph, schon gar nicht in der Hauptstadt, die er unter seiner Kontrolle behalten will. Dafür ist ihm jedes Mittel recht.[14] Chabalow ist zwar ein gehorsamer Stadtkommandant, aber im Gegensatz zu Russki, der im Fronteinsatz ist, weiß er nicht, was er mit der ihm übertragenen Macht anfangen soll. Er teilt die Hauptstadt in Distrikte ein und überträgt das Kommando über die innere Sicherheit Armeeoffizieren, die sich auf die Bekämpfung von Unruhen überhaupt nicht verstehen. Auf den Einsatz von Schußwaffen sollen Polizisten und Soldaten verzichten, ordnet Chabalow an. Denn sobald die Brücken blockiert seien, die die Innenstadt mit den Außenbezirken verbinden, werde sich die Menge wieder zerstreuen. Es ist alles ganz einfach, denkt er. Man sperrt die Arbeiter aus und sorgt dafür, daß sie die Bürger im Zentrum der Stadt nicht länger belästigen. Aber er verschwendet keinen Gedanken auf die Frage, wie ausgerechnet Reservisten, die noch niemals im Einsatz gewesen sind, die Ordnung in der Hauptstadt aufrechterhalten sollen.[15]
Am 18. Februar legen zehntausende Beschäftigte der Putilow-Werke die Arbeit nieder, verlangen die Auszahlung höherer Löhne. Die Direktion aber läßt sich nicht erpressen und sperrt die streikenden Arbeiter aus. Und so wächst das Heer der Unzufriedenen, die mit sich selbst nichts anzufangen wissen. Niemand erkennt die Gefahr, die sich aus der Massierung rebellischer Arbeiter in der Hauptstadt ergibt. Der Innenminister und sein General stellen sich selbst alle Fallen, in die sie wenig später hineinlaufen werden.[16] In der gleichen Woche, am 14. Februar nimmt die Duma, das Parlament, ihre Sitzungen wieder auf, aus allen Regionen des Zarenreiches treffen die Abgeordneten in Petrograd ein, und Protopopow fürchtet schon, die Parlamentarier könnten in Versuchung geraten, sich mit dem Protest von Revolutionären und streikenden Arbeitern zu verbinden. In den Kasernen werden Patronen an die Soldaten ausgegeben, der Ernstfall beschworen, obwohl die Offiziere im Zweifel sind, ob sie den Reservisten trauen können, die, wenn sie die Wahl hätten, lieber auf Polizisten als auf Arbeiter schössen.[17] Protopopow aber versichert dem Zaren, daß kein Grund zur Besorgnis bestehe.
Nikolai II., der seinem Innenminister aufs Wort glaubt, sagt in diesen Tagen zu Michail Rodsjanko, dem gutmütigen, schwergewichtigen Parlamentspräsidenten, daß er die Duma auflösen werde, sollte sie sich mit revolutionärem Aufruhr einlassen.[18] Er hält es offenbar für undenkbar, daß sich das Parlament seinen Entscheidungen widersetzen könne. Rodsjanko, der am 10. Februar zum Rapport in Zarskoje Selo erscheint, beschwört den Zaren, sich von seinem Innenminister zu trennen. Es entfaltet sich ein Gespräch, in dessen Verlauf der Parlamentspräsident sehr deutlich wird. «Sie fordern die Entfernung Protopopows», fragt der Zar erstaunt, und Rodsjanko antwortet ihm: «Ich fordere, Eure Majestät, früher habe ich gebeten, jetzt fordere ich.» Nikolai ist irritiert, aber Rodsjanko läßt sich nicht aufhalten. «Eure Majestät, retten Sie sich. Wir stehen vor großen Ereignissen, deren Ausgang wir nicht vorhersehen können. Das, was Ihre Regierung und Sie selbst tun, verärgert die Bevölkerung in einem solchen Maße, daß alles möglich ist.» Er habe die Regierung einem Hochstapler anvertraut. Er müsse handeln, denn Rußland stehe am Abgrund, und wenn er das Parlament auflöse, werde es zu einer Katastrophe kommen.[19]
Am nächsten Tag schon macht Nikolai Maklakow, der ehemalige ultrakonservative Innenminister, von dem sich der Zar im Sommer 1915 auf Anraten des Parlaments getrennt hat, seine Aufwartung im Palast. Immer noch übt Maklakow, Anführer der Reaktionäre im Staatsrat, der zweiten Kammer, einen unheilvollen Einfluß aus und versucht, den Zaren davon zu überzeugen, daß es besser sei, Rußland ohne Parlament zu regieren. Es komme darauf an, sagt er, die Macht in einer Hand zu konzentrieren und den inneren Feind zu beseitigen, damit der äußere besiegt werden könne. Er gibt ihm den Rat, die Duma aufzulösen und die Bürger erst im November 1917 wieder an die Urnen zu rufen. Der Zar schwankt, am Ende aber kann er sich zu einer solchen Entscheidung doch nicht durchringen. Vor Monaten schon hat er dem Vorsitzenden des Ministerrates eine von ihm unterschriebene Blankovollmacht überlassen, die es der Regierung jederzeit erlaubt, die Sitzungen der Duma zu unterbrechen oder das Parlament aufzulösen. Nun erinnert er Golizyn daran, daß er von dieser Vollmacht jederzeit Gebrauch machen könne. «Behalten Sie sie bei sich, und wenn es nötig ist, verwenden Sie sie.»[20]
Fürst Nikolai Golizyn (1850–1925), letzter Premierminister des Zarenreiches
Allem Verdruß zum Trotz will es die Opposition Ihrer Majestät, wie die Liberalen von den Radikalen verächtlich genannt werden, auf eine Konfrontation mit der Regierung gar nicht ankommen lassen. Sie wäre gern an der Macht beteiligt, weil sie glaubt, besser zu wissen, wie Rußland regiert werden solle, aber von einer Revolution träumen ihre Repräsentanten, die sich im August 1915 in der Duma zu einem «Progressiven Block» zusammengeschlossen haben, nicht. Am Ende säßen sie im Gefängnis, und davon hätte doch wirklich niemand einen Gewinn. Und so verbreiten Alexander Gutschkow, der im Kriegs-Industriekomitee und im Städtebund die Versorgung der Streitkräfte mit Munition und Verpflegung organisiert, und Pawel Miljukow, der wortgewandte Historiker und unbestrittene Führer der Liberalen im Parlament, die Nachricht, daß Protopopow eine Revolution «künstlich» herbeiführen wolle, um sie dann, wie im Herbst 1905, mit Gewalt niederschlagen zu können. In diese Falle, schreibt Miljukow in der Zeitung «Retsch» (Die Rede) dürfe die Opposition nicht hineinlaufen. Unter gar keinen Umständen, rät er auch den Arbeitern, solle man den Aufrufen der Revolutionäre folgen und stattdessen zu Hause bleiben.[21]
Als die Abgeordneten der Duma am 14. Februar zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen, sind überall streikende Arbeiter, fast 90.000, auf den Straßen zu sehen, tausende drängen sich auf der Peterhof-Chaussee im Süden der Stadt, gelangen aber nicht ins Zentrum. Vor dem Parlament haben sich nur einige hundert Demonstranten versammelt. Zwar wird das Gerücht gestreut, der Sozialrevolutionär Alexander Kerenski habe im Parlament über die physische Beseitigung all jener gesprochen, die die Verantwortung für die Krise trügen. Golizyn verlangt von Rodsjanko, er möge ihm das Stenogramm der Sitzung schicken. Sonst aber geschieht nichts.[22] Miljukow aber ist erleichtert, daß niemand zum Sturz der Regierung aufruft, Gewaltexzesse ausbleiben und der Innenminister keine Gelegenheit erhält, der Opposition den Fehdehandschuh hinzuwerfen. Selbst die Revolutionäre wissen um das Risiko, das sie eingehen würden, wenn sie alles auf eine Karte setzten. Seit der Zar der Opposition vor nunmehr zehn Jahren ein Parlament und eine Verfassung geschenkt hat, interessieren sich die Granden und Meisterdenker der Konstitutionellen Demokraten, Pawel Miljukow, Wladimir Nabokow, Pjotr Struwe und all die anderen Liberalen nicht mehr für den Protest der Arbeiter und ihrer Repräsentanten. Und was können die Sozialisten ohne die Unterstützung der liberalen Honoratioren schon tun? Wer kennt Alexander Schljapnikow, Wjatscheslaw Molotow oder Kusma Gwosdjow, die Mitglieder der lokalen Parteikomitees? Viele haben von ihnen noch nie gehört. Lenin, das «Artilleriegeschütz» der Revolution, wie Schljapnikow ihn nennt, lebt im fernen Zürich. «Wir, die Alten, werden die Revolution nicht mehr erleben», sagt er zu Nadjeschda, seiner Frau. Ohne ihn aber wollen seine Anhänger, die in den Komitees das Alltagsgeschäft der Agitation verrichten, den alles entscheidenden Schritt nicht wagen.[23]
Im Ausland streiten Viktor Tschernow und Nikolai Awksentjew, die Anführer der Sozialrevolutionäre, über die Frage, ob die Beteiligung Rußlands am Weltkrieg zu begrüßen sei oder abgelehnt werden müsse. Aber in der Heimat interessiert sich kaum jemand für die Debatten weltfremder Intellektueller, die gar nicht wissen, wonach Arbeitern und Soldaten der Sinn steht. Niemand glaubt, daß der Protest, der sich auf den Straßen zeigt, die alte Ordnung zum Einsturz bringen werde. Sergei Maslowski, ein Offizier und literarisch gebildeter Essayist aus den Reihen der Sozialrevolutionäre, der sich Mstislawski nennt und in der Garnison von Petrograd seinen Dienst verrichtet, hält es für vollkommen ausgeschlossen, daß sich die Staatsgewalt aus der Balance bringen lasse. Wie auch seine Parteifreunde richtet er sich auf weitere Jahre im Untergrund ein. Wohin könnte man sonst schon gehen? Die Reservisten, die in den Kasernen Trübsal blasen, sind unzufrieden mit ihrem Leben, sie hassen die Polizisten, die sich dem Wehrdienst entziehen, ihnen, den Soldaten, aber das Leben verderben. Eigentlich wollen sie nur ein wenig Krawall, auf sich aufmerksam machen. Für die Debatten in der Duma und die revolutionären Ansprachen der Sozialisten interessieren sie sich nicht. Nichts weist auf eine Revolution hin. Die Opposition ist an nichts anderem interessiert, als die Effizienz der Exekutive zu verbessern, nicht aber daran, einen Aufstand auszulösen. «Kein einziger verantwortlicher Politiker», schreibt Alexander Bublikow, ein liberaler Abgeordneter, in seinen Erinnerungen, habe eine Revolution für möglich gehalten.[24] Vor Liberalen und Revolutionären, die zwar unentwegt reden, deren Worten aber keine Taten folgen, fürchtet sich kein Innenminister. An die Schalthebel der Macht werden diese Schwätzer, wie nicht nur Protopopow glaubt, niemals gelangen. Vom Sterben an den Fronten ist in der Hauptstadt ohnehin nichts zu spüren. Die Beamten gehen weiterhin jeden Morgen zum Dienst in ihre Behörden, versorgen sich mit dem neuesten Klatsch des Tages, Polizisten laufen Streife, Minister unterschreiben Dekrete, und die Abgeordneten kritisieren sie. In den Schulen erteilen Lehrer ihren Schülern Lektionen, so wie sie es Tag für Tag tun, in den Bäckereien werden Brote gebacken, vor Gericht wird Recht gesprochen. Am Abend füllen sich die Theater und Konzerthäuser, in den Wohnungen wird das Licht gelöscht. Man geht zu Bett in der Erwartung, daß auch morgen alles wie heute sein wird.
Auch im Palast von Zarskoje Selo, der sich in einer großen Parkanlage, 25 Kilometer südlich von der Hauptstadt, befindet, verläuft das Leben in den gewohnten Bahnen. Von den Abgeordneten der Duma, die sich zu ihrer konstituierenden Sitzung versammeln, nimmt der Zar keine Notiz. Die Brotproteste scheinen ihn überhaupt nicht zu berühren. Vor einigen Tagen hat sich Alexei, der zwölfjährige Thronfolger, beim Spiel mit anderen Kindern angesteckt und ist an einem grippalen Infekt erkrankt. Auch seine Schwestern Tatjana und Olga müssen das Bett hüten. Der Zar selbst hat sich in den letzten Tagen einen Schnupfen zugezogen. Es ist nicht zu übersehen, wie sehr ihm das Wohl seiner Töchter und seines Sohnes am Herzen liegt und wie wenig ihn die politischen Fragen beschäftigen, die das gebildete Publikum in der Hauptstadt aufwühlen. Was geht ihn die Empörung irgendwelcher Politiker an, denkt er, die er gar nicht kennt und die ihn nicht einmal interessieren? In seinem Tagebuch vermerkt er das übliche Einerlei: ein Gebet, ein Besuch im Kinderzimmer, ein langer Spaziergang, Mitteilungen über das Wetter. Vom Parlament ist nicht die Rede.[25]
Am 22. Februar ist Alexander Spiridowitsch, der Stadthauptmann von Jalta und ehemalige Kommandant der kaiserlichen Palastwache, zu Gast im Haus Pjotr Sekretows, eines Generals, der den Fuhrpark und die Automobilschule des russischen Heeres kommandiert. Zur Abendgesellschaft gehören auch Sergei Fjodorow, der Leibarzt des Zaren, der ehemalige Direktor des Polizeidepartements Stepan Belezki und Senator Sergei Tregubow. Die Herren trinken Wein, rauchen Zigarren, amüsieren sich über Abgeordnete der Duma, die angeblich Listen führen, auf denen alle Personen verzeichnet sind, die nach der Revolution verhaftet werden sollen. Sekretow verachtet die Dilettanten, die im Parlament das große Wort führen. Auch Ihre Namen, sagt er zu seinen Gästen, stehen auf den Listen, das wisse er aus sicherer Quelle. Aber wer fürchte sich schon vor Leuten wie Nikolai Nekrassow, der, wie alle anderen Liberalen auch, ein Hasenfuß sei. Er, Sekretow, werde, wenn es zum Äußersten kommen solle, seine Lastwagen mit Maschinengewehren ausstatten und auf die Straße hinausschicken. Dann lacht der General, füllt die Gläser seiner Gäste. Fjodorow pafft grinsend eine Zigarre und auch Belezki ist gut aufgelegt. Männer von begrenztem Verstand, die sich entspannt in ihre Sessel zurücklehnen, weil sie glauben, sich und ihre Umgebung unter Kontrolle zu haben.[26] Wenige Tage später werden sie vom Leben widerlegt.
II.
Der Zar fährt ins Hauptquartier
Mittwoch, 22. Februar 1917
Im Alexander-Palast von Zarskoje Selo herrscht Aufbruchstimmung. Diener laufen durch die Korridore und tragen Koffer hinaus, wo sie in Kutschen verstaut werden, die vor der Auffahrt warten. Der Zar bereitet sich auf seine Abreise nach Mogiljow vor, wo sich das Hauptquartier der russischen Streitkräfte befindet, zu dessen Oberbefehlshaber er sich im August 1915 selbst ernannt hat. Nikolai glaubt, daß der Chef des Generalstabs, Michail Alexejew, ein Mann, der aus bescheidenen Verhältnissen stammt und sich durch außergewöhnliche Leistungen an die Spitze der militärischen Hierarchie emporgearbeitet hat, ihn dort erwartet. In Wahrheit aber ist der Zar eine Belastung für die Generalstabsoffiziere, weil er von der Strategie des Krieges nichts versteht und die Generäle, die mit ihm die Mahlzeiten einnehmen und das Hofleben teilen müssen, von ihrer Arbeit abhält.[1] Nicht nur die Höflinge fragen sich, warum der Zar ausgerechnet jetzt nach Mogiljow fahren will und ob er gut beraten ist, im Angesicht der angespannten Situation die Hauptstadt zu verlassen. Gerüchte verbreiten sich, daß Verschwörer die Zarin töten wollen. Alexander Spiridowitsch, ein einflußreicher Mann mit guten Verbindungen zur Geheimpolizei, unterhält sich in diesen Tagen mit Höflingen, mit denen er bekannt ist und fragt sie, warum der Zar unbedingt ins Hauptquartier fahren wolle, wenn er sich doch auch in der Hauptstadt nützlich machen könne. Aber Nikolai zieht es vor, dorthin zu fahren, wo ihn niemand braucht.[2]
In der unmittelbaren Umgebung des Zaren herrscht dennoch eine ausgelassene Stimmung, weil sich die Höflinge über die Abwechslung freuen, die mit der Reise verbunden ist und sie von der Langeweile des Palastalltags befreit. Wojejkow, der lieber unterwegs ist, als seine Tage in Zarskoje Selo zu verbringen, bestärkt den Zaren deshalb in seinem Vorhaben. Der Innenminister habe ihm versichert, sagt er, daß keinerlei Unruhen zu befürchten seien, er sich also getrost ins Hauptquartier begeben könne. Am 21. Februar erscheint Protopopow selbst im Palast, um dem Zaren die beruhigende Nachricht zu überbringen, daß die Ordnung in seinen Händen gut aufgehoben sei.[3] Auch im Gefolge hält es niemand für möglich, daß die Herrschaft auf dem Spiel stehen könnte. Dmitri Dubenski, Chronist und Hofhistoriker, der den Zaren seit 1914 auf all seinen Reisen begleitet, ist vollkommen arglos, als er den Zug nach Mogiljow besteigt. Zu seiner Frau und seinen Kindern sagt er vor der Abreise, daß es keinen Grund zur Beunruhigung gebe. Schon bald werde er wohlbehalten wieder zu Hause sein.[4]
Am Nachmittag des 22. Februar verlassen zwei identisch aussehende Züge, die sich aus je sechs blau lackierten Waggons zusammensetzen und das Wappen des Herrscherhauses tragen, den Bahnhof von Zarskoje Selo. Aus Furcht vor Anschlägen wird nicht mitgeteilt, welcher Zug vorausfährt. Heute ist es der kaiserliche Zug, der dem Gefolge hinterherrollt. Um 15 Uhr setzt sich die Entourage in Bewegung. Zu ihr gehören der Kommandeur des kaiserlichen Eisenbahnregiments, Sergei Zabel, der Zeremonienmeister Baron Rudolf von Stackelberg, der Hofhistoriker Dubenski, Beamte des Hofministeriums und Ingenieure der Eisenbahn. Eine Stunde später besteigt der Zar seinen eigenen Zug, der mit einem geräumigen Schlafzimmer und einem Büro ausgestattet ist, in dem ein Schreibtisch und bequeme Sessel stehen. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Abteile von Fredericks und Wojejkow, des Chefs der Hofkanzlei, Kirill Naryschkin, des Leibarztes Sergei Fjodorow und der Flügeladjutanten Graf Alexander Grabbe, Nikolai Leichtenbergski (eigentlich: Herzog Nikolaus von Leuchtenberg), Anatoli Mordwinow und Konstantin Nilow. Der mit grünen Seidentapeten ausgeschlagene Salonwagen dient dem Zaren während seiner Reise als Besprechungsraum. Tagsüber stehen vor dem Eingang zum Speisewagen zwei hochgewachsene, auffallend schöne Kosaken, die den Herrscher auch sonst überallhin begleiten.[5]
Niemals weicht der Zar von der täglichen Routine des Hofes ab, auch nicht auf Reisen: Frühstück, Mittagessen und Abendessen in immer gleicher Gesellschaft, die Lektüre von Depeschen und Telegrammen. Am Abend spielt er im Salonwagen Domino mit Nilow, Grabbe und Mordwinow. Nikolai II. schätzt es nicht, wenn in seiner Gegenwart über politische Fragen gesprochen wird. Niemand soll erfahren, was er selbst für bedenkenswert hält, denn nur so gelingt es, glaubt er, all die Intriganten gegeneinander auszuspielen, die auf ihn einreden, und sie im Ungewissen darüber zu lassen, welche Entscheidung er treffen könnte. Der Zar ist ein unpolitischer Herrscher. Für strategische Fragen interessiert er sich nicht, er stellt sich die Politik als Verlängerung seines privaten Haushaltes vor. Alle Höflinge und Minister wissen, daß sie an der kaiserlichen Tafel das Wort nur ergreifen dürfen, wenn der Herrscher es ihnen erteilt. Niemals spricht Nikolai über den politischen Alltag, unangenehme Nachrichten will er nicht hören. Allen Konflikten geht er stets aus dem Weg, weil er ihnen ohnehin nicht gewachsen wäre, wie er selbst weiß. Und so ziehen es auch die Gefolgsleute vor, zu schweigen.[6]
Nikolai II. mit Sohn und Töchtern vor dem kaiserlichen Zug, März 1914
Es ist noch hell, als der Zug des Zaren von Zarskoje Selo langsam nach Süden fährt. Rußland zeigt sich jenseits der Metropole von seiner stillen Seite. Wiesen und Wälder liegen im Nebel, und langsam gleitet der kaiserliche Zug durch die schneebedeckte Landschaft. Vom Krieg und seinen Folgen ist nichts zu sehen und zu spüren. In Rschew, Wjasma und Smolensk stehen Menschen auf dem Bahnsteig, sie lüften ihre Hüte, winken und rufen dem Zaren ein donnerndes Hurra entgegen. Gewöhnlich hält der Zug an den wichtigsten Stationen, und der Zar geht auf den Bahnsteig hinaus, um die zu seinen Ehren versammelten Honoratioren zu begrüßen. Nun aber zieht er es vor, im Waggon zu bleiben, weil ihm die Erkältung zusetzt, die er sich vor Tagen zugezogen hat. Bevor er sich am Abend des 22. Februar früher als sonst zu Bett legt, vertraut er seinem Tagebuch an, was er offenbar für bemerkenswert hält und deshalb in Erinnerung behalten möchte. «Der Tag war sonnig, frostig. Ich las, ich langweilte mich und ruhte mich aus. Wegen des Hustens ging ich nicht nach draußen.»[7] Am nächsten Morgen um 9 Uhr, der Zug passiert gerade den Bahnhof von Smolensk, wacht Nikolai auf. Er vertreibt sich die verbleibende Zeit damit, das Buch eines französischen Autors über die Eroberung Galliens durch Julius Cäsar zu lesen. Wenige Stunden später trifft er in Mogiljow ein.[8]
III.
Der Protest beginnt
Donnerstag, 23. Februar 1917
Am frühen Morgen des 23. Februar entlädt sich der aufgestaute Zorn in lautem Protest. Im Wyborger Stadtbezirk versammeln sich junge Männer und Frauen auf den Straßen und schreien ihre Wut heraus, ihnen schließen sich nach und nach Arbeiter an, die ihre Werkbänke verlassen und zu den Fabriken ziehen, in denen die Maschinen ihren Betrieb noch nicht eingestellt haben. Nicht alle tun es freiwillig. Demonstranten werfen mit Steinen auf Fabriktore, riegeln die Werkstätten ab, drohen Streikbrechern Gewalt an. Stunde um Stunde wächst die Zahl der Frauen und Männer, die sich in den Protestzug einreihen, der sich über die großen Straßen ergießt, bald sind es mehr als 70.000. Zur Mittagszeit spricht sich auch in den benachbarten Bezirken herum, was sich auf der Wyborger Seite zuträgt.[1] Und nun strömt die Masse auf die Liteiny-Brücke zu, die über die Newa in die Innenstadt führt. In den Industrievierteln bleiben Arbeiter mit ihrer Wut unter sich. Deshalb wollen sie sich jetzt im Zentrum hörbar und sichtbar machen, am feinen Newski-Prospekt und in seinen Nebenstraßen, wo die wohlhabenden Bürger und die Beamten des Staates wohnen. Die Gesellschaft von Besitz und Bildung soll die Wut der Arbeiter zu spüren bekommen. Darauf aber ist die Polizei vorbereitet. Sie holt Männer aus den Straßenbahnen, die durch schmutzige und schwielige Hände auffallen und nachlässig gekleidet sind und schickt sie zurück auf die andere Seite der Newa. Schon am Vormittag riegeln Polizisten die Liteiny-Brücke ab und drängen die Demonstranten zurück, einigen gelingt es jedoch, sich über die Troitzki-Brücke und über die zugefrorene Newa bis zum Snamenskaja-Platz am oberen Newski-Prospekt durchzuschlagen.[2] Auf dem Liteiny- und dem Suworow-Prospekt blockieren Demonstranten die Schienenwege und zwingen Straßenbahnfahrer, ihnen die Zündschlüssel auszuhändigen. Sie werfen sie in den Fluss. Die Menge schleudert Steine auf Polizisten, eine Straßenbahn wird in Brand gesetzt, eine Bank überfallen. Auf dem Bolschoi-Prospekt plündert die Menge eine Bäckerei.[3] Am Nachmittag begibt sich Louis de Robien, ein Mitarbeiter der französischen Botschaft, zu einem Spaziergang auf den Newski-Prospekt. Beunruhigt ist er nicht. Er trifft auf eine kleine Gruppe von Demonstranten, die von Polizisten eingekreist werden. «Alles ist vollkommen ruhig und die Passanten schauen sie amüsiert an.»[4]
Nicht überall geht es so friedlich zu. An der Kasaner Kathedrale treffen Demonstranten und eine Kosakeneinheit aufeinander, und für einen Augenblick sieht es so aus, als sei das Ende der Proteste nur eine Frage der Zeit. Denn gegen die Kosaken wird sich die unbewaffnete und unorganisierte Menge nicht behaupten können, wie jeder weiß. Zufällig fährt Alexander Balk, der Stadthauptmann von Petrograd, mit seinem Auto an der Kathedrale vorbei, er steigt aus und fordert den Kommandeur einer Kosakenschwadron auf, die Menge sofort auseinanderzutreiben. Die Kosaken setzen sich in Bewegung, in fliehendem Galopp reiten sie die Straße hinab, aber sie drosseln plötzlich das Tempo und drehen ab, noch bevor sie die Menge erreichen. Balk kann nicht glauben, was er sieht. Er erinnert sich noch an das Jahr 1905, als die Peitschen der Prätorianergarde das Regime vor dem Untergang bewahrten. Und nun verweigern die Kosaken zum ersten Mal einen Befehl.[5] In der Nähe des Anitschkow-Palastes an der Fontanka schreit ein Offizier Befehle heraus, aber er wird von der Menge einfach ausgelacht, die spürt, daß sie sich vor Männern wie ihm nicht länger fürchten muß. Auf den Straßen herrscht eine ausgelassene, geradezu fröhliche Stimmung. An manchen Kreuzungen mischen sich Kosaken unter die Passanten, die das Geschehen beobachten, und unterhalten sich mit ihnen. Ein Abgeordneter der Konstitutionellen Demokraten, der zufällig Zeuge dieser Szene wird, erfaßt sofort, daß hier etwas geschieht, was sich in die gewohnten Kategorien nicht einfügen läßt. All das, schreibt er später, wäre zuvor undenkbar gewesen. Am Abend des 23. Februar findet er dafür noch keine Erklärung. Vielleicht ist es Zufall, daß die Kosaken den Gehorsam verweigern. Was immer es auch gewesen sein mag: Die Unentschlossenheit der Staatsgewalt spricht sich herum, sie nimmt den Unzufriedenen die Furcht und läßt sie die Straße als einen Ort sehen, der ihnen gehört.[6]
Die Abgeordneten in der Duma sind von den Unruhen ebenso überrascht worden wie die Regierung. Aber sie können sich über den Unmut nicht einfach hinwegsetzen, auch wenn sie selbst nicht wissen, wie die Versorgungskrise zu bewältigen ist. Im Plenum des Parlaments entbrennt am Nachmittag eine leidenschaftliche Debatte über die Versäumnisse der Regierung. Rittich, der Landwirtschaftsminister, versucht, sich Gehör zu verschaffen, bricht seine Rede aber ab, weil ihn die Abgeordneten durch laute Zurufe zum Schweigen bringen und mit Vorwürfen überhäufen. Wieder einmal glaubt die Opposition, daß ihre Stunde gekommen ist. Die Versorgungskrise, ruft der liberale Abgeordnete Andrei Schingarjow, sei überhaupt erst durch die Inkompetenz der Regierung verursacht worden, von einer «Diktatur der Dummheit, einer Dummheit, die den Staat in der Stunde der größten Gefahr ruiniert», wie er hinzufügt, obwohl doch jedermann weiß, daß der Landwirtschaftsminister für den Brotmangel nicht verantwortlich gemacht werden kann.[7]
Matwei Skobelew, der zur Fraktion der Menschewiki gehört, jener sozialdemokratischen Gruppierung, die sich vor nunmehr fünfzehn Jahren im Streit von Lenin und seinen radikalen Bolschewiki getrennt hat, spricht von «unglücklichen, halbverhungerten Kindern und ihren Müttern», die in langen Schlangen vor den Brotläden stünden, nur um dort zu erfahren, daß die Vorräte aufgebraucht seien. In manchen Gouvernements seien schon Fälle von Skorbut registriert worden. Wie alle Sozialisten denkt auch Skobelew in historischen Analogien. Was er auf den Straßen sieht, erinnert ihn an die Anfänge der Französischen Revolution. Wer wisse denn nicht, ruft er, daß der französische König einst von der herrschenden Klasse beseitigt worden sei, die den Dilettantismus und die Unfähigkeit der Regierung nicht mehr habe ertragen können. Für den Hungertod Tausender sei die Regierung am Ende «grausam bestraft» worden. Skobelew ist klug genug, die Grenze nicht zu überschreiten, die Kritik vom Aufruhr trennt. Er spricht über Ludwig XVI., nicht über Nikolai II. Und auch der Sozialrevolutionär Alexander Kerenski, das rhetorische Sturmgeschütz des Parlaments, dessen theatralische Posen und hysterische Reden ihm landesweit Popularität verschafft haben, will es nicht zum Äußersten kommen lassen. «Wir verlangen», ruft der kleine, drahtige Advokat mit dem Bürstenhaarschnitt und den verkniffenen Augen den Ministern zu, die auf der Regierungsbank sitzen, «daß Sie sich unverzüglich von Ihren Plätzen entfernen.» Aber Kerenski, der sonst seiner Leidenschaft freien Lauf läßt, spürt in diesem Moment, daß er nicht wüßte, was er tun solle, würde man ihm jetzt die Macht übertragen. Wie stets gefallen sich die Abgeordneten darin, feurige Reden zu halten und Forderungen zu stellen, aber eigentlich haben sie keine Vorstellung davon, wie die Krise bewältigt werden soll, die Rußland aus dem Gleis geworfen hat.[8]
Nicht nur die liberalen Abgeordneten sind von den Unruhen überrascht. Auch die Revolutionäre begreifen nicht, was in den Industrierevieren geschieht. Jahrelang haben sie den Aufstand herbeigeredet, und nun sind sie ratlos, weil Arbeiter sich ohne ihre Aufforderung auf die Straße begeben. In ihrer Vorstellung soll das Proletariat, der Messias der Geschichte, die Bühne erst betreten, wenn es dazu aufgerufen wird. Später wird sich der Sozialdemokrat Iwan Tschugurin an die erstaunten Mienen erinnern, die auf den Gesichtern der Revolutionäre zu sehen waren. «Der Februarstreik», wird er schreiben, «brach gegen unseren Wunsch aus.»[9] Ratlosigkeit überall. Die Bolschewiki können der unangemeldeten Demonstration ohnehin nichts abgewinnen. Schljapnikow, der das Parteikomitee in der Hauptstadt führt, hält spontanen Aufruhr für sinnlos. Er folgt Lenins Devise, daß die Revolutionäre besser wissen, was Arbeiter wollen und man diesen deshalb nicht das letzte Wort überlassen dürfe. Aber was kann er schon tun? Die revolutionären Parteien sind schwach, sie haben nicht die Kraft und die organisatorischen Fähigkeiten, um einen Generalstreik auszurufen und zum Erfolg zu führen. Ihre Anführer und Vordenker sind im Exil, und nun ist guter Rat teuer. Was immer sie auch später über die Revolution sagen werden – am 23. Februar überwiegt noch die Angst vor den Konsequenzen, die sie zu tragen hätten, wenn sie alles auf eine Karte setzten. Nicht aus Machtwillen, sondern aus Verlegenheit stürzen sie sich in das Geschehen. Wassili Schulgin, der zynische und unerschrockene Anführer der Monarchisten in der Duma, hat die großspurigen Reden der Sozialisten noch nie ernst genommen. Er hält sie für Papiertiger, die sich vor dem Volk ebenso fürchten wie die liberalen Herren, die im Parlament gelehrte Reden halten. Er findet dafür eine passende Formulierung: «Sie, die Revolutionäre, waren nicht bereit, aber sie, die Revolution, war bereit.»[10]
Am Nachmittag berät sich Protopopow mit Chabalow und erteilt ihm den Auftrag, die Bevölkerung zu beruhigen. Der General erfährt, daß die Speicher in der Stadt mit Mehl und Getreide gefüllt sind und die Vorräte ausreichen, um Petrograd für weitere zehn Tage zu versorgen. Sie aber will er nicht herausgeben, weil ihm die Geheimpolizei versichert, daß der Aufruhr in wenigen Stunden beendet sein werde und die Depots deshalb nicht geleert werden dürften. Und so läßt Chabalow Plakate in der Stadt aushängen, auf denen zu lesen ist, daß alle Bäckereien mit Mehl versorgt seien, sich niemand um sein Wohl sorgen müsse. Am Nachmittag erfährt der General von einem seiner Agenten, daß in den Geschäften, die er, wie er beteuert, selbst inspiziert habe, Mehl in ausreichender Menge vorhanden sei, es keinen Grund gebe, in Panik zu verfallen. Am Abend lädt Chabalow Repräsentanten der Bäcker zu sich ein und erklärt ihnen, daß alle Verkaufsläden weiterhin mit Mehl beliefert würden, die Unruhen Provokateuren und Aufwieglern zugerechnet werden müßten.[11] Solche Versicherungen aber bewirken das Gegenteil dessen, was sie erreichen sollen. Der Sturm auf die Bäckereien nimmt überhaupt erst an Fahrt auf, weil die Frauen, die in den Schlangen stehen und Waren horten, der Regierung keinen Glauben schenken. Wer solche Plakate druckt, glauben sie, hat etwas zu verbergen. Die Journalisten der liberalen Zeitung «Retsch» haben längst begriffen, was Chabalow und Protopopow nicht wahrhaben wollen: daß die Versorgungskrise eigentlich eine Glaubwürdigkeitskrise ist und der Innenminister in der Öffentlichkeit den letzten Kredit verspielt. Die Regierung dürfe nicht den Eindruck erwecken, so «Retsch», als laufe sie den Ereignissen hinterher, als wisse sie nicht, was zu tun sei, sondern müsse Entschlossenheit zeigen und alle Maßnahmen ergreifen, die geeignet seien, die Krise zu überwinden. Wenn niemand mehr an den Willen und die Fähigkeit der Minister glaube, den Ereignissen eine Wendung zu geben, werde sich die Unzufriedenheit vergrößern wie ein Schneeball, der einen verschneiten Abhang hinunterrollt und an Fahrt aufnimmt.[12]
Die Regierung hat alle Vorteile auf ihrer Seite. Sie ist im Besitz der Kommunikationskanäle, sie übt die Kontrolle über die Infrastruktur, über Polizei und Militär aus. Und sie weiß um die Ahnungslosigkeit und Zerstrittenheit der Opposition. Aber diese Selbstgewißheit hält sie auch davon ab, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Wieder einmal glaubt Protopopow, es reiche, Drohungen auszusprechen. Drei Wochen zuvor sind auf seine Veranlassung hin alle sozialdemokratischen Mitglieder des Kriegs-Industrie-Komitees in ihren Wohnungen in der Hauptstadt verhaftet und in das Kresty-Gefängnis gebracht worden. Protopopow glaubt, Rußland vor einer Revolution bewahrt zu haben, und auch im Ministerrat prahlt er mit seinen Heldentaten. Wie oft hat es schon Unruhen gegeben, die nach wenigen Stunden wieder beendet worden sind, weil es niemanden gab, der den Demonstranten Ziele setzte, wie zuletzt im Juli 1914, als die schockierende Straßengewalt nach wenigen Tagen durch den rücksichtslosen Einsatz der Sicherheitskräfte beendet werden konnte. Und so wird es auch jetzt wieder sein, denkt Protopopow: Man bringt die Rädelsführer der Unruhen hinter Gitter, und sofort fügt sich das Leben wieder in den gewohnten Rahmen ein. Aber er unterschätzt die organisatorischen Fähigkeiten der Arbeiter, die nichts weiter tun müssen, als sich mit ihren Landsleuten aus dem Heimatdorf zu verabreden und den Protest auf die Straßen zu tragen. Das Dorf ersetzt die Gewerkschaft, die Gemeinschaft die Partei. Davon scheint der Innenminister keinen Begriff zu haben. Aber auch Chabalow begeht Fehler. Er erteilt zwar die Anweisung, den Zugang zu den Newa-Brücken abzuriegeln, weil er die Demonstranten daran hindern will, sich im Stadtzentrum bemerkbar zu machen, aber er verzichtet darauf, Polizisten in die Arbeiterviertel zu entsenden, wo sich der Aufruhr stattdessen frei entfaltet.[13]
Am Nachmittag ruft Chabalow den Stadthauptmann Alexander Balk sowie den Chef der Ochrana, Konstantin Globatschow, und einige höhere Polizeioffiziere zu sich, um sich mit ihnen über die Strategie der Sicherheitsorgane zu beraten. Balk bringt den mißglückten Einsatz der Kosaken an der Kasaner Kathedrale zur Sprache. Wie konnte es geschehen, daß die bewaffnete Staatsmacht vor dem Pöbel zurückweicht, will er wissen. Der Kommandeur des Kosakenregiments versucht, sich zu rechtfertigen. Die Kosaken, erklärt er, hätten bislang noch keine Erfahrungen im Polizeieinsatz machen können, auch seien sie nur unzureichend mit Peitschen (Nagaiki) ausgerüstet worden, ihre Pferde nicht darin geübt, sich auf asphaltierten Straßen zu bewegen. Für Chabalow ist die Wiederherstellung der Ordnung ohnehin nur eine technische Frage. So sehen es auch Balk und die Geheimpolizisten, die im Büro des Stadtkommandanten sitzen. Sie verständigen sich darauf, jedem Kosaken für den Kauf einer Nagaika fünfzig Kopeken auszuhändigen. An allen Kreuzungen im Zentrum der Stadt sollen Polizisten postiert, eine Kavallerieeinheit der Kosaken gegen die Demonstranten eingesetzt werden. Der Einsatz von Schußwaffen aber müsse unterbleiben. Eine verhängnisvolle Entscheidung, denn Polizisten, die auf Plätzen und an Straßenecken stehen, sind ein leichtes Ziel für Attentäter, weil sie schon von weitem zu erkennen sind und aus dem Hinterhalt angegriffen werden können. Chabalow schlägt die Lehren aus den Erfahrungen des Jahres 1905 in den Wind. Er versteht nichts von der technischen Seite des Machtkampfes, weiß nicht, wie man die Infrastruktur für die Zwecke der Macht einsetzt und wie man Soldaten motiviert, die den Gehorsam verweigern. Damals, im Dezember 1905, hatten die Strafexpeditionen des Militärs die Zentren der Aufstände eingekreist und voneinander isoliert. Jetzt aber läßt sich die Staatsgewalt an ihrem zentralen Ort belagern, ohne daß ihre Repräsentanten begreifen, was ihnen widerfährt. Nichts weiter als ein Sturm im Wasserglas seien die Proteste, die sich auf den Straßen hörbar machen, glaubt Chabalow. Und im Vergleich zur ersten Revolution ist dieser Brotprotest doch nur ein Hauch, der nichts und niemanden aus dem inneren Gleichgewicht bringen wird. Darin bestärken ihn auch die Agenten der Geheimpolizei. Globatschew hält es für unwahrscheinlich, daß sich die gewalttätigen Ereignisse am nächsten Tag wiederholen könnten, und Chabalow glaubt ihm. Er verzichtet darauf, weitere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, weil er annimmt, daß der Spuk schon morgen zu Ende sein wird. Und so gehen die Herren am frühen Abend beruhigt auseinander und fallen in der Nacht in einen tiefen Schlaf.[14]
Am Abend gibt Maurice Paléologue, der französische Botschafter, einen Empfang in seiner Residenz. Zwanzig ausgewählte Gäste sind gekommen, unter ihnen der spanische Geschäftsträger, der unlängst aus dem Amt entlassene Verkehrsminister und Vorsitzende des Ministerrates, Alexander Trepow, der Direktor der Eremitage, Graf Dmitri Iwanowitsch Tolstoi und der Maler und Kunstkritiker Alexander Benois und seine Ehefrau. Vom Fenster aus sehen die Gäste, wie Arbeiter von der Wassili-Insel aus über die Liteiny-Brücke laufen und Straßenbahnwaggons umwerfen, aber das Geschehen auf der Straße scheint sie nicht zu beschäftigen. Louis de Robien hört Benois nach dem Abendessen noch sagen, daß es einige Vorfälle in den Vororten gegeben habe, denen aber wohl keine Bedeutung beigemessen werden müsse.[15] Paléologue ist irritiert, weil sich offenbar niemand für die Unruhen interessiert. Und so fragt er Trepow nach den Vorkehrungen, die getroffen worden seien, um die Ordnung abzusichern. Trepow zuckt mit den Schultern. Er weiß es auch nicht. «Als ich zu meinen übrigen Gästen zurückkehre, finde ich weder in ihrem Ausdruck noch in ihren Redensarten die mindeste Spur der Besorgnis vor. Man spricht hauptsächlich von einem Fest, das für die Fürstin Leo Radziwill am Sonntag veranstaltet werden soll, das sehr zahlreich besucht und besonders glänzend sein wird, daß es Musik und Tanz gibt.» Wie kann man in einem solchen Augenblick an die Ausrichtung eines Festes denken? Und warum sprechen seine Gäste über die Tanzkünste der Matilda Kschessinskaja, die am Marientheater Triumphe feiert, schweigen aber, sobald man sie auf die Versorgungskrise anspricht? Paléologue versteht nicht, wie man dem Offensichtlichen mit solcher Gleichgültigkeit begegnen kann.[16]
Maurice Paléologue (1859–1944), Botschafter Frankreichs in Rußland
Am 23. Februar, um 15 Uhr, trifft der Zar in Mogiljow ein. Michail Alexejew, der sechzigjährige Chef des Generalstabes, empfängt ihn mit militärischen Ehren am Bahnhof, obwohl er an einer fiebrigen Erkältung erkrankt ist und sich kaum auf den Beinen halten kann. Nikolai besteigt ein Auto und fährt in Begleitung des Gefolges in sein Domizil, ein kleines zweistöckiges Haus, das auf einem Hügel oberhalb des Dnjepr liegt. Dort wird er für die Dauer seines Aufenthaltes wohnen. Im Nebenhaus ist Alexejew mit seinem Stab untergebracht, auf der anderen Seite der Straße, im Gebäude des Bezirksgerichts, wohnt das Gefolge. In seinem karg eingerichteten Zimmer stehen zwei Feldbetten: eines für seinen Sohn und eines für ihn selbst. Seit er den Oberbefehl über die Streitkräfte übernommen hat, will der Zar nur noch als erster Diener des Staates wahrgenommen werden. Er trägt die Uniform eines Obristen, teilt die einfachen Mahlzeiten mit den Offizieren und gibt sich als ein Herrscher, der, wie seine Untertanen, ein anspruchsloses, einfaches Leben führt. Die Strapazen der zurückliegenden Jahre haben ihn gezeichnet, niemandem, der den Herrscher zu Gesicht bekommt, bleibt verborgen, wie sehr er sich verändert hat. Seine Haare sind ergraut, das Gesicht von Falten zerfurcht. Er wirkt seltsam abwesend, in Gedanken verloren, als habe eine tiefe Melancholie von ihm Besitz ergriffen.[17]
Nikolai II. und Alexandra, 1894
Kaum hat er seine Residenz bezogen, schreibt er Alexandra einen Brief, versichert ihr, wie sehr er sie und ihre «süße Stimme» und die Kinder vermisse und daß er beherzigen wolle, wozu sie ihn ermahnt habe: stark zu sein und alle seine feste Hand spüren zu lassen. Eigentlich aber, fügt er noch hinzu, sei es nicht seine Art, andere Menschen «anzuschnauzen». Er ziehe es vor, sie mit einer «ruhigen, aber scharfen Bemerkung» davon zu überzeugen, daß er derjenige sei, dem sie Gehorsam schuldeten. Als ob solche Zurückhaltung jemals etwas bewirkt hätte. Auch beklagt er sich bei Alexandra über die Verpflichtungen, die ihn davon abhielten, sich am Abend, wie sonst, mit seinem Puzzle zu befassen. Nicht einmal im Hauptquartier kommt er dazu, sich zu entspannen. Sobald er dafür wieder Zeit finde, fügt er noch hinzu, wolle er auch wieder Domino spielen. Zum ersten Mal ist er ohne seinen Sohn nach Mogiljow gereist, er vermisst ihn. Leer sei das Haus ohne Alexei, schreibt er in sein Tagebuch.[18]
Nikolai scheinen die Proteste, die auf den Straßen Petrograds aufgeführt werden, nicht zu beunruhigen. Er empfängt ausländische Generäle, und am Abend plaudert er mit dem Gefolge, das an seiner Tafel sitzt. Fredericks, der stilsichere Hofminister, der auch ohne Aufforderung das Wort ergreifen darf, räsoniert über die Qualität von Äpfeln und Birnen, die zum Nachtisch gereicht werden, verliert aber kein Wort über die Brotkrise. All die aufsässigen Reden, die in der Duma gehalten werden und die den Pöbel auf die Straßen treiben, denkt er, hätte man Rußland ersparen können. Hätte man ihn, den Hofminister, im Jahr 1905 gefragt, was zu tun sei – er hätte dem Zaren davon abgeraten, Rußland eine Verfassung und ein Parlament zu schenken. Fredericks spricht es nicht aus, aber er hält die gegenwärtige Krise für das Resultat eines faulen Kompromisses, auf den sich ein Mann wie Alexander III., Nikolais Vater, niemals eingelassen hätte. Der Zar, glaubt er, ist Schöpfer allen Rechts und darf, was er einmal gewährt hat, auch jederzeit wieder zurücknehmen. Aber er weiß, daß Nikolai II. für den Moment der Entscheidung nicht gemacht ist. Auch an diesem Abend ist der Zar höflich und zuvorkommend, wie stets, aber verschlossen und in sich gekehrt. Er hört noch Alexejew an und geht zu Bett, ohne auch nur ein Wort über die Ereignisse in der Hauptstadt verloren zu haben.[19]
Nikolai II. im Kreise seiner Generäle im Hauptquartier in Mogiljow. Erster von rechts in der rechten Reihe, Nikolai Iwanow, dritter von rechts, Alexei Brussilow, dritter von rechts in der linken Reihe, Michail Alexejew
Im Hauptquartier herrscht eine beklemmende Atmosphäre, weil niemand auszusprechen wagt, was allen auf der Zunge liegt. Selbst die Generalstabsoffiziere haben von den Unruhen schon gehört, und sie machen sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Familien, die in Petrograd leben. Nun bedrängen sie die Soldaten der Palastwache, ihnen Auskunft über das Geschehen in der Hauptstadt zu geben. Aber auch sie wissen nur, was sie von anderen gehört haben. Am Abend sitzen Dubenski, Fjodorow und Nilow beisammen und sprechen über die Ereignisse im fernen Petrograd, von denen der Zar nichts hören will. Ob sie gut beraten waren, in diesen Tagen die Hauptstadt zu verlassen und sich selbst von allen Informationen abzuschneiden? «Mit einem Wort», wird Dubenski über diese einsamen Stunden später schreiben, «wir malten uns keine fröhlichen Perspektiven aus.» Um Mitternacht verläßt er das Domizil des Zaren. Vor dem Haus stehen Kosaken und Polizisten in Fellmänteln und halten Wache. Feiner Pulverschnee fällt vom dunklen Himmel herab. Tauwetter setzt ein.[20]
IV.
Der Aufruhr erreicht die Innenstadt
Freitag, 24. Februar 1917
Die Ruhe der Nacht ist trügerisch. Schon am frühen Morgen des 24. Februar setzt sich fort, was am Vortag begonnen hat. Wieder stehen Aufwiegler vor den Fabriktoren im Wyborg-Distrikt und fordern Arbeiter auf, sich auf den Weg in das Stadtzentrum zu machen. Nun mischen sich auch Mitglieder revolutionärer Parteien unter die Demonstranten. Sie geben den Arbeitern den Rat, sich mit Eisenstangen, Steinen, Schrauben und Messern zu bewaffnen. Ein gewisser Tichonow führt die Menge an, die von Fabrik zu Fabrik zieht und schon am frühen Vormittag auf 70.000 Menschen anwächst. Arbeiter, die sich dem Protest nicht anschließen wollen, werden mit Steinen beworfen oder verprügelt. Die Stimmung ist aggressiv. Auf dem Weg zum Finnländischen Bahnhof blockiert der Mob Schienen und zerrt Menschen aus Straßenbahnwaggons. Steine kommen zum Einsatz, Ladenfenster zerspringen und Bäckereien werden ausgeraubt. Und nun versuchen mehr als zehntausend Arbeiter, über die Newa ins Stadtzentrum zu gelangen. Auf der Liteiny-Brücke werden sie schon erwartet. Mehr als 500 Polizisten und Kosaken haben sich dort postiert. Sie sollen die Masse zurückdrängen und von der Innenstadt fernhalten. Als die ersten Demonstranten die Brücke betreten, geben die Offiziere den Befehl, die Menge auseinanderzutreiben. Eine Polizeischwadron reitet im Galopp und mit gezückten Säbeln auf die Arbeiter zu. Ihr folgen Kosaken. Die Polizisten schwingen ihre Peitschen, die Demonstranten geraten in Panik, als sie versuchen, den Schlägen auszuweichen. Aber es geschieht nichts von dem, was alle befürchten. Denn die Kosaken halten sich zurück, machen von ihren gefürchteten Nagelpeitschen keinen Gebrauch. Arbeiter schlüpfen unter ihren Pferden hindurch, und in kleinen Gruppen drängen sie sich auf den Liteiny-Prospekt, andere drehen ab und gelangen über das gefrorene Eis auf der Newa ans andere Ufer.[1] Louis de Robien steht an diesem Vormittag am Kai in der Nähe der Liteiny-Brücke und verfolgt die Bewegungen auf dem Fluß. Kleine Gruppen von Arbeitern laufen im Gänsemarsch über das Eis. Am Ufer reiten Kosaken auf ihren kleinen Pferden auf und ab und versuchen, den Demonstranten den Weg abzuschneiden. Mit ihren Lanzen und Karabinern hinterlassen sie bei de Robien einen «pittoresken Eindruck», wie er am Abend in seinem Tagebuch vermerkt.[2]
Inzwischen haben sich auch auf der Petrograder Seite und auf der Wassili-Insel zehntausende Arbeiter versammelt. Um 11 Uhr strömen sie über den Bolschoi-Prospekt und den Kamenoostrowski-Prospekt über die Troitzki-Brücke auf das Marsfeld, und bald erreichen sie das Stadtzentrum. Die berittene Polizei versucht, der Masse den Weg zu versperren, aber das gelingt ihr schon nicht mehr, weil die Demonstranten in Nebenstraßen ausweichen und sich erst auf dem Newski-Prospekt wieder vereinen. Es spricht sich herum, daß die Kosaken ihren Offizieren nur widerwillig gehorchen. Bäckereien und Metzgerläden werden geplündert, Hooligans, die sich unter die Demonstranten gemischt haben, schlagen die Fensterscheiben aller Läden ein, die sie auf ihrem Weg passieren. Unterdessen ist Nicolas Nabokow, der Neffe des liberalen Politikers Wladimir Nabokow, auf dem Weg zur Schule, aber er muß wieder umkehren, weil der Rektor die Anordnung erteilt, daß der Unterricht so lange ausfallen müsse, bis die Ordnung wiederhergestellt sei. Die Straßenbahnen haben ihren Betrieb eingestellt, man käme ohnehin nicht weit, selbst wenn man den Versuch unternähme.[3]