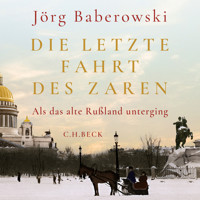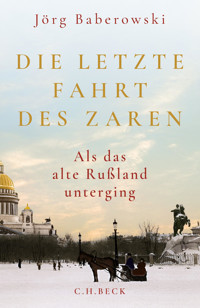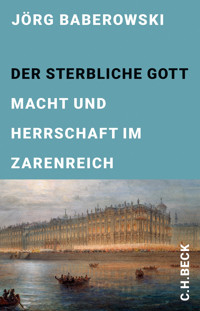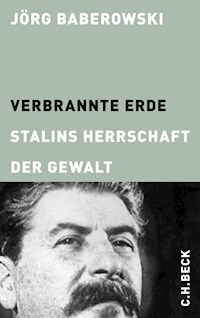9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum tun Menschen einander Gewalt an? In seiner eindringlichen und vieldiskutierten Studie »Räume der Gewalt« zeigt der bekannte Historiker Jörg Baberowski, Autor des mit dem Leipziger Buchpreis 2012 augezeichneten Buches »Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt«, warum ein Ende der Gewalt so schwer zu erreichen ist. Eigentlich sehnt jede Erklärung der Gewalt zugleich ihr Ende herbei. Das Leben soll schöner werden und die Gewalt aus ihm verschwinden. Doch die Gewalt war und ist eine für jedermann zugängliche und deshalb attraktive Handlungsoption – und kein »Betriebsunfall« oder »Extremfall«. Wer wirklich wissen will, was geschieht, wenn Menschen einander Gewalt antun, muss eine Antwort auf die Frage finden, warum Menschen Schwellen überschreiten und andere verletzen oder töten. Jörg Baberowski präsentiert nicht nur klare Einsichten über den sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Umgang mit Gewalt. Er zeigt zugleich, warum die Abwesenheit von Gewalt sowohl Sehnsucht als auch Utopie bleiben muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jörg Baberowski
Räume der Gewalt
Über dieses Buch
Warum tun Menschen einander Gewalt an, und warum ist das normal?
Jede Erklärung der Gewalt sehnt deren Ende herbei. Die Gewalt soll aus dem Leben der Menschen verschwinden. Doch die Gewalt war und ist eine für jedermann zugängliche und deshalb attraktive Handlungsoption – und kein »Extremfall«. Wer wirklich wissen will, was geschieht, wenn Menschen einander Gewalt antun, muss eine Antwort auf die Frage finden, warum Menschen Schwellen überschreiten und andere verletzen oder töten. In seinem viel diskutierten Buch präsentiert der bekannte Historiker Jörg Baberowski klare Einsichten über den sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Umgang mit Gewalt. Und zeigt, warum die Abwesenheit von Gewalt zugleich Sehnsucht und Utopie bleiben muss.
»Nach der Lektüre steht man weniger fassungslos vor dem Phänomen, begreift besser, warum [die Gewalt] nicht aufhört.«
Thomas Speckmann, Der Tagesspiegel
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jörg Baberowski, geboren 1961, studierte Geschichte und Philosophie und ist seit 2002 Professor für Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu seinen Veröffentlichungen zählen: ›Der Rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus‹ (2003), ›Der Sinn der Geschichte. Geschichtstheorien von Hegel bis Foucault‹ (2005) und zuletzt ›Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt‹ (2012, im Fischer Taschenbuch 2014). ›Verbrannte Erde‹ wurde 2012 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet und stand mehrere Wochen auf der »Spiegel«-Bestsellerliste.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hißmann
Coverabbildung: JBM / VISUM creative
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401085-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Zitat
Vorwort
1 Was ist Gewalt, und wie kann man sie verstehen?
Das Rätsel der Gewalt
Gründe und Rechtfertigungen
Das Menschenmögliche
Räume und Situationen
Wirkungen
Das Gehäuse der Gewalt
2 Zivilisierung: Die Gewalt verschwindet
Räume des Schreckens
Lust und Gewalt
Fremdzwang und Selbstzwang: Der Prozess der Zivilisation
Die Gewalt verschwindet nicht
Zivilisation und Moderne
3 Entgrenzung: Moderne und Gewalt
Der Staat als Gärtner
Fremdes und Eigenes: Die Utopie der Säuberung
Zerstörungskräfte
Bewahrung
Gewalt in staatsfernen Räumen
Gewalt und ihre Situationen
4 Unsichtbarkeit: Strukturelle Gewalt
Strukturen
Gewalt ohne Täter
Psychische Gewalt
5 Schicksal: Anthropologie der Gewalt
Der Mensch kann immer töten
Ordnung und Gewalt
Krieg
Massaker und Pogrome
Das Lager
Freiheit und Gewalt
Kultur und Gewalt
6 Gewalt und das Rätsel der Macht
Macht und Herrschaft
Machtdurchsetzung
Macht und Gewalt
Macht und Furcht
Anhang
Literatur
Personenregister
Für Dietrich Geyer
»Ich habe verstanden, was Macht bedeutet, und was ein Mann mit Gewehr.«
Warlam Schalamow
Vorwort
»Arthur Kruse war durch den Krieg erstmals aus Hamburg herausgekommen«, erinnert sich der Schriftsteller Uwe Timm, »war in Polen, in Russland, in der Ukraine gewesen. Seine Geschichten, die großen und kleinen Erlebnisse, habe ich vergessen, bis auf eine, die mir diesen etwas schlichten, aber uns Lehrlingen gegenüber freundlichen Mann für immer unheimlich machte. Er musste einmal zwei gefangene Russen von der Front zu einer Sammelstelle bringen. Im Sommer ’43, an einem heißen Julitag. Zwölf Kilometer Sandweg hin, zwölf Kilometer zurück. Staub und nochmals Staub. Nach einer Stunde habe er Stoi gesagt. Die beiden hätten sich nach ihm umgesehen, während er aus seiner Feldflasche getrunken habe. Natürlich hätten auch die beiden Russen Durst gehabt, so, wie sie herüberstarrten, und da habe er die Flasche auf den Boden gestellt, gegen einen Stein gelehnt, damit sie nicht umfiel, sei drei, vier Schritte zurückgegangen und habe ihnen dann gewunken, sie sollten trinken, allerdings habe er immer den Karabiner unter dem Arm gehalten, den Finger am Abzug. Die beiden hätten gezögert, dann aber seien sie gekommen, hätten die Flasche genommen, hätten beide nur einen Schluck, zwei Schluck getrunken, nicht mehr, die Flasche wieder an den Stein gestellt. Kruse sagte, er habe ihnen gewunken, sie sollten abhauen. Die beiden Russen hätten gezögert. Los, haut ab. Er habe mit der Hand gewunken, und dann, nach einem Augenblick, seien die beiden losgerannt. Er habe den Karabiner hochgenommen und geschossen, zweimal, kurz hintereinander. Ich war ein guter Schütze, hatte ne Schießschnur. Die wären sowieso verhungert, später, im Kriegsgefangenenlager. Er sei dann zurückgegangen, habe auf dem Weg noch eine Pause gemacht, sich hingesetzt, die Stullen gegessen, Stück Dauerwurst dazu, die Feldflasche ausgetrunken. Dann sei er weiter nach vorn, zur Einheit gegangen und habe Meldung gemacht: zwei Gefangene auf der Flucht erschossen. Gut so, habe der Spieß gesagt.«[1]
Auch ich habe als Kind viele Geschichten aus dem Krieg gehört, von Männern, die ihn als Soldaten überlebt hatten. Manche erzählten von ihren Abenteuern, von Lustigem, von Tier und Natur. Aber nur selten sprachen sie über das Handwerk des Tötens, und schon gar nicht über das Sterben der Kameraden. Und wenn sie es dennoch taten, sprachen sie in Formeln. Der Zuhörer sollte sich den Krieg als geräuschloses und geruchloses Geschehen vorstellen, alles andere hätte ihn um den Schlaf gebracht. Die Erzähler wussten, was in der Welt, in der ihre Geschichten gehört wurden, erzählbar war, und was nicht. Einmal erzählte mein Vater, der als Panzerfahrer an der Westfront eingesetzt war, wie er und seine Kameraden in eine amerikanische Fahrzeugkolonne hineingeschossen hatten. Das Gefecht habe sich zu Beginn des Jahres 1945 in der Eifel zugetragen. Die Kolonne der Amerikaner sei auf einer engen Straße langsam von der Talsohle nach oben gefahren. Man habe sie kommen sehen und die Panzer in Stellung gebracht. Mit einem gezielten Schuss aus der Panzerkanone sei das erste Fahrzeug der Kolonne in Brand gesetzt worden. Dann habe man das letzte Fahrzeug zerstört. Nun seien die Amerikaner bewegungsunfähig gewesen, hätten nicht vor und nicht zurück fahren können. Wie Tontauben hätten sie, die Soldaten der Wehrmacht, auf die eingeklemmten Fahrzeuge im Tross der Amerikaner gezielt und sie einzeln zerstört.
Mich hat diese Geschichte damals keineswegs um den Schlaf gebracht. Für den kleinen Jungen war niemand gestorben, es waren Fahrzeuge, eine Kolonne, der Feind vernichtet worden. Darunter konnte ich mir nichts vorstellen. Erst später, als ich mir als Student diese Geschichte ins Gedächtnis zurückrief, kam mir der Gedanke, dass der Vater Menschen getötet hatte und dass diese Menschen in ihren Fahrzeugen verbrannt sein müssen. Was, habe ich mich gefragt, wird der Vater gedacht haben, als er die brennenden Wracks sah und die Schreie der Verwundeten hörte? Hatte er sich schon daran gewöhnt? War er schockiert? Empfand er vielleicht Genugtuung, weil die feindlichen Soldaten auch seine Kameraden getötet hatten? Ich weiß es nicht. Doch ich konnte das Bild des Vaters, der zwar autoritär, aber auch ein fröhlicher Rheinländer war, nicht mit dem Bild des Panzersoldaten in Verbindung bringen.
Wir verleugnen die Gewalt, weil wir uns friedliche Menschen, die nicht böse sind, als Gewalttäter nicht vorstellen können. Und dennoch ist die Gewalt überall, obwohl die Welt nicht nur von bösen Menschen bewohnt wird. Menschen schlagen und töten im Affekt, sie tun es aus Gehorsam, aus Zwang, aus Gewohnheit, aus Freude oder weil sie sich gegen Gewalttäter zur Wehr setzen müssen. Offenbar hängt es nicht von Absichten und Überzeugungen, sondern von Möglichkeiten und Situationen ab, ob und wie Menschen Gewalt ausüben. Der Raum der Gewalt ist ein anderer Ort als der Raum des Friedens. Wer ihn betritt, durchschreitet ein fremdes Land, in dem er zu einem Anderen wird. Niemanden lässt Gewalt unberührt, niemand kann sich ihrem Zwang entziehen. Sie ist dynamisch und verändert alle sozialen Beziehungen zu ihren Bedingungen.
Mehr als fünfzehn Jahre habe ich mich mit den Schrecken der stalinistischen Gewaltherrschaft beschäftigt. Diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass Menschen zu allem fähig sind, wenn sie sich in einem Raum bewegen, in dem Gewalt nicht verboten, sondern geboten ist. Und sie hat mich davon überzeugt, dass man über die Wirkung der Gewalt nichts erfährt, wenn sie nicht als blutiges Geschehen empfunden wird. Der Leser soll sich schlecht fühlen, ihm soll übel werden, damit er versteht, dass Gewalt kein abstraktes, klinisch sauberes Geschehen ist, sondern Verletzte und Tote, Schmerz, Blut und Tränen verursacht. Wer darüber nicht schreiben will, sollte über die Gewalt schweigen.
Das Schreiben über die Gewalt verändert auch den Autor. Er wird zum Pessimisten, und er muss sich vor dem Bösen schützen, das er überall sieht und spürt. Eines Tages muss er aufhören, sich mit der Gewalt zu beschäftigen, weil sie sein Leben vergiftet und seine Stimmung verdüstert. Ich habe viele Jahre meines Lebens damit verbracht, eine Antwort auf die Frage zu finden, was Menschen in der Gewalt tun und wie Gewalt Menschen formt. Was auch immer geschieht: Die Gewalt wird stets ein Reich »undurchdringlicher Dunkelheit« sein, das wir vermessen, aber niemals vollständig verstehen können, schreibt Jacques Sémelin.[2] Wie die Liebe, so versetzt uns auch die Gewalt in ungläubiges Staunen. Dennoch wundert sich jeder auf seine Weise. Deshalb unterscheiden sich auch die Fragen, die Historiker stellen. Ich habe in diesem Buch Fragen gestellt, die mich bewegen, und Antworten gegeben, die ich für plausibel halte. Wer nach anderen Fragen und anderen Antworten sucht, soll ein anderes Buch lesen.
Ohne die Hilfe von Freunden und Kollegen hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. Robert Kindler, Felix Schnell und Christian Teichmann lasen das Manuskript und kritisierten, was sie für unhaltbar hielten. Christian Teichmann erinnerte mich daran, dass es nicht auf Vollständigkeit, sondern auf Klarheit ankommt. Ihnen allen danke ich für die Hilfe und Freundschaft, die sie mir in den letzten Jahren zuteil werden ließen. Mein Dank gilt auch Tanja Hommen vom S. Fischer Verlag, deren Kritik mir dabei half, manches vorschnelle Urteil zu korrigieren.
Historiker sollten schöne Sätze schreiben. Sie sollten an ihre Leser denken und in einer Sprache schreiben, die ihrer Erzählung entspricht. Von Dietrich Geyer habe ich gelernt, dass Stil und Inhalt eines Textes nicht voneinander zu trennen sind. Ihm, dem Stilisten unter den Historikern, der im Dezember 2015 87 Jahre alt wird, ist dieses Buch gewidmet.
1Was ist Gewalt, und wie kann man sie verstehen?
»Der Guerillakrieg schlängelte sich gen Süden durch den anhaltenden Regen Richtung Hauptstadt voran«, erinnerte sich der amerikanische Schriftsteller Denis Johnson, der im September 1990 Zeuge des liberianischen Bürgerkrieges wurde, »und eigentlich erwartete niemand, dass er je dort ankommen würde. Doch dann, Ende Juni, war er plötzlich da. Taylors Leute besetzten den Flughafen. Johnson näherte sich von der anderen Seite, eroberte die Stadt und isolierte den Präsidenten in seinem Amtssitz sowie einen Großteil der Armee in einem ein paar Häuserblocks umfassenden Gebiet in der Innenstadt. (…) Die Menschen begannen die Stadt zu verlassen. Die meisten britischen Diplomaten reisten ab. Alle französischen Diplomaten reisten ab. Ein halbes Dutzend Mitarbeiter des auswärtigen Dienstes der USA blieben, und die Marines errichteten Maschinengewehrstellungen rund um die Botschaft. In Monrovia ging der Strom aus. Es floss kein Wasser mehr. Die Lebensmittel wurden knapp. Der Bürgerkrieg entfaltete eine entsetzliche Brutalität. Als Taylors Männer in Hochzeitskleidern und Duschhauben, die sie auf ihren Raubzügen erbeutet hatten, mit der Armee um den Amtssitz des Präsidenten kämpften, breitete sich eine Atmosphäre aberwitzigen Grauens aus. Die Duschhauben waren gut gegen den Regen. Wozu die Hochzeitskleider gut sein sollten, wusste niemand. Indessen rasten Johnsons Soldaten, mit roten Baskenmützen und Haarteilen vom Perückenmacher auf dem Kopf, in frisierten Mercedes-Benz durch die Straßen und ballerten wild in der Gegend herum. Die Leute, die in der Nähe der britischen Botschaft wohnten, trauten sich schließlich, Johnsons Rebellen zu bitten, dass sie die Leichen ihrer Opfer nicht an ihrem Strand abladen möchten – wegen des Gestanks. Klar, sagten die Rebellen, geht in Ordnung. In Liberia gibt es kilometerlange Strände. (…) Die meisten Flüchtlinge machten sich zu Fuß auf den Weg, zuerst durch Taylors Territorium und dann nach Westen auf Liberias bestem Highway Richtung Sierra Leone, ein Menschenstrom wie nach einem Football-Spiel. Normalerweise ist das ein fünftägiger Marsch über einigermaßen ebenes Gebiet, doch er wurde beträchtlich erschwert, weil Taylors Rebellen – blutjunge Burschen der Volksstämme Gio und Mano, die meisten zwischen elf und fünfzehn Jahre alt und mit AK-47 und M-16-Gewehren bewaffnet – sich vorgenommen hatten, alle Krahn oder Mandingo sowie sämtliche Angehörigen der Armee des Präsidenten und der ehemaligen Regierung in der Menge ausfindig zu machen und zu töten. Nach etwa sechzig Kilometern, in der Stadt Klay, trafen die Flüchtlinge auf die erste Kontrollstelle. ›Riecht ihr das?‹, fragten die Rebellen. Sie meinten den Verwesungsgestank, der die Luft verpestete. ›Hoffentlich wisst ihr, wer ihr seid‹, sagten sie, ›sonst landet ihr da, wo der Gestank herkommt.‹ Wer nicht den richtigen Dialekt sprach, wer zu wohlhabend oder wohlgenährt aussah, wurde erschossen, geköpft oder mit Benzin übergossen und angezündet. Manche wurden im Mano River ertränkt. Die Flüchtlinge, die in Sierra Leone ankamen, erzählten von Kontrollstellen mit Zäunen rundherum, auf deren Pfählen abgetrennte Köpfe aufgespießt gewesen seien. (…) Das Vergewaltigen, Plündern und Morden war hier nicht schrecklicher als in anderen Bürgerkriegen; insofern jedoch die Gräuel dieses Krieges durch die Fäden des Aberglaubens mit gewissen dunklen Mächten verknüpft waren, bekamen sie etwas Unergründliches und Grausigeres.«[1]
Vier Jahrzehnte zuvor, im Februar 1944, notierte der Gefreite Willy Peter Reese, der seinen Heimaturlaub in Duisburg verbrachte, was ihm und seinen Kameraden wenige Wochen zuvor an der Ostfront widerfahren war. »Jäh setzte die große Symphonie des Krieges ein und brauste darüber hinweg. Wir hörten die Abschüsse der russischen Artillerie und das Echo von den Hügeln hinter feindlichen Gräben. Die Granaten schlugen weit im Hinterland ein. Der Widerhall donnerte, überlagerte sich in einem elementaren Dröhnen und hallte weiter wie ein Geisterchor. Dann krachten die ersten Einschläge im Wäldchen. Artilleriegranaten barsten dumpf und hart, grell heulten die Geschosse der Panzer und Panzerabwehrgeschütze heran und krachten schrill in die Explosion. Jäh zersprang die Granatwerfermunition. Dazwischen spannen Maschinengewehre ihr tödliches Netz. Die Salven russischer Nebelwerfer trommelten darein, ununterbrochen schrillte, stöhnte, pfiff, heulte, kreischte es heran, wuchs zum Orkan und ertrank in einem endlosen Donnern. Wir konnten die einzelnen Abschüsse und Einschläge nicht mehr unterscheiden. Das war das Trommelfeuer. Wir saßen im Bunker, fertig angezogen und die Waffen bereit. Nur zwei Lagen Balken und aufgeworfene Erde schützten uns, und wir fühlten uns doch von Lähmung und würgendem Warten erlöst. Die Schlacht hatte begonnen, und das Gefecht konnte nicht furchtbarer als dieser Auftakt sein. Der Bunker wankte und bebte. Ruhig sahen wir in das Wüten hinaus, in Feuer, fliegende Erdbrocken und Rauch. Schwarzer Staub stieg steil empor und fiel zerstreut zusammen. Ein Regen von Splittern und gefrorenem Lehm ging vor der Türe nieder. Graubraune, gelbliche, schwarze und lichtgraue Schwaden von Pulverdampf verwehten. Der Geruch ätzte unsere Lungen und biß in die Augen. So plötzlich wie er begonnen hatte, endete der tosende Spuk und verlagerte sich wieder ins Hinterland. Die Telefonleitungen waren zerfetzt, kein Melder durfte sich hinauswagen, aber wir wußten: jetzt stürmte die erste Welle der Russen gegen die Gräben vor uns heran. Wir eilten an den Granatwerfer, brachten unser Maschinengewehr in Stellung. Und sahen sie kommen: in weißer Tarnkleidung, in Gruppen und Reihen. Abwehrfeuer setzte ein. Wir sahen sie fallen, stocken und fliehen. Eine Stunde verging. Auch die zweite Welle brach im Feuer deutscher Maschinengewehre, Infanteriegeschütze und Granatwerfer zusammen. Dann senkte die Dämmerung sich herein. Weit vor uns lagen die Toten. Verwundete krochen zurück. Unsere Verletzten wurden zum Arzt getragen. Es war unheimlich still, nur ab und zu fiel ein Schuss wie ein Nachhall vom Lärm des Tages. Das Märchenwäldchen aber hatte sich verwandelt. Der Schnee war nicht mehr weiß: Von einer schwarzen Kruste von Pulverschleim überzogen, zerwühlt, mit Staub, Splittern und Erde gemischt, wodurch der helle Grund nur geisterhaft im frühen Abend schimmerte. Das Wäldchen schien wie gerodet. Entwurzelte Bäume lagen gehäuft, Trichter reihte sich an Trichter, und die Granaten hatten das gefrorene Gezweig von den Stämmen gefegt. (…) Schönheit und Leben des Wäldchens waren Opfer des Kriegs geworden, wie die Verwundeten und Toten umher. Wir Überlebenden aber liebten die Gefahr, die das mörderische Warten vertrieb. In der Materialschlacht bewies das Leben sich kräftiger in einer wilden Daseinslust. Der Krieg führte uns in einen traumhaften Bereich, und mancher, der friedlichen Herzens war, spürte eine geheimnisvolle Sehnsucht nach dem Furchtbaren in Dulden und Tat. Der Urmensch in uns wurde wach. Instinkt ersetzte Geist und Gefühl, und eine transzendente Vitalität nahm uns auf.«[2]
Ein Jahr später, am 15. April 1945, einem sonnigen Frühlingstag, erreichten britische Panzersoldaten das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Wenige Tage zuvor hatten sich Offiziere der britischen Armee mit Vertretern der Wehrmacht auf eine kampflose Übergabe des Lagers und seiner Umgebung geeinigt. Das Lager sollte britischem Kommando unterstellt werden, die Bewachung der Häftlinge aber in den Händen der Wehrmacht und der SS verbleiben. Denn es war eine Typhusepidemie im Lager ausgebrochen. Die britischen Offiziere hielten das Konzentrationslager offenkundig für einen Ort des zivilisierten Strafvollzuges. Denn sie hätten einer solchen Abmachung nicht zugestimmt, wenn sie gewusst hätten, was sie erwarten würde. Als die ersten britischen Soldaten das Lager betraten, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens. »Keine Beschreibung« und »keine Photographie«, erinnerte sich ein Sanitätsoffizier, könnten davon eine Vorstellung vermitteln. Infernalischer Gestank, Berge von Leichen, die auf dem Gelände und in den Baracken lagen, ausgemergelte Gestalten in Sträflingskleidung, die auf der Erde herumkrochen und nach Essbarem suchten.
Josef Kramer, der Kommandant des Lagers, aber schien überhaupt nicht zu bemerken, wie schockiert die Befreier waren. Er versuchte nicht zu entkommen, als das Ende nahte. Stattdessen empfing er die Soldaten am Eingangstor und führte sie durch das Lager, »schamlos« und ohne die geringste Regung, wie sich ein britischer Offizier erinnerte. Niemand habe verstehen können, warum Kramer angesichts der Schandtaten, die er begangen hatte, nicht geflohen sei. Doch auch die SS-Wachen begriffen nicht, dass die Zeit des Tötens und Schlagens vorüber war. Als Häftlinge die Küche des Lagers bedrängten, prügelten Kapos auf sie ein, mehrere Menschen wurden von SS-Männern erschossen, obwohl sich bereits britische Soldaten im Lager befanden. Es sei unmöglich, die Ordnung im Lager aufrecht zu erhalten, ohne Gewalt gegen Häftlinge anzuwenden, entgegnete Kramer den Offizieren, die ihn fragten, warum weiterhin geschossen und geprügelt werde. Als ihm befohlen wurde, Akten aus seinem Büro zu holen, setzte er sich an seinen Schreibtisch und schlug ein Bein lässig über die Lehne des Stuhls. Er hielt sich immer noch für den Kommandanten des Lagers, sprach über die Verwaltung der Hölle, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. Seit Jahren war er Kommandant gewesen, erst in Auschwitz, dann in Bergen-Belsen, und nun sollte alles vorbei sein? Als britische Offiziere ihn zwangen, einen verwundeten Häftling auf seinen Schultern ins Lazarett zu tragen, und ihm wenig später Handschellen anlegten, war er irritiert. Er konnte nicht glauben, dass er, der doch immer nur für Ordnung gesorgt hatte, verhaftet werden sollte.[3]
Das Rätsel der Gewalt
Gewalt verändert alles, und wer ihr ausgesetzt ist, wird ein Anderer sein. Das Erleben der Gewalt ist wie eine Reise in eine neue Welt, in der andere Regeln gelten und andere Menschen leben. In ihr verschieben sich die Maßstäbe für Normalität; was man für selbstverständlich halten konnte, erscheint im Licht der Gewalt seltsam fremd, und Außergewöhnliches wird zum Alltäglichen. Man betritt einen Gewaltraum und erfährt, dass nichts mehr ist, wie es war. Nie, schreibt der Soldat Willy Reese, habe er die Gewaltexzesse vergessen können, deren Zeuge er geworden sei. Er hatte in den Abgrund der menschlichen Seele geschaut und den Schrecken des Krieges mit allen Nerven seines Körpers empfunden. Aus dem Reich des Friedens und des Wohlstands war er nach Russland gekommen, als Gezeichneter hatte er das Land wieder verlassen. Reese, der feinsinnige Büchernarr, war zu einem Anderen geworden, seit er die Hölle gesehen hatte, Frauen und Kinder ermordet und gegnerische Soldaten mit dem Maschinengewehr niedergemäht hatte. Mechanisch und mitleidlos tötete er, um den Krieg zu überstehen und das eigene Leben zu retten. »Aber bald fand ich keine Ruhe mehr«, vertraute er seinem Tagebuch an, »und keinen Weg zu mir selbst zurück. Wie Furien verfolgten mich die Erinnerungen. Immer wieder erlebte ich die Schrecken des Winterkrieges, hörte wieder das Heulen der Granaten und das Schreien der Verwundeten, sah Soldaten stürmen und sterben und mich wie einen Fremden in meinem Schicksal am Rande des Niemandslands.«[1]
So erging es auch den britischen Soldaten, die niemals vergessen konnten, was sie in Bergen-Belsen gesehen hatten, und die zu begreifen versuchten, was Männer wie Josef Kramer dazu gebracht haben mochte, Grausamkeiten zu begehen, die durch nichts zu rechtfertigen waren. Sie, die den Krieg gesehen und die Nähe des Todes gespürt hatten, konnten es nicht verstehen. Man könnte es leichter begreifen, wenn der Kommandant von Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen und Liberias Präsident sadistische Triebtäter oder Monster gewesen wären. Aber auf sie traf überhaupt nicht zu, was gewöhnlich als Hintergrunderklärung für die Entstehung von Gewalt ins Spiel gebracht wird. Weder Taylor noch Kramer waren Psychopathen, sie waren in der Vergangenheit weder diskriminiert worden noch Opfer von Gewalt gewesen. Nicht einmal an politischen Programmen und Ideologien schienen sie interessiert gewesen zu sein. Und dennoch empfanden sie irgendwann als normal, was selbst Soldaten für einen Zivilisationsbruch hielten. Wie konnten Kramer und Taylor, die Zehntausende Menschen in den Tod geschickt hatten, glauben, sie seien zu Unrecht verhaftet worden und würden, sobald alle Irrtümer aufgeklärt seien, wieder freigelassen? Hatten sie nicht wahrgenommen, was um sie herum geschehen war? Der Fall scheint auf den ersten Blick eindeutig zu sein. Die Täter sahen nicht, was andere sahen, und sie hielten es nicht für ungewöhnlich, dass Menschen erschlagen, erschossen und ihre Leichen wie Abfall weggeworfen wurden. Aber wie soll man verstehen, dass diese Männer offenbar nichts empfanden, wir aber starr vor Entsetzen sind, wenn von ihren Taten die Rede ist?
Die Liebe und das Bedürfnis nach sexueller Befriedigung gelten uns als Selbstverständlichkeit, als Teil menschlicher Grundausstattung, der nicht erklärungsbedürftig zu sein scheint, während wir die Gewalt für eine Anomalie halten, die nicht in unser Leben gehört. Warum ist das so? Wir könnten es uns einfach machen und sagen: weil die Gewalt Schmerzen und Angst verursacht, wenigstens bei jenen, die sie zu erdulden haben, und weil Gewaltgelüste ohne das Leiden anderer nicht befriedigt werden können. Aber damit wäre nur die halbe Wahrheit über die Irritation gesagt, die Gewalttaten bei Menschen auslösen, die im Frieden leben. Wir sind irritiert, wenn wir mit grausamen Taten konfrontiert werden, die in unserer Umgebung nicht vorkommen. Denn wir leben in einer befriedeten Gesellschaft, in der Mord und Totschlag die Ausnahme, nicht die Regel sind. Wir vertrauen darauf, nicht Opfer von Gewalt zu werden, weil wir wissen, dass die Staatsmacht Gewalttäter in ihre Schranken weist und Konflikte nicht mit dem Tod der Unterlegenen entschieden werden. So sehr vertrauen wir den Institutionen und ihren unsichtbaren Regeln, dass wir es für selbstverständlich halten, nicht umgebracht zu werden, wenn wir am Morgen das Haus verlassen.[2]
Aber wer weiß eigentlich noch, dass der Frieden nur deshalb von Dauer ist, weil es Institutionen gibt, die ihn jederzeit erzwingen können? Für Menschen, die nichts anderes als Frieden und Wohlstand kennen, ist die Gewalt so fern, dass sie sie als verstörendes Ereignis erleben, das aus ihrem Leben verschwinden soll. Es ist gewiss kein Zufall, dass in der einflussreichen Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas, die auch eine Widerspiegelung des postheroischen Weltempfindens ist, die Gewalt als Möglichkeit, sich anderen gegenüber zu behaupten, überhaupt nicht vorkommt.[3] Wir glauben, unsere Welt sei gewaltfrei, weil sie friedfertig ist. Und wenn dennoch geschieht, was im Alltag einer zivilisierten Gesellschaft nicht vorgesehen ist, müssen Gründe und Motive ins Spiel gebracht werden, die den Glauben an den ewigen Frieden nicht erschüttern. Wir wollen uns die Gewalt nicht als Irritation zumuten, und deshalb behelfen wir uns mit Begründungen, die sich in die Konventionen einer befriedeten Gesellschaft einfügen lassen. So sehr haben wir uns in der Friedfertigkeit eingerichtet, dass wir Menschen, die sich in Spannungs- und Kampfsituationen befinden, überhaupt nicht mehr verstehen. Kaum träten Stolz, Empörung, Wut und Kampfbereitschaft auf, beklagt Peter Sloterdijk, nähmen die Therapeuten an, der Wütende sei Opfer eines »neurotischen Komplexes«.[4] Denn der Glaube, dass Gewalt abweichendes Verhalten ist, hilft Menschen in friedlichen Gesellschaften, sich ihre Wirklichkeit als einen Raum vorzustellen, in dem das Argument über die Faust triumphiert. »Wir verrätseln die Katastrophe«, sagt Jan-Philipp Reemtsma, »um uns unsere Normalität nicht als permanente Irritation zumuten zu müssen.«[5]
Gründe und Rechtfertigungen
Nach der Tat kommt die Stunde der Rechtfertigung. Es sind die Täter selbst, die den Kern der Gewalt verschleiern, weil sie für ihre Taten nur solche Gründe anführen, die es ihnen erlauben, ihr Handeln in die Verhaltenslogik einer befriedeten Gesellschaft einzuordnen. Denn wenn körperliche Auseinandersetzungen, Vergewaltigungen, Pogrome, Massaker und Kriege vorüber sind und Gewalt wieder verboten ist, kann als Motiv nur noch vorgebracht werden, was Täter und Opfer nicht um den Verstand bringt, was die Gewalt als eine vorübergehende Störung erscheinen lässt. Man behilft sich mit Hinweisen auf edle Motive, auf Notwendiges und Unabänderliches, um die Irritation zu überwinden, die die Gewalt auslöst. Täter verweisen auf den Befehlsnotstand, auf Sachzwänge oder die tödlichen Konsequenzen, die eingetreten wären, wenn sie sich Mordbefehlen widersetzt hätten. Manche bringen höhere Werte oder Ehrbegriffe ins Spiel, manche erklären, die Bösartigkeit der Opfer habe ihnen keine Wahl gelassen. Sie müssen, was sie ihren Opfern angetan haben, vor sich und vor anderen rationalisieren, und wenn man sie nach dem Ende der Gewalt zur Verantwortung zieht, versuchen sie, verstehbare Gründe vorzutragen, damit jeder begreift, warum sie nicht anders handeln konnten.
Wenn der Exzess vorüber und der Frieden angebrochen ist, kann die Gewalt nur noch als Ausnahme von der Regel beschrieben werden. Wer vor Gericht einräumte, er habe aus Gleichgültigkeit, aus Berechnung, niederen Motiven oder aus Lust Menschen in den Tod geschickt, brächte sich um jeden Kredit. Deshalb haben alle Handlanger von Diktatoren und Despoten nach dem Ende der Exzesse Begründungen vorgetragen, mit denen sie beweisen wollten, dass ihre Anweisungen verstehbaren Zwecken dienten. Auch Hitlers Helfer haben vor dem Nürnberger Tribunal auf unabänderliche Befehle hingewiesen, denen sie hilflos ausgeliefert gewesen seien. »Aber was konnte ich tun?«, rief der ehemalige Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm Keitel, vor dem Tribunal aus. »Ein Offizier kann sich nicht vor seinem Führer, dem Oberbefehlshaber, aufbauen und widersprechen! Wir können nur Befehle erhalten und gehorchen.«[1] Adolf Eichmann, der Organisator des Judenmordes, erklärte seinen Richtern in Jerusalem, er sei nur ein Rädchen im großen Getriebe gewesen, machtlos, sich gegen die Maschine zu wehren, die ihn gezwungen habe, das große Werk des Massenmordes zu verrichten. Nicht grausam, sondern gehorsam sei er gewesen, ein treuer Beamter und Diener seines Herrn, der getan habe, was ihm befohlen worden sei. Hannah Arendt ist auf diese Rechtfertigungsstrategie hereingefallen, weil sie Eichmann glaubte, dass die Pflichterfüllung Richtschnur seines Handelns gewesen sei.[2]
Andere, die für ihre Verbrechen niemals zur Verantwortung gezogen wurden, wiesen auf edle Motive, auf die Abwehr von Gefahren hin, um der Vernichtung von Millionen einen verstehbaren Sinn zu geben. Der Massenterror sei notwendig gewesen, erklärte Molotow noch zwanzig Jahre nach dem Tod Stalins, weil er die Sowjetunion vor inneren Feinden und äußeren Gefahren geschützt und vor dem Untergang bewahrt habe.[3] Charles Taylor teilte dem Tribunal, das in Den Haag über ihn zu Gericht saß, mit, er habe Gewalt anwenden müssen, um den Bürgerkrieg zu beenden, von dem das afrikanische Land heimgesucht worden sei. Was hätten Keitel, Molotow und Taylor auch anderes sagen können? Dass Menschen aus einer Laune heraus getötet worden seien? Was hätte Willy Reese in der bundesdeutschen Öffentlichkeit gesagt, wenn er überlebt hätte und nach seinen Kriegserlebnissen gefragt worden wäre? Hätte er gesagt, was er 1944 seinem Tagebuch anvertraut hatte? Nur eine Antwort, die sich auf die Zwänge des Krieges berief, war eine Antwort, die auch viele Jahre später noch einen Sinn ergab. Das Schreckliche rechtfertigte sich, indem die Täter auf Notwendiges und Unabänderliches verwiesen.
Denn Menschen handeln und sprechen so, wie es in einer Situation, einem Handlungsraum von ihnen erwartet wird. Während des Zweiten Weltkrieges hatte der britische Geheimdienst deutsche Soldaten und Offiziere in Kriegsgefangenenlagern systematisch abhören lassen. Kaum ein Gefangener sprach über den Krieg so, wie er es vor Gericht oder im Beisein seiner Familie getan hätte. Mit Stolz erzählten sie von ihren Heldentaten, von Kriegsverbrechen und Grausamkeiten, weil sie voreinander keine Geheimnisse haben mussten. Jedermann wusste, dass die Erschießung gefangener Partisanen, die Versenkung von Schiffen und die Tötung von Geiseln in der Wehrmacht Brauch gewesen war. Und offenbar sahen sie auch keinen Grund, für sich zu behalten, was sie angerichtet hatten.[4] Auch Vergewaltiger, Schläger und Hooligans prahlen mit ihren Taten nur, wenn sie unter ihresgleichen sind. Sobald moralische Instanzen in Erscheinung treten und sie zur Verantwortung ziehen, kommen Gründe ins Spiel, die eine zivilisierte Gesellschaft nicht irritieren. Von Gewalttätern wird erwartet, dass sie Erklärungen und Rechtfertigungen vortragen, selbst dann, wenn sie sich zu ihren Taten bekennen und der Sinn, den sie ihnen geben, sich mit den Grundregeln und dem Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft nicht verträgt. Niemand hört gern, dass Täter aus Freude an der Zerstörung, aus Langeweile gefoltert und gemordet haben, dass sie dem Gruppendruck nicht widerstehen konnten und darum taten, was sie, wenn sie allein gewesen wären, nicht getan hätten.[5] Täter ohne Verantwortung gibt es nur deshalb, weil eine befriedete Gesellschaft verantwortliche Täter nicht ertragen kann.
Die Gewalt soll also auf Gründen beruhen, die man verstehen kann. Jede Erklärung, die sich auf Ziele und Absichten beruft, ist uns lieber als die Lust an der Destruktion. Und so kommt es, dass nicht nur Täter, sondern auch Opfer versuchen, der erlittenen Gewalt einen Sinn zu verleihen, der sie nicht um den Verstand bringt. »Übelkeit steigt in mir auf«, schrieb die Leningrader Malerin Ljubow Wassiljewna Schaporina am 10. Oktober 1937 in ihr Tagebuch, »wenn ich gleichmütig erzählen höre: Der ist erschossen, jener erschossen, erschossen, erschossen. Dieses Wort liegt immer in der Luft, schwingt in der Luft. Die Menschen sprechen es vollkommen ruhig aus, als wollten sie sagen: ›Er ging ins Theater‹.« Wie soll man darüber hinwegkommen, dass Menschen scheinbar ohne jeden Grund aus ihren Häusern geholt und erschossen wurden? »Daß wir eine ganze Nacht lang hören können, wie lebendige und vermutlich unschuldige Menschen erschossen werden – und nicht den Verstand verlieren. Danach wieder einschlafen, weiterschlafen, als wäre nichts geschehen.«[6] Wie soll man damit fertig werden? Irgendwann kommt dann doch die Stunde der Erklärung, die dem Schrecken einen Sinn verleiht. Ein russische Jüdin aus Minsk, die wie Tausende anderer Juden im Sommer 1941 ins Ghetto deportiert wurde, nahm ihre Schmetterlingssammlung auf ihre letzte Reise mit. Normalität im Ausnahmezustand. »Die Menschen suchten einen Sinn in dem, was vorging«, sagte sie später über ihre schrecklichen Erlebnisse, »irgendeinen roten Faden. Selbst die Hölle möchte der Mensch verstehen.«[7] Wer Schmerz ertragen und den gewaltsamen Tod von Freunden und Verwandten erlebt hat, wird den Gedanken, das alles sei zufällig geschehen, nicht ertragen können.
Wer gegen die Konventionen der Rechtfertigung verstößt, wird in den Augen der Ankläger zum Monster. Josef Kramer spielte vor Gericht die Rolle des zynischen Befehlsempfängers, und er brachte zu seiner Rechtfertigung nur Gründe vor, die im Horizont von Anklägern und Richtern keinen Sinn ergaben. Ihm sei es egal gewesen, wen man in sein Lager geschickt habe, ob Kommunisten oder Juden, er habe nur die Aufgabe gehabt, die Häftlinge zu verwahren. Nicht einmal die nationalsozialistische Ideologie habe ihn interessiert, denn in die SS sei er nur eingetreten, weil er Arbeit gesucht habe. Mord aus Dankbarkeit für Einkommen und Fortkommen – auf dieses Motiv reduzierte Kramer seine Rechtfertigungen. Und auch über die Ermordung von Frauen in Gaskammern sprach er so, als habe er nur eine anspruchsvolle technische Aufgabe lösen müssen. Sobald das Gas in die Kammer geströmt sei, hätten die Frauen »gebrüllt«. Mehr hatte er zu diesem Thema nicht mitzuteilen. Als er 1944 wieder nach Auschwitz versetzt werden sollte, habe er sich diesem Befehl allerdings widersetzt. Warum er denn an die alte Wirkungsstätte nicht habe zurückkehren wollen, fragte ihn der Richter, und er erwartete wahrscheinlich, dass Kramer sagen würde, er habe sich dem Grauen nicht aussetzen wollen. Stattdessen antwortete er: »Mich ärgerten die polnischen Zustände dort! Die Ordnung fehlte mir!« Er hatte einfach nicht verstanden, dass eine Verteidigungsstrategie, die sich auf die Moral des Nationalsozialismus berief, vor dem Gericht der Sieger nichts bewirkte.
Kramer hatte den Tod zehntausender Menschen zu verantworten, und dennoch sah er sich nicht als Mörder, sondern als unbestechlichen Ordnungshüter, der sich nichts vorzuwerfen hatte. Noch in der Gefängniszelle glaubte er, dass auch die Ankläger ihren Irrtum einsehen und am Ende verstehen müssten, dass er nichts Verwerfliches getan habe. Er hoffe, schrieb er an seine Frau, dass »die Zeit der Leiden« ein Ende nehme und er bald wieder zu Hause sein werde.[8] Kramers Rechtfertigungen ergaben nur im Referenzrahmen nationalsozialistischer Moral einen Sinn, nach dem Ende der Diktatur aber blieb unverständlich, was er den Richtern zu seiner Entlastung vorzutragen hatte. Er hätte sich auf eine schwere Kindheit berufen, auf Arbeitslosigkeit und Elend verweisen können, selbst als Karrierist und Fanatiker, als Verführter oder Unbelehrbarer wäre er verstehbar gewesen. Stattdessen sprach er über die Gewalt, als sei sie eine Selbstverständlichkeit, die nach keiner Erklärung verlangte. Den Richtern schien, als habe der Angeklagte nichts zu seiner Entlastung vorzutragen. Kramer musste ein Monster gewesen sein, eine andere Erklärung konnte es für die Zeitgenossen nicht geben. Die »Bestie von Belsen«, so nannte ihn die britische Presse. Zur Grausamkeit ohne Grund war also nur imstande, wer an seelischer Abartigkeit litt. Anders konnte man die Botschaft nicht verstehen, die in der Nachkriegsöffentlichkeit über den Lagerkommandanten verbreitet wurde.
Was immer die Gewalt auch sein mag, stets wird sie als Abweichung, als Irrweg, Abweg oder Krankheit vorgestellt, die eines Tages geheilt sein wird. Wenn Krankheiten erst einmal diagnostiziert sind, so lautet das Argument der Therapeuten, können sie auch geheilt werden: durch Zivilisierung, durch Toleranz oder soziale Gerechtigkeit. Alle Erklärungen, die Kultur- und Sozialwissenschaftler für den Ausbruch von Gewalt vorgetragen haben, sind Variationen dieser Motive. Ihre Wirkung ergibt sich aus dem Glauben an die Beherrschbarkeit und Machbarkeit der Verhältnisse. Deshalb sind Erklärungen und Rechtfertigungen von Tätern und Opfern schlechte Ratgeber, wenn man verstehen will, was die Gewalt mit Menschen macht und was Menschen mit der Gewalt machen.[9] Denn wer nur von Gründen und Ursachen spricht, wird über die Dynamik und Eigenlogik von Gewaltverhältnissen wenig erfahren.
»Schon damals hat mich der Gedanke gestreift, der heute bei mir noch tiefer sitzt als die Empörung über das große Verbrechen«, erinnert sich Ruth Klüger, die das Vernichtungslager Auschwitz überlebte, »nämlich das Bewußtsein der Absurdität des Ganzen, das Widersinnige daran, die völlige Sinnlosigkeit dieser Morde und Verschleppungen, die wir Endlösung, Holocaust, die jüdische Katastrophe und neuerdings auch die Shoah nennen, immer neue Namen, weil uns die Worte dafür sehr schnell im Munde faulen. Das Absurde, Unvernünftige daran, wie leicht hätte es verhindert werden können, wie doch niemand was davon gehabt hat, daß ich Schienen getragen hab, statt auf einer Schulbank zu sitzen, und die Rolle, die der Zufall dabei spielte. Ich meine nicht, daß ich nicht verstehe, wie es dazu kam. Ich verstehe ganz gut, wie es dazu kam, zumindest weiß ich so viel wie andere über die Hintergründe. Aber dieses Wissen erklärt nichts. Wir zählen nur an den Fingern her, was vorher war, und verlassen uns darauf, daß das radikal Andere daraus hervorging.«[10]
In allen Geschichten, die Historiker erzählen, werden beliebige Ereignisse in der Zeit miteinander verbunden. Jedes Geschehen, sagen sie, werde von einer Kette ihm vorausliegender Ereignisse verursacht. So sehr haben sich Leser an die Konventionen der historischen Voraussetzungsprosa gewöhnt, dass sie auch ohne Beleg für glaubhaft halten, was die Verursachungshistorie ihnen einreden will. »Das kann man nur historisch erklären!« Warum nur, fragt Ruth Klüger in ihren Erinnerungen an das Grauen. »Weil jedes Kind eine Urgroßmutter hat, so muß jedes Ding eine Ursache haben. Und die arme Urgroßmutter trägt plötzlich die Verantwortung für den Unfug, den die Nachkommen treiben.«[11] Aber diese Rechnung geht nicht auf. Denn das Leben ist keine Aneinanderreihung von Ereignissen, die kausal miteinander verknüpft sind. Es setzt sich aus Augenblicken zusammen. Was immer vorher auch geschehen sein mag, es erklärt nicht, warum unter bestimmten Umständen Menschen andere Menschen umbringen. Alles hätte auch anders kommen können.[12] Die Suche nach dem Ursprung der Gewalt ist vergeblich.
Das Menschenmögliche
Man will nicht wahrhaben, dass manche Menschen sich an Wehrlosen vergreifen und sie töten, weil es ihnen Freude macht; dass Kriege, wenn sie erst einmal ausgebrochen sind, einer Logik gehorchen, die sich von Glaubenssätzen, Überzeugungen oder Argumenten nicht steuern lässt, und dass manche Menschen sich in wilde Bestien verwandeln, wenn sie tun dürfen, was im Frieden verboten ist. »Jeder Deutsche, der eine Uniform trug und eine Waffe hatte«, erinnerte sich Marcel Reich-Ranicki an sein Leben im Ghetto, »konnte in Warschau mit einem Juden tun, was er wollte. Er konnte ihn zwingen, zu singen oder zu tanzen oder in die Hosen zu machen oder vor ihm auf die Knie zu fallen und um sein Leben zu flehen. Er konnte ihn plötzlich erschießen oder auf langsamere, qualvollere Weise umbringen. Er konnte einer Jüdin befehlen, sich auszuziehen, mit ihrer Unterwäsche das Straßenpflaster zu säubern und vor aller Augen zu urinieren. Den Deutschen, die sich diese Späße leisteten, verdarb niemand das Vergnügen, niemand hinderte sie, die Juden zu misshandeln und zu morden, niemand zog sie zur Verantwortung. Es zeigte sich, wozu Menschen fähig sind, wenn ihnen unbegrenzte Macht über andere Menschen eingeräumt wird.«[1]
Schon immer haben Menschen einander verletzt und getötet, wenn sie im Glauben waren, es sei erlaubt, was sie tun, und wenn sie gewiss sein konnten, mit Strafe oder Rache nicht rechnen zu müssen. Wir haben nur vergessen, dass es so ist, weil wir in Räumen leben, die vom Recht strukturiert sind. »Ich kann es nicht verstehen«, dachte Herzog, die Hauptfigur in Saul Bellows gleichnamigem Roman, »aber das ist das Schlimme bei Leuten, die ihr Leben mit humanistischen Studien hinbringen und sich daher einbilden, dass die Grausamkeit aus der Welt geschafft sei, sobald sie in Büchern beschrieben worden ist. Selbstverständlich wusste er es besser – die Menschen würden einfach nicht so leben, dass die Herzogs sie begreifen konnten. Warum sollten sie auch?«[2]
Der Mensch wird nicht, was er ist, er ist immer schon komplett gewesen. Deshalb war die Gewalt zu allen Zeiten eine Möglichkeit, und kein Aufklärungsprogramm hat Menschen je daran gehindert, sich das Verletzen und Töten anderer Menschen vorzustellen. Nicht die Gewalt ist das Rätsel, sondern dass wir uns über sie wundern. Gewalt ist eine Handlungsressource, die nicht nur für jeden zugänglich ist, sondern auch von jedem genutzt werden kann. Der Soziologe Heinrich Popitz hat sie als Aktionsmacht definiert, die »zur absichtlichen körperlichen Verletzung anderer führt, gleichgültig, ob sie für den Agierenden ihren Sinn im Vollzug selbst hat (als bloße Aktionsmacht) oder, in Drohungen umgesetzt, zu einer dauerhaften Unterwerfung (als bindende Aktionsmacht) führen soll«.[3] Jedermann kann schreien, drohen, seine Fäuste einsetzen, Stich- oder Schusswaffen bedienen. Der Gewalttäter erzeugt Aufmerksamkeit. Ein Argument kann ignoriert werden, ein Schlag ins Gesicht nicht. Selbst der Geringste, dem sonst niemand zuhören will, kann durch den Einsatz seiner Faust einen Machtgewinn erzielen, sich Respekt verschaffen. Wer schlägt, kann nicht länger ignoriert werden. Man kann die Gewalt sprechen lassen, wenn die Sprache versagt, und man kann zum Ausdruck bringen, wofür die Worte fehlen. »Legitimationen«, sagt der Soziologe Trutz von Trotha, »sind Antworten auf Fragen. Überlegene Gewalt überzeugt, weil es gar keine Fragen mehr gibt.«[4] Wer Gewalt ausübt, bleibt im Gespräch, auch wenn es keine Widerrede gibt. In jedem Fall aber kann von niemandem, der gewalttätig wird, gesagt werden, er habe nicht gehandelt. »Wer gewalttätig wird«, schreibt der Soziologe Dirk Baecker, »bleibt im Spiel und legt fest, daß die nächsten Spielzüge etwas mit ihm zu tun haben.«[5]
Die Quelle der Gewalt liegt auf dem Grund der Vorstellungskraft. Wir können uns jede Grausamkeit vorstellen, und was sich einmal in das Gedächtnis eingegraben hat, das bekommt man aus ihm nicht wieder heraus. Gewalt ist nicht nur in der Erinnerung als Erlebtes präsent, sondern auch als Erwünschtes, das noch passieren wird. »Dieser Horizont des Möglichen«, so Popitz, »geht, wie wir wissen, weit hinaus über alles Kalkulierbare. Vorgestellte Gewalt irrlichtert in Tagträumen und Alpträumen aller Art.« Es gibt keinen Raum im Bewusstsein, in den Gewaltvorstellungen nicht eindringen könnten. Vor allem aber lässt sich die vorgestellte Gewalt als gefahrlos denken, weil wir »Widerstände, Risiken, die Beschränktheit der eigenen Kräfte nahezu beliebig überspielen« können. Nur in der Phantasie ist das Töten ohne Gefahr, ohne Geruch und Geräusch, und es bleibt ohne Konsequenzen.[6]
Wer vieles erreichen will, aber keine Unterstützung hat, mag Gewalt tatsächlich als Ausweg aus einem selbstverschuldeten Dilemma sehen. Denn als Handlungsressource verspricht Gewalt einen Machtgewinn, der anders nicht zu erringen ist. Man kann die Gewalt, die nur in den Köpfen präsent ist, so lange herbeireden, bis sie geschieht, bis jemand wirklich die Initiative ergreift und handelt. Deshalb degradieren Täter, die töten wollen und nach Legitimationen suchen, ihre Feinde zu Unmenschen. Sie nehmen ihnen ihre Menschlichkeit und machen sie zu Ungeheuern, die jedes Recht auf Leben verwirkt haben und die man ungestraft vernichten kann. Die Entmenschlichung des Opfers bereitet das Terrain vor, auf dem alles möglich wird. Aber nur in der Phantasie ist Gewalt als unblutige Lösung gesellschaftlicher Konflikte vorstellbar. Leichtfertig sprechen die Advokaten des Unbedingten über die Vernichtung ihrer Feinde. Sie berauschen sich an ihrer Phantasie und ihrer Sprache, weil sie das Blut nicht sehen und die Schreie der Opfer nicht hören müssen. Vorstellungen und Taten aber sind zweierlei. Sobald getan wird, was nur als Vorstellung in der Welt war, wird alles anders, weil im Akt der Gewalt Vorstellungen zu Taten und Kollektive zu einzelnen Menschen werden, deren Leben tatsächlich ausgelöscht wird.
Im Erleben der Gewalt erlischt die Vorstellung vom geräusch- und geruchlosen Tod. Denn wirkliche Gewalt ist hässlich und schockierend, auch für die meisten Täter. Sie ist das Gegenteil aller Vorstellungen, die man sich von ihr macht.[7] Das wissen auch Soldaten, für die das Töten im Gefecht zu einer Erfahrung wird, die sie sich nicht vorstellen konnten. »Manche Leute glauben«, erinnerte sich ein britischer Söldner, der 1975 im angolanischen Bürgerkrieg gegen kubanische Soldaten kämpfte, »der Krieg sei ein angenehmes, leichtes Kribbeln im Fuß. Das stimmt nicht. Krieg, das sind zu Brei zerschmetterte Schädel, abgerissene Beine, Burschen mit hervorquellenden Gedärmen, die sich im Kreis winden, Burschen, die mit Napalm überschüttet wurden, aber noch leben.«[8] So war es immer und überall, wo Menschen einander Gewalt antaten. Im September 1941 trafen Soldaten eines Polizeibataillons im ukrainischen Berditschew ein. Man hatte ihnen den Befehl gegeben, alle Juden des Ortes zu töten. Wir wissen nicht, was diese Männer gedacht und gefühlt haben, als sie Frauen und Kindern in die Hinterköpfe schossen und die Gehirnmasse der Erschossenen auf ihre Uniformen spritzte.[9] Wer aber die Gesichter der Opfer gesehen und ihre Schreie gehört, wer Leichen vergraben und das Blut der Erschossenen gerochen hatte, konnte sich den Mord nicht mehr als eine saubere, klinische Operation vorstellen. Selbst Hitler, der Tag für Tag Mordbefehle erteilte, wusste genau, was es bedeutete, sich dem Grauen auszusetzen. Im Sommer 1943 erklärte er vor Gästen, die ihn auf dem Berghof besuchten, wie sehr ihm Schlachthäuser zuwider seien, in denen Tiere getötet würden. Bis zu den Waden stünden die Schlachter im Blut. Er ziehe es deshalb vor, Gemüse zu essen, weil es ihm nichts ausmache, abgeschnittene Pilze anzusehen.[10] Er, der den Tod von Millionen zu verantworten hatte, konnte nicht einmal den Anblick geschlachteter Tiere ertragen.
Ohne Not, nur weil es ein Motiv gibt, ist niemand gezwungen, gewalttätig zu werden. Jeder kann, wenn Alternativen aufscheinen, seinen Zorn unterdrücken und sich gegen seine Neigungen entscheiden. »Der Mensch«, schreibt Heinrich Popitz, »muss nie, kann aber immer gewaltsam handeln, er muss nie, kann aber immer töten.«[11] Zwar kann ein Täter, der Menschen terrorisiert und misshandelt, arbeitslos oder Anarchist sein oder an Kopfschmerzen leiden, aber dieses Wissen wird uns nicht helfen zu verstehen, was geschieht. Die Arbeitslosigkeit führt dem Täter nicht die Hand, und auch nicht die Mordphantasien, die seinen Kopf besetzt haben. »Weshalb«, fragt der Soziologe Wolfgang Sofsky, »gibt es nicht Millionen von Gewalttätern, obwohl es Millionen von Depressiven, Waffennarren, Horrorfilmenthusiasten, Ehegeschädigten oder Arbeitslosen gibt?«[12] Die Antwort lautet: weil nicht jeder die Chancen nutzt, die sich ihm bieten, und weil es von Situationen und ihren Menschen abhängt, ob Gewalt eine attraktive Handlungsoption ist oder nicht. Wäre es anders, die Gewalt dürfte überhaupt kein Ende nehmen. Denn nicht jeder, der sich für einen überzeugten Nationalsozialisten oder Stalinisten hielt, war auch ein Fachmann für die Ausübung von Gewalt, nicht jeder Aufseher ein Folterer und nicht jeder Arbeitslose ein Amokläufer.
Alle Hintergrunderklärungen beruhen auf der Annahme, dass es motivierten Menschen leichter falle, Gewalt auszuüben. Aber Gewalt ist nicht nur ein Reflex sozialer Motive. Sie fällt schwer, und keine Idee hilft dem Täter dabei, seine Hemmungen zu überwinden. In Wahrheit fällt Gewalt nur jenen Menschen leicht, die aus reiner Lust töten, unter Druck stehen oder sich daran gewöhnt haben. »Wie motiviert jemand auch sein mag«, schreibt der amerikanische Soziologe Randall Collins, »wenn sich die Situation nicht dahin gehend entwickelt, daß die Konfrontationsanspannung und -angst überwunden wird, geht es mit der Gewalt nicht weiter.«[13]
Räume und Situationen
Gewalt ist dynamisch, sie erzeugt Handlungszwänge, deren Folgen nur selten wirklich vorauszusehen sind. Man weiß nicht, was geschehen wird. »Wenn doch Gewalt ausbricht«, so Collins, »dann liegt das zumeist an den Bedingungen der unmittelbaren Interaktion. Eine Theorie der Motive für Gewaltanwendung erklärt wenig, denn von den Motiven bis zur tatsächlichen Gewaltanwendung ist es ein weiter Weg.«[1] Gewaltoptionen setzen sich gegen andere Handlungsalternativen erst durch, wenn Menschen in Situationen sind, die es ihnen erlauben, Grenzen zu überschreiten. Es hängt immer von der Situation ab, welche Entscheidungen überhaupt möglich sind. Manche wägen Kosten und Nutzen einer Gewalttat genau ab und lassen die Fäuste erst sprechen, wenn sie mit Gegenwehr nicht rechnen müssen, andere schrecken vor ihrem Einsatz zurück, weil sie die Konsequenzen ihres Handelns fürchten, weil sie ahnen, dass sie nicht gewinnen können, wenn sie sich auf eine gewaltsame Auseinandersetzung einlassen, oder weil sie einfach den richtigen Augenblick verpasst haben. Sie entscheiden sich also gegen ihre Neigungen, obwohl sie Gründe haben, gewalttätig zu sein.
Manche Menschen handeln aus Lust oder weil Gewalt, die nur zerstören will, ihnen für einen Augenblick das Gefühl absoluter Macht verschafft.[2] Andere töten in Gruppen. Sie lassen sich von der Meute mitreißen, werden eins mit ihr und ihrer Wut und beruhigen sich erst wieder, wenn der Kampf vorbei ist und die Meute zerfällt. Gewalt in Gruppen eskaliert, wenn es keine Regeln gibt und die Gegner sich nicht wehren können. Der Täter wird unsichtbar, er wird Teil einer Masse und tötet, weil es auch die anderen tun. Gemeinsames Töten verbindet und enthemmt. Es hebt die Barrieren zwischen Menschen auf und schafft soziale Gleichheit. Die Lust verträgt sich nicht mit Abwägungen, deshalb kann die Gewalt in solchen Situationen außer Kontrolle geraten. »Ein gefahrloser, erlaubter, empfohlener und mit vielen anderen geteilter Mord«, schreibt Elias Canetti, »ist für den weitaus größten Teil der Menschen unwiderstehlich.«[3]