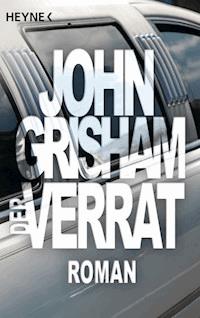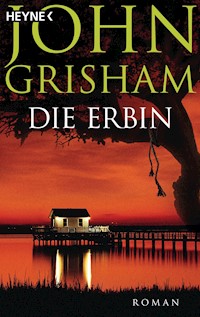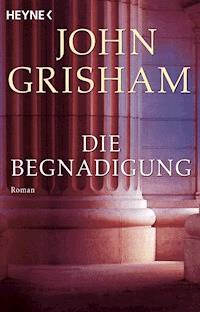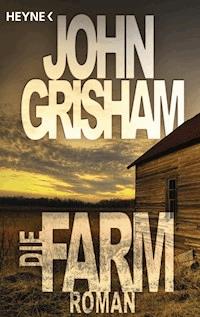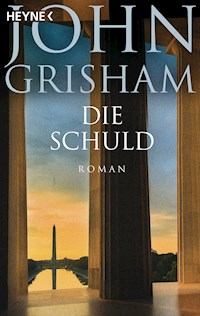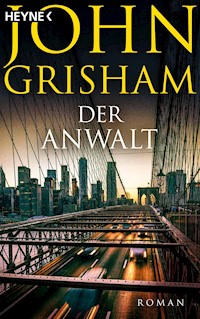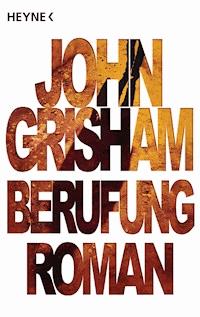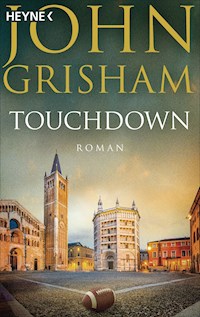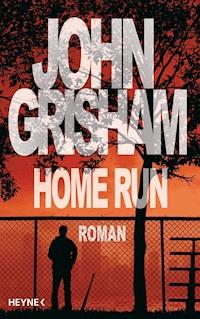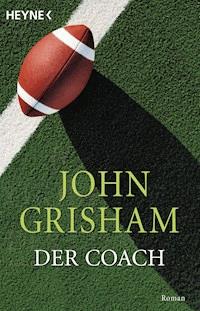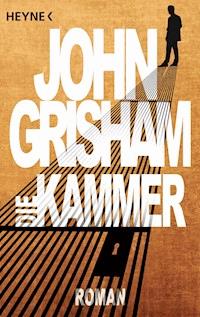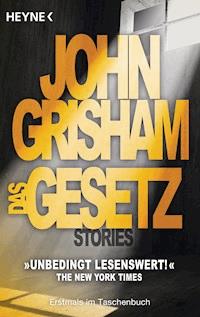8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sein spektakulärster Roman seit "Die Jury"
Ein junger Zeitungsreporter trägt mit exklusivem Material zur Aufklärung eines grausamen Mordes bei, woraufhin der Jubel groß ist. Doch als der mächtige Verurteilte in aller Öffentlichkeit das Leben der Geschworenen bedroht und Rache schwört, verstummen die Jubelrufe. Neun Jahre später kommt der Mörder frei und macht sich daran, seine Drohung in die Tat umzusetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Zum Buch:
Der gescheiterte Student Willie Traynor nimmt den Hilfsjob bei dem Provinzblatt Ford County Times eigentlich nur an, um sein Leben in so etwas wie geordnete Bahnen zu bringen. Doch als kurz darauf die Zeitung vor der Pleite steht, kauft er sie kurzerhand mit der Hilfe einer reichen Tante. Kaum hat der zum Verleger aufgestiegene junge Mann erste Kontakte geknüpft und das anfängliche Misstrauen überwunden, da geschieht ein grausamer Mord, der die Menschen in der ruhigen Kleinstadt Clanton zutiefst erschüttert: Eine junge Mutter wird vor den Augen ihrer Kinder vergewaltigt und ermordet. Der Täter scheint schnell gefasst. Er gehört der berüchtigten und korrupten Padgitt-Familie an, die die Menschen der Region seit langem in Angst und Schrecken versetzt. Willie, der Außenseiter, berichtet mutig und schonungslos von der Tat und dem bald beginnenden Prozess. Er hat Erfolg, die Auflage der Zeitung steigt rapide an, aber Willie macht sich damit auch mächtige Feinde. Als der Angeklagte am Tag der Urteilsverkündung in aller Öffentlichkeit das Leben der Geschworenen bedroht und Rache schwört, legt sich ein Schatten auf das Leben der Stadt.
Inhaltsverzeichnis
Teil I
1
Nach Jahrzehnten des Missmanagements und der liebevollen Vernachlässigung war die Ford County Times 1970 finanziell am Ende. Die Eigentümerin und Herausgeberin der Zeitung, Miss Emma Caudle, war dreiundneunzig Jahre alt und in einem Pflegeheim in Tupelo im wahrsten Sinne des Wortes ans Bett gefesselt. Der Chefredakteur, ihr Sohn Wilson Caudle, hatte die siebzig schon überschritten und als Erinnerung an den Ersten Weltkrieg eine Metallplatte im Kopf zurückbehalten. Oben auf seiner hohen, fliehenden Stirn, wo der Chirurg sie eingesetzt hatte, prangte ein kreisrundes, dunkleres Stück transplantierter Haut. Diesem Fleck verdankte es Mr Caudle, dass er seither den Spitznamen »Spot« ertragen musste: Spot hat dies getan, Spot hat das getan. Spot hier, Spot da.
In jüngeren Jahren hatte er als Journalist über Gemeindeversammlungen, Footballspiele, Wahlen, Gerichtsverfahren, kirchliche Veranstaltungen und alle möglichen anderen Ereignisse in Ford County berichtet. Er war ein guter Reporter, gründlich und besaß eine schnelle Auffassungsgabe. Offensichtlich hatte die Kopfverletzung sein journalistisches Talent nicht in Mitleidenschaft gezogen. Doch irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich die Metallplatte in seinem Kopf augenscheinlich etwas gelockert, und Mr Caudle beschloss, sich exklusiv dem Schreiben von Nachrufen zu widmen. Er liebte Nachrufe. Stundenlang beschäftigte er sich damit, noch das unbedeutendste Mitglied der Gesellschaft von Ford County mit einem ausführlichen, in schwungvoller Prosa abgefassten Nekrolog zu ehren. Starb gar ein wohlhabender oder prominenter Mitbürger, nutzte Mr Caudle die Gunst der Stunde und hievte den Nachruf auf die Titelseite. Nie verpasste er eine Totenwache oder eine Beerdigung, kein einziges Mal ließ er auch nur ein schlechtes Wort über den Verblichenen fallen. Auf den posthumen Glorienschein musste niemand verzichten – Ford County war ein idealer Platz zum Sterben. Und Spot, wenngleich verrückt, ein äußerst beliebter Mann.
Die einzige wirkliche Krise seiner journalistischen Laufbahn ereignete sich im Jahr 1967, ungefähr zu der Zeit, als sich die Bürgerrechtsbewegung schließlich auch in Ford County bemerkbar machte. Bisher hätte man der Zeitung nicht einmal ansatzweise entnehmen können, dass sie um Toleranz in Rassenfragen bemüht gewesen wäre. Schwarze Gesichter, von Verbrecher- oder Fahndungsfotos abgesehen, suchte man auf ihren Seiten vergebens. Heiratsanzeigen von Schwarzen, herausragende schwarze Studenten, schwarze Baseballteams – Fehlanzeige. Doch im Jahr 1967 machte Mr Caudle eine bestürzende Entdeckung. Eines Morgens ging ihm mit dem Erwachen ein Licht auf: In Ford County starben Schwarze, ohne dass sie angemessen gewürdigt worden wären. Für einen Verfasser von Nachrufen war damit ein ganz neues, fruchtbares Feld zu bestellen, und Mr Caudle machte sich auf in die gefährlichen, unbekannten Gewässer. Am Mittwoch, dem 8. März 1967, brachte die Ford County Times als erste weiße Wochenzeitung in Mississippi die posthume Würdigung eines Schwarzen, doch der Nachruf blieb weitgehend unbeachtet.
In der folgenden Woche legte Mr Caudle mit drei Abgesängen auf verstorbene Schwarze nach. Die Leute begannen zu reden, und in der vierten Woche sah er sich einem regelrechten Boykott ausgesetzt. Abonnenten kündigten, Anzeigenkunden zahlten nicht. Mr Caudle schätzte die Situation zwar richtig ein, war aber schon zu sehr in seine Rolle als Vorkämpfer der Gleichberechtigung Schwarzer vernarrt, um sich noch über Bagatellen wie Auflage und Gewinne Gedanken zu machen. Sechs Wochen nach dem historischen Nekrolog erklärte er der Öffentlichkeit seine neue Strategie, auf der Titelseite und in Fettdruck: Er werde nur noch veröffentlichen, was ihm gefalle, und falls das irgendwelchen Weißen nicht in den Kram passe, werde er kurzerhand die Zahl der ihnen gewidmeten Nachrufe zurückfahren.
Ein würdiger Abgang ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens in Mississippi, für Schwarze und Weiße, und der bloße Gedanke, ohne einen von Spots ruhmreichen Nekrologen zur letzten Ruhe gebettet zu werden, war für die meisten Weißen unerträglich. Sie wussten, dass er verrückt genug war, seine Drohung wahr werden zu lassen.
In der nächsten Ausgabe fanden sich, unter Aufhebung der Rassentrennung, ordentlich alphabetisch geordnet, Nachrufe auf Schwarze und Weiße. Die Auflage war bald ausverkauft, und für die Ford County Times folgte eine kurze Phase der Prosperität.
Der Bankrott wurde »unfreiwilliger Konkurs« genannt, als gäbe es andere Formen der Pleite, die man bevorzugte. Die Meute der Gläubiger wurde von einem Geschäft für Druckereibedarf aus Memphis angeführt, das Außenstände von sechzigtausend Dollar geltend machen konnte. Andere hatten seit einem halben Jahr kein Geld mehr gesehen. Die gute alte Security Bank forderte einen Kredit zurück.
Obwohl ich noch nicht lange bei der Zeitung arbeitete, hatte ich schon Gerüchte gehört. Ich saß im vorderen Büro der Redaktion und las gerade eine Illustrierte, als ein Zwerg mit spitzen Schuhen hereinspaziert kam und nach Wilson Caudle fragte.
»Ist im Bestattungsinstitut«, erwiderte ich.
Er war ein großspuriger Wicht. Unter seinem zerknitterten marineblauen Blazer konnte man eine Waffe erkennen, die offenbar auch gesehen werden sollte. Wahrscheinlich hatte er sogar einen Waffenschein. Doch eigentlich brauchte man den in Ford County nicht, zumindest nicht im Jahr 1970. Tatsächlich lösten Waffenscheine eher ein Stirnrunzeln aus. »Ich muss ihm diese Papiere zustellen«, sagte der Zwerg und fuchtelte mit einem Umschlag herum.
Eigentlich hatte ich nicht vor, mich hilfsbereit zu zeigen, aber es ist schwierig, einem Zwerg gegenüber ruppig zu werden. Selbst wenn er bewaffnet ist. »Er ist im Bestattungsinstitut« , wiederholte ich.
»Dann lasse ich sie Ihnen hier.«
Obwohl ich an einem College im Norden studiert hatte und noch keine zwei Monate bei der Times war, hatte ich doch schon ein paar Dinge gelernt. So etwa, dass gute Nachrichten nie persönlich zugestellt, sondern in der Regel mit der Post befördert wurden. Diese Papiere bedeuteten Ärger, und ich wollte nichts damit zu tun haben.
»Ich nehme sie nicht an«, sagte ich.
Der Natur gehorchend, verhalten sich Zwerge als gelehrige, friedliebende Wesen, und dieser Winzling machte keine Ausnahme. Die Waffe diente nur dekorativen Zwecken. Er blickte sich mit einem affektierten Grinsen im Büro um, wusste aber, dass die Situation hoffnungslos war. Also ließ er den Umschlag mit einer übertrieben schwungvollen Bewegung in der Tasche seines Jacketts verschwinden. »Wo ist das Bestattungsinstitut?«
Ich beschrieb ihm den Weg, und der Zwerg verschwand. Eine Stunde später stolperte Spot durch die Tür, hysterisch schreiend und mit den Papieren herumfuchtelnd. »Es ist vorbei! Das war’s!« Während er weiterjammerte, nahm ich ihm die Dokumente aus der Hand – es war ein Konkursantrag der Gläubiger. Margaret Wright, die Sekretärin, und Hardy, der Drucker, kamen nach vorn und versuchten, Spot zu trösten. Er setzte sich auf einen Stuhl, die Ellbogen auf die Knie gestützt, das Gesicht in den Händen, und schluchzte mitleiderregend. Ich las den Konkursantrag laut vor.
Darin stand, Mr Caudle habe in einer Woche in Oxford vor Gericht zu erscheinen, um sich mit dem Richter und seinen Gläubigern zu treffen. Dort solle entschieden werden, ob die Zeitung weiter erscheinen könne, während ein Treuhänder die Lage zu klären versuche. Ich hatte den Eindruck, dass Margaret und Hardy sich eher um ihre Jobs als um Mr Caudle und seinen Nervenzusammenbruch Sorgen machten, aber sie klopften ihm trotzdem tapfer auf die Schulter.
Als der Weinkrampf vorbei war, stand Spot abrupt auf und biss sich auf die Unterlippe. »Ich muss es meiner Mutter sagen«, meinte er.
Wir anderen drei blickten uns an. Miss Emma Caudle hatte dieses Leben schon seit Jahren hinter sich gelassen, und ihr schwaches Herz funktionierte gerade noch gut genug, um die Beerdigung ein bisschen hinauszuschieben. Sie wusste nicht mehr, welche Farbe der Wackelpudding hatte, mit dem man sie fütterte, und es war ihr auch egal, und das Schicksal von Ford County und seiner Zeitung war ihr mit Sicherheit genauso egal. Sie war blind und taub, wog deutlich unter vierzig Kilogramm, und jetzt kam Spot auf die Idee, mit ihr über einen unfreiwilligen Konkurs zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass auch er schon nicht mehr in unserer Welt lebte.
Er begann erneut zu weinen und verließ das Büro. Wenige Monate später sollte ich seinen Nachruf schreiben.
Weil ich das College besucht und die Papiere an mich genommen hatte, erhofften Margaret und Hardy von mir guten Rat. Ich war Journalist, kein Jurist, sagte aber zu, mit den Unterlagen den Familienanwalt der Caudles aufzusuchen. Seinen Rat würden wir dann beherzigen. Sie bedachten mich mit einem matten Lächeln und machten sich wieder an die Arbeit.
Mittags fuhr ich nach Lowtown – das schwarze Viertel von Clanton – und kaufte bei Quincy’s One Stop ein Sixpack. Anschließend machte ich mit meinem Spitfire einen Ausflug. Es war Ende Februar und für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Ich zog das Verdeck auf und fuhr zum See. Unterwegs fragte ich mich, nicht zum ersten Mal, was ich in Mississippi und Ford County eigentlich verloren hatte.
Ich war in Memphis aufgewachsen und hatte fünf Jahre lang in Syracuse im Staat New York Publizistik studiert, bevor meine Großmutter es satt hatte, für eine Ausbildung zu zahlen, die für ihren Geschmack zu lange dauerte. Meine Noten waren alles anderes als spektakulär, und von einem Examen trennten mich noch zwölf Monate, vielleicht auch achtzehn. Meine Großmutter BeeBee hatte jede Menge Geld, gab es aber nur äußerst ungern aus, und nach fünf Jahren kam sie zu der Ansicht, ich hätte meine Chance gehabt und sie mich ausreichend gefördert. Als sie mir die Unterstützung strich, war ich sehr enttäuscht, beklagte mich aber nicht. Ich war ihr einziger Enkel und sah meinem Erbe voller Vorfreude entgegen.
Von den Idealen, mit denen ich mein Studium in Syracuse begonnen hatte, war nicht viel übrig geblieben. In den unteren Semestern bewunderte ich den investigativen Journalismus und sah mich schon als Reporter der New York Times oder der Washington Post. Ich wollte die Welt retten, Korruptionsskandale, Umweltsünden und Steuerverschwendung aufdecken. Die Ungerechtigkeit anklagen, unter der die Schwachen und Unterdrückten zu leiden hatten. Pulitzerpreise waren nur eine Frage der Zeit. Nachdem ich mich ungefähr ein Jahr lang diesen abgehobenen Träumereien hingegeben hatte, sah ich einen Film über einen Auslandskorrespondenten, der als Kriegsberichterstatter um die Welt jettete, wunderschöne Frauen verführte und trotzdem irgendwie noch Zeit fand, preisgekrönte Artikel zu Papier zu bringen. Er beherrschte acht Sprachen, hatte einen Bart, trug Kampfstiefel und gestärkte Khakihosen, die offenbar knitterfrei waren. Ich beschloss, sein Kollege zu werden, ließ mir einen Bart stehen, kaufte mir Kampfstiefel und Khakihosen und versuchte, mir Deutsch beizubringen und bei hübschen Frauen zu punkten. Im vorletzten Studienjahr, als meine Noten ständig schlechter wurden, begann ich mich für die Idee zu begeistern, Journalist bei einer Kleinstadtzeitung zu werden. Die Faszination, die dieser Job auf mich ausübte, kann ich nur so erklären, dass ich mich ungefähr zu dieser Zeit mit Nick Diener anfreundete. Er stammte aus dem ländlichen Indiana, wo seine Familie seit Jahrzehnten eine einigermaßen gut florierende Zeitung besaß. Nick fuhr einen coolen kleinen Alfa Romeo und hatte immer reichlich Bargeld. Bald waren wir enge Freunde.
Nick war ein intelligenter Student und hätte genauso gut Arzt, Jurist oder Ingenieur werden können. Trotzdem kannte er nur ein Ziel. Er wollte nach Indiana zurückkehren und den Familienbetrieb übernehmen. Ich war verblüfft. Zumindest so lange, bis wir uns eines Abends gemeinsam betranken und er mir erzählte, wie viel Profit die kleine Wochenzeitung mit einer Auflage von sechstausend Exemplaren jährlich für seinen Vater abwarf. Laut Nick war das Geschäft eine Goldgrube. Nur Lokalnachrichten, Heiratsannoncen, kirchliche Veranstaltungen, Jubiläen, Sportberichte, Fotos von Basketballteams, ein paar Rezepte, ein paar Nachrufe und ein Anzeigenteil. Vielleicht auch ein bisschen Politik, aber bloß nicht zu kontrovers. Man brauchte nur noch das Geld zu zählen. Sein Vater war Millionär. Schenkte man Nick Glauben, dann war dies die gemütliche Variante des Journalismus, bei der man keinem nennenswerten Druck ausgesetzt war, einem das Geld aber in den Schoß fiel.
Das hörte ich gern. Nach meinem vierten Studienjahr, das eigentlich mein letztes hätte sein sollen, es aber nicht wurde, machte ich im Sommer ein Praktikum bei einer kleinen Wochenzeitung in den Ozark Mountains in Arkansas. Die Entlohnung war kaum erwähnenswert, aber BeeBee war beeindruckt, weil ich einen Job hatte. Jede Woche schickte ich ihr die Zeitung, deren Beiträge ich mindestens zur Hälfte selbst verfasst hatte. Eigentümer, Herausgeber und Chefredakteur des Blatts war in Personalunion ein wunderbarer alter Gentleman, der hocherfreut war, einen Reporter zu haben, der gern schrieb. Außerdem war er ziemlich wohlhabend.
Nach fünf Jahren in Syracuse ließen meine Noten keine Hoffnung mehr auf einen Abschluss des Studiums zu, und die Geldquelle versiegte. Ich kehrte nach Memphis zurück, stattete BeeBee einen Besuch ab, bedankte mich für die finanzielle Unterstützung und versicherte ihr, dass ich sie liebte. Sie sagte, ich solle mir einen Job suchen.
Zu jener Zeit lebte Wilson Caudles Schwester in Memphis, und es ergab sich, dass diese Lady BeeBee bei einer jener aufregenden Teepartys für Senioren traf. Nach ein paar Telefonaten zwischen den beiden alten Damen packte ich meine Sachen und machte mich nach Clanton in Mississippi auf, wo Spot mich bereits ungeduldig erwartete. Im Anschluss an einen nur einstündigen Einführungskurs ließ er mich auf die Bevölkerung von Ford County los.
In der nächsten Ausgabe veröffentlichte er einen netten kleinen Artikel samt Foto über mich, in dem er die Öffentlichkeit über mein »Praktikum« bei der Times unterrichtete. Er setzte ihn auf die Titelseite. In jenen Tagen war die Nachrichtenlage etwas flau.
Sein Text enthielt zwei entsetzliche Irrtümer, die mich jahrelang verfolgen sollten. Die erste und weniger schwer wiegende Fehlinformation bestand darin, dass Syracuse laut Spot mittlerweile zu den Eliteuniversitäten gehörte. Er teilte seiner schwindenden Leserschaft mit, ich hätte in Syracuse entsprechend eine exzellente Ausbildung genossen. Es dauerte einen vollen Monat, bis mich jemand darauf ansprach. Ich begann schon zu glauben, dass niemand mehr diese Zeitung las. Oder, schlimmer noch, dass sie nur von Vollidioten gelesen wurde.
Der zweite Lapsus veränderte mein Leben. Ich war auf den Namen Joyner William Traynor getauft worden. Bis zum Alter von zwölf Jahren hatte ich meine Eltern mit der Frage gelöchert, wie zwei angeblich intelligente Menschen auf die Idee verfallen könnten, ihrem Kind den Vornamen Joyner zu geben. Schließlich kam heraus, dass mein Vater oder meine Mutter – beide wiesen die Verantwortung von sich – mich Joyner genannt hatte, um einem verfeindeten Verwandten namens Joyner, der angeblich reich war, ein Friedensangebot zu machen. Ich habe ihn nie kennen gelernt, meinen Namensvetter. Bei seinem Tod muss er pleite gewesen sein, aber ich durfte seinen Namen ein Leben lang tragen. Als ich mich in Syracuse einschrieb, nannte ich mich J. William, was für einen Achtzehnjährigen ziemlich imposant klang. Doch der Vietnamkrieg, die Krawalle, die Studentenrevolte und der ganze soziale Aufruhr ließen in mir die Überzeugung aufkommen, dass der Name zu sehr nach Geschäftswelt und Establishment roch. Aus J. William wurde Will.
Spot nannte mich nach Lust und Laune mal Will, mal William, mal Bill oder sogar Billy, und da ich auf alle Varianten reagierte, wusste ich nie, welche als Nächstes an der Reihe war. In der Zeitung, unter dem Foto mit meinem lächelnden Konterfei, stand mein neuer Name: Willie Traynor. Ich war entsetzt. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass mich jemals ein Mensch Willie nennen würde. Weder auf der Vorbereitungsschule für das College in Memphis noch auf dem College selbst war ich je einem Willie begegnet. Der Name passte nicht zu mir. Ich fuhr einen Triumph Spitfire und hatte lange Haare.
Was sollte ich meinen Freunden von der Studentenverbindung in Syracuse erzählen? Oder meiner Großmutter BeeBee?
Nachdem ich mich zwei Tage lang in meiner Wohnung verbarrikadiert hatte, brachte ich den Mut auf, Spot gegenüberzutreten und ihn zum Handeln aufzufordern. Ich wusste nicht genau, was ich von ihm erwartete, aber er hatte einen Fehler gemacht und sollte ihn jetzt bitte auch wieder ausbügeln. Ich spazierte in die Redaktionsbüros der Times und stolperte über Davey Bigmouth Bass, den Sportredakteur des Blatts. »Hey, cooler Name«, sagte er. Ich begleitete ihn in sein Büro, um seinen Rat einzuholen.
»Ich heiße nicht Willie«, sagte ich.
»Jetzt schon.«
»Mein Name ist Will.«
»Die Leute hier lieben Sie. Ein cleverer Kerl aus dem Norden mit langen Haaren und einem importierten Sportschlitten. Teufel, mit einem Namen wie Willie wird man für cool gehalten. Denken Sie an Joe Willie.«
»Wer ist Joe Willie?«
»Joe Willie Namath.«
»Ach der.«
»Er ist auch aus dem Norden, genau wie Sie, aus Pennsylvania oder sonst wo, aber als er nach Alabama kam, wurde aus Joseph William Joe Willie. Die Frauen haben ihn gar nicht mehr in Ruhe gelassen.«
Allmählich fühlte ich mich etwas besser. Im Jahr 1970 war Joe Namath wahrscheinlich der berühmteste Sportler im ganzen Land. Ich machte eine Spazierfahrt und murmelte immer wieder »Willie« vor mich hin. Innerhalb von ein paar Wochen hatte sich der Name bei den Leuten festgesetzt. Alle nannten mich Willie und schienen glücklich zu sein, dass ich einen so bodenständigen Namen hatte.
BeeBee erzählte ich, er sei nur ein vorübergehend benutztes Pseudonym.
Die Ford County Times war eine sehr dünne Zeitung, und ich wusste sofort, dass sie Probleme hatte. Jede Menge Nachrufe, aber wenig Nachrichten und Anzeigen. Die Angestellten waren verärgert, hielten jedoch den Mund und zeigten sich loyal. 1970 waren Jobs in Ford County Mangelware. Nach einer Woche konnte selbst ein Neuling nicht mehr übersehen, dass die Zeitung Verluste machte. Im Gegensatz zu Anzeigen brachten Nachrufe kein Geld. Spot verbrachte den größten Teil seiner Zeit in seinem voll gestopften Büro. Wenn er nicht gerade ein Nickerchen hielt, rief er im Bestattungsinstitut an. Gelegentlich meldete sich der Bestatter auch bei ihm. Manchmal lieferten Familienmitglieder nur Stunden nach dem letzten Atemzug irgendeines Onkel Wilber eine lange, blumig geschriebene, handschriftliche Rohfassung eines Nachrufs ab, die Spot dann an seinem Schreibtisch hinter verschlossenen Türen so lange umschrieb, bearbeitete und ergänzte, bis ein perfekter Nekrolog daraus geworden war.
Er erklärte mir, mein Arbeitsgebiet sei das gesamte County. Das Blatt hatte noch einen anderen Reporter für allgemeine Themen – Baggy Suggs, ein dem Alkohol zugetaner alter Knabe –, doch der hing meistens auf der anderen Seite des Platzes vor oder in dem Gerichtsgebäude herum, wo er Gerüchte aufzuschnappen versuchte und mit einem kleinen Kreis heruntergekommener Anwälte Bourbon trank, die viel zu alkoholisiert waren, als dass sie ihrem Beruf noch hätten nachgehen können. Schon bald stellte ich fest, dass Baggy zu faul war, um zu recherchieren und nach interessanten Geschichten zu suchen. Daher war es nichts Ungewöhnliches, wenn seine Titelgeschichten von so langweiligen Dingen wie Landstreitigkeiten oder verprügelten Ehefrauen handelten.
Margaret, unsere gutherzige, christlich gesonnene Sekretärin, schmiss praktisch den ganzen Laden, aber sie war clever genug, Spot in dem Glauben zu lassen, er wäre der Boss. Sie war Anfang fünfzig, arbeitete bereits seit zwanzig Jahren für die Times und war deren Seele. Alles drehte sich um sie. Margaret war eine stille Frau mit leiser Stimme, die von meinem ersten Arbeitstag an völlig eingeschüchtert war, weil ich aus Memphis kam und fünf Jahre lang ein College im Norden besucht hatte. Ich gab mir alle Mühe, den ehemaligen Studenten der Eliteuniversität nicht allzu sehr heraushängen zu lassen, aber zugleich wollte ich durchaus, dass diese Provinzler aus Mississippi von meiner erstklassigen Ausbildung wussten.
Wir begannen, miteinander zu plaudern, und nach einer Woche bestätigte sie, was ich ohnehin vermutet hatte – Mr Caudle war verrückt und die Zeitung in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Aber, fügte sie hinzu, die Caudles hätten ja Familienvermögen.
Es sollte Jahre dauern, bis ich dieses Mysterium begriff.
In Mississippi durfte man Familienvermögen nicht mit Reichtum verwechseln. Es hatte nichts mit flüssigem Geld oder irgendwelchen Anlagen zu tun. Familienvermögen war ein gesellschaftlicher Status und »gehörte« immer einem weißen Bürger, der etwas mehr als den Besuch einer Highschool vorzuweisen hatte und in einem großen Haus mit Vorderveranda aufgewachsen war, am besten inmitten von Baumwoll- oder Sojabohnenfeldern, wenngleich das keine zwingende Voraussetzung war. Er war auf der einen Seite von einem innig geschätzten schwarzen Dienstmädchen namens Bessie oder Pearl erzogen worden, auf der anderen von abgöttisch geliebten Großeltern, die einst die Sklavenhalter von Bessie oder Pearl gewesen waren und ihrem Enkel die natürlichen Privilegien einer Geburt von Stand einimpften. Landbesitz und Treuhandvermögen konnten hilfreich sein, aber in Mississippi gab es jede Menge zahlungsunfähige Privilegierte, die trotzdem den Status geerbt hatten, der sich mit dem Begriff Familienvermögen verband. Man konnte es nicht verdienen. Es musste einem in die Wiege gelegt worden sein.
Als ich mit dem Anwalt der Familie Caudle sprach, wurde ich in ziemlich rohen Worten über den wahren Wert dieses Familienvermögens unterrichtet. »Sie sind arm wie die Kirchenmäuse«, sagte er, während ich in einem ramponierten Ledersessel versank und ihn über seinen großen, uralten Mahagonischreibtisch hinweg anblickte. Das war also Walter Sullivan von der renommierten Kanzlei Sullivan & O’Hara. Renommiert nach den in Ford County gültigen Maßstäben – sieben Anwälte. Er studierte den Konkursantrag und schwadronierte über die Caudles, ihr einstiges Vermögen und darüber, wie dumm man sein müsse, um eine einstmals profitable Zeitung so herunterzuwirtschaften. Er vertrat die Familie schon seit dreißig Jahren. Damals, als Miss Emma noch das Ruder in der Hand gehabt hatte, konnte die Times fünftausend Abonnenten und eine lange Liste mit Anzeigenkunden vorweisen. Zu dieser Zeit hatte Miss Emma bei der Security Bank verbriefte Bankeinlagen im Wert von fünfhunderttausend Dollar. Nur für den Fall, dass mal schlechte Zeiten kommen sollten.
Dann starb ihr Mann, und sie heiratete einen zwanzig Jahre jüngeren Alkoholiker. Nüchtern war er halbgebildet, aber er sah sich selbst als an der Welt leidenden Dichter und Essayisten. Miss Emma liebte ihn und installierte ihn neben ihrem Sohn als zweiten Chefredakteur. Er nutzte diese Stellung, um in ellenlangen Leitartikeln mit Wörtern auf alles zu schießen, was sich in Ford County bewegte. Das war der Anfang vom Ende. Spot hasste seinen Stiefvater, und die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit. Ihre Beziehung fand schließlich mit einer der spektakuläreren Prügeleien in der Geschichte Clantons in Anwesenheit einer großen, verblüfften Menge ihren Höhepunkt – und ihr Ende. Die Einwohner glaubten, dass Spots ohnehin bedenklicher Geisteszustand an diesem Tag weiteren Schaden genommen hatte. Kurz danach begann er, sich ganz auf die Nachrufe zu kaprizieren.
Der Stiefvater verschwand mit dem Geld, und Miss Emma zog sich mit gebrochenem Herzen ins Einsiedlerdasein zurück.
»Es war einmal eine gute Zeitung«, sagte Mr Sullivan. »Aber schauen Sie sich an, was daraus geworden ist. Keine zwölfhundert Abonnenten mehr, jede Menge Schulden. Pleite.«
»Was wird das Gericht tun?«, fragte ich.
»Einen Käufer suchen.«
»Einen Käufer?«
»Ja, irgendjemand wird die Times übernehmen. Es muss schließlich eine Zeitung im County geben.«
Auf Anhieb fielen mir zwei Kandidaten ein – Nick Diener und BeeBee. Nicks Familie war durch ihre Provinzzeitung reich geworden. BeeBee hatte jede Menge Geld und nur einen innig geliebten Enkel. Ich witterte meine Chance, und mein Herzschlag beschleunigte sich.
Mr Sullivan betrachtete mich eingehend, und es war unübersehbar, dass er meine Gedanken erriet. »Sie wäre für ein Butterbrot zu haben«, sagte er.
»Für wie viel?«, fragte ich mit dem geballten Selbstbewusstsein eines dreiundzwanzigjährigen, unerfahrenen Reporters, der eine stinkreiche Großmutter hatte.
»Wahrscheinlich für fünfzigtausend. Fünfundzwanzig für die Zeitung, die andere Hälfte, damit Sie arbeiten können. Über einen Großteil der Schulden kann nach einer Insolvenzerklärung mit den Geldgebern, die Sie brauchen, neu verhandelt werden.« Er schwieg kurz, beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch. Seine dichten grauen Augenbrauen zuckten, als würde sein Gehirn gerade Überstunden machen. »Das Blatt könnte eine wahre Goldmine sein.«
BeeBee hatte noch nie in eine Goldmine investiert, aber nachdem ich sie drei Tage lang bearbeitet hatte, verließ ich Memphis mit einem Scheck über fünfzigtausend Dollar. Ich übergab ihn Mr Sullivan, der das Geld auf ein Treuhandkonto einzahlte und bei Gericht einen Antrag auf den Verkauf der Zeitung stellte. Der altersschwache Richter, der eigentlich in das Bett neben Miss Emma gehört hätte, nickte gütig und kritzelte seinen Namen unter einen Gerichtsbeschluss, durch den ich zum neuen Eigentümer der Ford County Times wurde.
Bis man in Ford County wirklich akzeptiert wird, dauert es mindestens drei Generationen. Geld und gesellschaftliche Herkunft spielen dabei keine Rolle. Man kann nicht einfach dorthin ziehen und mit Vertrauen rechnen. Über jedem Neuankömmling schwebt eine dunkle Wolke des Misstrauens, und ich bildete da keine Ausnahme. Die Bevölkerung ist außergewöhnlich warmherzig, gütig und höflich, was fast so weit geht, dass ihre Freundlichkeit an Schnüffelei grenzt. Die Leute nicken einem auf der Straße zu, unterhalten sich mit einem, fragen nach der Gesundheit, plaudern über das Wetter und laden einen zum gemeinsamen Kirchgang ein. Sie stürzen geradezu herbei, um Fremden zu helfen.
Doch echtes Vertrauen werden sie nur dem schenken, dessen Großvater sie schon vertraut haben.
Als sich die Nachricht herumsprach, dass ich, ein Grünschnabel aus Memphis, also gleichsam von einem anderen Stern, die Zeitung für fünfzigtausend Dollar gekauft hatte – manche sprachen auch von hundert- oder zweihunderttausend – , ergoss sich eine Riesenlawine von Tratsch über die Stadt. Margaret hielt mich auf dem Laufenden. Weil ich als Single lebte, konnte ich durchaus homosexuell sein. Da ich in Syracuse studiert hatte – wo immer das auch liegen mochte –, war ich wahrscheinlich Kommunist. Oder, noch schlimmer, ein Liberaler. Und da ich aus Memphis stammte, war ich bestimmt ein Subversiver, der Ford County schlecht machen wollte.
Wie auch immer, die Leute mussten sich eingestehen, dass ich jetzt der Herr über die Nachrufe war. Ich war jemand.
Die neue Times erschien erstmals am 18. März 1970, nur drei Wochen, nachdem der Zwerg mit den Papieren aufgetaucht war. Die Ausgabe war fast drei Zentimeter dick und präsentierte mehr Fotos, als je in einer Provinzwochenzeitung erschienen waren. Fotos von Jungpfadfindern, Highschool-Basketballteams, Gartenklubs, Buchklubs, Teeklubs, Bibelgruppen, Softballteams, Bürgerversammlungen. Dutzende Fotos. Ich versuchte, jede lebende Seele aus dem ganzen County irgendwie ins Blatt zu bringen, und die Toten wurden besungen wie nie zuvor. Die Nachrufe waren beschämend lang. Ich war mir sicher, dass Spot stolz sein musste, hörte aber nie etwas von ihm.
Die Nachrichten waren seicht und oberflächlich, Leitartikel tabu. Da die Leute immer gern Storys über Verbrechen lasen, hatte ich in der linken unteren Ecke der Titelseite eigens Platz für eine spezielle Rubrik reserviert. Glücklicherweise waren in der Vorwoche zwei Kleinlaster geklaut worden, und ich präsentierte die Story, als wäre Fort Knox geplündert worden.
Mitten auf der Titelseite prangte ein Gruppenfoto der neuen Mannschaft – es zeigte Margaret, Hardy, Baggy Suggs, mich, unseren Fotografen Wiley Meek, Davey Bigmouth Bass und Melanie Dogan, eine Teilzeitangestellte, die noch auf die Highschool ging. Ich war stolz auf mein Team. Zehn Tage hatten wir rund um die Uhr gearbeitet, und unsere erste Ausgabe war ein durchschlagender Erfolg. Die Auflage von fünftausend Exemplaren war bald ausverkauft. Ich schickte BeeBee einen ganzen Karton voll. Sie war äußerst beeindruckt.
Im Verlauf des nächsten Monats nahm die neue Times allmählich Gestalt an, doch ich zerbrach mir noch immer den Kopf darüber, wie sie letztendlich aussehen sollte. Veränderungen sind im ländlichen Mississippi nur schwer durchzusetzen, sodass ich mich für ein behutsames Vorgehen entschied. Die alte Times war tot, aber das Blatt hatte sich in fünfzig Jahren kaum verändert. Ich schrieb mehr Nachrichtenbeiträge, verkaufte mehr Anzeigenraum und veröffentlichte immer mehr Fotos von allen nur denkbaren Grüppchen und Klubs. Besonders hart arbeitete ich an den Nachrufen.
Ich war nie ein großer Freund von Überstunden gewesen, doch jetzt, als Eigentümer der Zeitung, vergaß ich die Uhrzeit. Ich war zu jung und zu beschäftigt, um ängstlich zu sein. Mit dreiundzwanzig war ich durch Glück, günstiges Timing und eine reiche Großmutter urplötzlich zum Inhaber einer Wochenzeitung geworden. Hätte ich innegehalten und die Lage analysiert, den Rat von Banken und Buchhaltern eingeholt, dann, da bin ich mir sicher, hätte mich jemand »zur Vernunft« gebracht. Aber mit dreiundzwanzig Jahren glaubt man, sich vor nichts fürchten zu müssen. Man hat nichts, und folglich hat man auch nichts zu verlieren.
Meiner Meinung nach sollte es etwa ein Jahr dauern, bis die Zeitung schwarze Zahlen schrieb. Zunächst stiegen die Erträge auch nur langsam an. Dann wurde Rhoda Kassellaw ermordet. Vermutlich liegt es in der Natur dieses Geschäfts, dass die Auflage nach einem Gewaltverbrechen in die Höhe schießt, denn die Leute wollen Details erfahren. In der Woche vor ihrem Tod hatten wir zweitausendvierhundert Exemplare verkauft, in der danach fast viertausend.
Es war kein gewöhnlicher Mord.
Ford County war ein friedliches Fleckchen Erde, wo die Menschen gläubige Christen waren oder zumindest vorgaben, es zu sein. Schlägereien waren an der Tagesordnung, doch in diese Auseinandersetzungen waren in der Regel Mitglieder der Unterschicht verwickelt, die in Bierkneipen oder ähnlichen Kaschemmen herumhingen. Einmal in der Woche schoss ein ungebildeter weißer Landarbeiter auf seinen Nachbarn, vielleicht auch auf seine Frau, und an jedem Wochenende gab es in den Bars der Schwarzen mindestens eine Messerstecherei. Tote waren bei diesen Zwischenfällen fast nie zu beklagen.
Ich war zehn Jahre lang Besitzer der Zeitung, von 1970 bis 1980, aber über Morde in Ford County mussten wir so gut wie nie berichten. Und keiner war so brutal wie der an Rhoda Kassellaw, keiner so vorsätzlich. Noch dreißig Jahre später denke ich jeden Tag daran.
2
Rhoda Kassellaw lebte in Beech Hill, knapp zwanzig Kilometer nördlich von Clanton, direkt an der schmalen, asphaltierten Landstraße. Die Blumenbeete vor ihrem bescheidenen grauen Haus waren durch keinerlei Unkraut verunziert und wurden täglich gepflegt, auch der dichte Rasen war ordentlich geschnitten. Neben der mit hellen Kieselsteinen bestreuten Auffahrt fand sich eine bunte Kollektion von Rollern, Bällen und Fahrrädern. Ihre beiden kleinen Kinder spielten häufig draußen und blickten allenfalls auf, wenn gelegentlich ein Auto vorbeikam.
Es war ein hübsches Häuschen auf dem Land, nur einen Steinwurf von dem der Familie Deece entfernt. Der junge Mann, der Rhoda Kassellaws Haus einst gekauft hatte, war irgendwo in Texas bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, und sie war mit achtundzwanzig Witwe geworden. Mit der Lebensversicherung des Verstorbenen konnten das Haus und der Wagen abbezahlt werden, der Rest des Geldes wurde angelegt, damit Rhoda über ein bescheidenes monatliches Einkommen verfügte und sich weiterhin zu Hause um die Kinder kümmern konnte. Auch sie verbrachte viele Stunden draußen, wo sie sich um den Gemüsegarten kümmerte, Blumen eintopfte, Unkraut jätete oder die Beete vor dem Haus mulchte.
Sie blieb für sich. Die alten Damen von Beech Hill sahen in ihr eine Musterwitwe, die nicht ausging, traurig dreinschaute und ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben auf einen gelegentlichen Kirchgang beschränkte. Sie fanden lediglich, das hätte sie regelmäßiger tun sollen.
Kurz nach dem Tod ihres Ehemannes schmiedete Rhoda Pläne, zu ihrer Familie in Missouri zurückzukehren. Wie ihr verstorbener Mann, den ein Job hierher geführt hatte, stammte auch sie nicht aus Ford County. Aber das Haus war bezahlt, die Kinder waren glücklich und die Nachbarn nett. Außerdem zeigte ihre Familie ein auffällig großes Interesse daran, wie viel ihr die Lebensversicherung ausbezahlt hatte. Also blieb sie. Obwohl sie der Gedanke an einen Umzug auch weiterhin beschäftigte, konnte sie sich nie dazu aufraffen.
Rhoda war eine ausgesprochen hübsche Frau, wenn sie es sein wollte, doch das kam nicht besonders häufig vor. Ihr schlanker, wohlgeformter Körper blieb dem Blick in der Regel durch ein weit geschnittenes, bügelfreies Baumwollkleid entzogen – wenn nicht gar durch ein viel zu großes, kariertes Flanellhemd, das sie bei der Gartenarbeit bevorzugt trug. Sie schminkte sich kaum und trug ihr langes blondes Haar immer hochgesteckt. Was sie aß, stammte zumeist aus ihrem ohne Kunstdünger bewirtschafteten Garten, und ihre Haut hatte einen gesunden, zarten Schimmer. Eine derart attraktive junge Witwe wäre normalerweise ein heiß umkämpfter Schwarm der Männerwelt gewesen, doch Rhoda blieb lieber allein.
Nachdem sie drei Jahre lang getrauert hatte, machte sich in ihr jedoch Unruhe breit. Auch sie wurde nicht jünger, und die Jahre zogen vorüber. Sie war zu jung und zu hübsch, um jeden Samstagabend zu Hause zu sitzen und ihren Kindern Gutenachtgeschichten vorzulesen. Irgendwo da draußen musste etwas los sein, wenn auch mit Sicherheit nicht in Beech Hill.
Sie stellte eine junge Schwarze aus der Nachbarschaft als Babysitterin ein und fuhr mit ihrem Wagen eine Stunde in nördliche Richtung, bis zur Grenze nach Tennessee. Sie hatte gehört, dass es dort ein paar anständige Klubs und Diskotheken gab. Vielleicht kannte sie da ja niemand. Sie genoss es, zu tanzen und zu flirten, trank aber nie Alkohol und kehrte stets früh nach Hause zurück. Es wurde ihr zur Gewohnheit, diese Ausflüge zwei- oder dreimal im Monat zu unternehmen.
Nach einer Weile trug sie engere Jeans, tanzte leidenschaftlicher, und es wurde später und später. Sie fiel auf, und in den Bars und Klubs entlang der Grenze zwischen den Bundesstaaten wurde über sie geredet.
Bevor er sie tötete, war er ihr zweimal bis zu ihrem Haus gefolgt. Es war März, und eine Warmfront hatte Hoffnung auf einen vorzeitigen Frühling aufkeimen lassen. Die Nacht war dunkel und mondlos. Bear, der Hund der Familie, erschnüffelte ihn hinter einem Baum im Garten hinter dem Haus. Als er knurren und bellen wollte, wurde er für immer zum Schweigen gebracht.
Rhodas Sohn Michael war fünf, ihre Tochter Teresa drei. Die Kinder trugen ordentlich gebügelte, zueinander passende Schlafanzüge mit Disney-Zeichentrickfiguren und blickten ihre Mutter gebannt an, die ihnen die Geschichte von Jonas und dem Wal vorlas. Dann brachte sie die Kinder ins Bett und gab ihnen einen Gutenachtkuss. Als sie das Licht im Kinderzimmer ausknipste, war er bereits im Haus.
Eine Stunde später schaltete sie den Fernseher aus, verschloss die Türen und wartete auf Bear, der sich aber nicht blicken ließ. Das war nicht weiter überraschend, weil er häufig Jagd auf Kaninchen und Eichhörnchen machte und erst spät zurückkam. Gewöhnlich schlief er dann hinten auf der Terrasse, um sie im Morgengrauen mit seinem Geheul zu wecken. Nachdem sie in ihrem Schlafzimmer das leichte Baumwollkleid abgestreift hatte, öffnete sie die Tür des Kleiderschranks, wo er in der Finsternis auf sie wartete.
Er packte sie von hinten und hielt ihr mit einer fleischigen, verschwitzten Hand den Mund zu. »Ich hab ein Messer, und wenn du nicht still bist, stech ich dich und deine Kinder ab.« Er fuchtelte mit einer glänzenden Klinge vor ihren Augen herum. »Kapiert?«, zischte er ihr ins Ohr.
Rhoda zitterte, schaffte es aber zu nicken. Sie wusste nicht, wie er aussah. Er stieß sie auf den Boden des voll gestopften Kleiderschranks, mit dem Gesicht nach unten, und zwang ihr die Hände auf den Rücken. Dann verband er ihr mit einem braunen Wollschal, den sie von einer alten Tante geschenkt bekommen hatte, die Augen. »Kein Wort, sonst sind deine Kinder dran«, knurrte er. Anschließend riss er sie an den Haaren hoch und zerrte sie zum Bett hinüber, wo er ihr die Spitze des Messers unters Kinn hielt. »Wenn du dich wehrst – ich hab das Messer griffbereit.« Er zerschnitt ihren Slip, und die Vergewaltigung nahm ihren Lauf.
Er wollte ihre Augen sehen, diese wunderschönen Augen, die ihm in den Klubs aufgefallen waren. Und ihr langes Haar. Er hatte ihr Drinks spendiert und zweimal mit ihr getanzt, doch als er zur Sache kommen wollte, hatte sie ihm die kalte Schulter gezeigt. »Na komm, mach ein bisschen mit, Baby«, murmelte er gerade so laut, dass sie es hörte.
Drei Stunden lang hatte er sich Mut angetrunken und war nun wegen des Whiskeys angenehm entspannt. Er lag auf ihr und bewegte sich langsam. Ohne Eile genoss er jede einzelne Sekunde. Er gab das leise, selbstgefällige Stöhnen eines richtigen Mannes von sich, der sich nimmt und bekommt, worauf er Lust hat.
Der Geruch des Whiskeys und sein stinkender Schweiß verursachten Rhoda Übelkeit, aber sie war zu verängstigt, um sich zu übergeben. Vielleicht würde ihn das wütend machen und dazu bringen, das Messer zu benutzen. Während sie begann, das entsetzliche Geschehen nur noch über sich ergehen zu lassen, versuchte sie nachzudenken. Verhalt dich still. Weck die Kinder nicht auf. Aber was hat er mit dem Messer vor, wenn es vorbei ist?
Seine Bewegungen wurden schneller, sein Gemurmel lauter. »Schön ruhig, Baby«, zischte er immer wieder. »Sonst benutz ich das Messer.« Das Eisenbett quietschte. Wurde wohl noch nicht oft auf die Art benutzt, dachte er. Zu viel Lärm, aber es war ihm egal.
Das Quietschen des Bettes riss Michael aus dem Schlaf. Er weckte Teresa, und sie verließen ihr Zimmer und schlichen durch den dunklen Flur. Michael öffnete die Tür des Schlafzimmers seiner Mutter und sah den seltsamen Mann auf ihr liegen. »Mama!« Der Mann hielt inne, sein Kopf wirbelte zur Tür herum.
Die Stimme ihres Sohnes verängstigte Rhoda noch mehr. Sie riss den Oberkörper hoch und versuchte, den Vergewaltiger blindlings zu attackieren. Eine kleine Faust traf sein linkes Auge, ein harter Schlag, der ihn verdutzte. Er riss ihr den Schal herunter, ohrfeigte sie und versuchte, sie wieder auf die Matratze zu drücken. »Danny Padgitt!«, schrie sie, während sie sich wehrte. Er schlug erneut zu.
»Mama!«, kreischte Michael.
»Lauft weg!«, versuchte sie zu schreien, brachte es aber wegen der Schläge kaum heraus.
»Halt’s Maul!«, brüllte Padgitt.
»Lauft!«, schrie Rhoda erneut. Die Kinder rannten durch den Korridor in die Küche und dann nach draußen.
In dem Sekundenbruchteil, nachdem sie seinen Namen herausgeschrien hatte, war ihm klar geworden, dass er sie zum Schweigen bringen musste. Er stach zweimal zu, kroch von dem Bett herunter und griff nach seinen Kleidern.
Als sie Michaels Schreie hörten, saßen Aaron Deece und seine Frau gerade vor dem Fernseher, um sich das Spätprogramm aus Memphis anzuschauen. Mr Deece riss die Haustür auf und sah den Jungen in seinem von Schweiß und Tau durchnässten Schlafanzug. Seine Zähne klapperten so heftig, dass er kaum sprechen konnte. »Er hat meiner Mama wehgetan, er hat meiner Mama wehgetan«, wiederholte er immer wieder.
Trotz der Finsternis zwischen den beiden Häusern sah Mr Deece, dass Teresa ihrem Bruder folgte. Sie schien sich kaum vom Fleck zu bewegen, als wollte sie den einen Ort erreichen, ohne den anderen zu verlassen. Als Mr Deece sie schließlich an der Garage abfing, lutschte sie am Daumen und war unfähig, auch nur ein Wort zu sagen.
Mr Deece rannte ins Haus und holte zwei Schrotflinten, eine für sich, eine für seine Frau. Die beiden Kinder waren in der Küche, vor Schock wie gelähmt. »Er hat meiner Mama wehgetan«, wiederholte Michael noch immer. Mrs Deece nahm die Kinder in den Arm und versicherte, alles werde wieder gut. Sie blickte auf die Schrotflinte, die ihr Mann auf den Tisch gelegt hatte. »Du bleibst hier«, sagte er, während er schon nach draußen stürmte.
Er musste nicht weit laufen. Bevor sie in dem nassen Gras zusammengebrochen war, hatte Rhoda es fast bis zum Haus von Mr Deece geschafft. Sie war völlig nackt und vom Hals abwärts blutverschmiert. Er hob sie hoch, trug sie zur Vorderveranda und rief seiner Frau zu, sie solle sich mit den Kindern hinten im Haus im Schlafzimmer einschließen. Er durfte nicht zulassen, dass sie ihre Mutter in den letzten Augenblicken ihres Lebens so sahen.
Als er sie auf die Hollywoodschaukel legte, flüsterte Rhoda: »Es war Danny Padgitt. Es war Danny Padgitt.«
Er legte eine Decke über sie, dann rief er den Notarzt.
Danny Padgitt hielt den Pick-up in der Mitte der Straße und fuhr mit einer Geschwindigkeit von über hundertdreißig Stundenkilometern. Er war halb betrunken und völlig verängstigt, auch wenn er sich das nicht eingestehen wollte. In zehn Minuten würde er zu Hause sein, in der Sicherheit des kleinen Königreichs seiner Familie, das unter dem Namen Padgitt Island bekannt war.
Die Kinder hatten alles zerstört. Er würde morgen darüber nachdenken. Nach einem großen Schluck Jack Daniel’s fühlte er sich besser.
Es war ein Kaninchen oder ein kleiner Hund oder irgendein anderes Tier. Als es vom Seitenstreifen auf die Fahrbahn schoss, sah er es aus dem Augenwinkel, doch er reagierte falsch. Er trat instinktiv aufs Bremspedal, aber nur für einen Moment. Eigentlich war es ihm völlig egal, was er da überrollte. Es machte ihm sogar Spaß, Tiere über den Haufen zu fahren. Aber er hatte zu heftig auf die Bremse getreten. Die Hinterräder blockierten, und noch bevor er es begriff, hatte er schon ernsthafte Probleme. Er riss das Steuer herum, aber in die falsche Richtung, und der Wagen scherte auf den Seitenstreifen aus und begann sich zu drehen wie ein Stockcar auf der Gegengeraden. Der Pick-up rutschte in den Graben hinab, überschlug sich zweimal und krachte gegen eine Wand von Kiefern. Nüchtern hätte er wahrscheinlich nicht überlebt, aber Betrunkene haben Glück.
Padgitt kroch durch eines der zersplitterten Fenster nach draußen und stand dann lange da, an den Pick-up gelehnt. Er überprüfte seine Wunden und Kratzer und überlegte, wie es weitergehen sollte. Sein eines Bein war plötzlich steif geworden, und als er mühsam über die Böschung zum Straßenrand hinaufkletterte, wurde ihm klar, dass er nicht weit kommen würde. Doch das war auch nicht nötig.
Es dauerte einen Moment, bis er bemerkte, dass er in blaues und rotes Licht getaucht war. Der Deputy war bereits ausgestiegen und betrachtete den Unfallort im Licht einer langen schwarzen Taschenlampe. Aus der Ferne näherten sich weitere Blaulichter.
Der Deputy sah das Blut, roch den Whiskey und griff nach seinen Handschellen.
3
Der Big Brown River schlägt in Tennessee einen nonchalanten Bogen nach Süden und fließt dann für fünfundvierzig Kilometer schnurgerade, wie ein von Hand ausgehobener Kanal, mitten durch das zu Mississippi gehörende Taylor County. Drei Kilometer oberhalb von Ford County beginnt er, sich zu winden und zu schlängeln, um dann hinter der Grenze an eine verängstigte, sich zusammenkringelnde Schlange zu erinnern. Das schlammige Wasser des meist seichten Flusses schleppt sich langsam dahin. Für seine Schönheit ist der Big Brown nicht gerade bekannt. Die Uferböschungen an den unzähligen Windungen und Kurven sind sandig, verschlammt oder mit Kies bedeckt. Ein unerschöpflicher Speicher von Sümpfen und Bächen speist seine trägen Fluten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!