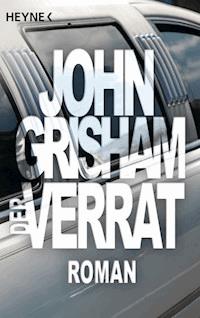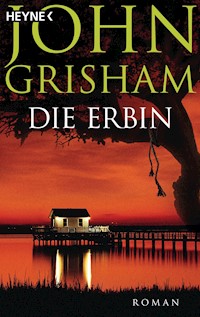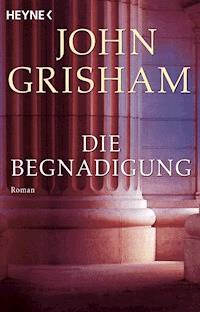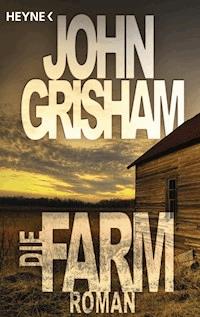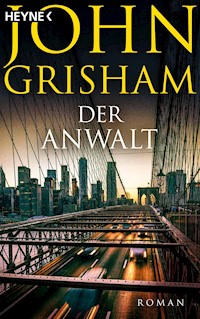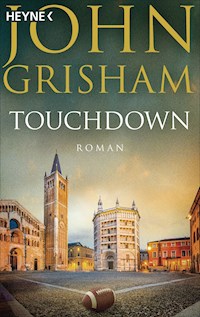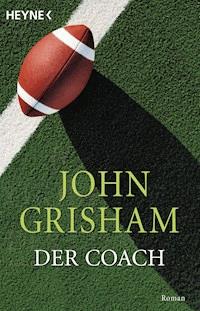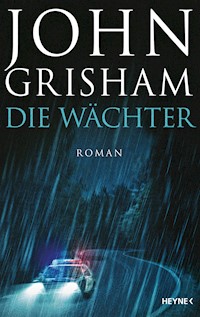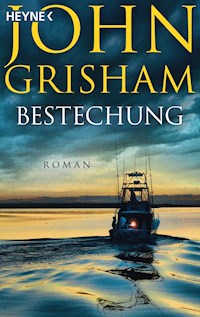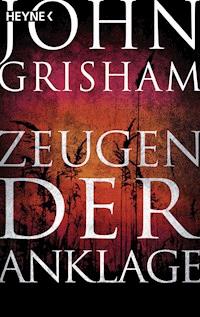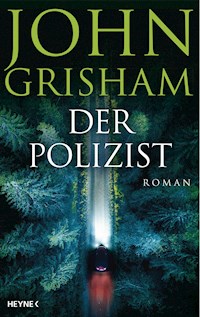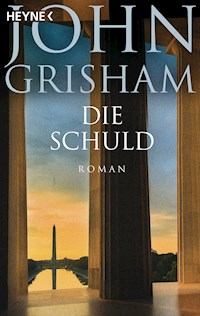
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gefangen im weiten Netz der Korruption
Clay Carter muss sich schon viel zu lange und mühsam seine Sporen im Büro des Pflichtverteidigers verdienen. Nur zögernd nimmt er einen Fall an, der für ihn schlicht ein weiterer Akt sinnloser Gewalt in Washington D.C. ist: Ein junger Mann hat mitten auf der Straße scheinbar wahllos einen Mord begangen. Clay stößt aber auf eine Verschwörung, die seine schlimmsten Befürchtungen weit übertrifft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Clay Carter ist ein junger Rechtsanwalt. Er träumt von einer prestigeträchtigen und lukrativen Stelle in einer der großen Kanzleien. Stattdessen muss er sich schon viel zu lange und zu mühsam seine Sporen im Büro des Pflichtverteidigers verdienen. Nur zögernd nimmt er einen Fall an, der für ihn schlicht ein weiterer Akt sinnloser Gewalt in Washington, D.C., ist: Ein junger Mann hat mitten auf der Straße scheinbar wahllos einen Mord begangen. Doch als Clay sich routinemäßig mit den Hintergründen der Tat und der Vergangenheit des Angeklagten befasst, taucht wie aus dem Nichts ein geheimnisvoller, einflussreicher Mann auf, der Clay ein Angebot macht, das er kanum auschlagen kann: Aus dem einfachen Mordfall wird unversehens ein kompkiziertes und gefährliches Verfahren gegen einen der größen Pharmakozerne der Welt. Die Schadenssumme, um die es geht, ist gigantisch. Der Fall könnte Clay zerstören, sollte er jedoch Erfolg haben, wäre Clay am Ende des Verfahrens nicht nur ein reicher Mann, sondern über Nacht ein berühmter und gefürchteter Opferanwalt. Er muss nur bereit sein, sich viele, mächtige Feinde zu machen – und alles zu verraten, an das er je geglaubt hat.
Inhaltsverzeichnis
1
Als die Kugeln Pumpkins Kopf durchschlugen, hörten nicht weniger als acht Leute die Schüsse. Drei schlossen instinktiv die Fenster, überprüften die Türschlösser und verharrten in ihren kleinen Wohnungen, wo sie sich halbwegs in Sicherheit wähnten. Zwei andere, denen derartige Vorfälle vertraut waren, suchten schneller das Weite als der Mörder. Ein weiterer, der Mülltrennungsfanatiker des Viertels, hörte die kurzen, scharfen Explosionen aus nächster Nähe, als er gerade auf der Suche nach Getränkedosen den Abfall durchwühlte. Da solche Scharmützel hier an der Tagesordnung waren, sprang er hinter einen Berg aufeinander getürmter Kartons und wartete dort, bis der letzte Schuss verhallt war. Dann trat er vorsichtig wieder auf die kleine Straße. Dort fiel sein Blick auf das, was von Pumpkin noch übrig war.
Die restlichen zwei Personen sahen fast alles. Sie saßen an der Ecke Georgia Avenue und Lamont Street direkt vor einem Spirituosenladen auf Plastikkästen für Milchkartons. Bevor der Mörder Pumpkin in die Seitengasse folgte, blickte er sich flüchtig um, aber er bemerkte die beiden nicht, weil sie teilweise durch einen geparkten Wagen verdeckt wurden. Gegenüber der Polizei gaben sie später übereinstimmend zu Protokoll, sie hätten gesehen, dass der Mann eine Waffe aus der Tasche gezogen habe – eine kleine schwarze Pistole. Eine Sekunde später seien die Schüsse gefallen. Allerdings hätten sie nicht gesehen, wie die Kugeln in Pumpkins Schädel einschlugen. Einen Augenblick darauf tauchte der junge Mann mit der Pistole aus der Seitenstraße auf und flüchtete aus unerfindlichen Gründen ausgerechnet in Richtung der beiden Augenzeugen. Er rannte wie ein verängstigter Hund, hatte den Oberkörper gebeugt, als lastete schwere Schuld auf ihm. Seine rot und gelb gemusterten Basketballschuhe wirkten fünf Nummern zu groß und verursachten bei jedem Schritt ein klatschendes Geräusch auf dem Asphalt.
Als er an den beiden Zeugen vorbeilief, hielt er die Waffe, wahrscheinlich eine Achtunddreißiger, noch in der Hand. Er bemerkte sie und zuckte zusammen, da ihm schlagartig bewusst wurde, dass sie zu viel gesehen hatten. Einen quälenden Moment lang kam es ihnen so vor, als würde er die Waffe auf sie richten, um sie zu töten. Geistesgegenwärtig ließen sie sich von den Getränkekästen nach hinten fallen und robbten in einem wilden Durcheinander aus Armen und Beinen in Deckung. Währenddessen verschwand der Mann mit der Pistole.
Einer der beiden stieß die Tür des Spirituosenladens auf und schrie, jemand solle die Polizei benachrichtigen, es habe eine Schießerei gegeben.
Eine halbe Stunde später erhielt die Polizei die Nachricht, dass ein junger Mann, auf den die Beschreibung von Pumpkins Mörder passte, zweimal in der Ninth Street gesehen worden sei. Er halte die Pistole noch in der Hand und habe sich einigermaßen auffällig verhalten. Zumindest eine Person habe er auf ein unbebautes Grundstück zu locken versucht, doch dem Betreffenden sei es gelungen zu fliehen. Anschließend informierte er die Polizei.
Eine Stunde später wurde der Mann verhaftet. Er hieß Tequila Watson, war zwanzig Jahre alt, schwarz und hatte das übliche Vorstrafenregister eines Drogenabhängigen. Keine Familie, die diese Bezeichnung verdient hätte, kein fester Wohnsitz. Zuletzt hatte er in einer Drogenentziehungseinrichtung in der W Street gewohnt. Die Pistole hatte er unterwegs verschwinden lassen. Falls er Pumpkin Drogen oder sonst etwas geraubt hatte, musste er auch das weggeworfen haben, denn in seinen Taschen war nichts zu finden. Sein Blick wirkte klar, und die Polizeibeamten waren sicher, dass er bei der Festnahme weder unter Drogen- noch unter Alkoholeinfluss stand. Nach einem kurzen und ruppigen Verhör, das an Ort und Stelle stattfand, legte man ihm Handschellen an, um ihn dann unsanft auf die Rückbank eines Streifenwagens der Washingtoner Polizei zu verfrachten.
Die Beamten brachten den Verdächtigen zur Lamont Street zurück, wo eine Art Gegenüberstellung mit den beiden Zeugen stattfinden sollte. Sie führten Tequila in die Seitengasse, in der Pumpkins Leiche gelegen hatte. »Schon mal hier gewesen?« , fragte einer der Polizeibeamten.
Statt zu antworten, starrte Tequila nur auf die Blutlache auf dem schmutzigen Asphalt. Mittlerweile wurden die beiden Zeugen unauffällig geholt.
»Das ist er«, sagten beide wie aus einem Mund.
»Dieselben Klamotten, dieselben Schuhe. Nur die Pistole fehlt.«
»Ja, das ist er.«
»Da gibt’s keinen Zweifel.«
Nachdem Tequila wieder in den Streifenwagen geschoben worden war, brachte man ihn ins Gefängnis. Da er wegen Mordverdachts eingesperrt wurde, hatte er keine Chance, gegen Kaution sofort wieder auf freien Fuß gesetzt zu werden. Ob aus Erfahrung oder aus Angst – Tequila sagte kein Wort, als die Polizeibeamten ihn befragten, bedrängten und schließlich bedrohten. Nichts Belastendes, nichts Klärendes. Es gab keinerlei Hinweise auf ein mögliches Motiv für den Mord an Pumpkin oder darauf, ob zwischen ihnen eine Verbindung bestand. Ein erfahrener Detective hielt in einer kurzen Aktennotiz fest, dieser Mord komme ihm willkürlicher vor als bei ähnlichen Fällen.
Tequila bat nicht darum, telefonieren zu dürfen, und fragte weder nach einem Anwalt noch nach einem Kautionsbürgen. Er wirkte benommen und schien damit zufrieden zu sein, in einer überfüllten Zelle zu sitzen und auf den Boden zu starren.
Pumpkins Vater war spurlos verschwunden. Seine Mutter arbeitete als Sicherheitsbeamtin im Erdgeschoss eines großen Bürogebäudes in der New York Avenue. Die Polizei hatte drei Stunden benötigt, um den richtigen Namen – Ramón Pumphrey – und die Adresse ihres Sohnes herauszubekommen und einen Nachbarn zu finden, der bereit war, den Beamten zu sagen, dass Ramón Pumphrey noch eine Mutter hatte.
Als die Polizisten an ihrem Arbeitsplatz eintrafen, saß Adelfa Pumphrey hinter einem Tisch und starrte unbeteiligt auf mehrere Monitore. Sie war groß, dick und trug eine eng sitzende Khakiuniform, an deren Gürtel eine Pistole baumelte. Ihre Miene wirkte völlig desinteressiert. Die Beamten hatten sich schon hunderte Male in einer solchen Situation befunden. Nachdem sie die schlechte Nachricht überbracht hatten, fragten sie nach ihrem Chef.
In einer Stadt, in der sich tagtäglich junge Menschen gegenseitig umbrachten, wurden die Menschen dickfellig und hartherzig. Jede Mutter kannte etliche andere Mütter, deren Kinder durch Gewaltverbrechen ums Leben gekommen waren, und jeder Verlust eines Menschenlebens ließ den Tod auch in der eigenen Familie einen Schritt näher rücken. Alle Mütter wussten, dass jeder Tag der letzte sein konnte. Aber sie hatten auch gesehen, wie andere Mütter die Tragödie überlebt hatten. Während Adelfa Pumphrey dasaß, das Gesicht in die Hände gebettet, dachte sie an ihren Sohn, an seinen leblosen Körper, der jetzt irgendwo in dieser Stadt lag und von Fremden untersucht wurde.
Sie schwor demjenigen Rache, der Ramón getötet hatte, wer immer es auch sein mochte.
Sie verfluchte seinen Vater, der das eigene Kind im Stich gelassen hatte.
Sie weinte.
Aber Adelfa Pumphrey wusste, dass sie überleben würde. Irgendwie würde sie es schaffen.
Als die Vernehmung zur Anklage stattfand, war auch Adelfa Pumphrey anwesend. Die Polizisten hatten ihr erzählt, dies sei der erste Auftritt des Mörders ihres Sohnes vor dem Richter – eine reine Routineangelegenheit, die schnell über die Bühne gehen werde. Der Häftling werde sich nicht schuldig bekennen und einen Anwalt verlangen. Eingerahmt von ihrem Bruder und einem Nachbarn, saß Adelfa weinend in der letzten Reihe des Gerichtssaals und tupfte sich mit einem durchnässten Taschentuch die Tränen ab. Sie wollte den Jungen endlich sehen. Sie wollte ihn fragen, warum er ihren Sohn umgebracht hatte. Aber sie machte sich keine Illusionen – diese Chance würde man ihr nicht geben.
Nacheinander wurden die Kriminellen durch den Raum getrieben wie Rinder bei einer Viehauktion. Es waren ausnahmslos junge Schwarze, alle in orangefarbenen Overalls und mit Handschellen. Und mit einem vergeudeten Leben.
Bei Tequila hatte man sich nicht mit Handschellen begnügt, sondern seine Handgelenke und Fußknöchel zusätzlich aneinander gekettet. Obwohl er ein besonders gewalttätiges Verbrechen begangen hatte, machte er einen ziemlich harmlosen Eindruck, als er mit der nächsten Gruppe von Gesetzesbrechern in den Gerichtssaal gebracht wurde. Mit einem raschen Blick über die Anwesenden suchte er nach irgendeinem bekannten Gesicht. Vielleicht hatte sich ja jemand seinetwegen in den Gerichtssaal bemüht. Als man ihn auf einen der Stühle drückte, ließ es sich einer der bewaffneten Gerichtsdiener nicht nehmen, Tequila auf Adelfa Pumphrey aufmerksam zu machen: »Da hinten sitzt die Mutter von dem Jungen, den du umgebracht hast. Die Frau in dem blauen Kleid.«
Mit gesenktem Kopf wandte sich Tequila langsam um. Er blickte Pumpkins Mutter in die verheulten, geröteten Augen, aber nur für einen winzigen Moment. Während Adelfa den dürren Jungen in dem viel zu großen Overall anstarrte, fragte sie sich, wo seine Mutter sein mochte, wie sie ihn großgezogen hatte, ob auch er ohne Vater aufgewachsen war und – am wichtigsten – wie und warum sich die Wege dieses Jungen und ihres Sohnes gekreuzt hatten. Die beiden waren im selben Alter wie die anderen Delinquenten hier – um die zwanzig. Die Polizeibeamten hatten ihr berichtet, bislang deute bei diesem Mord nichts darauf hin, dass Drogen im Spiel gewesen seien. Aber sie wusste es besser. Bei dem, was auf den Straßen passierte, waren auf die eine oder andere Weise immer Drogen im Spiel. Adelfa kannte sich aus. Auch Pumphrey hatte Marihuana und Crack konsumiert. Er war sogar einmal festgenommen worden, aber nur wegen Drogenbesitz. Gewalttätig war er nie gewesen. Die Polizisten sahen kein Motiv; ihrer Meinung nach hatte bei diesem Mord der Zufall Regie geführt. Adelfas Bruder dagegen hatte gesagt, alle Straßenmorde wirkten zwar zufällig, aber es gebe immer einen Grund.
An einem Tisch auf der einen Seite des Gerichtssaals saßen die Vertreter des Staates. Die Polizisten flüsterten mit den Anklägern, während diese Akten und Berichte durchblätterten und sich tapfer bemühten, mit ihrem Papierkram nicht hinter den vorgeführten Kriminellen zurückzubleiben. Auf der anderen Seite stand ein Tisch für die Rechtsanwälte, die kamen und gingen, während die Verdächtigen an dem Richter vorbeidefilierten. Der Richter seinerseits rasselte die Anklagen herunter – Drogendelikte, dazwischen ein bewaffneter Raubüberfall, ein etwas unklares Sexualdelikt, erneut Drogengeschichten und immer wieder Verletzung der Bewährungsauflagen. Wenn die Namen der Angeklagten aufgerufen wurden, brachte man sie vor den Richter, wo sie wortlos warteten. Nachdem Papierkram und Formalitäten erledigt waren, wurden sie unsanft weggezerrt und wieder in ihre Zellen gebracht.
»Tequila Watson«, rief schließlich einer der Gerichtsdiener.
Ein Kollege half Tequila aufzustehen. Während er mit kleinen Trippelschritten auf den Richter zustolperte, hallte das Klirren der Ketten durch den Raum.
»Sie sind des Mordes angeklagt, Mr Watson«, sagte der Richter laut. »Wie alt sind Sie?«
»Zwanzig«, antwortete Tequila mit gesenktem Blick.
Die laut vorgebrachte Mordanklage war niemandem im Gerichtssaal entgangen. Einen Augenblick lang herrschte Schweigen. Die Mienen der anderen Kriminellen verrieten Bewunderung, die der Rechtsanwälte und der Polizisten Neugier.
»Können Sie sich einen Anwalt leisten?«
»Nein.«
»Hätte mich auch gewundert«, murmelte der Richter, während sein Blick bereits zum Tisch der Anwälte schweifte. Beim Obersten Gericht des Distrikts Columbia, Abteilung Kapitalverbrechen, gab es fruchtbare Felder zu beackern, um die sich Tag für Tag die Anwälte des Büros der Pflichtverteidiger, des OPD, bemühten. Das OPD war die letzte Hoffnung aller mittellosen Angeklagten. Siebzig Prozent der Prozesse wurden von vom Gericht bestellten Anwälten übernommen, von denen in der Regel immer ein halbes Dutzend anwesend war. Pflichtverteidiger erkannte man an ihren billigen Anzügen, dem ramponierten Schuhwerk und den vor Unterlagen berstenden Aktentaschen. Doch ausgerechnet in diesem Augenblick war nur ein einziger anwesend, nämlich der ehrenwerte Clay Carter II., der kurz vorbeigeschaut hatte, um sich um zwei Verbrecher deutlich weniger schweren Kalibers zu kümmern. Jetzt fand er sich allein auf weiter Flur und hatte nur einen Wunsch – diesen Gerichtssaal so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Er blickte nach links und nach rechts und begriff dann, dass der Richter tatsächlich ihn ins Visier genommen hatte. Wo waren die anderen Pflichtverteidiger abgeblieben?
Vor einer Woche hatte Mr Carter einen Mordfall abgeschlossen, der ihn fast drei Jahre lang beschäftigt hatte. Als das Urteil gefällt war, wurde sein Mandant in ein Gefängnis verfrachtet, das er sein Leben lang nicht mehr verlassen würde – zumindest nicht auf dem offiziellen Weg. Clay Carter war ziemlich glücklich darüber, dass dieser Mandant jetzt hinter Gittern saß, und erleichtert, weil im Augenblick keine Akten auf seinem Schreibtisch herumlagen, die irgendetwas mit Mord zu tun hatten.
Doch das sollte sich jetzt offensichtlich ändern.
»Mr Carter?«, fragte der Richter. Das war kein Befehl, sondern eine Einladung, die ihm zugedachte Rolle zu spielen. Man erwartete von ihm, dass er vortrat und sich wie ein Pflichtverteidiger verhielt, dessen Aufgabe eben darin bestand, die Mittellosen zu vertreten, egal, worum es ging. In Anwesenheit der Staatsanwälte und der Polizisten durfte er sich keine Verunsicherung anmerken lassen. Carter musste schlucken, aber er zuckte nicht zusammen. Möglichst beherzt trat er vor den Richter, als wollte er sofort ein Schwurgerichtsverfahren beantragen. Der Richter reichte ihm die eher dünne Akte, und Carter blätterte sie flüchtig durch, ohne Tequila Watsons flehendem Blick Aufmerksamkeit zu schenken. »Wir werden auf nicht schuldig plädieren, Euer Ehren«, sagte er dann.
»Danke, Mr Carter. Heißt das, dass Sie die Verteidigung übernehmen?«
»Zumindest fürs Erste.« Carter tüftelte bereits aus, unter welchem Vorwand er diesen Fall einem seiner Kollegen aufhalsen konnte.
»Gut, vielen Dank«, sagte der Richter und griff nach den Unterlagen zum nächsten Fall.
Für ein paar Minuten nahm Carter mit seinem neuen Mandanten am Tisch der Verteidigung Platz. Tequila Watson rückte allerdings nur ein paar äußerst dürftige Informationen heraus. Abschließend versprach Carter, am nächsten Tag im Gefängnis vorbeizuschauen, damit sie ein längeres Gespräch führen konnten. Während die beiden sich leise unterhielten, tauchten plötzlich wie aus dem Nichts Carters Kollegen aus dem OPD auf.
War das ein abgekartetes Spiel?, fragte er sich. Waren die anderen Pflichtverteidiger klammheimlich verschwunden, weil sie wussten, dass dem Richter ein Mordverdächtiger vorgeführt werden sollte? Während der vergangenen fünf Jahre hatte sich auch Carter mehrfach auf diese Weise aus der Affäre gezogen. In seinen Kreisen hatte es sich fast zu einer Kunst entwickelt, sich vor den unangenehmen Fällen zu drücken.
Er klemmte sich seine Aktentasche unter den Arm und stürmte durch den Mittelgang, ohne von den besorgten Verwandten der Angeklagten oder von Adelfa Pumphrey und ihren beiden Begleitern Notiz zu nehmen. Im Flur befanden sich etliche weitere Kriminelle, auch sie in Begleitung ihrer Mütter, Freundinnen und Anwälte. Unter den anderen Pflichtverteidigern gab es einige, die schworen, ohne das Chaos im H. Carl Moultrie Courthouse nicht leben zu können. Angeblich liebten sie den Druck, unter dem die Verfahren stattfanden, die Atmosphäre latenter Gefahr, die die vielen, in einem Raum zusammengepferchten Gewaltverbrecher verströmten, die schmerzlichen Konflikte zwischen Opfern und Tätern und die endlos langen Prozesslisten mit den dicht gedrängten Terminen. Wollte man ihren Worten Glauben schenken, dann hielten sie es für ihre Mission, die Unterprivilegierten zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie von der Polizei und der Justiz fair behandelt wurden.
Sollte Clay Carter jemals den Wunsch empfunden haben, als Pflichtverteidiger im OPD Karriere zu machen, so war ihm der Grund dafür mittlerweile entfallen. In einer Woche stand sein fünfjähriges Dienstjubiläum an, doch zum Feiern gab es keinen Anlass. Er hoffte, dass sich niemand daran erinnern würde. Mit seinen einunddreißig Jahren war Clay bereits ausgebrannt, gefangen in einem Büro, das er seinen Freunden allenfalls beschämt präsentieren konnte, und auf der Suche nach einem Ausweg aus seiner Misere. Doch er fand keinen. Und jetzt hatte er auch noch diesen sinnlosen Mordfall am Hals, der von einer Minute zur anderen zu einer immer schwereren Last wurde.
Im Aufzug verfluchte er sich, weil er so blöde gewesen war, sich den Mord aufbürden zu lassen. Er hatte einen echten Anfängerfehler gemacht und war doch eigentlich schon viel zu lange in diesem Geschäft, um noch in eine solche Falle zu tappen. Eine Falle, die ihm zudem auf bestens vertrautem Terrain gestellt worden war. Ich schmeiß den ganzen Kram hin, versprach er sich, doch diesen Schwur hatte er während des vergangenen Jahres fast jeden Tag vor sich hin gemurmelt.
Außer ihm waren noch zwei andere Personen im Lift – eine Gerichtsschreiberin mit einem Haufen Akten unter dem Arm und ein etwa vierzigjähriger Mann in schwarzer Designerkleidung: Jeans, T-Shirt, Jackett, Krokodillederstiefel. Er hielt eine Zeitung in den Händen und schien zu lesen. Seine kleine Lesebrille hatte er bis auf die Spitze der ziemlich langen, markanten Nase hinabgeschoben. Tatsächlich beobachtete er Clay, der aber nichts bemerkte, weil er in Gedanken versunken war. Warum sollte man auch einem anderen Menschen im Aufzug dieses Gebäudes Beachtung schenken?
Hätte Carter seine Umgebung aufmerksam betrachtet, statt seinen Gedanken nachzuhängen, wäre ihm mit Sicherheit aufgefallen, dass dieser Mann für einen Angeklagten zu gut und für einen Anwalt nicht dezent genug gekleidet war. Außer der Zeitung hatte er nichts dabei, und schon das war merkwürdig. Dieses Gerichtsgebäude war nicht gerade dafür bekannt, dass man darin ein gemütliches Lektürestündchen abhalten konnte. Der Mann schien weder Richter noch Gerichtsschreiber, weder Verbrechensopfer noch Angeklagter zu sein. Aber Clay nahm ihn nicht zur Kenntnis.
2
In Washington gab es etwa sechsundsiebzigtausend Rechtsanwälte, von denen viele für die riesigen Kanzleien arbeiteten, die sich in Steinwurfnähe zum Kapitol befanden. Das waren reiche und mächtige Büros, die die hellsten Köpfe der Branche mit geradezu obszönen Bonussen als Partner köderten, farblosen ehemaligen Kongressabgeordneten großzügig dotierte Lobbyistenjobs anboten und deren gefragteste Prozessführer eigene Agenten hatten. Das OPD spielte nicht annähernd in dieser Liga.
Einige Pflichtverteidiger vom OPD glaubten mit missionarischem Eifer daran, die Armen und Unterdrückten verteidigen zu müssen. Für sie war dieser Job kein Sprungbrett für eine aussichtsreichere Karriere an anderer Stelle. Ungeachtet des miserablen Gehalts und der mickrigen Budgets blühten sie förmlich auf, wenn sie daran dachten, dass ihre einsame Arbeit immerhin mit einer gewissen Unabhängigkeit verbunden war. Außerdem verschaffte es ihnen innere Befriedigung, ihre schützende Hand über die Underdogs zu halten.
Andere Pflichtverteidiger sahen diesen Job nur als Übergangslösung, als hartes Grundlagentraining, das für einen späteren Karrieresprung unabdingbar war. Wollte man die Stufen des gesellschaftlichen Erfolgs erklimmen, musste man diese harte Schule eben durchstehen und sich dabei auch die Hände schmutzig machen. Als Pflichtverteidiger machte man Erfahrungen, die einem Juristen aus einer großen Kanzlei verwehrt blieben. Eines Tages würde sich der Lohn dieser harten Fronarbeit schon einstellen, und zwar in Form einer lukrativen Offerte einer Kanzlei mit Perspektive. Eine unerschöpfliche, praktische Erfahrung mit Prozessen, das Wissen um den Umgang mit Richtern, Gerichtsschreibern und Polizisten, die Bewältigung härtester Arbeitsbelastung und der geschickte Umgang mit den schwierigsten Mandanten – dies waren nur einige der Pluspunkte, die ein Pflichtverteidiger bereits nach ein paar Jahren gesammelt hatte.
Beim OPD arbeiteten achtzig Anwälte, deren Büros in zwei Stockwerken des Gebäudes der Stadtverwaltung untergebracht waren, einem gesichtslosen Betonkasten an der Mass Avenue, ganz in der Nähe des Thomas Circle, der allgemein nur »Würfel« genannt wurde. Außer den Pflichtverteidigern waren im Gewirr der mikroskopisch kleinen Büros des OPD noch etwa vierzig schlecht bezahlte Sekretärinnen und drei Dutzend Anwaltsassistenten tätig. Chefin des OPD war eine Frau namens Glenda, die sich die meiste Zeit in ihrem Büro einschloss, weil sie sich dann in Sicherheit glaubte.
Das Anfangsgehalt eines Pflichtverteidigers betrug 36 000 Dollar pro Jahr. Gehaltserhöhungen gab es nur in großen Abständen, und sie fielen immer minimal aus. Der älteste Anwalt – mit dreiundvierzig Jahren bereits völlig ausgepowert – verdiente mittlerweile 57 800 Dollar und drohte seit neunzehn Jahren mit Kündigung. Der Grund für die extreme Arbeitsbelastung lag darin, dass Washington den Kampf gegen das Verbrechen verlor. Seit acht Jahren beantragte Glenda zehn weitere Rechtsanwälte und ein Dutzend Anwaltsassistenten. Stattdessen wurde ihr das Budget seit vier Jahren im Vergleich zum Vorjahr immer weiter zusammengestrichen. Doch im Augenblick war ihr Problem, dass sie die unangenehme Entscheidung treffen musste, welche Anwaltsassistenten sie entlassen und welchen Rechtsanwälten sie eine Teilzeitstelle verordnen sollte.
Wie die meisten seiner Kollegen hatte auch Clay Carter während des Jurastudiums nicht im Traum daran gedacht, eines Tages als Pflichtverteidiger verarmter Krimineller sein Geld zu verdienen – nicht einmal übergangsweise. Während seiner Zeit am College und später an der juristischen Fakultät der Georgetown-Universität hatte Clays Vater eine eigene Anwaltskanzlei gehabt. Neben seinem Studium hatte Clay dort jahrelang in einem eigenen Büro stundenweise gearbeitet. Damals konnte er sich noch ausschweifenden Träumen hingeben, in denen er gemeinsam mit seinem Vater finanziell lukrative Prozesse führte.
Doch als Clay im letzten Studiumsjahr war, musste sein Vater die Kanzlei dichtmachen. Anschließend verließ er Washington – aber das war eine andere Geschichte. Clay wurde Pflichtverteidiger, weil er kurzfristig keine andere Stelle ergattern konnte.
An seinem neuen Arbeitsplatz musste er drei Jahre lang taktieren und alles in Bewegung setzen, um ein eigenes Büro zu bekommen, in dem er nicht ständig von einem Kollegen oder einem Anwaltsassistenten gestört wurde. Leider war der fensterlose Raum nur so groß wie die Abstellkammer einer bescheidenen Vorortwohnung, und schon der Schreibtisch nahm die Hälfte der Fläche ein. Sein Büro in der Kanzlei seines Vaters war viermal so groß gewesen und hatte Fenster auf das Washington Monument gehabt. Clay versuchte, diese Bilder aus seinem Gedächtnis zu löschen, doch sie drängten sich ihm immer wieder auf. Mittlerweile waren fünf Jahre ins Land gegangen. Manchmal saß er nur an seinem Schreibtisch, starrte die Wände an, die von Monat zu Monat näher zu rücken schienen, und fragte sich, wie um alles in der Welt er in diesem Kabuff gelandet war.
Er warf Tequila Watsons Akte auf seinen sauberen, aufgeräumten Schreibtisch und zog das Jackett aus. In dieser trostlosen Atmosphäre war die Versuchung groß, das Büro zu vernachlässigen. Unordnung, aufeinander getürmte Akten und hohe Papierstöße wären jederzeit durch die extreme Arbeitsbelastung und fehlendes Personal zu entschuldigen gewesen. Aber sein Vater hatte immer gesagt, ein aufgeräumter Schreibtisch lasse auf ein gut funktionierendes Gehirn schließen. Wenn man nicht in der Lage sei, etwas innerhalb von dreißig Sekunden wiederzufinden, müsse man mit finanziellen Verlusten rechnen. Eine weitere unumstößliche Regel, die zu befolgen er Clay gelehrt hatte, besagte, dass anfallende Rückrufe sofort getätigt werden sollten.
Folglich war Clay eifrig darum bemüht, Schreibtisch und Büro aufgeräumt zu halten, was bei seinen eher schlampigen Kollegen für Erheiterung sorgte. In der Mitte einer Wand hing das gerahmte Abschlusszertifikat der juristischen Fakultät der Georgetown-Universität. Zwei Jahre lang hatte er das gute Stück in der Schublade gelassen, aus Furcht davor, dass seine Anwaltskollegen fragten, warum ein Absolvent von Georgetown für ein so lausiges Gehalt arbeite. Weil man Erfahrungen sammeln muss, sagte sich Clay. Ich arbeite hier, um Erfahrungen zu sammeln. Jeden Monat ein Prozess – harte Prozesse gegen harte Staatsanwälte vor harten Jurys. Umgang mit den Unterprivilegierten aus der Gosse, den ihm keine große Kanzlei bieten konnte. Geld würde er später verdienen, als im Kampf gestählter und immer noch sehr junger Anwalt.
Während er auf die dünne Watson-Akte starrte, die fein säuberlich genau in der Mitte seines Schreibtischs lag, dachte Clay erneut darüber nach, wie er diesen undankbaren Job einem Kollegen aufhalsen konnte. Allmählich hatte er die Nase voll von der exzellenten praktischen Ausbildung, den schwierigen Fällen und all den anderen unsinnigen Aufgaben, mit denen man sich als unterbezahlter Pflichtverteidiger gewöhnlich abfinden musste.
Sechs Zettel auf seinem Schreibtisch informierten ihn darüber, dass er sechs Rückrufe tätigen musste, fünf davon geschäftlicher Natur. Doch zuerst rief er seine langjährige Freundin Rebecca an.
»Ich habe wahnsinnig viel zu tun«, sagte Rebecca, nachdem sie die obligatorischen einleitenden Nettigkeiten hinter sich gebracht hatten.
»Du hast mich angerufen«, erinnerte Clay sie.
»Ja, aber jetzt habe ich trotzdem nur eine Minute.« Rebecca arbeitete als Assistentin für einen Hinterbänkler aus dem Kongress, der Vorsitzender irgendeines sinnlosen Unterausschusses war. Doch wegen dieser Funktion hatte man ihm ein weiteres Büro zugebilligt, in dem er zusätzliches Personal unterbringen konnte, zu dem auch Rebecca gehörte. Tagelang war sie damit beschäftigt, sich hektisch auf die nächsten Anhörungen vorzubereiten, die vor leeren Reihen stattfanden. Den Job verdankte sie ihrem Vater, der im Hintergrund die Fäden gezogen hatte.
»Ich kann mich vor Arbeit auch kaum retten«, sagte Clay. »Gerade kam wieder ein Mordfall rein.« Irgendwie schaffte er es, ein bisschen Stolz in seiner Stimme mitschwingen zu lassen, ganz so, als wäre es eine Ehre, den Pflichtverteidiger für Tequila Watson spielen zu dürfen.
Diese Gespräche waren bei ihnen ein Ritual. Wer hatte am meisten zu tun, wer den wichtigeren Job? Wer arbeitete am härtesten? Wer musste dem größeren Druck standhalten?
»Morgen hat meine Mutter Geburtstag«, sagte Rebecca. Eine kleine Kunstpause gab Clay die Chance zu der Bemerkung, er habe es nicht vergessen. Aber so war es nicht. Der Geburtstag ihrer Mutter war ihm herzlich egal. Er mochte sie nicht. »Meine Eltern haben uns zum Essen im Club eingeladen.«
Ein ohnehin schlimmer Tag drohte zum Fiasko zu werden. Clay fiel nur eine reflexhafte Antwort ein: »Ja, natürlich.«
»Also, so gegen sieben Uhr. Mit Jackett und Krawatte.«
»Natürlich.« Lieber hätte er mit Tequila Watson im Knast zu Abend gegessen.
»Ich muss weitermachen«, sagte Rebecca. »Ich liebe dich.«
»Ich dich auch.«
Wieder eines der typischen Gespräche zwischen ihnen. Ein paar schnell hingeworfene Sätze, bevor beide wieder ihren ach so wichtigen Aufgaben nachgingen. Clay blickte auf die Fotografie von Rebecca, die vor ihm auf dem Schreibtisch stand. Die Komplikationen ihrer bisherigen Beziehung hätten völlig ausgereicht, um zehn Ehen zu zerstören. Vor langer Zeit hatte Clays Vater ihren Vater verklagt; wer den Prozess gewonnen oder verloren hatte, ließ sich nicht mehr recht nachvollziehen. Ihre Familie stammte aus der alteingesessenen Gesellschaft von Alexandria, während Clay in deren Augen nur der Sohn eines Verlierers war. Rebeccas Eltern waren stark rechtsgerichtete Republikaner, was man von Clay nicht behaupten konnte. Weil ihr Vater durch rücksichtslose Naturzerstörung im Norden Virginias Bauland für die wuchernden Vorstädte von Washington erschloss, wurde er allgemein »Bennett der Bulldozer« genannt. Da Clay nicht gefiel, was Bennett trieb, überwies er – ohne es an die große Glocke zu hängen – Geld an zwei Organisationen von Umweltschützern, die gegen diese Erschließung kämpften. Rebbeccas Mutter hatte nichts außer dem gesellschaftlichen Aufstieg der Familie im Sinn und hätte es am liebsten gesehen, wenn ihre beiden Töchter schwerreiche Männer geheiratet hätten. Clay hatte seine Mutter seit elf Jahren nicht mehr gesehen. Gesellschaftliche Ambitionen waren ihm fremd. Und Geld hatte er auch nicht.
Seit fast vier Jahren gab es zwischen Clay und Rebecca jeden Monat heftige Auseinandersetzungen, die in den meisten Fällen von ihrer Mutter angezettelt wurden. Beider Liebe, Lust und Entschlossenheit, allen Widrigkeiten zu trotzen, hatten ihre Beziehung bisher am Leben gehalten. Doch in letzter Zeit glaubte Clay bei Rebecca eine gewisse Ermüdung wahrzunehmen, einen sich unmerklich steigernden Überdruss, der vermutlich etwas mit dem Älterwerden und dem permanenten Druck ihrer Familie zu tun hatte. Mittlerweile war sie achtundzwanzig. An einer beruflichen Karriere hatte sie eigentlich kein Interesse. Sie wollte einen Ehemann und eine Familie. Sie sehnte sich nach müßigen Tagen im Country Club, wo sie ihre Kinder verwöhnen, Tennis spielen und mit ihrer Mutter essen gehen konnte.
Als plötzlich wie aus dem Nichts Paulette Tullos auftauchte, zuckte Clay erschrocken zusammen. »Sie haben dich wieder drangekriegt und dir einen Mordfall angehängt, oder?«, fragte sie schmunzelnd.
»Warst du dort?«
»Ich habe das Unheil kommen sehen und beobachtet, wie es seinen Lauf nahm. Leider konnte ich nichts für dich tun.«
»Wirklich sehr aufmerksam. Ich werde mich revanchieren.«
Wäre in Clays Büro ein weiterer Stuhl gewesen, hätte er Paulette gebeten, sich einen Moment zu setzen, doch für zusätzliche Möbel gab es keinen Platz. Allerdings benötigte Clay auch in der Regel keinen zweiten Stuhl, da seine Mandanten sowieso immer im Gefängnis saßen. Gemütliche Plauderstündchen waren in der täglichen Routine des OPD nicht vorgesehen.
»Wie stehen meine Chancen, mir diesen Fall vom Hals zu schaffen?«
»Schlecht bis aussichtslos. Auf wen wolltest du ihn denn abwälzen?«
»Eigentlich hatte ich an dich gedacht.«
»Tut mir Leid, ich habe bereits zwei Mordfälle. An deiner Stelle würde ich mich nicht darauf verlassen, dass Glenda dir hilft, den Fall loszuwerden.«
Von seinen Kollegen im OPD war Clay mit Paulette am engsten befreundet. Sie stammte aus einer üblen Gegend der Stadt und hatte College und Jurastudium mühsam in Abendkursen absolviert. Trotz allem schien ihr Aufstieg in die Mittelklasse vorgezeichnet gewesen zu sein. Dann lernte sie einen wohlhabenden alten Griechen kennen, der ein Faible für junge schwarze Frauen hatte. Er heiratete sie und brachte sie in einer komfortablen Wohnung im Nordwesten Washingtons unter. Kurz darauf entschloss er sich überraschend, doch wieder in Europa zu leben, und entschwand über den Ozean. Paulette vermutete, dass er dort eine oder zwei weitere Ehefrauen hatte, aber das bereitete ihr kein sonderliches Kopfzerbrechen. In finanzieller Hinsicht hatte sie keinen Grund zum Klagen, und sie war alles andere als vereinsamt. Nach zehn Jahren funktionierte das Arrangement mit ihrem Mann bestens.
»Ich habe gehört, was der Staatsanwalt gesagt hat«, berichtete Paulette. »Wieder ein Mord auf offener Straße, aber das Motiv ist unklar.«
»Das kam in der langen Geschichte dieser Stadt schon öfter vor«, bemerkte Clay.
»Aber es scheint kein Motiv zu geben.«
»Irgendein Motiv gibt’s immer – Geld, Drogen, Sex oder auch nur ein Paar neue Nikes.«
»Stimmt es, dass der Junge bisher nie durch Gewalttätigkeit aufgefallen ist? Kein ellenlanges Vorstrafenregister?«
»Du weißt, dass man sich nur selten auf den ersten Eindruck verlassen kann, Paulette.«
»Vor zwei Tagen bekam Jermaine einen ähnlichen Fall – kein Motiv.«
»Davon habe ich nichts gehört.«
»Vielleicht solltest du es mal mit ihm versuchen. Er ist ehrgeizig und noch nicht lange im Geschäft. Wer weiß, möglicherweise kannst du den Fall auf ihn abwälzen.«
»Ich werde mich sofort darum kümmern.«
Jermaine war nicht im Haus. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund stand die Tür von Glendas Büro einen Spaltbreit offen, und so klopfte Clay kurz an und trat dann ein. »Haben Sie einen Augenblick Zeit?«, fragte er, obwohl ihm klar war, dass es seiner Chefin verhasst war, auch nur eine Minute mit ihren Untergebenen zu verbringen. Glenda erledigte ihren Job ganz passabel. Sie organisierte die Arbeitsabläufe und hielt die Gelder zusammen, doch am wichtigsten war, dass sie sich um die politischen Angelegenheiten im Rathaus kümmerte. Aber eigentlich mochte sie die Menschen nicht, und deshalb zog sie es vor, sich hinter ihrer Bürotür zu verschanzen.
»Natürlich«, antwortete Glenda, ohne dass es auch nur im Geringsten überzeugend geklungen hätte. Es war unübersehbar, dass ihr die Störung nicht behagte, und genau damit hatte Clay auch gerechnet.
»Ich war heute Morgen zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort und habe wieder einen Mordfall angehängt bekommen, den ich lieber abgeben würde. Ich habe gerade erst den Fall Traxel abgeschlossen, und Sie wissen ja, dass mich diese Geschichte drei Jahre in Anspruch genommen hat. Was Mord angeht, könnte ich mal eine kleine Pause gebrauchen. Wie wär’s denn mit einem der jüngeren Kollegen?«
»Sie wollen kneifen, Mr Carter?«, fragte Glenda stirnrunzelnd.
»Allerdings. Mal wieder ein paar Monate Drogendelikte und Einbrüche. Um mehr bitte ich Sie gar nicht.«
»Und wer soll Ihrer Meinung nach den Fall … Wie heißt der Angeklagte?«
»Tequila Watson.«
»Ah, Tequila Watson. Also, Mr Carter, wem hatten Sie den Fall Watson zugedacht?«
»Ist mir eigentlich egal. Ich brauche nur einfach eine kleine Atempause.«
Glenda lehnte sich in ihrem Bürosessel zurück wie eine weise alte Vorstandsvorsitzende und begann, auf dem hinteren Ende ihres Stifts herumzukauen. »Ist das nicht bei uns allen so, Mr Carter? Brauchen wir nicht alle eine kleine Atempause?«
»Ja oder nein?«
»Wir haben achtzig Rechtsanwälte, Mr Carter, von denen nur etwa die Hälfte die für Mordfälle nötigen Voraussetzungen mitbringt. Von denen hat jeder mindestens zwei solche Fälle am Hals. Übergeben Sie Ihren Fall einem Kollegen, wenn Sie es schaffen – aber ich werde mich nicht einschalten.«
Auf dem Weg zur Tür drehte sich Clay noch einmal um. »Übrigens, eine Gehaltserhöhung könnte ich auch brauchen. Wenn Sie die Güte hätten, sich damit zu befassen.«
»Nächstes Jahr, Mr Carter. Nächstes Jahr.«
»Ein Anwaltsassistent wäre auch hilfreich.«
»Nächstes Jahr.«
Und so blieb die Akte Tequila Watson auf dem penibel aufgeräumten Schreibtisch von Jarrett Clay Carter II.
3
Das Gebäude war ein Gefängnis, und obwohl es der modernen Architektur entsprach und von einigen stolzen Stadtoberen mit großem Pomp eingeweiht worden war, blieb es das auch. Es entsprach den neuesten Sicherheitsstandards und war mit allem möglichen technischen Schnickschnack ausgerüstet. Gebaut für das nächste Jahrhundert, effizient, sicher und human, aber vom ersten Tag an überbelegt. Schon von außen verbreitete der an einer Seite fensterlose Betonklotz eine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit. Innen waren die von zahllosen Wärtern beaufsichtigten Kriminellen auf engstem Raum zusammengepfercht. Weil es sich besser anhörte, hatte man den von den Architekten geprägten Projektnamen »Strafjustizzentrum« übernommen, doch auch dieser zeitgemäße Euphemismus konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Wunderwerk der Baukunst ein Gefängnis war.
Für Clay Carter war das Gefängnis vertrautes Terrain, da er fast alle seine Mandanten hier traf, nachdem sie verhaftet worden waren und bevor sie gegen Zahlung einer Kaution wieder freigelassen wurden – falls sie sie bezahlen konnten. Etliche waren dazu nicht in der Lage. Obwohl bei den Verbrechen vieler seiner Mandanten keine Gewalttätigkeit im Spiel war, wurden sie – ungeachtet von Schuld oder Unschuld – so lange weggeschlossen, bis sie ihren letzten Gerichtstermin hinter sich gebracht hatten. Tigger Banks hatte fast acht Monate in diesem Gefängnis gesessen – wegen eines Einbruchs, den er gar nicht begangen hatte. Dadurch verlor er nicht nur seine beiden Teilzeitjobs, sondern auch seine Wohnung, von seiner Würde ganz zu schweigen. Als er Clay zum letzten Mal anrief, bettelte er ihn mit flehenden Worten um Geld an. Er lebte auf der Straße, rauchte wieder Crack und war auf dem besten Weg, erneut mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
In dieser Stadt konnte praktisch jeder Strafverteidiger seine eigene Tigger-Banks-Story erzählen; auf ein Happyend wartete man bei diesen Geschichten vergebens. Daran war nichts zu ändern. Jeder Gefängnisinsasse kostete den Staat einundvierzigtausend Dollar pro Jahr. Warum war das System so scharf darauf, Geld zum Fenster rauszuwerfen?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!