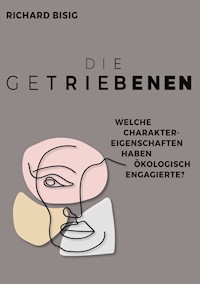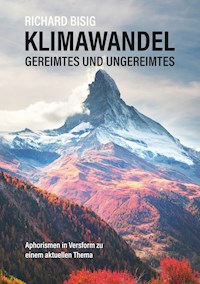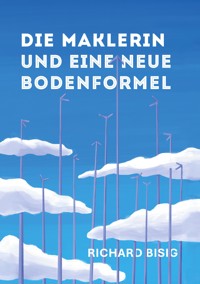
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Steigende Mietzinse und Steigende Landpreise und Steigende Hauspreise. Diese Schlagworte reflektieren den sozialpolitischen Zündstoff, der im Wohnungsmarkt steckt. Richard Bisig erzählt seine Erfahrungen mit dem eigenen Hausverkauf und den damit gemachten einschlägigen Erfahrungen im Maklermarkt. Damit lässt er es aber nicht bewenden. Fachleute diskutieren im Rahmen eines Think Tanks Lösungsmöglichkeiten. Ergebnis ist eine Formel, wie dem aus dem Ruder laufenden Wohnungsmarkt begegnet werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Erfahrungsbericht aus dem Häusermarkt und ein Vorschlag, wie der Krise auf dem Wohnungsmarkt begegnet werden kann
Mit Illustrationen von Balz Schlegel
Gewidmet den Teilnehmenden der politischen Freitags-Lunch-Gespräche Chez Philippe: Adrian, Hans, Hans-Jörg, Marianne, Philipp.
Inhaltsverzeichnis
Die wichtigsten Personen
Mitglieder des Think-Tanks ›Bodenformel‹
Nina Meili verkauft ihr Haus
Think-Tank Bodenpolitik 1: Hohe Zielsetzung und Charakterisierung des Immobilienmarktes
Maklervertrag auf der Basis eines Pauschalpreises oder eines Erfolgshonorars?
Think-Tank Bodenpolitik 2: Mögliche Lösungsansätze
Makler-Zwist
Think-Tank Bodenpolitik 3: Eigentumsförderung
Makler-Ärger
Think-Tank Bodenpolitik 4: Mehrwert-Abschöpfung und Rolle der Gemeinden
Nörglerische Kauf-Interessierte
Think-Tank Bodenpolitik 5: Eigentumsförderung, Quantitäten und Abschöpfung der Bodenrente
Die Maklerbranche sollte zertifiziert sein
Think-Tank Bodenpolitik 6: Eine neue ›Bodenformel‹
Maklermarkt und schwarze Kassen
Think-Tank Bodenpolitik 7: Förderung des sozialen Wohnungsbaus und Umsetzung der Boden-Formel
Maklermarkt und Geldwäscherei?
Think-Tank Bodenpolitik 8: Beispiel eines parlamentarischen Vorstosses
Begriffserklärungen
Literatur
Vom gleichen Autor
Der Autor
Dankeswort
Die wichtigsten Personen
Burch Cäcilia: Cäcilia hat eine Lehre als Kauffrau absolviert. Wegen eines Autobahnprojektes musste der Bauernhof ihrer Eltern verkauft werden, was sie sehr bedauerte. Da in ihrer Familie im Vorfeld dieses Verkaufs viel über Bauland und Landpreise diskutiert wurde, entschloss sie sich, bei einer Immobilienfirma tätig zu werden. Während rund fünf Jahren erwarb sie sich dort Erfahrung vorerst in der Administration, später als Maklerin und wagte dann den Sprung in die Selbstständigkeit.
Dubach Emil: Emil absolvierte eine Lehre als Automechaniker. Wegen eines Töff-Unfalls war er mit seiner rechten Hand leicht handicapiert. Deshalb liess er sich an einer Abendschule zum technischen Kaufmann ausbilden. Dank der Vermittlung seines Onkels fand er danach in einer Maklerfirma eine Anstellung.
Mitglieder des Think-Tanks ›Bodenformel‹:
Gerhard Franz: Ordentlicher Professor und Leiter des Instituts für Volkswirtschaft an einer Universität. Als ausgebildeter Ökonom hat er eine Dissertation über den Einfluss der Nationalbanken auf den Hypothekarmarkt und eine Habilitation über die Interaktion Nationalbank und Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde verfasst.
Holderer Isabelle: Journalistin mit volkswirtschaftlicher Ausbildung.
Kocher Lucas: Nationaler Politiker, der sich für eine sozialere Bodenverwendung einsetzt.
Meili Nina: Hausverkäuferin, ausgebildete Betriebswirtschafterin mit Promotion, hat diesen Think-Tank initialisiert und moderiert ihn.
Die ersten drei Personen dieses Think-Tanks haben sich schon seit längerem mit Wohnungs- und Bodenfragen befasst und wurden von Nina Meili aufgrund ihrer Fachkompetenz und ihrem Erfahrungsschatz ausgewählt. Ihre Rolle ist es, Ideen einzubringen, solche kritisch zu hinterfragen und eine Gewichtung des politisch Machbaren aufzuzeigen.
Nina Meili verkauft ihr Haus
»Frau Meili, ich bin ganz irritiert über den Telefonanruf eines gewissen Herr Dubach. Dieser hat mir soeben gesagt, er habe mit Ihnen einen Vertrag über den Verkauf Ihres Hauses. Was geht hier vor? Sie haben doch einen Vertrag mit mir!« Sichtlich aufgebracht und atemlos, ja gleichzeitig ängstlich, tönt es vom anderen Ende der Leitung.
»Aber selbstverständlich haben wir einen Verkaufsvertag mit Ihnen, Frau Burch.« Nina Meili ist überrascht, von Frau Burch diesen Anruf zu erhalten. Sie glaubte, nach dem Scheitern der ersten Verkaufsrunde nun auf gutem Wege zu sein. Das Gebaren von Herr Dubach erstaunt sie. Er hatte mit ihrem Mann telefoniert und die beiden hatten ein Gespräch abgemacht. Während dieses Dreiergesprächs hatte Dubach seine umfangreiche Datenbank von Kaufinteressenten angeboten, was für sie ja sehr interessant war, denn je grösser der Personenkreis, der auf das zum Verkauf anstehende Haus aufmerksam gemacht werden konnte, desto höher sind die Chancen, dass dieses verkauft werden kann.
Think-Tank Bodenpolitik 1: Hohe Zielsetzung und Charakterisierung des Immobilienmarktes
Nina Meili begrüsst, dankt den Anwesenden für Ihre Teilnahme und verweist auf Ihre Vorgespräche mit jedem einzelnen. »In diesen Vorgesprächen haben wir bilateral ausgiebig über die Zielsetzung dieses Think-Tanks gesprochen. Dabei hat sich folgendes Ziel herauskristallisiert: Wir wollen den Versuch wagen, die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse für eine weniger preistreibende Bodenpolitik auszuwerten – und dies ist das eigentliche Wagnis, denn ein Scheitern ist möglich –, und einen Vorschlag zu skizzieren, mit welchen Massnahmen der Preissprung vom landwirtschaftlich genutzten Boden zu Bauland und Preissteigerungen infolge von Um- und Aufzonungen für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus genutzt werden können.«
Ihr Blick in die Runde vermittelt Zuversicht und zeugt von ihrer inneren Überzeugung, die desolate Preis-Spirale auf dem Wohnungsmarkt mit einem neuen Konzept durchbrechen zu können. Diese Optik untermauert sie mit der Feststellung, dass die Zusammensetzung dieses Think-Tanks dafür beste Voraussetzung bietet und fährt fort: »Als Einstieg schlage ich euch vor, dass wir uns, wie in unserem gemeinsamen Zoom-Vorgespräch abgemacht, durch Franz Gerhard über den aktuellen Stand auf dem Immobilienmarkt orientieren lassen.«
Mit einem kurzen Nicken seines überrunden Kopfes mit dem braungebrannten Seglergesicht, das diametral einem nüchternen, wissenschaftsorientierten Gelehrten widerspricht, beginnt Franz sein einführendes Referat mit einem Dank an Nina für deren Initiative, dieses Thema auf unkonventionelle Art anzugehen. Anhand weniger Folien zeigt er die wesentlichen Eckdaten des gegenwärtigen Immobilienmarktes:
»Zentral ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Da seit langem in den meisten Regionen die Nachfrage das Angebot übersteigt, verzeichnen wir steigende Preise im Immobilienmarkt. Folgende fünf Faktoren haben im Weiteren einen grossen Einfluss auf die bezahlten Preise von Wohnbauland: ÖV-Fahrzeit nach Zürich, Steuer, Aussicht, Nähe zum See, Fluglärm; die Hypothekarzinsen üben ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf diesen Markt aus. Aktuell steigen diese Zinsen und sie üben demzufolge eine dämpfende Wirkung auf die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser aus.«
Franz zeigt in einem Vergleich der Bodenpreise zwischen dem Jahr 1999 und 2020 für einen Quadratmeter Boden in der Bauzone im Kanton Zürich Folgendes: Der Medianpreis betrug 1999 551 Franken und im Jahr 2020 1353 Franken; dies entspricht einer Zunahme von rund 250 Prozent. Das Medianeinkommen bei den Bundessteuern betrug im Jahr 1999 44.200 Franken und stieg bis 2020 auf 54.000 Franken. Dies entspricht einer Zunahme von rund 25 Prozent. Dieser Vergleich zeigt eklatant, wie wenig die Einkommen mit der Bodenpreisentwicklung Schritt halten konnten und wie schwierig es geworden ist für mittlere Einkommen, sich Land, und damit ein Eigenheim zu erwerben.
Einzelne Kantone versuchen dieser unheilvollen Entwicklung Einhalt zu gebieten. So hat der Kanton Waadt ein Vorkaufsrecht im Kanton eingeführt. Dies ermöglicht es den dortigen Gemeinden, neu verkauftes Land zum vereinbarten Kaufpreis zu übernehmen und dieses Genossenschaften zu überlassen oder selber zu bebauen.
Zur Veränderung des Flächenbedarfs zitiert Franz die NZZ am Sonntag: 1970 beanspruchte die Stadtzürcher Bevölkerung pro Kopf 30 Quadratmeter Wohnfläche und heute sind es über 40 – dies als Zeichen eines höheren Wohlstands. Der gestiegene Flächenbedarf pro Kopf für Wohnungen ist somit einer der vielen Nachfragetreiber. Ein weiterer ist die beschränkte Siedlungsfläche. Diese beträgt in der Schweiz lediglich 8 Prozent der Gesamtfläche. Da Einzonungen kaum mehr möglich sind, bleibt das Angebot beschränkt – bei gleichzeitig grösserer Nachfrage. Hinzu kommt die Zunahme der Bevölkerung, die ebenfalls nachfrage- und preissteigernd wirkt.
Zum Thema der Einzonungen interveniert Isabelle. »Von meiner Ratsberichterstattung weiss ich von folgender Möglichkeit, die das Planungs-und Baugesetz des Kantons Zürich bietet. Seit dem Jahr 2019 ist in diesem PBG der Artikel 49b in Kraft. Führen Zonenänderungen, Sonderbauvorschriften oder Gestaltungspläne zu erhöhten Ausnützungsmöglichkeiten, kann für ganze Zonen, gebietsweise oder für einzelne Geschosse, die ganz oder teilweise für Wohnzwecke bestimmt sind, ein Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum festgelegt werden. Obwohl der Kanton eine restriktive Haltung bezüglich Erweiterung des Siedlungsgebietes praktiziert, könnte er diese restriktive Haltung aber lockern und den Gemeinden erlauben, neue Gebiete einzuzonen, wenn sie die Einzonung mit dem Artikel PBG 49b verbinden und einen Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum schaffen.«
Isabelle ist anzusehen, dass sie stolz ist, von Ihrer Erfahrung als Journalistin zu profitieren und hier einschlägiges Wissen einbringen kann. Und sie kann nachdoppeln mit einem weiteren gesetzesspezifischen Thema. »Eine weitere Möglichkeit zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus ginge über eine Gestaltungsplanpflicht. Bei einer Zonenänderung können Gebiete der Gestaltungsplanpflicht unterstellt werden und die Details sind in Verträgen zu regeln. Die dabei mögliche erhöhte Ausnutzung müsste mit der Auflage eines Mindestanteils an preisgünstigem Wohnraum verknüpft werden.«
»Interessant, Isabelle,« kommentiert Franz, »das birgt doch auch einiges Potential in unserem Sinne,« und geht auf das Wirken der Pensionskassen ein. Diese haben zwischen 2004 und 2020 jedes Jahr Immobilien im Wert von 3 bis 4 Milliarden Franken gekauft. Dass dieser Trend anhält, zeigt eine Studie der Hochschule Luzern. Gemäss dieser Studie aus dem Jahr 2015 gaben 40 Prozent der befragten Pensionskassenmanager an, weiterhin in Direktanlagen investieren zu wollen.
Nina ergänzt Franz mit einem Hinweis auf eine aktuelle Studie: »Zum Thema Flächenbedarf pro Kopf hat Raiffeisen eine interessante – und auch brisante – Studie veröffentlicht. Gemäss dieser Untersuchung beanspruchen Rentner im Schnitt mehr als 55 Quadratmeter Wohnraum. Zum Vergleich liegt der Wohnraumbedarf bei den 25- bis 50-Jährigen zwischen 39 und 45 Quadratmetern. Rein rechnerisch könnten so in der Schweiz 170.000 Wohnungen frei werden.«