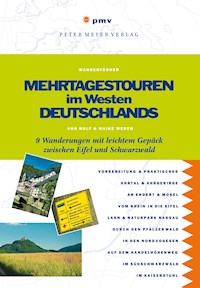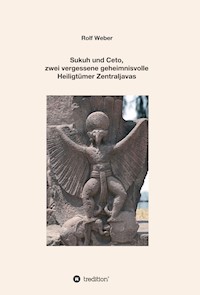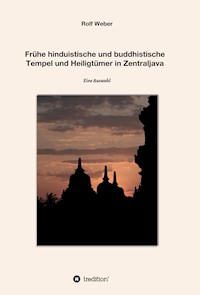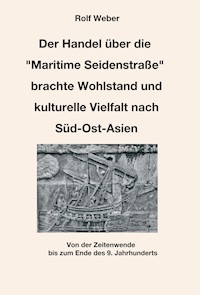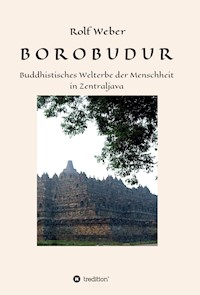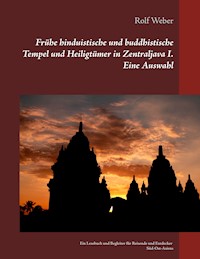Die Maritime Seidenstraße prägte durch ihren weltoffenen Handel Süd-Ost-Asiens Völker in kultureller und religiöser Vielfalt Von der Zeitenwende bis zum Ende des 9. Jahrhunderts E-Book
Rolf Weber
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Geschichtsschreibung wenig beachtet kam es nach Entdeckung der Hippalaos-Winde, jener Wechselwinde, die etwa bis zum 20. südlichen und nördlichen Breitengrad um den Äquator in den unterschiedlichen Jahreszeiten von West nach Ost oder umgekehrt wehen, zu einem stark anwachsenden Schiffsverkehr. Schon lange vor der Zeitenwende kam es zu einem umfassenden Seehandel, der jedoch meist von gegenüberliegenden Küsten betrieben wurde, weil das offene Meer noch selten befahren wurde und Schiffe sich küstennah bewegen mussten. Neben der über Land laufenden Seidenstraße gesellte sich damit bald eine vielbefahrene zu Wasser, die sogenannte Maritime Seidenstraße, die die halbjährigen Wechselwinde in Äquatornähe geschickt nutzte und Schiffe von den Häfen des Roten Meeres bis Indien kaum zwei Monate unterwegs waren. Mit besseren Schiffsbauten und einer höheren Nachfrage nach seltenen und damit kostbaren Waren wie Gewürzen, wohlriechenden Ölen und Seide explodierte der Handel. Dazu kamen, die Wanderung von Verfolgten, Abenteurern, Landsuchenden und Kaufleuten, die neben Sicherheit auch den Erfolg suchten, auch religiöse Eiferer und fromme Mönche begaben sich auf die unsichere Meere ihren Glauben weiter zu tragen. Weitaus wichtiger als die Suche nach Reichtum und Glück waren die Begegnungen der Menschen. Ihre unterschiedlichen Lebensarten, ihre Kulturen und Religionen begegneten sich, bewirkten Veränderungen, wobei die indischen Kulturen und Religionen sich hervortaten. Deswegen wurde für Süd-Ost-Asien von einer totalen Kulturüberflutung, besonders durch die indischen Kulturen gesprochen, da sich dieses sichtbar in Kunst, Bauwesen und Sakralbauten zeigte, ohne dabei die Eigenarten der lokalen Einflüsse zu berücksichtigen. Von einer "Indisierung" wurde ausgegangen, einem Überstülpen der indischen Lebensarten auf viele Völker Süd-Ost-Asiens ohne die kreative Kraft dieser Völker zu respektieren. Mit den Begegnungen erwuchs mit Hilfe der Einwanderer erste Gemeinwesen im Archipel, getragen durch eigene wirtschaftliche Erfolge und dem Handel mit ihren Produkten aus den Tropenwäldern. Mehr und mehr Gemeinwesen an günstig gelegenen Orten taten sich bereits im 2. Jahrhundert hervor. Durch Änderungen der Handelswege erwuchsen wiederum andere, erstere verschwanden. Im 6. und 7. Jahrhundert kam es bereits zu Zusammenschlüssen von Gemeinwesen, die schließlich im Reich von Srivijaya, einer Art hanseatischen Verbundes gipfelten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Früher Seehandel zwischen Europa, Afrika, Indien und China
Spurensuche: Schifffahrt und Seehandel bis zur Zeitwende
Seehandel und Schifffahrt ab der Zeitenwende vom Roten Meer bis Indien
Rom und der Indienhandel
Der Ausbau des Römischen Osthandels
Exkurs: Gab es Kontakte und Begegnungen zwischen Chinesen und Römern?
Anfänglicher Seehandel zwischen China, Indien, den ‘Großen Sunda-Inseln’ und dem ‘Goldenen Chersones‘
Schon früh befuhren Malaiische Seeleute die Meere Süd-Ost-Asiens
Von Fu-Nan bis Chen-la
Champā
1.
Exkurs: Rebellionen, Aufstände und andere kriegerische Attacken ab dem Jahr 750 n.u.Z.
2.
Exkurs: Sassaniden und Araber befuhren ab dem 3. Jahrhundert die Handelswege nach Indien und China
Länder und Inseln des “Südlichen Ozeans“
Insel Borneo - Kutai
Insel Java (Shepo) - Ho-lo-tan und P’u-huang
Tarumanegara [To-lo-mo]
Tan-Tan
P’o-li und Lo-ch‘a
Goldener Chersones und Sumatra
P’an P’an
Lang-ya-hsiu [Langkasuka]
Von Kan-t’o-li bis Malayu
Zusammenfassung und Ausblick
Bildete sich Śrīvijaya (Shih-li-fo-shi) bereits in seinen Anfängen im 6. Jahrhundert aus?
Das 6. und 7. Jahrhundert und seine politische Neugestaltung
Exkurs: Die Reisen des buddhistischen Mönches und Gelehrten I Tsing (Yi-Jing)
Exkurs: Verlandungsprozesse des südöstlichen Sumatras
Śrīvijayas Aufstieg ab dem Jahr 682
Kha-ling – Ho-ling
Annex
Seerouten im 7. / 8. Jahrhundert von Kanton nach Indien
Exkurs: Die Śrīvijaya-Inschriften auf Sumatra
Die Kedukan Bukit Inschrift (auf der Karte Nr. 2)
Die Telaga Batu (Sabokingking) Inschrift (auf der Karte Nr. 1)
Die Kota Kapur Inschrift (auf der Karte Nr. 5)
Herkommen und Auftreten der Śailendra Dynastie
Die Śailendras in Java, in Ho-ling und Kedu-Ebene
Die Canggal Inschrift von 732
Besetzungen von Teilen der nördlichen Malaiischen Halbinsel durch Chen-la und seine Befreiung durch Śrīvijaya
Die Ligor-Inschrift
Śrīvijayas Kriege gegen konkurrierender Handelsmächte
Die Śailendras und König Jayavarman II (802 – 834 n.u.Z., † 850 in Hariharalaya) von Kambodscha
Die javanischen Śailendras auf dem Zenit
Niedergang und Flucht
Zeittafel der Javanischen Śailendras
Herrscherliste
Glossar
Früher Seehandel zwischen Europa, Afrika, Indien und China
Spurensuche: Schifffahrt und Seehandel bis zur Zeitwende
Frühe Beziehungen und ein ebenso früher Handel lassen sich ab dem 3./4. Jahrtausend v.u.Z. in klassischen Hochkulturen des Nahen und Mittleren Osten zwischen Mesopotamien, den Küsten des Persischen Golfs und dem indischen Industal durch sumerisch-akkadische Texte belegen. Darin werden unter anderem Städte wie Dilmun (heutige Bahrein-Inseln) und Meluhha im Industal genannt. Der Kupferhandel zwischen den Sumerern und dem Land Oman begann vermutlich schon im 4. Jahrtausend v.u.Z. und in einer Epoche noch vor Sargon I. (2350‒2300), wie das Schriftbelege vom Schiffshandel zwischen Mesopotamien und dem Reich Magan zu berichten wissen {www.iot.unibe/ch}.
In der Zeit Sargon I. kam es ebenso zwischen Indien und Babylon zu einem ausgedehnten Fernhandel, weiterhin über das alte Dilmun, wie Siegel aus dieser Zeit der indischen Harappa-Kultur belegen, die man in ‘Ur ‘ und in anderen Orten Mesopotamiens in Bodenschichten aus dieser Zeit gefunden hat, was erst später durch Überprüfungen durch die Radiokarbonmethode (C14) bestätigt werden konnte. Dabei verdient Beachtung, dass Dilmun nur über den Seeweg zu erreichen war, was nicht heißt, der ganze Weg vom Indus bis in den Persischen Golf wäre mit dem Schiff zurückgelegt worden. Nicht zuletzt war es der Metallhandel, besonders Kupfer und Mangan, die zur Haupthandelsware wurden und über das Meer bis nach Mesopotamien verschifft wurden. Natürlich Weihrauch für die Tempel und Zeremonien und kostspielige Luxusgüter gehörten dazu und zwischen Südarabien, dem Persischen Meerbusen, den Flüssen Euphrat und Tigris und dem Industal bestand ein reger Handelsverkehr über die anliegenden Meere.
Auf dem Nil begann im 3. Jahrtausend n.u.Z der Warenverkehr sowohl auf den bekannten Landrouten über den Sinai als auch über küstennahe Schiffswege, in Sonderheit zu den südlichen Nachbarn in Afrika ins Goldland Punt. Pharao Sesostris III. (1887‒1849 v.u.Z.) forcierte den Handel Ägyptens mit Palästina, auch mit dem Zweistromland und Südeuropa (Mykene). Heutige Erkenntnisse sehen den Bernsteinhandel von den Ostseeküsten bis nach Ägypten bereits im 3. Jahrtausend aufkommen, wovon der Seeweg über Zypern und Kreta, durch die Ägäis und durch die Adria nach Norden eine wichtige Verbindung war. Zudem war Ägypten am Weihrauchhandel sehr gelegen. In großen Mengen brauchten ihre Priester das wohlriechende Baumharz für ihre Tempelzeremonien. Für seine Schifffahrt ließ Pharao Sesostris III. vermutlich einen Kanal vom rechten Arm des Nildeltas durch das Wadi Tumilat zu den Bitterwasserseen ausheben, der nördlich des Roten Meeres angrenzend gelegen ist, um von dort aus ins Rote Meer zu gelangen [https://de.wikipedia.org/wiki/Bubastis-Kanal].
Ob nun tatsächlich Schiffe vom Roten Meer zum Nil oder umgekehrt fuhren, ist unbekannt und bisher nicht belegt, jedenfalls nutzten, wie aus Nachrichten hervorgeht, spätere Pharaonen diesen Kanal. Kein geringerer als Pharao Thutmosis III. (1504‒ 1450 v.u.Z.), der als Begründer des ersten ägyptischen Weltreiches gilt, erneuerte den Kanal, ob er ihn dabei vielleicht vertiefte oder wie er ihn sonst ausbaute, ist völlig unbekannt. Er versuchte damit asiatische Handelswege näher an Ägyptens zu bringen, um es stärker einzubeziehen und für den Warenaustausch attraktiver zu machen. Seine Schiffswege führten nun durch das Rote Meer, dann über den Kanal des Wadi Tumilat in den Nil; Handelsmittelpunkt war nun nicht mehr das Zweistromland, sondern das ägyptische Nildelta.
Für das Minoische Reich begann bereits noch im dritten Jahrtausend ein durch seine wirtschaftlichen Erfolge im östlichen Mittelmeerraum einmaliger Aufstieg, der sich in seiner Kunst und Kultur niederschlug. Seine Schiffe waren im östlichen Mittelmeer an vielen Küsten unterwegs, um Waren bis in die entferntesten Orte zu bringen. Im 2. Jahrtausend wurde eine weitere Steigerung des Handels über See erreicht, nicht zuletzt mit der Einbindung der nördlich von Kreta gelegenen Insel Santorin, damals Thera genannt, die dann nach einer Vulkanexplosion unterging, vermutlich als das Atlantis Platons. Jüngste Ausgrabungen in Thera brachten Fresken mit Schiffsdarstellungen und Märkte mit ihren Häfen zutage, die von einem quirligen Handel zeugen, der dann durch den Vulkanausbruch schlagartig sein Ende fand.
Um 1200 v.u.Z waren es die sogenannten ‘Seevölker‘, die wohl durch einen plötzlich einsetzenden Klimawandel aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben wurden. Niemand kann genau sagen, woher diese Menschen kamen. Sie machten sich wegen der extrem einsetzenden Trockenheit auf die Suche nach neuem Siedlungsland und trafen auf das durch die Nilwasser immer fruchtbare Ägypten. Pharao Ramses III. (1198–1168 v.u.Z.) war zum schnellen Handeln und umfassendem militärischen Eingreifen gezwungen. Immer häufiger fielen Gruppen, ja ganze in Bewegung sich befindende Völkerschaften und seewandernden Gruppen raubend und mordend in das reiche und fruchtbare Nildelta ein. Dem galt es unbedingt Einhalt zu bieten. Ramses III. unterhielt deswegen eine kostspielige Söldnertruppe und in teils glänzenden Siegen vernichtete er viele der eingefallenen Räuber, auch siedelte er Gruppen dieser kampferprobten Leute zur Abwehr im Delta selbst an. Zusätzlich baute er die ägyptischen Flotte aus, je eine agierte im Mittelmeer und die andere im Roten Meer, letztere diente in ruhigeren Zeit ebenso zu Handelsfahrten bis ins Goldland Punt. Überhaupt war der Pharao an einem beschützten und florierenden Handel sehr gelegen, wie anders hätte er sollen die enormen Kosten seiner Militär- und Seemacht begleichen können. Viele Inschriften künden in seinem Totentempel Medinet Habu von den Taten Pharao Ramses III. Er baute sogar eine Großbarke von 67 Metern Länge als neuen Schiffstypus, wozu extra starke Zedern aus dem Libanon herbeigeschafft wurden. An den Mauern seines Totentempel Medinet Habu auf der Westbank des heutigen Luxor, ließ er seine Schreiber und Steinmetze Berichte von den vielen Schlachten und seinen Siegen gegen die ‘Seevölker‘ einmeißeln. Er wäre nicht Pharao Ramses III. gewesen, hätte er sich nicht darin selbst gerühmt wie sein Namensvorgänger Ramses II., der von der Schlacht am Kadesh mit den Hethitern im Tempel Abu Simbel berichtet und dabei so maßlos übertreibt, dass deswegen viele Nachrichten beider Inschriften leider oft als historisch wertlos angesehen werden müssen.
Nicht vergessen zu erwähnen dabei bedarf es den Handel der Phönizier, der sich über das gesamte Mittelmeer erstreckte und der nach dem Zusammenbruch des kretisch-mykenischen Handels durch die Seevölker voll aufblühte. Auch die Bibel kennt die Phönizier als bedeutende Kauf- und Seefahrer, deren Schrift schließlich von den Griechen übernommen wurde und sich aus dem Griechischen ebenfalls das lateinische Alphabet entwickelte, um nur ein Beispiel ihrer hohen Kultur zu geben. Sie siedelten an der Küste des heutigen Palästinas, ihre Städte Byblos, Tyros und Sidon galten als Handelszentren der damaligen bekannten Welt, sie gründeten etliche weitere Städte an den Küsten des Mittelmeeres, so um 814 v.u.Z. die Stadt Karthago. Ihre Handelsfahrten führten die Phönizier bis nach Britannien, erst mit der römischen Eroberung des Ostens um 133 v.u.Z. kam ihr Handel und seiner Trabantenstädten zum Erliegen.
König Salomon wusste um das Jahr eintausend Handel und Wandel für sein Land so zu gestalten, dass es kein kostenverschlingendes Heer brauchte, um ein Land zur Größe zu führen. Mit den benachbarten Sabäern soll er den Weihrauchhandel und bereits den Indienhandel mit Schiffen für seine Ziele eingesetzt haben.
König Hanno von Karthago, ein mutiger Seefahrer, unternahm noch vor dem Jahr 450 v.u.Z. eine Fahrt an die Westküste Afrikas und erreichte Sierra Leone. Wegen Mangel an Lebensmittel kehrt er um. Sein Bericht ist vollständig erhalten, ebenso bedeutend seine Karte und viele Hinweise auf geographische Fixpunkte.
Welche Bedeutung der Kanal zwischen Nil und Rotem Meer tatsächlich im frühen Welthandel erlangte, wie hoch die Anzahl der durchfahrenden Schiffe war, die Mengen an Waren, all dieses liegt völlig im Dunkeln, dazu gibt es keine Nachrichten. Erst wieder Pharao Necho (609‒594), der leider zu früh verstarb, erneuerte den Nilseitenkanal des Wadi Tumilat und soll ihn wieder schiffbar gemacht haben. Er rüstete gar eine Expedition mit phönizischen Seeleuten und Schiffen aus und umrundete den afrikanischen Kontinent, was jedoch ohne Folgen blieb, so wusste es Herodot zu berichten. Mehr als einhundertfünfzig Jahre nach Necho hält eine Inschrift des persischen Königs Dareios I. (521–486/485) die Schiffbarmachung des Wadi Tumilat Kanales fest. Ägypten war von Perserkönig Dareios I. im Jahr 518 v.u.Z. erobert worden und ab diesem Zeitpunkt eine persische Satrapie, eine Provinz. Auf einer Stele, die unweit der heutigen Stadt Suez gefunden wurden, erinnert die Inschrift an seine Kanaleröffnung: ‘Dareios hat den Kanal wieder hergestellt, Schiffe fahren von Ägypten bis nach Persien und in den Indischen Ozean‘. Der persische Herrscher ließ weitere Seewege ergründen und nutzen. Dem griechischen Seefahrer Skylax von Karyander ( frühestens 480 v.u.Z.) gab er den Auftrag das Indus Tal mit einem Schiff zu durchfahren und zu erforschen, das Tal selbst hatte Dareios I. schon vor dem Jahr 519 als XVIII. Satrapie für das Perserreich erobert. Skylax hielt diese Fahrt in seinem Periplus (Reisebericht, Reistagebuch) fest. Danach benötigte er 30 Monate vom Indus bis nach Ägypten. Jedenfalls bestand unter dem großen Perserkönig Dareios I. wieder eine Schiffsverbindung von Indien bis ins Niltal. Zwei ein halb Jahre lang war Skylax unterwegs, was die seemännische Anstrengung unterstreicht, da es vermutlich im 6. Jahrhundert v.u.Z. noch kaum Häfen für Proviant und Reparaturen an diesen Küsten gab, die aber auch oft von dort siedelnden Bewohnern leidenschaftlich verteidigt wurden. Seine Erfahrungen flossen mit für spätere Handelsreisen ein, bis schließlich zu jenem griechisch schreibenden ägyptischen Kapitän, dessen Namen aber unbekannt blieb und im ersten Jahrhundert n.u.Z. in seinem ‘Periplus des Erythräischen Meeres‘ den Seefahrern ein umfassendes Reisebuch zur Hand gab, das die Reisen von Ägypten mit dem Roten Meer bis Indien leichter machte und von dem später noch die Rede sein wird.
Zuvor war es Alexander der Große ([*356]; 336–323 v.u.Z.), der seine persische und weitere asiatische Eroberungen nur kurzzeitig antreten konnte und seinen Jugendfreund und Flottenbefehlshaber Nearchos († um 312 v.u.Z) mit der Erneuerung des Seeweges beauftragte, er sollte vom Indus bis in den Persischen Golf einen brauchbaren Seeweg finden. Das Unternehmen führte Nearchos in dem Jahr 326/325 durch, er hat das ebenfalls in seinem Seetagebuch festgehalten, das über den Geschichtsschreiber Arrian (Flavius Arrianus (95–175 n.u.Z)) teilweise erhalten ist.
Seine Nachfolger teilten sein Reich unter sich auf, die Ptolemäer sahen sich mit Ägypten und Arabien mit dem Roten Meer beerbt. Schon unter Ptolemaius II Philadelphos (282-242) kam es zu einer Reihe von Ansiedlungen an den Küsten des Roten Meeres, die als Hafenplätze und Stützpunkte ausgebaut wurden. Südlich von Arsinoe wurde Myos Hormos, Leukos Limen, Berenike bis zu Adulis angelegt, wobei einige dieser Hafenanlage Verbindungen über Karawanenstraßen zum Nil hatten (siehe Kartenskizze). Auch sollen die beiden ersten Ptolemäer den Kanal durch das Wadi Tumilat wieder schiffbar gemacht haben.
Neben dem Weihrauch aus Arabien, der meist im Innern der Halbinsel über Petra zu Küste mit Karawanen verbracht wurde, stieg von Jahr zu Jahr der Indienhandel durch das Rote Meer, nicht zuletzt durch das Erstarken der Landmacht der Parther.
Die vorzeitliche Seeschifffahrt soll in ihren Anfängen eine reine Küstenschifffahrt gewesen sein, die Schiffe wären längst nicht hochseetüchtig gewesen, so das hervorstechendste Argument gegen Seeschifffahrt und seinen Handel. Natürlich litten die Küstenfahrten unter der Seeräuberei, Häfen waren kaum angelegt und mühselig zu erreichen, die Fahrten waren stark von Witterung und Winden abhängig. Deswegen wäre man auch lieber über die Landhandelswege gezogen, das sei allemal noch sicherer gewesen, so die Ablehnung, trotz räuberischen Überfälle einzelner Völker oder mordenden Nomadenbanden und die durch Zölle erheblich verteuerten Waren.
Doch muss hier der Einwand unbedingt gelten, dass beispielsweise Schiffe der Ägypter und Kreter, der Seevölkern und Phönizier schon sehr früh das Mittelmeer auf ihren Handelsfahrten durchkreuzten. Gerade die ‘Seevölker‘ – Lybier, Illyrer und Sarden – , die aus dem westlichen Mittelmeer aufbrachen, haben dieses Meer ab dem Jahr 1200 v.u.Z. auf hochseetüchtigen Booten durchfahren, denn nur so war es möglich an die Küste Kleinasiens, Palästinas und zum Nildelta zu gelangen – unter der Wucht des Sturmes der Seevölker brach das Reich der Hethiter zusammen – und deutlicher kann es für Ägypten nicht bezeugt werden, als an den Wänden des Totentempels Medinet Habu des Pharao Ramses III.
Seehandel und Schifffahrt ab der Zeitenwende vom Roten Meer bis Indien
Rom und der Indienhandel
In den ersten beiden Jahrhunderten nach der Zeitenwende begann eine zuvor nie dagewesene Nachfrage nach allerlei Kostbarkeiten wie Seide, Elfenbein, Edelsteinen, Perlen, Spezereien und Gold; insbesondere und vermehrt kamen die Nachfragen aus der römischen Welt. Der Handel florierte zwischen Ost und West wie nie zuvor. Unter Kaiser Augustus wurden Märkte und Wirtschaftsleben der römischen Welt konsolidiert, viele Römer kamen zu Wohlstand, hohe Preise schreckten nicht vor dem Kauf von Luxuswaren. Nicht genug mit all den Freuden für Gaumen und Heim, die Frauen Roms eiferten um die schönsten und prachtvollsten chinesischen Seidenstoffe für ihre Roben und modischen Eskapaden.
Schon Plinius d.Ä. schrieb in seiner naturalis historica:
Nach niedriger Schätzung bezahlen wir Indien, den Serern [Chinesen] und den Völker der Arabischen Halbinsel alle Jahre einhundert Millionen Sesterzen für den Luxus [und die Seide] unserer Frauen…
Auch Seneca wetterte gegen die Serer und machte sie für den Geldabfluss in Millionen von Sesterzen für den Kauf von Seide verantwortlich.
Es waren in erster Linie indische und ostasiatische Kaufleute, die den Handel mit China betrieben. Chinesische Kaufleute beschränkten sich dagegen mehr auf Kontakte in ihrer Heimat, soweit es jedenfalls die Seerouten betraf. Überall dort wo Archäologen die antiken Hafenanlagen oder bei den Landrouten die Karawansereien der Handelswege untersuchten, stießen sie wie selbstverständlich auf römische Münzen. Die Schwerpunkte der Funde lagen im Süden des indischen Subkontinentes und im Nordwesten bei den Pässen zu den Hochgebirgen nahe Afghanistan. Die römischen Münzen im Süden wurden durch einen Hieb durch das Abbild des Kaisers ungültig geschlagen, sie galten nur nach dem Metallwert; im Norden schmolz man die Goldmünzen einfach ein.
[http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%römisch-indische-Beziehungen].
Der Landweg, der hier nicht näher betrachtet werden soll, blieb über Jahrtausende bestehen, wobei Unterbrechungen durch politische Kräfteverschiebungen angenommen werden müssen. Neben zahlreichen Münzfunden haben französische Archäologen nördlich von Kabul bei der ehemaligen Stadt Kāpishi zwei Zimmer ausgegraben, die als Warenlager hergerichtet waren und im Wesentlichen asiatische Luxuswaren enthielten: Chinesische Bronzespiegel zusammen mit feinsten Lackarbeiten, aber auch römische Glaswaren ebenso wie römisch-griechische Bronzestatuetten, dann wiederum indisches Elfenbein, das als Verzierungen bei Möbeln Verwendung fand, wie es römische Möbel bei Funden in Pompeii zeigen; überhaupt war die Nachfrage der höheren römischen Klasse nach wertvollen Elfenbeinschnitzereien groß.
Ein Periplus ist ein Reisebuch, mehr ein praktisches Handbuch für Seefahrt und Seehandel. Das ‘Peryplus des Erytrhräischen Meeres‘, niedergeschrieben in Griechisch, wurde von einem unbekannten, vielleicht ägyptischen Kapitän oder Kauffahrer verfasst. Es diente den Handelsschiffern etwa ab der Mitte des 1. Jahrhundert nach der Zeitenwende als eine Art Logbuch und Wegweiser. Es bestimmte nicht nur den Kurs der Steuerleute, auch Hindernisse, Sandbänke und Felsformationen wurden beschrieben und die Winde benannt, ebenso die unbedingt einzuhaltenden Abfahrtszeiten aus den Häfen, um den günstigen Passat zu nutzen.
Den Kaufleuten wurden wichtige Detailkenntnisse über Waren und Preise übermittelt. Dank der Erkenntnis über den ‘Hippalaos-Wind‘, die Wechselwinde beim Monsun und den Passaten, wurden die Segelfahrten immer sicherer. Vom südlichen Ausgang des Roten Meeres oder des Persisches Golfes bis nach Indiens westlicher Malabar-Küste gelangten die Schiffe durch das genannte Erythräische Meer etwa zum indischen Hafen Muziris dem heutigen ‘Cranganore‘.
Dieser unbekannte Kapitän des Periplus hat in seinem Reisebuch alles sorgfältig ausgewählt und beschrieben, schilderte Städte und Häfen, die dem Seefahrer nutzten, deswegen fehlen meist Orte oder Residenzen im Inneren eines Landes, weil sie keine Bedeutung für die Seefahrt hatten. Über historische Ereignisse berichtet er nur, wenn sie etwas mit Handel und Seefahrt zu tun hatten, alles andere betrachtet er als nebensächlich und verzichtet auf eine Wiedergabe. So berichtet er zwar von Alexander dem Großen und seinen Indienfeldzügen. Abgesehen davon, dass er den Bericht an einer falschen Stelle vornimmt (§ 47 seines Berichtes) und das Geschehen nicht historisch beschreibt, wollte er nur den Gebrauch von griechischen Münzen (Drachmen) auf dem Markt der Stadt Barygaza begründen. Deswegen können und dürfen seine Aufzeichnungen nicht als Geschichtsbuch verstanden werden, für ihn sind allein die Handelsstationen (Emporien) wichtig, damit sich die Seefahrer auf ihrer Fahrt mit Waren, Wasser und Proviant versorgen können.
[Das Periplus ist unter: https://archive.org/details/derperiplusdeser00diet nachzulesen und in diversen Abschriften erhalten geblieben].
Besonders Monsun- und Passatwinde sind teils minutiös festgehalten und machten es dem Skipper zur Verpflichtung, wenn er seine Fahrt in diese oder jene Richtung angehen wollte, dann ziemlich genau an einem bestimmten Tag auszulaufen und den Hafen zu verlassen. Wer im Frühjahr von Afrika oder dem Roten Meer nach Indien und weiter bis zu den Küsten der Malaiischen Halbinsel segeln wollte, der segelte im Monat April los, dann nutzte er den Monsun, der von West nach Ost unter dem 20 Breitengrad blies. In den Sommermonaten konnten die Häfen wegen des sehr starken Windes nicht in Indien angelaufen werden und die Rückfahrt wurde erst nach neun Monaten möglich. Segelten die Kapitäne über Indien weiter nach Osten, taten sie das etwa im September.
Außer den Monsunwinden gab es noch eine Reihe lokaler Wechselwinde, die den Kapitänen bekannt waren. Umgekehrt blies in den Wintermonaten ab November auf der nördlichen Halbkugel ein Wind von den chinesischen Küsten nach Südwesten, die Fahrten nun in entgegengesetzter Richtung ermöglichten.
Den Anfang der Seereise des Periplus begann in Myos Hormos, dem ‘Muschelhafen‘ [auch ‘Mäusehafen‘] am nördlichsten Punkt des Roten Meeres. Sie führte dann über Berenice weiter zu dem Hafen Ptolomais der Jagden bis nach Adulis am südlichen Ausgang des Roten Meeres. Oftmals, so eine Vermutung, fuhren die Schiffe wegen der Piratenplage im Roten Meer im Pulk. In Schätzungen geht man von bis zu 150 Schiffen aus, was vermutlich übertrieben ist. Erst mit den römischen Stützpunkten und den römischen amicitia-Verträgen mit verschiedenen dort ansässigen Völkern, konnten die Räubereien eingedämmt werden. Die Fahrt ging dann aus dem Roten Meer weiter über die Insel Dioscoridus (heute: Socotra), wenn nicht Hafen- und Küstenstädte der arabischen Südküste angelaufen wurden und weiter durch das genannte Erythräische Meer, das sich südlich der Arabischen Halbinsel erstreckt. Plinius d.Ä. bemerkte hierzu:
…Schifffahrt beginnt im hohen Sommer vor dem Frühaufgang des Hundssterns oder unmittelbar darauf, und in ungefähr 30 Tagen kommt man nach Okelis [?] in Arabien oder nach Kane in einer Weihrauch hervorbringenden Gegend ... und von da fährt man mit dem Hippalaos-Wind in 40 Tagen bis zum ersten Hafen in Indien Muziris genannt….
Der Periplus schildert in § 57 die Reise vom Ausgang des Roten Meeres bis zur Koromandelküste mit großer Genauigkeit, wenn es da heißt:
Diese gesamte oben geschilderte Küstenfahrt von CANE [Hafenstadt an der Südküste Arabiens; siehe Karte] und ARABIA EUDAIMON [Aden] legten die Früheren [bevor sie Kenntnis von den Passatwinden hatten] auf kleineren Fahrzeugen den Busen durchfahrend [d.h. an den Küsten hinfahrend, von Bucht zu Bucht steuernd]. Hippalos aber, ein Steuermann, der die Lage der Handelsplätze und die Beschaffenheit des Meeres kennen gelernt hatte, fand die Fahrt durch die hohe See, nach den auch der in jenen Gegenden vom Ocean aus, zu der nämlichen Zeit mit den Passatwinden bei uns, wehende Südwestwind Hippalos genannt zu sein scheint. Und von da an bis jetzt fahren die Einen direkt von CANE, die Andren von AROMATA [ein Vorgebirge und Ort auf der arabischen Halbinsel] und wer nach LIMYRIKE [Südspitze Indien] will, laviert [im Zickzackkurs gegen den Wind kreuzend; sich mit Geschick durch etwas hindurchbringen] eine größere Strecke, wer aber nach BARYGAT [BARYGAZA, siehe Karte] und Skythien segelt, der hält sich nicht länger als drei Tage am Ufer und umsegelt, indem er für das weitere einen günstigen Wind hat, weit in der hohen See bei dem vorher erwähnten Busen [Meeresbucht] vorbei.
Eine Schilderung des Seeweges von BARYGAZA nach Kap Komarin ist zuvor ab dem §49 des Periplus dargestellt, …eingeführt wird in den Handelsplatz [BARYGAZA] Wein vorherrschend italienischer, laodikenischer und arabischer, dann Kupfer, Zinn, Blei, Korallen, Chrysolithe [grüner Heilstein], einfache und bessere Gewänder, bunte ellenlange Gürtel, Storax [wohlriechender, aromatischer Balsam aus dem Storaxbaum], Melitolon, rohes Glas, Sandarake [Arsen?], Arsenik, Spiessglanz [Antimon, wird bei der Metallherstellung gebraucht], goldene und silberne Denare, die einen gewinnreichen Umsatz haben,… .
Abb. 1. Handelsschiff (Segelschiff) aus dem 8. Jahrhundert ‘auf hoher See‘, dargestellt auf einem Relief der ersten Galerie des Borobodur in Java. Deutlich zu erkennen sind die durch den Wind aufgeblähten Segeln mit einem Vorsegel zur schnelleren Fahrt, einem Seemann im Ausguck und im vorderen Schiffsteil die Mannschaften, während Kaufleute und andere Passagiere sich auf dem Heck des Schiffes unterhalten, Spaß haben oder ruhen. Die Ausleger zur Stabilisierung sind ebenfalls unter dem Boot dargestellt, so wie diese heute noch bei Fischerbooten oder anderen kleineren Schiffen in Südostasien und Ozeanien gebräuchlich sind. Auch das Heckruder mit einem darauf sitzenden und steuernden Seemann, ist zu erkennen. Vor der Bugwelle springende Fische, darunter Meeresschildkröten[?], links, Wolken am Firmament. Vgl.: John Miksic: BOROBUDUR – Golden Tales of the Buddhas, S. 68/69. Auf der linken Hälfte des Reliefs ist ein Teil eines Sumatra-Batak-Haus aus der Gegend des Toba-Sees mit dicken Steinstelzen und unter dem Haus arbeitendes Gesinde zu finden. Das abgebildete Haus hat keine hochgezogenen Giebelspitzen, wie das von den Minangkabau Häusern bekannt ist. Miksic beschreibt das Haus als ein Minangkabau-Haus. Das hier dargestellte Haus hat jedoch keine Spitzgiebel! Bevor sie aus dem pazifischen Nordraum in den Westen Sumatras einwanderten und später dem islamischen Glauben beitraten, verehrten die malaiischen Minangkabau in Vorzeiten den Wasserbüffel als ein Fruchtbarkeitssymbol. Sie huldigten ihrem “Wasserbüffel durch Hochziehen der Hausgiebel analog den Spitzen der Hörner des Kerbau [Büffel]“. Mit dieser Bauweise drücken sie bis heute ihre Verehrung aus. Das Haus der Toba-Batak-Leute des Reliefs zeigt keine spitzen Giebel und ist kein Minangkabau-Haus, vgl. Abb.2.
Die Tafel zeigt die Ankunft von Flüchtlingen, vermutlich von der indischen Küste, in Sumatra. Freundlich und würdevoll werden sie von den Einheimischen willkommen geheißen, Speisen werden ihnen von den mitfühlenden Menschen gereicht und so ihr Leben gerettet. Kniend bedanken sie sich! Foto: Angkormann/R. Weber 2014.
In einem der nächsten Abschnitte wird die Landschaft und die Orte an der Malabarküste beschrieben, so heißt es in § 53,
Abb. 2. Altes Batak-Haus in der Toba-See-Region von Nordsumatra. Einige dieser Haustypen, wie es ähnlich auf der vorigen Tafel der Abb. 1 zu sehen ist, findet man heute noch bewohnt in einigen Dörfern der Region. Die Stützpfeiler werden heute nicht mehr ganz aus Stein geschlagen, sondern man setzt unter die Holzpfeiler einen Stein oder gießt diesen aus Beton zum Schutz gegen Termitenfraß. Früher war unter dem Haus der Raum für Kleinvieh und Gesinde, heute ist es der Abstellraum. Foto: Ingo, Leipzig – Ubud/Bali, 2015.
…in welcher Gegend sich Seeräuber aufhalten [siehe Karte Peuteringiana], und danach die Insel LEYKE. Darauf folgt NAURA und TYNDIS, die ersten Handelsplätze von LIMYRIKE und nach diesen MUZIRIS und NELKYNDA, die jetzt die erste Stelle einnehmen.
Der Bericht des Periplus setzt sich mit § 56 fort:
Nach diesen Handelsplätzen segeln große Schiffe wegen des Umfanges und der Menge Pfeffers und Malabathrons [Cinnamonum Tamala, Blätter eines Baumes, sie wurden in Küche und im Wein verwendet]. Eingeführt werden daselbst vorzüglich sehr viele goldene Gefäße, Chrysolithe, rohes Glas, Kupfer, Zinn, Blei wenig Wein… zum Verkauf kommen Pfeffer, der allein in einer einzigen Gegend bei diesen Handelsplätzen dem sogenannten Kottonarischen [vermutlich ist es die Malabarküste, Provinz Kadutinada, das Gebiet wo der indische Pfeffer wächst] in Massen erzeugt wird. Ferner ein ziemliches Quantum ausgezeichneter Perlen, Elfenbein, serische [chinesische] Baumwolle, gangetische Narde [?], Malabathron aus den inneren Teilen des Landes….
Der unbekannte griechisch schreibende Kapitän oder Steuermann, lässt seinen Periplus etwa an der indischen Südspitze enden, beschreibt aber die Fahrt um Kap Komarin zu den Ostküstenhäfen und von dort bis zum Ganges, doch wird er wohl diesen letzten Abschnitt nicht selbst bereist haben und kannte ihn nur vom Hörensagen.
Archäologische Berichte sprechen von einer Niederlassung und Fremdensiedlung griechisch-römischer Händler in der Nähe Muziris. Sehr viele Weinamphoren, die bei jüngeren Grabungen gefunden wurden, deuten in diese Richtung, …den sensationellen Fund von Fragmenten importierter antiker Weinamphoren aus der Zeit zwischen dem späten 1. Jahrhundert v. Chr. und dem frühen 1. Jahrhundert n. Chr. beim Dorf Pattanam weiter östlich im Landesinnere…. Diese Bruchstücke sind die allerersten archäologischen Belege für die Lage des römischen Muziris an der Südwestküste Indiens. Von einer gründlichen Ausgrabung der Fundstelle in Pattanam - auch bekannt unter den Namen Neeleswaram und Ithilparambu -, die in einer Schicht von 2 m und ein Gebiet von 1,5 km2 umfasst, erhoffen sich die Wissenschaftler nun weitere erhellende Zeugnisse dieser römischen Siedlung.
[http://www.ioz.unibe.ch/].
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass römische Händler den Templum Augusti gebaut haben, der in der vorstehend abgebildeten Peutingeriana (tabula Peutingeriana) eingezeichnet ist, nahe bei einer römischen Handelsniederlassung zwischen Tyndis (Tandis) und Muziris, es…
…verfügte Muziris nämlich nicht nur über einen Hafen, über den die Amphoren ins Land gelangten, sondern auch über einen Tempel für den Kaiserkult. [http://www.ioz.unibe.ch/content/zeit_des_periplus/muziris/index_ger.ht…].
Erhalten gebliebene Tamil-Texte berichten ebenso vom nahe dabei liegenden Muziris und seinem Handel,…als die Stadt, wo die guten Schiffe, Meisterwerke aus dem Yavana-Land [Länder des Westens], die den weißen Schaum des Periyarflusses in Kerala durchschneiden, mit Gold ankommen und mit Pfeffer fortfahren… [http://www.academia.edu/705643/Muziris_in_Karnataka].
Ausschnitt aus der Peutingeriana aus Segment XII(„<a href=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TabulaPeutingeriana.jpg#mediaviewer/File:TabulaPeutingeriana.jpg“>TabulaPeutingerianageriana</a>“ von Conradi Millieri - <a class="external text" href=„http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe00.html" rel="nofollow">Ulrich Harsch Bibliotheca Augustana</a>. Lizenziert unter Public domain über <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/">Wikimedia Commons</a>.). [Darstellung etwas verzerrt].
Andere sehen bereits zu diesem Zeitpunkt an der ostindischen Küste Seefahrende aus Sumatra und Java, wer anders hätte können Pfeffer und Spezereien von den Gewürzinseln der Molukken nach Indien bringen, wo römische Händler über diese wagemutigen Seeleute, den kun-lun, nur staunen konnten, ihre Auslegerboote kamen vermutlich von Küsten und Häfen der indonesischen Inseln [siehe Abbildung des Steinreliefs vom Borobudur]. Miksic, John hielt dazu fest: Boroburdur, Golden tales oft the Buddhas, S. →) wo es heißt:
Graeco-Roman traders stationed in south India around A.D. 100 were impressed by large non-Indian ships bringing cargoes of pepper and spices from east. No doubt thes were Indonesians sailing from ports in Java and Sumatra.
So wundert es auch nicht, wenn über Muziris große Mengen an chinesische Seide ausgeführt wurden.
Erst jüngst wurden weitere Hinweise, von denen bereits Strabon und Plinius berichteten, durch Funde bestätigt. Demnach waren die Küstenstädte Ostafrikas in den Gewürzhandel von Indien und Südostasien über das Rote Meer ins Mittelmeer lange Zeit einbezogen und spielten eine bedeutende Rolle. Dies konnte durch entsprechende archäologische Funde von Handelswaren in Höhlen auf der Insel Sansibar untermauert werden, die durch den Fachbereich ‘Archäologie‘ der Universität Bern/ Schweiz durchgeführt wurden.
Der Ausbau des Römischen Osthandels
Nach der Seeschlacht bei Actium zu Anfang des Monats September des Jahres 31 v.u.Z. und damit dem Ende des Ptolomäischen Krieges, kam es zu einer Neuordnung des östlichen Mittelmeerraumes. Nach mehr als 3000 Jahren hörte Ägypten auf als selbständiges Staatsgebilde durch den Freitod der letzten Herrscherin Kleopatra zu bestehen; Ägypten wurde römische Provinz. Weitere Länder der nahöstlichen Hemisphäre wurden ebenfalls zu Provinzen des Römischen Kaiserreiches, andere durch sogenannte Freundschaftsverträge an Rom gebunden.
Durch die Aufnahme Ägyptens in das Römische Imperium verlängerten sich die römischen Außengrenzen im Osten um etliche tausend Kilometer, denn allein das Ufer des Roten Meeres zwang zu weitreichenden Änderungen der römischen Strategien. Eine völlig neue Situation war geschaffen, die es auch erst einmal durch militärische Übernahmen zu sichern galt. Noch unter Kaiser Augustus wurden erste punktuelle Erfolge erzielt, aber wegen der enormen Entfernungen konnte so schnell keine durchgreifende Beruhigung etwa der Seeräuberei erreicht werden, um den Fernhandel zur See umfänglich zu schützen.
Archäologische Grabungen brachten jüngst eine ganze Reihe von Artefakten zutage, die beweisen, dass bereits unter den Ptolomäern des 2. und 1. Jahrhunderts v.u.Z. ein mehr oder weniger reger Handel vornehmlich mit den südlichen Küsten Arabiens wegen des Weihrauches und ebenso um und vom ostafrikanische Horn nach Süden des afrikanischen Kontinentes bestand. Über die Warenmengen und deren Ursprung können nur hypothetische Aussagen gemacht werden. Strabon von Amaseia hielt dazu fest, dass es früher, womit er die ptolomäische Herrschaftszeit meinte, 20 Schiffe waren, die jährlich vom Roten Meer aus in Richtung Indien fuhren, jetzt aber unter Augustus wären es deren schon 120 Schiffe jährlich und Strabon schreibt dazu in II.5.12.:
Als Aelius Gallus Präfekt in Ägypten war, begleitete ich ihn den Nil aufwärts bis nach Syene an die äthiopische Grenze; ich hörte dort, dass mehr als 120 Schiffe vom Hafen Myos Hormos aus jährlich nach Indien fuhren. Unter den ptolemäischen Königen wagten es zuvor überhaupt nur wenige dorthin zu segeln, um indische Waren einzuführen. (Vgl. hierzu: Mommsen, Römische Geschichte, 8. Buch; 12 Kap.].
Im ersten bis weit ins zweite Jahrhundert der Kaiserzeit kann von einem verwaltungsmäßigen und militärischen Ausbau und Sicherung des gesamten Raumes des Roten Meeres bis zur Ausfahrt Bab el Mandeb ausgegangen werden. Allein der kräftig gestiegene Handel und die Kauffahrer selbst waren zu beschützen, waren doch mit jedem ankommenden Schiff 25% an Einfuhrzoll fällig. Beim Weitertransport an die Endabnehmer mussten erneut 25% für diese Warenanteile entrichtet werden, was eine explosionsartige Steigerung der Einnahmen für Rom darstellte. Es wird behauptet, dass die Zolleinnahmen in dieser Zeit so enorm anstiegen, dass man die gesamte römische Truppe davon hätte bezahlen können. Die römische Zoll- und Steuereinnahmestelle für den Ost- oder Indienhandel befand sich im Hafen von Leuke Kome [dem weißen Hafen] des nördlichen Roten Meeres auf der Arabischen Halbinsel.
Wie als Beweis dafür wurden jüngst auf dem Farasan-Archipel im südlichen Roten Meer zur Arabischen Halbinsel gelegen römische Inschriften gefunden, die von einer größeren Militärstation berichten, die hier zeitlich gegen Ende des ersten Jahrhunderts n.u.Z. aufgebaut oder ausgebaut worden war. Immerhin war dieser Außenposten mehrere tausend Kilometer von Rom entfernt und die Marinetruppen sollten, so ist jedenfalls zu vermuten, hier den Warenverkehr auf dem Roten Meer schützen, denn eine andere Aufgabe wäre für sie schwer vorstellbar.
Schon deswegen ist es realistisch in dem Militärlager eine schnelle Eingreiftruppe zu sehen, die Seeräuber bis in ihre Heimatgebiete verfolgen konnte, sie dort auslöschte, die Bewohner als Gefangene mitnahm, um damit nach bekannter römischer Vorgehensweise eine Wiederholung unmöglich zu machen. Das machte eine geeignete Bewaffnung dieser Truppe notwendig. Die lange Zeit von der Geschichtsschreibung vertretene Meinung, dass im Gebiet des Roten Meeres keine Kriegsschiffe vorzufinden gewesen wären, kann so nicht mehr stehen bleiben. Was hätte ein Militärpräfekt auf dem einsamen Außenposten denn sonst mit seinen Soldaten schützen sollen als die Handelsschiffe? Ohne Ausrüstung mit kriegstüchtigen Booten wäre das Ganze eine Farce gewesen. Es ist nicht geklärt, ob Handelsschiffe den Farasan-Stützpunkt anliefen, um Bewaffnete für eine bestimmte Strecke an Bord zu nehmen, möglicherweise je nach Intensität der Seeräuberei.
Wenn sich römische Militärstrategie wirkungsvoll zeigen sollte, dann tat sie das hier mit jener Perfektion, die von anderen militärischen Aktivitäten bekannt ist, wie etwa beim Limes in Germanien. Bei der Übernahme und Bekämpfung feindlicher Völker in diesen von Rom ferngelegenen Gebieten, die insbesondere in mit Seeräuberei ihr Dasein fristeten, war eine schlagkräftige Seemacht notwendig.
Nach dem Desaster gegen die Sabäer auf der arabischen Halbinsel im Jahr 25/24 v.u.Z. durch die Niederlage des Aelius Gallus und dem vollkommenen Verlust der Truppen, wurde der Militärverwaltung schnell klar, dass eine schnelle und umfassende Lösung nicht möglich war. Deshalb wurde bedächtig aber dafür mit Nachdruck Militärposten nach Militärposten aufgebaut, begleitet von einem entsprechenden Aufbau der Marine, die es mit schnellen Schiffen aufzurüsten galt. Es gab eine ganze Reihe von Hafenstädten, die erst einmal als Stützpunkt sowohl für die Marine als auch die Landtruppen dienen konnten, wie es beispielsweise von der Hafenstadt Berenike heißt. Schon Mommsen hat in seiner umfassenden ‘Römischen Geschichte‘ ausdrücklich auf das Seeräuberunwesen hingewiesen und vermerkt, dass bereits unter Augustus in verschiedenen Teilen des römischen Reiches mit dessen Bekämpfung begonnen wurde, womit er ausdrücklich das Rote Meer zu beiden Ufern einschloss, um den so wichtigen Handel zu schützen und die Steuereinnahmen zu gewährleisten.
Augustus selbst brach im Herbst des Jahres 22 v.u.Z. zu einer mehrjährigen Reise in die Ostgebiete auf, was die Bedeutung des östlichen Mittelmeerraumes für die Stabilität des Reiches hervorhebt, schon um die neu eingerichteten Provinzen stärker an sich zu binden. Auch das Desaster im Teutoburger Wald des Jahres 9 n.u.Z. mag die Weitsicht römischer Politik und des Kaisers stark beeinflusst haben und eine Veränderung des politischen Schwerpunktes nach dem Osten des Reiches gebracht haben.
Wenn jedoch die Meinung vertreten wird, es wären wirtschaftliche Gründe gewesen, die verstärkt die veränderte Politik erbracht hätte, muss sich enttäuscht sehen. Rom maß einer solchen Überlegung kaum eine Bedeutung bei und besonders bei den späteren Kriegen der Kaiser Trajan und Hadrian gegen die Parther blieb die Bedeutung des Handels ohne Berücksichtigung. Diese Überlegungen fanden in der römischen Politik kaum Beachtung.
Augustus musste schon deswegen aus innenpolitischen Überlegungen, die ihm noch mehr Anerkennung in Rom verschaffen sollten, einen Erfolg gegenüber den Parthern vorzeigen, wozu er nicht nur selbst 4 Legionen unmittelbar befehligte, sondern 6 weitere in Kleinasien unter seinem Stiefsohn Tiberius stationierte. Er wusste zu genau, dass eine militärische Auseinandersetzung mit dem mächtigen Gegner im Osten nicht von vornherein zu gewinnen war, baute mit der Truppenzahl mehr auf eine Drohgebärde, die Wirkung zeigen sollte. Jedenfalls gab der Partherkönig Phraates IV. schnellstens erbeutete Legionsadler zurück, auch Kriegsgefangene, was Augustus später überschwänglich als umfassenden Erfolg für das Volk feiern ließ. Er ging noch einen Schritt weiter und posaunte in Rom: „Die Parther habe ich gezwungen die Feldzeichen zurückzugeben und sie flehten um unsere Freundschaft!“ Damit war für Rom klar, die Parther erkannten die römische Vorherrschaft an. Für Augustus stellte sich das Problem Parther durch diesen Ausgleich somit nicht mehr, was jedoch seinen Nachfolgern nicht erspart blieb.
Am Rande seiner Empfänge im Osten während des Winters der Jahre 20/19 empfing Augustus auch eine indische Delegation, die allein Handelsfragen klären wollte. Leider reisten die Inder mit leeren Händen wieder zurück, Rom oder Augustus waren nicht gewillt ihnen bestimmte Rechte und Schutz einzuräumen, was als absoluter Misserfolg zu werten ist. Die indischen Vertreter wollten natürlich die Seewege durch Rom gesichert sehen, um große Warenmengen um Parthien herum, direkt ins Römische Reich zu transportieren. Dadurch wären die Warenmengen für Parthien erheblich gesenkt worden, die Einnahmen für Rom fast ins Unermessliche gestiegen.
Nachdem dann fast ein Jahrhundert später Kaiser Trajan mit viel kluger Voraussicht den Osten weiter befriedet hatte, das für Rom wichtige Reich der Nabatäer im Jahr 106 n.u.Z an Rom binden konnte und Mesopotamien gerade mal wieder im Dauerkrieg den Parthern entrissen hatte, um es bei den beiden Beispielen zu belassen, gelang es ihm und seinem Nachfolger Hadrian die römische Kriegsflotte für das Rote Meer und Arabiens Küsten bestens aufzustellen.
Rom hatte zwischenzeitlich schon die Wichtigkeit eines geordneten und geschützten Handels schätzen gelernt, auch wenn weiterhin ein restriktiver Umgang mit den Beteiligten politisch als opportun galt und wenig Entgegenkommen gegenüber handeltreibenden privaten oder staatlichen Nichtrömern angesagt war. Es scheint, wenn es um Annäherung und Aufwertung des Handels ging, erkannte Rom nach wie vor nicht die weitreichende Bedeutung eines florierenden Wirtschaftens und daraus sprudelnder dringend benötigter Geldeinnahmen.
Dabei stellte sich für Rom ebenfalls immer wieder die Frage einer Übereinkunft mit dem Reich der Parther, dessen Existenz Rom daran hinderte, weiter nach Osten über die Landwege vorzurücken, was allerdings schon wegen der Entfernungen ein großes logistisches Problem überhaupt dargestellt hätte. Es war Rom längst bekannt, dass die Parther den Fernhandel zu Land über die Seidenstraße kontrollierten und nicht unerhebliche Zölle erhoben und ihre außerordentliche Kraft und Macht diesen Einnahmen verdankte. Bereits König Mithridates II. (124 - 87 v.u.Z.) hatte im Jahr 115 v.u.Z. mit dem chinesischen Kaiser Han Wu-ti (141–87 v.u.Z.) entsprechende Verträge geschlossen, um sich diese lukrativen Einnahmen zu sichern. Vom Persischen Golf aus, über den Euphrat lief der Handel über Palmyra, von wo die Küste des Ost-Mittelmeeres schnell zu erreichen war.
Schon zur Mitte des 3. Jahrhunderts v.u.Z. hatte die Parther in wenigen Jahren das östlich des Euphrat gelegene Reich der Seleukiden erobert, ließen aber offenbar geschickt die alten Handelsbeziehungen bestehen, ohne dass hierüber genauere Kenntnis besteht. Auffallend war die Beibehaltung des strengen Finanzsystems dessen geldlicher Zugewinn allein der Krone zufloss. Jedenfalls zeigten die Parther sehr viel Interesse an einem reibungslosen Handel, die bestehenden wichtigen Zentren der Nabatäer und Palmyrener ließen sie deshalb unangetastet. Chinesische Quellen berichten von den ‘Anxi‘, so der Name der Parther in den einschlägigen chinesischen Quellen über den Handel des Partherreiches, wo es heißt:
Der Bericht beschreibt weiter, dass die Parther Silbermünzen mit dem Kopf ihres Königs prägten. Erwähnt werden auch in dem Bericht Schiffe, wie auch durch andere Belege deutlich wird, dass es schon einen Schiffshandel − vermutlich seit Nearchos eine Küstenschifffahrt – gab und von Barygaza, am nördlichen Abschnitt der westlichen Indienküste gelegen, nach dem Delta von Euphrat und Tigris und dem Roten Meer unterwegs waren.
Unter dem bereits erwähnten chinesische Kaiser Han Wu Ti (141–87 v.u.Z.), der sich besonders gegen die Steppenvölker wie die Hunnen, den Xiongnu, hervortaten, drang dessen General Zhang Qian im Jahr 138 v.u.Z. nach Westen vor, vermutlich suchte er mit dieser militärischen Expedition willige Bündnispartner gegen die Xiongnu gewinnen. Nach dem Shiji, einer der frühesten chinesischen Aufzeichnungen, wurde Zhang Qian jedoch 10 Jahre von den Xiongnu in Gefangenschaft gehalten, bevor er seine Expedition weiter nach Westen fortsetzten konnte, ohne dabei jedoch in das Gebiet der Parther vorzudringen. Kaiser Wu-Ti wünschte sich mit den Parthern enge Beziehungen wegen eines reibungslosen Warenverkehrs über die Landstraßen, Alsop nicht wegen des Seehandels, der zu dieser Zeit erst sporadisch stattfand. Durch Militärbündnisse mit anderen Völkern hoffte er, die unberechenbaren Xiongnu