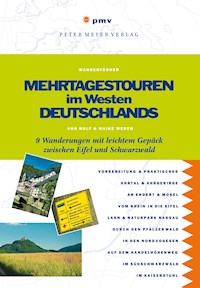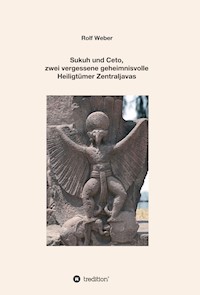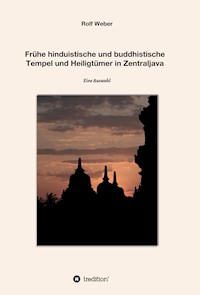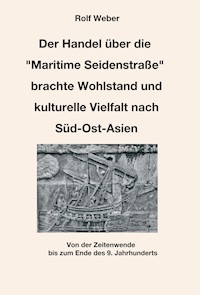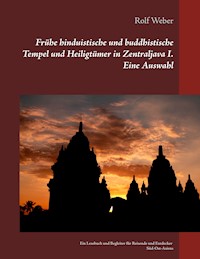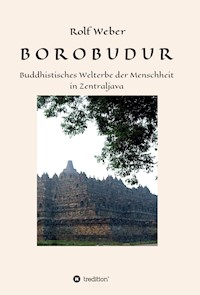
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Borobudur wurde um das Jahr 800 n.u.Z. in Zentraljava von der buddhistischen Śailendra-Dynastie erbaut. Nur für eine kurze Zeitspann war er das zentrale Heiligtum des Buddhismus, soweit dieser in Java blühte, war Eckpunkt und Abschluss der großen Pilgerwege, die vom Merapie-Vulkan über die Tempel Mendut und und Pawon zum Borobudur führten. Die Bauzeit dürfte etwa 60 Jahre umfasst haben, ohne dass hierzu Einzelheiten bekannt wurden und dieses nur aus archäologischen Hinweisen begründet werden kann. Der Untergrund des Heiligtums besteht dabei aus einem natürlichen Unterbau aus Erdmasse, die terrassenförmig gestaltet wurde. Das bringt große Instabilität bei den zahlreichen Erdbeben, die durch wasserreiche Tropenregen noch erhöht wird. Sechs Hauptterrassen verblieben nach umfangreichen Bautätigkeiten, obwohl es anfangs anders geplant war. Die letzte Terrasse wurde rundtreppenartig gesetzt und mit kleineren Stupas kreisförmig besetzt, die den am Höchsten in der Mitte stehenden großen Stupa umschließen. Zum Ende des letzten Jahrhunderts entschloss sich Indonesien sein einzigartiges Kulturdenkmal zu erneuern, um es vor dem Zusammenbruch und Ruin zu retten. Auch wenn es viele Vorschläge und auch Gegenstimmen zur Renovierung gab, gelang es unter Berücksichtigung der kaum zu beziffernden Kosten einen Steinwall um das Monument zu setzen, der bis heute kritisch betrachtet und kommentiert wird, um eine ausreichende Stabilität zu erreichen. Dadurch wurde vorerst ein Abgleiten des Untergrundes verhindert und der Menschheit ein Werk höchster Kultur erhalten. Auch wenn den Besuchern oft nur wenig Zeit bleibt, um sich mit jedem Steinbild vertiefend auseinandersetzen zu können, wird ein Besuch Einblicke in Kultur und Religion der asiatischen Welt eröffnen. Nicht die modernen Megastädte zeigen Seele und Wärme des asiatischen Menschen, sie sind weltweit austauschbar, ihr Seelen sind ihre kunstvollen Kleinode, um ihr wahres Innere widerzuspiegeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Rolf Weber
BOROBUDUR
Buddhistisches Welterbe der Menschheit in Zentraljava
Ein Begleiter für Reisende und Entdecker der Tempelanlagen in Südostasien
© 2020 Rolf Weber
Herausgeber: Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359
Hamburg
© Autor: Rolf Weber
Umschlaggestaltung, Illustration: Rolf Weber
ISBN Paperback: 978-3-347-02313-0
ISBN Hardcover: 978-3-347-02314-7
ISBN e-Book: 978-3-347-02315-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Borobudur
Die Erbauung des Borobudur
Auswahl der Örtlichkeit - Landschaft und Architektur
Prozessionswege und Galerien für Pilger und Besucher
Das Mahakarmavibhangga
Menschliches Tun und Handeln - eine Welt der Nächstenliebe,der täglichen Arbeit, seiner Begierden, seiner Laster und seiner Verbrechen
Die Basisgalerie, heute zugemauert
Jataka, Geschichten der Geburt des Buddha, “Ein Blütenkranz der Geburtsgeschichten“
Eine Auswahl
Bilder und Tafeln aus unbekannten Erzählungen
Die Avadanas - Heroische, edle Taten sowie Heldensagen
Die Nymphe Manohara und der Prinz Sudhana
Prinz Mandhatar, oder: Hochmut kommt vor dem Fall!
Das Opfer des tugendhaften Königs Sibi
Eine tapfere, sich für ihren Gatten aufopfernde Prinzessin
Die Geschichte des Königs Rudrayana und seiner Königin und ihr schlimmes Schicksal durch ihren boshaften Sohn
Die Erzählung von König Bhallathiya und dem kinnera Paar
Die Sage von Maitrakanyaka
Lalitavistara - Das Leben des Gautama Buddha
Mythen und Erzählungen von der Geburt des Buddha
Geburt und Jugendzeit des Buddha Sakyamuni
Die Vermählung Buddhas-Sakyamuni und seine Abkehr vom früheren Leben
Der Bodhisattva beschreitet seinen Weg des Erkennens und seine Erleuchtung
Die Predigt und Verkündigung des Gesetzes der Errettung
Gandavyuha Sutra - Eintreten in den Kosmos der Wahrheit
Sudhanas Suche nach Weisheit und Erleuchtung
Sudhanas Begegnungen mit den Bodhisattvas
Die Bodhisattvas trennen sich von ihrem Besitz
Begegnungen im Jenseits
Die oberste Terrasse des Borobudur
Ist der Borobudur ein Stupa oder ein Mandala?
Vorwort
Dem Leser wird das unterschiedliche Bildmaterial auffallen, da durch Klima, andere Umwelteinflüsse und Vulkanausbrüche die Steintafeln mehr oder weniger stark in ihren Oberflächen durch Verschmutzungen, Säurebrände und Regen verändert wurden. Um das wiederzugeben und nicht durch technische Eingriffe etwas vorzutäuschen, was nicht sichtbar ist, wurde so nahe wie vertretbar an ihrer wirklichen Ausstrahlung festgehalten. Farbliche Änderungen wurden da vorgenommen, wo es galt Einzelheiten und Besonderheiten hervorzuheben, deswegen reichen die Wiedergaben vom Farbbild bis zu schwarzweiß Darstellungen.
Wegen der Fülle des dargestellten Bildmaterials ist für die einzelnen Terrassenwege eine streng unterteilte Gliederung für den Besucher in den Text mit eingeflossen, die als Orientierungshilfe dienen soll. So wird immer am östlichen Aufgang ein Umgang über einen Terrassenrundweg begonnen und nach jeder Richtungsänderung dieses vermerkt. Die so geschaffenen Abschnitte dürften dem Besucher und Betrachter eine Hilfe bei seiner individuellen Auswahl anbieten, insbesondere dann, wenn nur ein zeitlich begrenzter Besuch möglich ist. Zuvor sollte der Besucher selbst jene Abschnitte festlegen, die er betrachten möchte.
Die individuelle Auswahl wird erfahrungsgemäß von dem Erhaltungszustand der Tafeln beeinflusst sein, denn wo starke “Abwitterungen“ oder Zerstörungen durch Erdbeben ein gutes Erkennen erschweren, wird meist von einer zeitlich längeren Betrachtung Abstand genommen. Bilder der Nordseite sind von Verwitterungen am wenigsten betroffen, weil hier kaum Beeinflussungen durch den Regen vorliegen.
Borobudur
Der Maler hat einen Festtag aus früherer Zeit für sein Gemälde ausgewählt und just den Augenblick ins Bild gesetzt, als sich sehr viele Besucher um das Heiligtum versammeln. Er gibt mit dem bunten Treiben dem Betrachter eine Vorstellung von der Größe und Bedeutung des Monuments. Im Vordergrund stehen buddhistische Mönche, die an ihren rasierten Köpfen zu erkennen sind, dabei Wedel und Sonnenschutz halten und eine um die Schulter geschlungene gelbe Mönchsrobe. Rechts stehen zwei arabische Kaufleute unter einem Sonnenschutz, den ein junger Diener über sie hält. Ob die javanisch gekleidete Dame hinter ihnen dazu gehört, ist nicht ohne weiteres erkennbar. Links wird ein Besucher in einer Sänfte von Dienern zur Feierlichkeit getragen. Im Hintergrund sitzen Würdenträger in Sänften, vielleicht auch der königliche Hofstaat, der von Elefanten getragen wird und sich in Richtung Heiligtum bewegt. Nach dem Schatten der Sonne, befinden sich die Besucher vor dem östlichen Aufgang, was auch der terrassenförmig aufgebaute Hügel links zeigt, der auch in der Realität an dieser Stelle liegt. Gemälde von G.B. Hooijer (c. 1916 – 1919).
Die Erbauung des Borobudur
Nur sehr wenige altjavanische Quellen berichten über die Erbauung des Borobudur, ebenso wenig über den gewählten Standort und die beim Bau verwandten Materialien. Es gibt keinen ausführlichen Bericht über die am Aufbau beschäftigten Menschen, auch kaum literarische und nur einige archäologische Quellen, die darüber Auskunft geben, warum dieser Ort in Zentraljava als Platz für dieses Monument ausersehen wurde. So bleibt nur sich Schritt für Schritt an die Entstehungsgeschichte des Bauwerks heranzutasten.
Weit über eine Million Steine wurden verbaut, die mühsam aus dem Flussbett und einem Hügel daneben herausgewuchtet und zur Baustelle transportiert wurden, wo sie auf einem vorgerichteten Arbeitsfeld geschnitten und zurecht gemeißelt durch geschickte Steinmetze, ihre erste Form erhielten. Das war allein für sich genommen schon sehr beeindruckend. Dafür, vom Beginn bis zur Fertigstellung, musste die Zustimmung und Unterstützung der javanischen Gesellschaft für ein monumentales Werk gewonnen werden, dies alles ohne einen materiellen Gewinn aus der riesigen Arbeit. Um dies zu meistern, musste diese Gesellschaft fast übermenschliche Kräfte und einen starken Willen zeigen. Es lag im wahrsten Sinn des Wortes in den Händen der Menschen, die Steine zu heben, diese durch ihre Geschicklichkeit passend zu schneiden und zu setzen. Aber nicht genug damit, sie schufen dazu eine effizient arbeitende Landwirtschaft, um alle Arbeiter zu versorgen, ganz zu schweigen von der gekonnten Koordination aller nötigen Tätigkeiten. Das Opfer ihrer Ressourcen für den Aufbau dieses einmaligen Heiligtums brachte ihnen geistige und religiöse Erfüllung. Das alte Java und seine Menschen wurden dadurch zu einer der Hochkulturen der Menschheitsgeschichte.
Die Javaner siedelten nicht in großen Städten, wie das oft bei anderen Kulturen zu beobachten ist, so fand man auch keine Plätze von Großsiedlungen. Das mag ganz mit ihrem Adat – ihren Traditionen und Bräuche – zusammenhängen, da sie immer in kleinen Gemeinschaften wohnten und ihre Sawahs, ihre Nassreisfelder, mit bis zu drei Ernten jährlich bebauten. Der fruchtbare Boden und der Wasserreichtum der Kedu Ebene in Zentraljava ermöglichten eine vielseitige, insbesondere kreative Bauerngesellschaft, für die es etliche Beispiele in der Menschheitsgeschichte gibt, man denke an das Ganges- oder Industal, das Zweistromland oder an das Niltal. War es diese Kreativität, die eine Gemeinschaft dazu brachte, ein so außergewöhnliches Monument zu schaffen, ermuntert durch ihre Könige? Möglicherweise erzeugte beides zusammen den zündenden Funken! Aber auch darauf werden keine Antworten gegeben.
Die Dörfler und Reisbauern lebten zusammen mit Mönchen, denen man Klöster und Schlafhäuser – Sari – baute. Die Mönche zogen in Erfüllung ihrer Gelübde morgens durch die Siedlungen, so wie heute noch in anderen Ländern, um sich ihre Reisportion für den Tag wortlos zu erbitten und diese still dankend entgegen zu nehmen.
Die Frage nach den Kosten für den Bau eines so ungewöhnlichen Heiligtums beschäftigte die Gelehrtenwelt schon immer. Die Millionen von Steinen wurden zwar nicht weit vom Borobudur selbst gebrochen oder aus dem Flussbett heraus geklaubt, um sie dann vermutlich mit hölzernen, von Ochsen gezogenen einfachen Karren zu den Arbeitsplätzen der Steinmetze und Steinschneider zu transportieren, damit sie dort mit Schlegeln und metallenen Meißeln in Form gebracht werden konnten. Doch vermutlich war das nur ein Bruchteil der anfallenden Kosten der Arbeiten, die möglicherweise auch in Freizeiten oder Fronarbeiten geleistet wurden. Die Qualität der einzelnen Steine, die dann am und im Borobudur verarbeitet und aufgesetzt wurden, zeugt von einem großen und weit überdurchschnittlichen handwerklichen Können, um nicht zu sagen von einer Kunst. Die beidseitig an den einzelnen Pilgerwegen in den gemauerten Stein gehauenen Bilder, als ‘Tafeln‘ bezeichnet, sind meisterlich in ihrer vollendeten künstlerischen Harmonie. Leider hat die Zeit, vor allem der Regen und nicht zuletzt die säurehaltige Vulkanasche des nahen Vulkans Merapie den Stein schon teilweise sehr in Mitleidenschaft gezogen oder gar zerfressen.
Abb. 1. Blick vom Borobudur auf den im nachmittäglichen Dunst nur schemenhaft zu erkennenden Vulkan Merapi. Foto: Inge und Fritz (Germany 2015).
Ungeklärt bis heute bleibt für viele Wissenschaftler und Besucher die Frage, für wen denn eigentlich der Borobudur errichtet wurde. Für Gläubige und Anhänger der buddhistischen Gemeinschaften oder doch nur für die Herrscher, den Adel und höheren Klerus? War das Monument in allen seinen Terrassen und Stufen für jedermann zu betreten? Dafür spricht, dass die Pilgerwege der einzelnen Stufen ja nur Sinn machten, wenn sie zur Erbauung, Erleuchtung eines jeden Buddhisten offen standen und somit zumindest die unteren Terrassen der Pyramide allen zugänglich waren.
Abb. 2. Einblick in eine Galerie. Links ist die Wand zum Hauptbau zu sehen mit einer Doppelreihe von Reliefs, die durch einen meist verzierten rechteckigen Rahmen voneinander getrennt sind. Rechts die Balustrade, mit meist kleineren meist einreihigen Steinbildern. Foto: Inge und Fritz (Germany 2015).
Im Lauf der Zeit änderten sich auch die Lehrmeinungen. Das LOTUS SUTRA, eines der frühesten buddhistischen Textwerke für die Gläubigen außerhalb Indiens, lehrt, dass nicht alle Gläubige berechtigt waren, die höchsten Lehren und Weisheiten zu empfangen. Die Maßgabe, die Grundelemente des Glaubens für alle zu belassen, die Gläubigen aber aufzuteilen, um bestimmte Zeremonien und Feierlichkeiten in getrennten Gruppen zu feiern, sollte den gesellschaftlichen Unterschieden gerecht werden. Was in den Anfängen des Buddhismus so nicht zu beobachten war, verbreitete sich mit dem Aufkommen tantrischer Lehren, die gerade in der Zeit der Errichtung des Borobudur hervortraten und einen größeren Einfluss erlangten.
Nach allgemeiner Lehrmeinung wurde der Borobudur just zu der Zeit errichtet, als der Buddhismus eine unbeweglichere Haltung einnahm und nachhaltig erstarrte. Dieser starre Status dauerte nach Lehrmeinung fünfzig Jahre über die Fertigstellung des Borobudur hinaus. In dieser Zeit erhoben sich elitäre Gruppen über einfache und sozial unter ihnen stehende Gläubige. Doch damit wird nicht die offene Frage beantwortet, für wen eigentlich der Borobudur erbaut wurde, für die Könige und ihren Hofstaat, für höhere Kleriker oder doch die Gemeinschaft aller Buddhisten?
Die Balustraden sind Mauern an der offenen Seite der Pilgerwege des Monuments am äußeren Rand jeder Terrassenstufe. Sie verhindern so, dass jemand abstürzt. Mit ihnen wurde damit bewusst noch mehr Raum und Platz zum Anbringen weiterer Reliefs gewonnen, denn sie konnten, wie in offenen Galerien, mit Bilderzyklen teilweise doppelreihig ausgeschmückt werden. Die Treppenverbindungen über die dazugehörenden Torwege können als Aufgang von einer Ebene oder ‘Daseinsstufe‘ auf die nächste Ebene des Seins gelten, diese Verbindungen sollten symbolisch auch ein Höherstreben in der Religion oder im sozialreligiösen Rang andeuten. Über und durch das Tor zur nächsten Ebene konnte nur derjenige gelangen, der bestimmte Voraussetzungen erfüllte. Vielleicht konnte und sollte aber ein gläubiger Pilger sich auch selbst befragen, ob er die Anforderungen der Lehren erfüllt hatte, um auf die nächsthöhere Terrasse zu steigen und sich so selbst eine Antwort geben.
Der unterste Zyklus des Mahakarmavibhangga – der Begierden des Weltlichen – ist heute wie schon beschrieben, durch den Fundamentvorbau nicht mehr sichtbar, nur an der südöstlichen Ecke ist ein Teil ausgespart, damit der Besucher sich eine Vorstellung davon machen kann. Es folgt in der ersten Galerie das avadana – noble, heroische, edle Taten und das Jataka – Geschichte der Geburt des Buddha – dem in den aufsteigenden Rundwegen das Lalitavistara – Leben des Gautama Buddha – folgt. Dessen Texte waren nicht in die Lehren des Tantraismus aufgenommen worden, erst ab dem höher eingestuften Gandavyuha – Sutra eines jungen Mannes auf der Suche nach Erleuchtung und Weisheit [http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-MAG/ma-g204407.pdf?origin=pub…] –.
Die Darstellungen des Gandavyuha ist dabei der Teil des tantrischen Sutra, unter dem ein Lehrtext des indischen bzw. des buddhistischen Schrifttums zu verstehen ist und hier seinen Niederschlag findet. Somit war eine Auswahl getroffen, wie sie die symbolhafte Architektur des Borobudur forderte. Einige Gelehrte fanden ab der dritten Galerie Hinweise auf frühe tantrische Elemente am Borobudur und verglichen die dort angebrachten Sinnbilder und Hinweise mit denen des benachbarten Tempels Mendut. Dieser liegt in einem Abstand von nur 4 Kilometern auf der geraden Linie zum Merapie-Vulkan und zeigt unter anderem tantrische Formen zu Bodhisattva Vajradha- tu.Beim Mendut Tempel wurden jedoch bewusst und nicht versteckt tantrische Sinnbilder verwendet, denn es ist bekannt, dass im 10. Jahrhundert viele javanisch buddhistische Eliten tantrischen Zirkeln angehörten, die das auch offen zeigten. Dies bestärkt die Meinung, dass der Borobudur für diese Gruppe gebaut wurde, wovon sich ein Verbot für die ‘normale‘ Anhängerschaft, nicht über die zweite Terrasse hinauf zu steigen, ableiten ließe. Andere Lehrmeinungen sehen dagegen diese tantrischen Elemente nicht und argumentieren, dass der Borobudur für alle Gläubigen errichtet wurde.
Damit ist doch von einer Öffnung des Tempels für alle auszugehen, denn von Differenzen beider Gruppen ist nichts bekannt. Die vollkommen offene Bauweise als Mandala und Stupa prägt die Architektur des Borobudur, die bewusst so gewählt wurde, dass von jeder Himmelsrichtung aus Treppenwege bis zum Höchsten führen. Die Terrassen sind mit offenen Toren verbunden, um die vollkommene Offenheit des Buddhismus auszudrücken, es finden sich, auch nicht sinnbildlich, keine Sperren oder Gehverbote, um ganz nach oben zu steigen, Es ist ebenfalls nicht bekannt, ob es einen abgesonderten Teil innerhalb der oberen Rundterrassen des Borobudur oder eine Abteilung für königliche oder höher gestellte Personen gab.
Neben dieser offenen Bauweise, die zu einem wie schon angedeutet großen Stupa in der Grundform eines Mandala gehört und somit keine Tempelform bildet, gab es immer auch kleinere, geschlossene buddhistische Tempel – Pawon, Plaosan, Mendut, Sewu, Kalasan und Sari, um nur einige zu nennen – die teils in einzelliger, teils in mehrzelliger Bauweise erstellt wurden, ein bewusst gewähltes Mittel, die Offenheit des Glaubens zu demonstrieren. Diese Bauweise wurde später sogar von der balinesischen Hindureligion übernommen. Viele Tempel in Bali haben eine offene Bauweise und zeigen dadurch, dass sie für jeden Hindu zur Andacht offen stehen.
Auswahl der Örtlichkeit - Landschaft und Architektur
Das Heiligtum wurde in der Kedu-Ebene zwischen den Flüssen Elo und Progo mit ihren vielen Nebenwassern errichtet. Vielleicht suchte man bewusst die Ähnlichkeit oder das Vorbild indischer Flusssysteme, etwa mit dem Ganges. Nur etwa 35 km Luftlinie trennen das Monument und den äußerst unruhigen Merapie-Vulkan, der oft aktiv ist und dessen Asche auch auf den Borobudur niederfallen kann, die dann umgehend wegen ihres Säuregehaltes aus allen Fugen und von allen Steinen ausgekehrt werden muss, denn sobald sie durch den Regen feucht wird, beginnt die Zersetzung des Gesteins. Schäden an den Reliefs sind so in vielen Jahrhunderten entstanden, weil früher keine Säuberung vorgenommen wurde, wie Verfärbungen und stellenweise Zerstörungen auf und an den Reliefs als bläulich graue Auswucherungen zeigen. Dort, wo mehr Regen ankommt, ist die Verwitterung stärker und es sind deutlich mehr Zerstörungen auszumachen.
Diese außerordentlich fruchtbare, zugleich wasserreiche Ebene, mit durchschnittlichen Niederschlägen von 2 Metern pro Jahr, ist schon seit prähistorischer Zeit besiedelt. Sie stellte für die Architekten ein vollkommenes, harmonisches Landschaftsbild dar, umgeben von den hohen Vulkanen im Norden und Osten, im Süden das malerisch gezackte Kalkgebirge mit tausend Höhenmetern und in der Ebene einige wenige hügelartigen Erhebungen. Alles bedeckt von einem wuchernden tropischen Grün, das von fleißigen Händen zu Gärten und Sawahs gestaltet worden ist, unterbrochen und gleichzeitig geschmückt von den einfachen Behausungen der Menschen.
Das innere Fundament des Borobudur bildet ein natürlicher Erdhügel, der durch Anschüttungen und Glättungen des Erdreiches so verändert wurde, dass daraus ein stufenpyramidialer Untergrund geformt werden konnte, auf dem dann die unteren drei quadratischen Terrassen treppenartig sich von Stufe zu Stufe nach oben verjüngend, aufgesetzt werden konnten. Die Veränderungen des Erdreichs brachten aber die Gefahr der Instabilität mit sich, verstärkt durch eindringendes Regenwasser, wie sich es bei den folgenden Bauperioden herausstellte. Bei der Fertigstellung in buddhistischer Bauzeit folgten auf die drei unteren drei weitere quadratische Plattformen und drei mehr oder weniger kreisrunde Terrassen aufsteigend. Auf der dritten und letzten Stufe steht mittig ein gewaltiger Stupa, der von 72 kleineren Stupas umrandet wird.
Der an dieser Stelle vorhandene natürliche Hügel wurde schon lange vor der Bauzeit des Borobudur ausgewählt. Einzelheiten dazu lassen sich aber nicht mehr finden. Jedenfalls begannen Arbeiter damit Terrassen im und am Hügel einzubauen und ihm so eine erste Struktur zu geben. Mit Karren schafften sie einen Teil des vermutlich losen Grundes vom Hügel weg, dafür wurden stabilisierend Steine gesetzt, um das Erdreich zu festigen. Die Bewohner dieser Landschaft setzten drei massive Terrassen, deren Ausmaße in etwa dem späteren buddhistischen Monument entsprachen. Jedoch konnte bis heute niemand sagen, was das Gebaute anfänglich zeigte und darstellen sollte. In Java sind eine Reihe ähnlicher vorzeitlicher Terrassenbauten bekannt, was zu der Annahme führte, dass sie unbekannten traditionellen Zeremonien gedient haben könnten. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass man sie meist auf Bergkuppen ganz in der Nähe von Dörfern fand. So gesehen trifft das auch für den Borobudur zu, um die eigenartige Form der Terrassen zu erklären, die nichts Hinduistisches oder Buddhistisches aufweisen und eher als rein javanisch eingestuft werden müssen.
Es fällt schwer, eine Antwort darauf zu geben, was die ersten Erbauer eigentlich errichten wollten, weil Teile wieder umgebaut oder rückgebaut worden waren. Auch zeitlich schiebt sich das in den angenommenen Baubeginn um das Jahr 760 n.u.Z., möglicherweise aber auch erst 10 - 20 Jahre danach. Insgesamt gesehen bleiben damit sehr viele Fragen offen, um die architektonische Identität des Monumentes verständlich zu machen.
Unklar bleibt ebenso, ob die ersten Bauherren möglicherweise mit Gewalt von dem Hügel vertrieben wurden oder ob sie freiwillig das Feld räumten, da sie für sich und den weiteren Bau keine Hoffnung mehr sahen. Auch das bleibt im Dunkel, bevor dann die buddhistischen Baumeister ihr großartiges Werk begannen.
Auf Grund all dieser Einwände und zeitlichen Unsicherheiten ist von einem späteren Baubeginn des Monumentes auszugehen und erst ab dem Jahr 780 n.u.Z. ein gesicherter
Nachweis möglich. Handwerker, Maurer, Steinmetze und Künstler setzen dann die nächsten Terrassen mit den Mauern und Galerien, mit den vierseitigen Eingangstreppen und deren Tore. Sie beginnen die Flanken der Pilgerwege mit den Steinbildtafeln zu schmücken, alles das, was Pilger und Besucher heute noch bestaunen können.
Doch dann die Katastrophe, vielleicht durch ein Beben ausgelöst, fielen die Basisterrassen, von den Vorerbauern ganz anders konzipiert, in sich zusammen und hielten den Aufbauten nicht mehr stand. Das Gewicht überforderte die Fundamente, Teile brachen heraus und obere Bauabschnitte rutschten nach, vieles wurde zerstört.
Hütedämon – Bildnis eines Kala – er dient mit seinem weit geöffneten Maul als Wasserabfluss.Foto: R. Weber 2014.
Die Architekten und Bauleute fanden einen Kompromiss dahingehend, dass sie die geplante Höhe des Monumentes zurücksetzten und dazu zusätzlich die unteren Terrassen in ihren Fundamenten verstärkten. Ein Teil der oberen Elemente und besonders die Reliefs mussten als verloren gelten, wofür jedoch die unteren so ummantelt wurden, dass hier nun Platz und Möglichkeiten für weitere Galerien geschaffen werden konnten. Einiges von den oberen Reliefs konnte gerettet und abgenommen werden, anderes blieb zerstört. Diese nachträgliche Verstärkung durch eine Art Steinstützmauer an den unteren Bauteilen reichte jedenfalls aus. All diese Vorgänge deuten darauf hin, dass die Erbauer zuvor die Gewichts- und Druckprobleme nicht erkannt hatten, die sich im Laufe der Jahrhunderte durch Wassereinwirkungen zeigten und verstärkten. Bei der großen Renovierung durch Indonesien in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde eine Ummauerung als "hidden foot" nötig, mit der man gleichzeitig einen großen Rundweg neu bildete.
Überhaupt ist festzustellen, dass in Java die frühesten buddhistischen Strukturen und Spuren bei Renovierungen und Umbauten verloren gingen, dies erschwert eine klare Vorstellung für die Zeit vor 800 n.u.Z., was auch für wesentliche Elemente des Heiligtums Borobudur zutrifft. Ungeachtet dessen bleibt es ein Mysterium, wie es den Architekten gelang, das Monument in dieser Harmonie in die erwählte Landschaft einzubetten. Dies gilt es im Folgenden noch näher vorzustellen.
Prozessionswege und Galerien für Pilger und Besucher
Eine unsichtbare direkte Linie führt vom Borobudur über den Pawon und Mendut zum Merapie