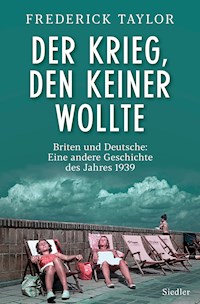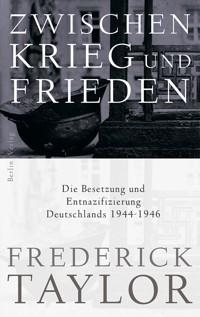7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bassermann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Beinahe dreißig Jahre stand die Mauer – sie spaltete ein Land, sie zerriss Familien, viele starben beim Versuch, sie zu überwinden. Frederick Taylor erzählt die Geschichte dieses Bauwerks, das nicht nur ein Symbol für den verlorenen Krieg und die daraus resultierende Teilung Deutschlands, sondern auch ein Fanal der Unmenschlichkeit war. Ein eindringliches Buch über die Zeit des Kalten Kriegs und darüber, was der Eiserne Vorhang für das Leben der Menschen bedeutet hat.
- "Ein künftiges Standardwerk." (FAZ)
- Die Geschichte der Mauer vollständig erzählt
- Ein eindringliches, spannendes und höchst fundiertes Buch über die Zeit des Kalten Krieges von Bestsellerautor Frederick Taylor
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 848
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Frederick Taylor
DIE MAUER
13. August 1961 bis9. November 1989
Aus dem Englischen vonKlaus-Dieter Schmidt
ISBN 978-3-641-33248-8
© 2025 by Bassermann Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München [email protected] (Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
© der deutschen Erstausgabe 2009 by Siedler Verlag,einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
© der englischen Originalausgabe 2006 by Bloomsbury Publishing, LondonDie Originalausgabe erschien auf Englischunter dem Titel The Berlin Wall. 13 August 1961 – 9 November 1989.© Frederick Taylor, 2006
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhGausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Projektleitung dieser Ausgabe: Martha SprengerLektorat: Jorg Spater, FreiburgCover: Atelier Versen, Bad AiblingBildredaktion: Annette BaurKarten und Grafiken: Peter Palm, BerlinLayout und Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Die Informationen in diesem Buch sind vom Autor und vom Verlag sorgfältig geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
118008820209
Für meinen VaterThomas George Arthur Taylor,1909 –1961
Durch Betrug, Korruption und Erpressung veranlassen Regierungsorgane und Rüstungskonzerne der Bundesrepublik einen gewissen labilen Teil von Einwohnern der DDR, nach Westdeutschland zu gehen. … [Daher] können die Warschauer Vertragsstaaten nicht umhin, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um ihre Sicherheit und vor allem die Sicherheit der DDR im Interesse des deutschen Volkes selbst zu gewährleisten.
Erklärung der Warschauer-Pakt-Staaten, herausgegeben am Sonntag, den 13. August 1961, um 1.11 Uhr, während an der Grenze zwischen Ost- und West-Berlin die ersten Stacheldrahtverhaue aufgebaut wurden1
Den ganzen Herbst das Scheuern und Stoßen des Atomkriegs; wir haben unser Aussterben besprochen.
Robert Lowell, »Herbst 1961«
Wiederholt sei es … vorgekommen, dass man sich gerade durch das Ergreifen von Befestigungsmaßnahmen, die ja, sagte Austerlitz, grundsätzlich geprägt seien von einer Tendenz zu paranoider Elaboration, die entscheidende, dem Feind Tür und Tor öffnende Blöße gegeben habe …
W. G. Sebald, Austerlitz2
Also … sie haben die Mauer gebaut, damit die Leute nicht gingen, und jetzt reißen sie sie ein, damit die Leute nicht gehen.Das nenne ich Logik.
Anonymer Trinker in einer Ost-Berliner Bar,kurz nach dem Mauerfall im November 1989
Inhalt
EinleitungWillkommen an der Mauer
SAND
KAPITEL 1Sumpfstadt
KAPITEL 2Die Roten
KAPITEL 3»Es muss demokratisch aussehen …«
KAPITEL 4Blockade
BLUT
KAPITEL 5Das Volk auflösen und ein anderes wählen?
KAPITEL 6Kronprinzen, Chruschtschows Glücksspiel und das Götterghetto
KAPITEL 7Mit dem Hund wedeln
KAPITEL 8Aktion »Rose«
DRAHT
KAPITEL 9Sonntag, 13. August 1961
KAPITEL 10Gefangene: Bernauer Straße und Hohenschönhausen
KAPITEL 11»Dieser Bastard in Berlin«
BETON
KAPITEL 12Spiele und Schüsse an der Mauer
KAPITEL 13High Noon in der Friedrichstraße
KAPITEL 14Flüchtlinge, Fluchthelfer und Grenzsoldaten
KAPITEL 15Kennedys Besuch und die »zweite Geburt« der DDR
GELD
KAPITEL 16Der surrealistische Käfig, die Grenzfestung und der Geheimtresor
KAPITEL 17Endspiel
KAPITEL 18Die Mauer stürzt ein
NachwortGestohlene Hoffnung
Danksagung
Abkürzungen
Anmerkungen
Bibliographie
Personenregister
Ortsregister
Bildnachweis
EinleitungWillkommen an der Mauer
Es war an einem Wochenende im August 1961. Ich hatte eine glückliche Kindheit hinter mir und mit meinen 13 Jahren ohne allzu viele unangenehme Zwischenfälle die Schwelle der Adoleszenz erreicht. Jetzt jedoch hing eine Wolke über dem Horizont. Meinem Vater ging es nicht gut, ganz und gar nicht. Das Rauchen – sein einziges Laster, soweit ich wusste – hatte ihn bereits einen Lungenflügel gekostet. Nach der Operation anderthalb Jahre zuvor schien er sich gut erholt zu haben, aber in diesem Sommer wirkte er wieder schwach und erschöpft und hütete oft das Bett. Ich ging häufig hinauf, um ihm Gesellschaft zu leisten. An diesem Tag sprachen wir über einen Artikel in der Sonntagszeitung. Deshalb erinnere ich mich daran, dass es ein Wochenende war. Bedeutsame, irgendwie unheilvolle Dinge gingen vor in der Welt.
Mein Vater hatte an jenem Abend einen schweren Herzanfall. Unsere Nachbarin, eine Krankenschwester, eilte herbei, und ich erhaschte durch die halb offene Schlafzimmertür einen Blick auf sie, wie sie auf seine Brust drückte, um ihn am Leben zu erhalten. Dann wurden wir nach unten geschickt. Der Arzt kam. Jemand schaltete den Fernseher ein, um uns zu beschäftigen. Flackernde Schwarz-Weiß-Bilder einer Großstadt. Wütende Menschen, Männer mit Gewehren und Stacheldraht. Vielleicht ein oder zwei Panzerspähwagen. Die Erinnerung ist etwas verschwommen, so wie die Bilder. Es ist lange her.
Ich weiß immer noch nicht, ob der Entschluss, dieses Buch zu schreiben, etwas mit diesem Abend zu tun hatte. Aber für mich wird die Berliner Mauer stets nicht nur mit dem Zustand der Welt von damals und heute verbunden sein, sondern auch mit einem starken Gefühl von Abschied und Trennung. Der Tag, an dem sie gebaut wurde, markierte für mich wie für viele Millionen andere Menschen das Ende eines Lebensabschnitts und den Beginn eines neuen, schwereren. Mein Problem an jenem Tag war jedoch weder ökonomischer noch geographischer oder politischer, sondern rein privater Natur, und es hatte nichts mit Berlin zu tun.
Mein Vater blieb noch einige Zeit im Obergeschoss. Ich sah ihn nur noch einmal, später am Abend, wieder durch eine halb offene Tür, diesmal diejenige zu meinem Schlafzimmer. Sanitäter trugen ihn auf einer Bahre über den Flur zur Treppe. Er war bei Bewusstsein und sah sich um. Er machte einen ernsten, aber gefassten Eindruck. Fast schien es, als sei er neugierig auf das, was mit ihm geschah.
Im Krankenhaus erlitt er einen weiteren – dieses Mal tödlichen – Herzinfarkt. Es war der 14. August 1961. Tags zuvor, am Sonntag, war eine Vorform der späteren Berliner Mauer errichtet worden, die eine Großstadt teilte und Menschen voneinander trennte, Freunde von Freunden, Eltern von ihren Kindern, Brüder und Schwestern von ihren Geschwistern. Gleichzeitig war es auch der Tag, an dem ich von meinem Vater getrennt wurde. Das Hindernis, das ihn von mir trennte, war düster, geheimnisvoll und vor allem dauerhaft. Die Berliner Mauer war dagegen in keiner Weise geheimnisvoll. Sie war real und brutal. Es sollte sich erst noch herausstellen, dass sie nicht dauerhaft war, aber das konnte damals noch niemand ahnen.
Als ich Berlin fast auf den Tag genau vier Jahre später zum ersten Mal besuchte, hatte ich ganz gewiss den Eindruck, als würde die Mauer bis an mein Lebensende bestehen bleiben. Ich war 17 Jahre alt und stand ein Jahr vor meinem Schulabschluss. Im Jahr vor dem Tod meines Vaters hatte ich begonnen, Deutsch zu lernen, und jetzt war ich auf einer Klassenfahrt in der Stadt, die geteilt worden war, als er starb. Ich erinnerte mich an die Bilder aus jener Nacht im Jahr 1961, auch wenn sich die Stadt, als ich sie wirklich sah, ganz in Farbe präsentierte und keineswegs so verschattet und bedrückend wirkte wie ein Horrorfilm aus der Stummfilmzeit, wie ich sie mir seltsamerweise vorgestellt hatte. Stattdessen unterschied sie sich nicht allzu sehr von London. Es war allerdings ein London mit wesentlich mehr Bomben- und Granatenlöchern und mit einer quer durch die Stadt verlaufenden Zement- und Stacheldrahtsperre, die immer noch improvisiert und wacklig aussah.
Das Hotel, in dem wir untergebracht waren – es handelte sich wohl eher um eine Jugendherberge –, befand sich an einer Ecke des ehemals ziemlich prächtigen, dann aber weitgehend zerstörten und noch nicht wieder aufgebauten Askanischen Platzes im West-Berliner Bezirk Kreuzberg. Dem Hotel gegenüber stand die Ruine der Eingangsfront des Anhalter Bahnhofs; der Rest der einst größten Berliner Eisenbahnstation war dem großen amerikanischen Luftangriff am 3. Februar 1945 zum Opfer gefallen. 200 Meter weiter zog sich die Mauer hin, und der Checkpoint Charlie war bequem zu Fuß zu erreichen. In der Nähe des Hotels stand eine Holzplattform, auf die man über eine Treppe hinaufsteigen konnte, um einen Blick in den »Osten« zu werfen. Man sah damals allerdings hauptsächlich ramponierte und größtenteils ungenutzte Regierungsgebäude in der Leipziger und der Wilhelmstraße. Heute weiß ich, dass dies das »Regierungsviertel« war, mit Hermann Görings berühmtem Luftfahrtministerium als einem der herausragenden Bauwerke. Das in den dreißiger Jahren errichtete Gebäude sah schlimm aus, so leer und verwaist und vom Krieg gezeichnet. Zwischen den Pflastersteinen und auf den verkehrsfreien Straßen wuchs Unkraut.
Ich glaube, wir waren ungefähr ein Dutzend Jungen und Mädchen. Die Leitung lag bei unserem liebenswürdigen Deutschlehrer, Mr. Kitson, und bei einem fröhlichen jungen Studenten aus Österreich, der die Angewohnheit hatte, beim Gehen eine Melodie zu summen und hin und wieder einige Tanzschritte einzulegen. Wenn ich mich richtig entsinne, war es irgendeine geförderte politische Bildungsreise. Ich weiß noch, dass ich erstaunt war, wie wenig die Menschen dem Stereotyp des »Deutschen« aus den Kriegs- und Nazifilmen glichen. Man sah nur wenige Uniformen, dafür viel Freizeitkleidung; die Deutschen waren etwas blonder und rotgesichtiger als die meisten Briten, ansonsten aber erstaunlich, um nicht zu sagen enttäuschend normal. Und soweit ich es mit meinen immer noch begrenzten Deutschkenntnissen verstand, besaßen sie einen frechen, vorlauten Humor, nicht unähnlich dem der Cockneys in London. Wir wurden in ein echtes Berliner Kabarett geführt. Eine der Nummern war ein »Schulmädchen«-Lied, das von drei Schauspielerinnen in durchsichtigen Regenmänteln und hochhackigen Schuhen vorgetragen wurde, die angeblich in der Augsburger Straße arbeiteten. Ich verstand sogar einige der Witze, etwa den Wink, dass sie am meisten beschäftigt seien, wenn der Bundestag seine Sitzungen in Berlin abhielt. Dieser Witz wurde von den Zuschauern am lautesten belacht. Berliner sind nicht gerade für Respekt bekannt.
Bevor wir die obligatorische Reise durch den »Eisernen Vorhang« nach Ost-Berlin unternahmen, mussten wir uns auf der Westseite zu Kaffee und Keksen einen Vortrag anhören. Gehalten wurde er von einem jungen Mann, den ich zuerst für einen Amerikaner hielt – Bürstenhaarschnitt, Button-Down-Kragen, Hornbrille –, der sich aber trotz seines stark amerikanisierten Englisch als West-Berliner herausstellte. Er erklärte uns, was wir schon wenige Minuten, nachdem wir unsere Unterkunft erreicht hatten und zu einem Spaziergang die Straße entlang aufgebrochen waren, erkannt hatten: dass die Mauer ein monströses Bauwerk sei, das Menschen errichtet hätten, die Freiheit nicht nur als entbehrlich, sondern auch als gefährlich ansähen.
Als wir schließlich eines Morgens die Grenze überschritten, fühlte ich mich sogar ein bisschen heimisch. Ich erinnerte mich, dass mein Vater, der im Krieg in der nordafrikanischen Wüste gekämpft hatte, die dortigen Deutschen stets gemocht und geachtet hatte, obwohl sie Feinde waren. Ihr Befehlshaber, General Rommel, war jemand, den er gern auf unserer Seite gesehen hätte. Die Deutschen in El Alamein und anderen Küstenorten waren nicht die unheimlichen Gestapo- und SS-Männer gewesen, die die furchtbaren Gräuel an der Ostfront und in den besetzten Ländern begingen, sondern die normalen Soldaten des Afrikakorps. Für mich sahen die meisten West-Berliner wie die Durchschnittsdeutschen aus, an die sich mein Vater erinnert hatte.
Den ersten Schock löste dann das Aussehen und Auftreten der uniformierten Beamten am Grenzübergang aus. Mit versteinerter Miene starrten sie auf das Foto in meinem Pass, dann auf mich, dann wieder auf das Foto und scheinbar endlos so weiter. In einem Deutsch, das ich nicht verstand, wurden Befehle gebrüllt; heute weiß ich, dass es Sächsisch war. Noch während wir erfolglos versuchten, locker schlendernd an den letzten Wachposten vorbeizugehen und das triste, reklamefreie Ost-Berlin zu betreten, musste ich mich zwingen, mich nicht umzudrehen, um zu überprüfen, ob sie uns immer noch anstarrten. Überall waren Uniformen. Sie ähnelten in der Tat denjenigen der Nazischergen in den Kriegsfilmen. Als wir wenig später Unter den Linden haltmachten, um die klassizistische Neue Wache zu betrachten, vollführten die Wachsoldaten irgendein Ritual – im Stechschritt und in Schaftstiefeln! Und auf den Köpfen trugen sie eine seltsame Mischung aus dem Kohleneimerhelm der Wehrmacht und dem klassischen Helmmodell 40 der Roten Armee.
Dann begann die historische Besichtigungstour. Die Ostdeutschen hatten mit einem Respekt, den ich naiverweise von Kommunisten nicht erwartet hätte, damit begonnen, einige der schönen klassizistischen Bauten zu restaurieren. Als dann der Nachmittag in den Abend überging, drängte sich unser Haufen durch die Tür eines Neubaus am Alexanderplatz. Dort begegneten wir einem Mann von Ende dreißig, Anfang vierzig in ostdeutscher Armeeuniform mit großen, verzierten Epauletten, die auf 20 Meter Entfernung seinen hohen Rang signalisierten, und den obligaten Schaftstiefeln. Er fixierte mich mit dem stahlharten Blick seiner hellen Augen und ließ nach einem Knurren eine Tirade vom Stapel, die zu verstehen mein Deutsch gerade gut genug war: Ich sei ein dekadenter Jungspund mit zu vielen Haaren, dem der Respekt vor der Uniform fehle. Wenn ich in seinem Land wäre, wüsste er, was er mit mir tun würde, o ja, er würde wissen, wie man einen Mann aus mir macht. Der Mann war zwar offensichtlich betrunken, dennoch verfehlte sein militärisches Gebaren seine Wirkung nicht. Ostdeutschland, begriff ich, mochte vorgeben, ein Arbeiterparadies zu sein, doch von den kostenlosen Krippenplätzen, den billigen Wohnungen und den lebenslangen Arbeitsstellen einmal abgesehen, ging es letzten Endes um Macht. Unbegrenzte, ungezügelte Macht. Jene Art von Macht, die eine Mauer bauen konnte, durch die 17 Millionen Menschen eingesperrt wurden, 17 Millionen Menschen, denen Figuren wie der betrunkene Offizier sagen konnten, was sie zu tun und zu lassen hatten, und die keine andere Wahl hatten, als strammzustehen und die Befehle entgegenzunehmen. Seit dem 13. August 1961 gab es keinen anderen Ort mehr, an den sie gehen konnten.
Wir kamen unversehrt davon. Ich glaube, Mr. Kitson hatte einige diplomatische Erfahrungen gesammelt, als er unmittelbar nach dem Krieg beim Militär in Deutschland diente. Als wir schließlich gegen Mitternacht – damals die Sperrstunde, zu der das Tagesvisum für ausländische Ost-Berlin-Besucher auslief – den Grenzübergang in umgekehrter Richtung hinter uns gebracht hatten, seufzten wir alle erleichtert auf.
Als Student der deutschen Sprache und Geschichte unternahm ich zwei weitere Reisen nach Berlin. 1972/73 wollte ich dann länger im Osten bleiben. Ich recherchierte für eine Dissertation über die äußerste Rechte in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg, und während sich viele Quellen aus der Zeit nach 1918 in Westdeutschland befanden, war das Material aus dem Kaiserreich durch die Wirren des Krieges zum größten Teil in ostdeutschen Archiven gelandet. Ich musste also für Wochen, wenn nicht Monate »rüber«.
Gelegentlich einen Tagesausflug nach Ost-Berlin zu unternehmen, wie es viele Ausländer taten, war leicht. Aber die Berliner Stadtgrenze zu überqueren und den geheiligten Boden der eigentlichen DDR zu betreten war eine andere Sache. Das bürokratische Verfahren, das ich durchlaufen musste, um die Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, die ich brauchte, um die Archive im Osten zu besuchen, war nervenaufreibend. Ich kam in West- Berlin beim Freund eines Freundes unter und pilgerte, wie mir schien, endlos – obwohl es nur zwei- oder dreimal gewesen sein dürfte – über den Grenzübergang in der Friedrichstraße zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Dort reihte ich mich in eine Warteschlange ein und erfuhr die volle Wucht der Abneigung und des Misstrauens, die der »Arbeiter-und- Bauern-Staat« gegen Menschen hegte, die ihn besuchen wollten. Einmal stand ich hinter einem langgliedrigen, lächelnden Südamerikaner, der nach Prag wollte und um die Genehmigung bat, sein Fahrrad auf der Fahrt durch die Deutsche Demokratische Republik mitnehmen zu dürfen. Ha! Wo kommen wir denn da hin! Warum wollte er das? Der Gesichtsausdruck des ostdeutschen Beamten sagte: Spion, du musst ein Spion sein. Antrag abgelehnt!
Mir gegenüber waren die bürokratischen Torwächter um keinen Deut freundlicher. Aber ich hatte die nötigen Vorarbeiten erledigt, und so erhielt ich schließlich die Erlaubnis für einen dreiwöchigen Aufenthalt in Potsdam. Dafür musste ich eine für einen Studenten riesige Summe in harter Währung in überall sonst wertlose Ostmark eintauschen. Außerdem musste ich in einer von den ostdeutschen Behörden ausgesuchten Pension absteigen, die – ebenfalls in harter Währung und zu einem exorbitanten Kurs – im Voraus zu bezahlen war.
Potsdam ist nur durch die Havel vom West-Berliner Stadtteil Wannsee getrennt. Hätte es eine offene Brücke gegeben, hätte ich zu Fuß ins Archiv gehen können. Stattdessen musste ich über den Bahnhof Friedrichstraße einreisen und dann eine zweistündige Fahrt unternehmen, zuerst an die Grenze von Ost-Berlin und von dort mit einem anderen Zug um die halbe Stadt herum nach Potsdam, immer die Genehmigung griffbereit, die es mir als westlichem Ausländer erlaubte, mich auf dem Territorium der DDR aufzuhalten. Das Archiv lag direkt an der Havel. Mittags, wenn ich meine Aktenarbeit unterbrach, ging ich in den wunderschönen Park hinunter, der sich am Flussufer entlang erstreckte. Es war ein idyllischer Ort, abgesehen von den Warnschildern, den bewaffneten Grenzwachen, die in Barkassen auf dem Wasser patrouillierten, und dem Stacheldraht, der die nahe gelegene Glienicker Brücke schmückte, die seit dem 13. August 1961 geschlossen war – außer bekanntlich für den Agentenaustausch zwischen Ost und West. Sogar in der DDR, dem Land der Vorschriften, gab es stets eine Ausnahme.
Die lauernde Macht war gleichwohl immer zu spüren. Während eines weiteren längeren Besuchs in Ostdeutschland recherchierte ich im zweiten bedeutenden Archiv der DDR in Merseburg, 190 Kilometer südwestlich von Berlin. In jenem Sommer forschten dort auch einige andere westliche Studenten, und natürlich verbrachten wir viel Zeit zusammen. Wir aßen die einfachen Gerichte in den tristen örtlichen Wirtshäusern – außerhalb des Schaufensters Berlin wurden die Dinge rasch schlechter –, tranken zu viel billiges Bier und unterhielten uns mit den Einheimischen. Unsere Trinkkumpane waren häufig Arbeiter aus dem großen Chemiekomplex in Leuna, dem größten Arbeitgeber der Gegend. Sie sprachen offen über die verheerende Luftverschmutzung, die Arroganz der Unternehmensleitung und die Skrupellosigkeit bei der Erfüllung von Normen und Quoten, ein Kampf um Ergebnisse, der ebenso unbarmherzig war wie in der kapitalistischen Wirtschaft. Unabhängige Gewerkschaften, Enthüllungsjournalismus oder die anderen Gegengewichte, die es in pluralistischen Gesellschaften trotz aller sonstigen Mängel gab, fehlten in der DDR.
Sosehr die Ostdeutschen darauf erpicht waren, mit einem zu reden, so auffallend war bei den meisten dieser leicht verkniffene Blick, mit dem sie sich ständig umsahen. Sie vergewisserten sich, dass niemand zuhörte, dann begannen sie zu sprechen, für gewöhnlich, um sich über die schlechte Qualität der Dinge, die sie in den Geschäften kaufen konnten, zu beklagen, weil alles Anständige in den Export ging, um Devisen ins Land zu holen. Die »große« Politik wurde selten erwähnt. Dann wieder dieser Blick in die Umgebung, ein Blick von Menschen, die in einem kleinen Land in der Falle saßen, ohne einen Ausweg zu haben, in einem Land, in dem jede Unmutsäußerung und schon mildes Fernweh als Verrat angesehen werden konnten.
Natürlich gab es auch jene, denen das Leben in der DDR gut bekam, sehr gut sogar. Auch das konnte ich während meines Besuchs in Merseburg beobachten. Man erwartete von uns, dass wir den Bezirk, für den unsere Visen galten, nicht verließen, doch als aufmüpfige westliche junge Menschen der siebziger Jahre vergaßen wir diese Vorschrift, sobald das Wochenende kam. An einem solchen drängten wir uns in einen Zug und unternahmen verbotenerweise einen Tagesausflug in die deutsche Kulturhauptstadt Weimar, die einstige Wirkungsstätte von Goethe und Schiller. Wir hatten Glück. Es waren ziemlich viele Touristen dort, sodass wir nicht auffielen. Und Gott sei Dank kontrollierte niemand unsere Papiere. Bevor wir an jenem Sonntagabend nach Merseburg zurückfuhren, statteten wir, wie es westliche Besucher nun einmal, ohne weiter darüber nachzudenken, taten, der besten Herberge am Ort, dem Hotel Elephant, einen Besuch ab und gingen in den Keller hinunter, um zu Abend zu essen.
Dort trafen wir die üblichen lustlosen Kellner der »volkseigenen« Gastronomie an, die offenbar speziell dafür ausgebildet waren, den Gästen nicht in die Augen zu sehen. Es dauerte eine ganze Weile, bis unsere Getränke kamen, und sogar noch länger, bis unser Essen serviert wurde. Im Lauf der Zeit weckte eine in einer Ecke sitzende Gruppe nicht eben vornehmer Männer mittleren Alters unsere Aufmerksamkeit. Sie hatten die Krawatten gelockert, die Jacketts über die Stuhllehnen gehängt und waren ziemlich laut. Aber die Kellner reagierten wie ein geölter Blitz auf jeden ihrer Wünsche, auf jedes Schnippen ihrer nikotingelben Finger und quittierten jede banale Bemerkung mit einem Lächeln. Sie katzbuckelten regelrecht vor ihnen. Wie kam das? Als ich an der Gruppe vorbei zur Toilette ging, erkannte ich den Grund. Ich entdeckte zuerst an einem und dann an einem anderen Jackett das kleine Parteiabzeichen. Die Männer waren die örtlichen SED-Bonzen. Jahre später fiel mir die Ähnlichkeit dieses Tableaus mit jener Szene in Martin Scorseses Spielfilm Goodfellas auf, in der ein Mafiagangster in einem Restaurant erscheint und den anderen Anwesenden klar wird, dass man ihn in den inneren Kreis der »Familie« aufgenommen hat, und plötzlich ist er der König …
Wie die meisten Mafiabanden entstand die kommunistische, weil sie den Unterdrückten am Anfang Hoffnung und Schutz versprach. In gewisser Weise erfüllte sie ihr Versprechen auch, freilich zu einem enormen Preis an Freiheit und Vergnügen. Und wie jede andere Mafia wagte sie es nicht, ihrem Schützling eine Wahlmöglichkeit zu lassen, nachdem sie ihre Herrschaft gefestigt hatte. Wer weiß, vielleicht haben sich die sizilianischen Paten – auch ohne die ideologische Unterstützung des Marxismus-Leninismus – ebenfalls eingeredet, die von ihnen ausgeübte Unterdrückung sei zum Besten des Volkes. Die Kombination von hohem moralischen Ton und niedriger Unterdrückung war gewiss nichts Neues.
Willkommen an der Mauer. Dieses Buch hofft ein wenig erklären zu können, wie diese geschlossene Welt zuerst durch Sand und Blut und dann durch Stacheldraht und Beton entstand, wieso sie ein halbes Menschenleben lang eine, wenn auch im Kern verrottete, Blüte erleben konnte und wie sie in einer aufregenden Nacht auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Weise zu Ende ging.
SAND
1.
Sumpfstadt
Im Sommer 1961, 16 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war die Welt zum ersten Mal mit der realen Möglichkeit der atomaren Vernichtung konfrontiert. Sowohl der Osten als auch der Westen hatten in den fünfziger Jahren nukleare Massenvernichtungswaffen entwickelt. Und nun wurde von heute auf morgen eine Mauer errichtet, eine Mauer, die die Welt teilte, eine Mauer durch eine auf Sand gebaute Stadt.
Berlin, die Mauer-Stadt, war schon immer eine seltsame Metropole gewesen, eine Fischer- und Händlersiedlung auf sandigem, morastigem Boden, die zur Hauptstadt einer der ärmsten Monarchien Europas wurde: Preußen war ein Staat, dessen Schwäche sich im Lauf der Zeit zu seiner Stärke wandelte: Der Mangel an natürlichen Ressourcen ließ eine Kultur des Militärischen erblühen; der Militarismus wiederum machte Preußen mächtig und Berlin zu einer der großen urbanen Zentren der Welt. Aber wie und wann begann der Aufstieg der Stadt?
Wie nach dem Zweiten Weltkrieg war Berlin auch am Anfang seiner Geschichte geteilt, genauer gesagt bestand es aus zwei Städten oder, besser, großen Dörfern, Berlin und Cölln, die einander gegenüber an einem Flussübergang der nach Norden fließenden Spree lagen. Das im Westen auf einer Spreeinsel gelegene Cölln verdankte seinen Namen der alten, von den Römern gegründeten Domstadt am Rhein; Berlin am Ostufer der Spree war wahrscheinlich nicht nach dem edlen Bären benannt worden – worauf seine Bewohner heute noch pochen –, sondern ganz prosaisch nach dem westslawischen Wort für Sumpf, brlo (berlo) – Sumpfstadt.
In diesen beiden Namen fanden zwei Erbschaften ihren Ausdruck, diejenige der deutschen Siedler aus dem Westen, die im Zuge der Eroberung der slawischen Gebiete zwischen Elbe und Oder dorthin zogen, und diejenige der Nichtdeutschen, die vorher dort gelebt hatten. Letztere wurden zwar im Lauf der Zeit eingedeutscht, blieben aber auf rätselhafte Weise das, was sie waren – spätere Theoretiker der Rassereinheit sollte das zur Verzweiflung bringen. Dies war die Berliner »Mischung«, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als die Hauptstadt des vereinigten Deutschland eine der großen Boomstädte des Kontinents wurde, durch massive Zuwanderungen aus Ost- und Südeuropa ergänzt wurde.
Am Anfang dehnte sich die Doppelsiedlung nur langsam aus. Ihr fehlte ein fruchtbares Hinterland, aber die Lage an Flusshandelswegen zwischen Ost- und Nordsee einerseits und Mitteleuropa andererseits war günstig genug, um die Grundlage eines steten Wachstums zu bilden. Roggen und Eichenholz aus der Umgebung wurden auf den Wasserwegen, welche die norddeutsche Tiefebene wie Adern durchzogen, nach Norden verschifft, und im Austausch kamen Heringe und getrockneter Kabeljau aus Hamburg. Später gelangten Eisen aus Thüringen, feine Tuche aus Flandern und sogar Öl und mediterrane Spezialitäten wie Feigen und Ingwer in die Doppelstadt. Eine Stadtmauer wurde errichtet. Bald teilte ein Mühlendamm die Spree. 1307 schlossen sich die beiden Städte zusammen.
Berlin-Cölln schuldete einem regionalen Magnaten Gehorsam. Oberherr der Stadt war der Markgraf von Brandenburg, an den sie jährliche Steuern zahlte. Allerdings überließ der Markgraf, obwohl er durch einen Gouverneur vertreten war, die Stadt zumeist sich selbst. Von Patrizierfamilien beherrschte Magistrate und Zünfte bestimmten das alltägliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben. Gesetzesverstöße wurden hart bestraft. Nicht nur auf Mord oder Hochverrat, sondern auch auf Vergiftung, schwarze Magie, Hexerei, Brandstiftung und Ehebruch stand der Tod oder tödliche Folter. Zwischen 1391 und 1448 wurden in Berlin, einer Stadt mit rund 8000 ständigen Einwohnern, 46 vermeintliche Missetäter gehängt, 20 auf dem Scheiterhaufen verbrannt, 22 enthauptet, elf aufs Rad geflochten, 17 lebendig begraben (eine bevorzugte Strafe für Frauen) und 13 zu Tode gefoltert.1 Für geringere Vergehen wurden Missetäter in zahllosen Fällen verstümmelt, das heißt, ihnen wurden Hände oder Ohren abgeschnitten oder Zungen herausgerissen.
Dennoch bot das Stadtleben selbst unter solch harten Bedingungen eine gewisse Sicherheit und relative Freiheit. »Stadtluft macht frei«, wie ein altes deutsches Sprichwort lautet. Selbstverständlich wurden die Berliner genauso wie andere Europäer im unglücklichen 14. Jahrhundert von Kriegen, Seuchen und Bränden heimgesucht. Die Dynastie der Askanier, die jahrhundertelang über Brandenburg geherrscht hatte, starb schließlich aus. Krankheiten, Krieg und Hunger verheerten das Gebiet. Da beschloss der römisch-deutsche Kaiser, diesem vernachlässigten Landstrich einen neuen Herrn zu geben. Seine Wahl fiel auf den Sprössling einer Familie aus Nürnberg, der die Stellung des Burggrafen dieser mächtigen Freien Reichsstadt zu Macht und Einfluss verholfen hatte. Dieses Geschlecht nannte sich (Hohen-)Zollern. 500 Jahre lang sollten seine Angehörigen in Triumph und Katastrophe über die Mark Brandenburg herrschen.
Im Jahr 1415 wurde Friedrich VI. von Hohenzollern zu Friedrich I. von Brandenburg. Die Berliner atmeten auf. Die patrizische Elite nahm erfreut zur Kenntnis, dass dieser viel beschäftigte Mann aus einer fernen Provinz sie weiter regieren ließ. Berlin behielt seine Privilegien, und das Gleiche galt für die Patrizier.
1440 starb der erste Hohenzollernherrscher der Mark Brandenburg. Sein Nachfolger, Friedrich II., der unter dem nicht sehr vielversprechenden Namen »Eisenzahn« bekannt war, erwies sich als Fluch der Stadt. Er spielte die gewöhnlichen Einwohner gegen die Patrizier aus und zerschmetterte die anschließende Rebellion. Danach wurde die Stadt von seinen Vertretern regiert, und er ging mit dem Eigentum der Berliner nach Belieben um und bürdete ihnen Steuern auf, wie es ihm passte.
1486 wurde die Stadt zur offiziellen Residenz des Landesherrn. Fortan übte der Monarch bis ins zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts dort eine persönliche und nahezu absolute Herrschaft aus.
Im Jahr 1530 trat Joachim II. von Brandenburg – immerhin Kurfürst, also Mitglied jenes Kollegiums, das den römisch-deutschen Kaiser wählte – zum Protestantismus über. Im Februar 1539 nahm er am ersten lutherischen Gottesdienst in Berlin teil. Seine Untertanen folgten ihm und schlossen sich, im Großen und Ganzen freiwillig, ebenfalls der neuen Konfession an.
Die Länder des Heiligen Römischen Reichs einigten sich auf gegenseitige Toleranz. Gemäß der prägnanten lateinischen Redewendung cuius regio, eius religio – wessen Land, dessen Religion – hing es vom jeweiligen Fürsten ab, ob Protestantismus oder Katholizismus in einem Gebiet zur Staatsreligion wurde. Der religiöse Waffenstillstand und die gedeihliche Entwicklung Deutschlands hielten bis ins frühe 17. Jahrhundert an. Dann erkor der alternde Kaiser Matthias seinen Neffen, Erzherzog Ferdinand, zu seinem Nachfolger. Ferdinand, ein katholischer Hardliner, wurde König von Ungarn und 1618 auch von Böhmen und begann die Protestanten in seinen Ländern zu verfolgen. Es war ein böses Vorzeichen dessen, was unter seiner Herrschaft im »Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation« noch geschehen sollte.
Zufälligerweise war 1618 auch für die Hohenzollern in Brandenburg ein entscheidendes Jahr. Der Herzog von Preußen, ein Nachfahre der Deutschordensritter und Vasall des polnischen Königs, herrschte über weite Gebiete an der Ostsee. Da er nur Töchter hatte, fiel die Herzogswürde nach seinem Tod in jenem Jahr an seinen Schwiegersohn, den Kurfürsten von Brandenburg. Fortan wurde die Familie der Hohenzollern mit dem Wort »Preußen« assoziiert. Auf diese Weise wurde eine baltische Stammesbezeichnung – die Prußen, die ursprünglichen Bewohner des Landes, waren Balten – im Lauf der Zeit zu einer Idee, einem Lebensstil, einer Weltanschauung. Im Guten wie im Bösen.
Vorerst jedoch explodierte das religiöse und dynastische Pulverfass, das Europa im frühen 17. Jahrhundert war. In Böhmen, das zwischen Protestanten und Katholiken aufgeteilt war, lösten Ferdinands Maßnahmen gegen die Protestanten einen Aufstand lokaler Adliger aus. Die Rebellen erklärten Ferdinand für abgesetzt und wählten einen protestantischen Fürsten zum König. Seine Krönung – und die seiner Frau, einer Tochter von James I. von England – fand in Prag statt.
1620 besiegten kaiserliche Truppen in der Schlacht am Weißen Berg die böhmischen Protestanten und löschten die Blüte des einheimischen Adels aus. Kaiser Ferdinand beschloss, den Krieg fortzuführen und nach Deutschland zu tragen, um die protestantischen Staaten im Norden in den Schoß der Heiligen Mutter Kirche zurückzuholen.
Es folgte der höllische Malstrom des Dreißigjährigen Krieges, der furchtbarste Konflikt seit dem Mittelalter, in dem ein größerer Anteil der Bevölkerung Europas umkam als im Zweiten Weltkrieg. Blutige Schlachten verwüsteten die Länder, endlose Belagerungen hungerten so manche Stadt aus. Eine räuberische, häufig halb verhungerte Söldnersoldateska streifte Jahr für Jahr durch Deutschland, vergewaltigte, brandschatzte und mordete, zerstörte Felder und verwüstete Städte, die einst der Stolz Europas gewesen waren. Hinzu kamen Pest und Typhus, die eine durch Unterernährung geschwächte Bevölkerung weiter dezimierten. Als die erschöpften Mächte 1648 ein Friedensabkommen schlossen, waren Deutschland und Europa für immer verändert.
Berlin blieb zunächst verschont, doch dann plünderten im Jahr 1627 kaiserliche Truppen die Stadt, und eine lange Nacht des Schreckens senkte sich über sie herab. Einige Jahre später »befreite« der Schwedenkönig Gustav Adolf die Stadt, aber die von seinen Soldaten begangenen Gräuel erwiesen sich als mindestens so schrecklich wie diejenigen der kaiserlichen Desperados. Berliner Bürger wurden regelmäßig mit Feuer und kochendem Wasser oder durch Verstümmelungen gefoltert, damit sie verrieten, wo sie ihre »Schätze« und Lebensmittel gehortet hatten. Eine der Lieblingsmethoden von Gustav Adolfs Soldaten bestand darin, den Opfern Jauche, den so genannten Schwedentrank, einzuflößen. 1631/32 wurde der Hunger in Berlin so groß, dass sogar Schindanger nach Essbarem durchwühlt wurden. Selbst die Toten an den Galgen der Stadt wurden offenbar geplündert. Einem Bericht zufolge wurden in einer Grube frische Menschenknochen gefunden, deren Mark ausgesaugt worden war.
Die Verpflegungsanforderungen von riesigen, umherziehenden Heeren und die Bemühungen der Kombattanten, auch noch das letzte Goldstück und das letzte Getreide aus den eroberten Gebieten herauszupressen, hatten dazu geführt, dass Brandenburg bei Kriegsende ebenso wie das restliche Deutschland verarmt, verroht und von Hungersnöten geplagt war. In ganz Berlin standen nur noch 845 Wohnhäuser, Cölln war 1641 fast vollständig ein Opfer der Flammen geworden, und die Bevölkerung von Brandenburg war auf 600 000 Köpfe zurückgegangen.
Erst nach dem Friedensschluss begann sich für Berlin und Brandenburg-Preußen das Blatt zu wenden. Der seit 1640 regierende Kurfürst Friedrich Wilhelm I. erwies sich als erster einer Reihe von kraftvollen und talentierten Herrschern, die ihr karges, verwüstetes Land in eine europäische Macht von einigem Gewicht verwandelten.
Der Dreißigjährige Krieg hatte keinen wirklichen Sieger gehabt; keine Macht war stark genug gewesen, ihre Vorstellung von »Siegermoral« durchzusetzen. Gemäß dem Westfälischen Frieden, der den Krieg beendete, sollte es keine Schuldzuweisungen und Bestrafungen von Gräueltaten geben. Die entsprechende lateinische Phrase lautete: Perpetua oblivio et amnestia – ewiges Vergessen und Verzeihen. Intoleranz war Europa teuer zu stehen gekommen.
Im Frieden erwarb der junge Friedrich Wilhelm neues Land: Ostpommern, das die Lücke zwischen Preußen und Brandenburg füllte, die früheren Bistümer Magdeburg und Halberstadt sowie einige Ländereien im Westen Deutschlands. Er nahm der Bevölkerung die letzten traditionellen Rechte und Freiheiten, und seine kriegsmüden Untertanen erduldeten es, ohne Widerstand zu leisten. Brandenburg-Preußen führte jenen effizienten, maßvollen und (den meisten Menschen gegenüber) wohlwollenden Despotismus ein, der zum Kennzeichen des Landes werden sollte.
Außerdem schuf der »Große Kurfürst«, wie er genannt werden sollte, eine Institution, die gewaltige Bedeutung erlangte: das preußische Heer. Als er die Herrschaft antrat, war die Armee eine kleine, wenig schlagkräftige Söldnerorganisation. Doch er war entschlossen, ein professionelles stehendes Heer aufzubauen, das Brandenburg, der »Streusandbüchse«, wie das Land abschätzig genannt wurde, Respekt verschaffen würde. 1648 kommandierte er eine Berufsarmee von 8000 Mann, genug, um ihn zu einem nützlichen Verbündeten zu machen und ihm einen Anteil am Friedensgewinn zu sichern.
Trotz der absoluten Herrschaft betonte man im Kurfürstentum nach 1648 die religiöse Toleranz. Das hatte praktische Gründe. Der Dreißigjährige Krieg hatte einen katastrophalen Bevölkerungsschwund bewirkt. In einer vernachlässigten Landschaft stieß man allerorten auf zerstörte und verlassene Bauern- und Herrenhäuser. Brandenburg-Preußen brauchte dringend Menschen, welcher Nationalität und welchen Glaubens auch immer.
Am Ende der Herrschaftszeit des Großen Kurfürsten begann der katholische französische König Ludwig XIV. in einem Anfall radikaler Frömmigkeit die bedeutende protestantische Minderheit in seinem Land zu verfolgen. 1685 verbot er den Protestantismus und begann protestantische Kirchen zu zerstören. Die französischen Protestanten, die Hugenotten, waren geschickte Handwerker und Kaufleute, fleißig und arbeitsam – also genau das, was Brandenburg-Preußen brauchte. Friedrich Wilhelm erließ das Edikt von Potsdam, in dem er die hugenottischen Flüchtlinge einlud, nach Brandenburg zu kommen. Daraufhin ließen sich mehr als 20 000 Hugenotten in Brandenburg nieder. Als der Große Kurfürst 1688 starb, stellten sie 20 Prozent der Berliner Bevölkerung. Berlin war zur Einwandererstadt geworden – und blieb es bis ins 21. Jahrhundert.
Friedrich Wilhelms Nachfolger gab die strenge Haushaltspolitik seines Vaters auf. Der Staat ließ die Zügel schleifen, und in Berlin machte sich eine freizügige Stimmung breit, wie sie erst wieder in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts entstehen sollte. Die einzige politische Leistung des neuen Kurfürsten war, dass ihm der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs 1701 die Königskrone gewährte. Fortan war er »König in Preußen« – das Wörtchen »von« kam erst später im Jahrhundert in Gebrauch.
Die verschwenderischen Ausgaben des Hofs brachten in Berlin viel Geld in Umlauf. Die Einwohnerzahl der Stadt wuchs von 4000 am Ende des Dreißigjährigen Kriegs auf 55 000 im Jahr 1713. Allerdings ging Preußen dabei bankrott.
Der neue Herrscher, der als Friedrich Wilhelm I. den Thron bestieg, war grobschlächtig und engstirnig. Doch obwohl er weder an Kunst oder Wissenschaft (außer derjenigen für militärische Zwecke) noch an den üblichen königlichen Vergnügungen interessiert war, formte er seinen Staat in vieler Hinsicht zum Besseren um, indem er das Bildungswesen und den Staatsapparat reformierte und das Heer noch schlagkräftiger und damit furchteinflößender machte. Er war ein beeindruckender und sogar herausragender Monarch. Aber am erstaunlichsten war, dass er zwar bis zu 80 Prozent des Staatshaushalts in die Armee steckte und als »Soldatenkönig« in die Geschichte einging, aber in der Praxis ein Mann des Friedens war. Die Bevölkerung von Brandenburg-Preußen wuchs auf über zwei Millionen Menschen an, und die Wirtschaft entwickelte sich prächtig.
Das persönliche Verhalten des Königs war zwanghaft, neurotisch und sogar sadistisch. Seine Späher suchten in ganz Europa nach Männern, die mindestens 1,88 Meter maßen. Sie wurden für seine Garde angeworben. War er krank oder niedergeschlagen, ließ er diese »langen Kerls« zu seinem Vergnügen paradieren und sogar durch sein Schlafzimmer marschieren. Da er das Heer als Vorbild der Gesellschaft ansah und nach einer vollkommen geordneten Gesellschaft strebte, setzte er eine brutale Disziplin durch.
In den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts wurde auf Friedrich Wilhelms Geheiß die längste Stadtmauer errichtet, die Berlin jemals gehabt hatte. Sie diente jedoch nicht der Verteidigung gegen Angreifer, sondern als Zoll- und Akzisemauer, die es dem König erlaubte, Reisende zu besteuern und auf alle Waren, die in die Stadt kamen oder sie verließen, Zölle zu erheben. Außerdem sollte sie die Zahl der Desertionen aus dem Heer des Königs verringern. Alle hundert Meter wurde ein Wachposten aufgestellt, und wenn einer der unglücklichen Soldaten bei der Flucht entdeckt wurde, alarmierte ein Kanonenschuss die benachbarten Dörfer. Wieder eingefangene Deserteure mussten Spießrutenlaufen; ein zweiter Fluchtversuch bedeutete den Tod.2 Potsdam wurde ebenfalls durch eine Mauer eingeschlossen, damit die dortige Garnison nicht ausblutete.
Friedrich Wilhelm hatte zehn Kinder. In Fortsetzung der hohenzollernschen Zickzack-Tradition war sein ältester Sohn, Friedrich, das ganze Gegenteil seines Vaters: ein schmaler, empfindsamer Junge, der sich für Kunst und Philosophie begeisterte. Um seinen Erben abzuhärten und für den Thron fit zu machen, ließ ihn Friedrich Wilhelm jeden Morgen durch einen Kanonenschuss wecken. Mit sechs Jahren bekam der kleine Fritz einen eigenen Trupp von Kinderkadetten zur Ausbildung, und bald darauf verfügte er über ein eigenes Arsenal von echten Waffen. Er erhielt Schläge, weil er sich von einem durchgehenden Pferd hatte abwerfen lassen oder weil er Schwäche gezeigt hatte, indem er bei kaltem Wetter Handschuhe anzog.
Mit 18 Jahren versuchte der Kronprinz zusammen mit einem älteren adligen Freund, Hans Hermann von Katte, aus dem Königreich zu fliehen. Sie wurden gefangen, Fritz kam in Festungshaft und musste an einem Fenster mit ansehen, wie sein Freund auf dem Paradeplatz darunter geköpft wurde. Zwei Jahre später wurde er mit einer netten, frommen Prinzessin, Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern, verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. Nach seiner Thronbesteigung lebten sie getrennt. Fritz hielt sich keine Geliebten. Seither ist seine mögliche Homosexualität Gegenstand von allerlei historischem Geschwätz.
Als Friedrich Wilhelm starb, stießen viele seiner Untertanen einen Seufzer der Erleichterung aus. Es gehört indessen zu den großen Paradoxa der europäischen Geschichte, dass der »Soldatenkönig« Frieden brachte, während sein Sohn, der »Philosophenkönig«, Krieg und Leid verursachte.
Friedrich trat im Mai 1740 die Nachfolge seines Vaters an. Im Oktober starb Kaiser Karl VI., ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen. Da der Kaisertitel, obwohl er theoretisch durch eine Wahl vergeben wurde, in Wirklichkeit zum Familieneigentum der Habsburger geworden war, drohte ein Machtvakuum. Karl hatte durch eine Gesetzesänderung dafür gesorgt, dass seine Tochter Maria Theresia ihm auf dem Thron folgen konnte, und die meisten europäischen Staaten hatten dies akzeptiert. Preußen jedoch gehörte nicht zu ihnen.
In einem Akt von skrupellosem Opportunismus ließ der »Philosophenkönig« das von seinem gehassten Vater geschaffene mächtige Heer in die benachbarte habsburgische Provinz Schlesien einmarschieren. Wenn er dieses einst zu Polen gehörende reiche Gebiet halten konnte, würde es den Wohlstand von Preußen-Brandenburg unermesslich vergrößern, denn es verfügte über landwirtschaftliche und industrielle Ressourcen sowie über Bodenschätze, die das Land dringend benötigte. Zur Rechtfertigung der Besetzung verwies Friedrich auf einen obskuren Vertrag aus dem 16. Jahrhundert, den seine Rechtsgelehrten aus den Tiefen der diplomatischen Archive ausgegraben hatten.
Dank seines ausgezeichneten Heeres gewann der junge Preußenkönig den so genannten Österreichischen Erbfolgekrieg und behielt die schlesischen Reichtümer. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Die hochintelligente und scharfsinnige Maria Theresia schloss den Frieden, den sie schließen musste, begann aber umgehend ihre Rache zu planen und ein neues Netz von Bündnissen zu spinnen, das die Macht von Österreich, Frankreich und Russland gegen den Emporkömmling Preußen vereinigte.
Als 1756 erneut Krieg drohte, führte Friedrich, gerissen wie er war, einen Präventivkrieg, indem er in das wohlhabende, aber militärisch schwache Sachsen einfiel und es für mehrere Jahre besetzte, um seinen Reichtum und sein Humankapital für seine Kriegsanstrengungen zu nutzen. »Sachsen«, bemerkte er zynisch, »ist wie ein Mehlsack. Man mag darauf schlagen, sooft man will, so kommt immer etwas heraus.« Fast 100 000 der zwei Millionen Sachsen oder fünf Prozent der Bevölkerung, einschließlich etwa des gleichen Anteils der Einwohnerschaft von Dresden, brachten die preußische Invasion und Besetzung den Tod. Ein Drittel der bebauten Fläche der sächsischen Hauptstadt wurde 1760 durch preußische Kanonenkugeln und Brandbomben zerstört. Dennoch blieb Friedrich der Große ein Nationalheld, obwohl er mehr Deutsche getötet und einen größeren Teil Deutschlands zerstört hatte als jeder andere Militärbefehlshaber vor dem Oberkommandierenden der britischen Royal Air Force, »Bomber« Arthur Harris, 200 Jahre später.
Bis 1760 hatte Friedrich indessen mehrere verheerende Niederlagen erlitten. Berlin war von Russen und Österreichern besetzt worden. Die Kapitulation erschien unabwendbar. Dann starb die russische Zarin Elisabeth. Ihr Sohn, der ihr als Peter III. auf dem Zarenthron folgte, war ein fanatischer Anhänger des preußischen Militarismus. Dieser unerwartete Deus ex Machina wendete Friedrichs Schicksal. Der junge russische Herrscher gewährte ihm einen Frieden zu günstigen Bedingungen und beendete damit den Siebenjährigen Krieg.
Darüber hinaus hatte Preußens Hauptverbündeter, Großbritannien, die Franzosen aus Nordamerika vertrieben und sich in Indien als vorherrschende Macht etabliert. Großbritannien wurde zur ersten globalen Supermacht. Sein heldenhafter Freund Friedrich von Preußen war in England überaus beliebt. Bis der Name Preußens im Ersten Weltkrieg mit Militarismus und Barbarei in Verbindung gebracht wurde, gab es dort sogar nach ihm benannte Gasthäuser, und das englisch-preußische Bündnis wurde bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auf beiden Seiten als selbstverständlich vorausgesetzt.
Der letzte Coup von Friedrichs Herrschaft war die Auflösung des fast 1000 Jahre alten Königreichs Polen. Von inneren Querelen gelähmt, stellte dieses einst mächtige osteuropäische Land für seine Nachbarn eine verlockende Beute dar. 1772 einigte sich Friedrich mit Österreich und Russland darauf, große Stücke des polnischen Staatsgebiets abzutrennen. Gut zwei Jahrzehnte später wurde Polen völlig von der Landkarte getilgt; als unabhängiges Land sollte es erst 1918 wieder erstehen. Preußen hingegen gewann ein massives, zusammenhängendes Territorium und vergrößerte seine Bevölkerung erheblich.
1786 verstarb Friedrich in Sanssouci, nur in Gesellschaft seiner Hunde und nach allen Berichten weltmüde und einsiedlerisch. Berlin hatte sich erstaunlich schnell von den katastrophalen Kriegsfolgen erholt. Es hatte 150 000 Einwohner, von denen 30 000 in Handel und Gewerbe arbeiteten und 3500 Beamte waren. Die Berliner Garnison zählte 25 000 Mann, und 20 Prozent der Einwohner waren auf irgendeine Weise mit dem Militär verbunden.3 Die Zukunft von Friedrichs Regierungssystem schien auf Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hinaus gesichert zu sein.
Drei Jahre später brach die Französische Revolution aus und veränderte alles. Der erste Ausbruch eines demokratischen Volksaufstands breitete sich wie ein Virus aus und drohte das gesamte System der ererbten Privilegien, auf dem Friedrichs Denken wie dasjenige aller anderen europäischen Monarchen beruhte, zu zerstören. Als die Revolution ihren Elan verlor, gelangte in Gestalt von Napoleon Bonaparte ein neuer Despot an die Macht.
Der größte General und erfolgreichste Eroberer der nachmittelalterlichen Welt schuf in den zwei Jahrzehnten seiner Herrschaft ein neues Europa, dessen Umrisse auch 200 Jahre später noch erkennbar sind. Der korsische Emporkömmling war die Nemesis des alten Preußen. Und, zumindest auf kurze Sicht, von Berlin.
Am 27. Oktober 1806 ritt Napoleon in Berlin ein. Zwei Wochen zuvor hatte er den preußischen Truppen einen schweren Doppelschlag versetzt. Die Franzosen hatten zuerst bei Jena und dann, wenige Reitstunden entfernt, bei Auerstedt die Oberhand gewonnen. Der Sieg gegen die über 100 000 Mann zählende preußische Streitmacht war total. Bei Auerstedt waren die Truppen Friedrichs III. dem Gegner zweifach überlegen gewesen, und dennoch hatten sie vor den disziplinierten Franzosen die Flucht ergriffen.
Napoleon führte seine siegreiche Armee durchs Brandenburger Tor und über den breiten Boulevard Unter den Linden ins Zentrum der Stadt. Das beeindruckende Tor mit seinen klassizistischen Säulen war eine neue, größere Öffnung in der jetzt 17 Kilometer langen und 4,20 Meter hohen Zollmauer, welche die Mitte Berlins immer noch umgab. Entworfen hatte es der berühmte Architekt Carl Gotthard Langhans, und es war erst wenige Jahre zuvor fertiggestellt worden. Gekrönt wurde es von einer riesigen steinernen Quadriga, einem vierspännigen Streitwagen, dem Siegessymbol der antiken Olympischen Spiele, die der Bildhauer Johann Gottfried Schadow geschaffen hatte. In diesem Fall trug die Siegesgöttin, die den Wagen lenkte, einen Olivenzweig als Zeichen des Friedens, was ihr einen zwar freundlichen, aber wohl allzu optimistischen Anstrich verlieh.
Anfangs hatten jene Berliner, die mehr Freiheit wünschten, insbesondere das nicht wahlberechtigte Bürgertum, auf Napoleon gehofft. Der Kaiser versprach politische Reformen und sogar eine Verfassung. Erstmals wurde eine Stadtverordnetenversammlung gewählt. Die wahren Absichten des Kaisers wurden jedoch bald offensichtlich. Er betrachtete Berlin und Preußen als Geldmaschine und Menschenreservoir und gedachte dort ein weiteres Marionettenregime im französisch beherrschten Europa zu errichten. Das verarmte Preußen, das bereits riesige Gebiete verloren hatte und nur noch über ein Heer von etwas mehr als 40 000 Mann verfügte (von denen 16 000 für Napoleons weitere militärische Abenteuer bereitzustehen hatten), musste Hunderte Millionen Francs an Reparationen und Besatzungskosten zahlen. Darüber hinaus gingen die Franzosen daran, die Hauptstadt ihrer Schätze zu berauben, einschließlich der Quadriga des Brandenburger Tors, die wie alles andere nach Paris geschafft wurde. Und das war nur die offiziell requirierte Kriegsbeute. Mit 25 000 bei ihren Bürgern einquartierten, häufig ungehobelten französischen Besatzungssoldaten erlebte die Stadt eine dunkle Zeit wie in den nächsten 150 Jahren nicht mehr.
Napoleon selbst schien erstaunt zu sein, wie leicht ihm Preußen zugefallen war. Kurz vor seinem Einzug in Berlin hatte er dem Grab Friedrichs des Großen in der Krypta der Potsdamer Garnisonkirche einen Besuch abgestattet und zu seinen Offizieren gesagt: »Entblößen Sie Ihr Haupt, meine Herren! Wenn er noch lebte, stünden wir nicht hier!«4
Nicht nur die breite Bevölkerung war nun gezwungen, das unterlegene System, unter dem sie gelebt hatte, kritisch unter die Lupe zu nehmen, sondern auch die preußische Elite. Einige der nachfolgenden Reformen dienten dazu, Preußen effektiver zu verwalten. Andere sollten seine Militärmacht erneuern. Unter den gegebenen Umständen musste dies insgeheim geschehen, etwa als General Scharnhorst eine Landwehr aufstellte, die die von Napoleon festgelegten militärischen Beschränkungen umging, indem sie als Bürgerarmee wechselnde, auf Zeit dienende Rekruten ausbildete. Ihre offizielle Stärke mag die vorgeschriebene Obergrenze nie überschritten haben, doch stand dem König 1813 von heute auf morgen ein Heer von 280 000 Mann zur Verfügung.
Unter der relativ ruhigen Oberfläche gärte ein rebellischer Geist. Die franzosenfeindlichen Kräfte in Preußen und überall in Deutschland warteten bloß auf eine günstige Gelegenheit. Im Juni 1812 fiel Napoleon, nachdem er aus ganz Europa, einschließlich Preußens, eine Million Männer zusammengezogen hatte, in Russland ein. Er gewann jede große Schlacht, und doch endete der Feldzug in einer Katastrophe. Im strengen Winter 1812/13 floh seine Grande Armée aus dem in Flammen stehenden Moskau und musste sich durch Schnee und Eis auf den Rückmarsch ins sichere Mitteleuropa machen, von Kosaken gejagt und von Kälte, Hunger und Krankheiten geplagt. Nur 18 000 Mann kehrten über die Memel nach Polen zurück.
Der preußische König Friedrich III., der Napoleon für seinen verheerenden Marsch auf Moskau widerspruchslos 20 000 Mann zur Verfügung gestellt hatte, wechselte schließlich die Seite. Das gesamte preußische Heer wandte sich gegen Napoleon, und die heimlich ausgebildeten Männer sammelten sich um die Fahnen. Eigens für sie entwarf der Architekt und Maler Karl Friedrich Schinkel eine Tapferkeitsmedaille, die jedem heldenhaften Kämpfer, unabhängig vom Rang, verliehen werden konnte. Sie wurde Eisernes Kreuz genannt.
Von der Welle eines idealistischen, romantischen Nationalismus getragen, erhoben sich Preußen, die deutschen Länder und das übrige Europa in den so genannten Befreiungskriegen gegen die französische Herrschaft. Napoleon wurde besiegt und verbannt. In Berlin und anderswo hofften viele auf ein neues, besseres Deutschland. Aber in Berlin, Preußen und Deutschland entstand mitnichten eine schöne neue Welt. Stattdessen erlebte man in den folgenden Jahren eine gemeinsame Anstrengung, den Geist der Reform wieder in die Flasche zu sperren. Die siegreichen absoluten Herrscher glaubten die Uhr ins 18. Jahrhundert zurückdrehen zu können, und 40 Jahre lang hatte es den Anschein, als wäre es ihnen gelungen. Jede Diskussion über nationale Befreiung und bürgerliche Freiheiten wurde unterdrückt, in Preußen genauso wie andernorts.
Es war eine aussichtslose Anstrengung. Preußen war nicht mehr die karge, abgelegene Streusandbüchse im Osten der deutschen Lande. Es hatte große Territorien in Westdeutschland erworben, etwa im Rheinland und in Westfalen. Dabei handelte es sich um überwiegend katholische, landwirtschaftlich fruchtbare Gebiete mit reichen Kohle- und Erzvorkommen, die für die Zukunft des Staates von entscheidender Bedeutung waren. Bald verwandelten sich die neupreußischen Städte im Westen in dynamische Industriezentren. In den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Eisenbahnstrecken gebaut. Die Berliner Zoll- und Akzisemauer wurde 1840 zum letzten Mal ausgebessert. 20 Jahre später wurde das ganze, 17 Kilometer lange Bauwerk abgerissen, und Berlin konnte endlich seine Grenzen ausdehnen. Danach lebte die Stadt rund 100 Jahre lang ohne eine innere Mauer.5
Die Industrie in der Hauptstadt wuchs rasch, geriet in den späten vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts jedoch in eine Krise. 1848 brach in Frankreich eine Revolution aus, und die Bewegung breitete sich nach Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien aus. In Preußen kamen alle seit dem Sieg über Napoleon unterdrückten Leidenschaften erneut zum Vorschein: der Wunsch nach einem vereinigten Deutschland sowie nach politischer Repräsentanz und geistiger Freiheit.
Auch in Berlin kam es zum Aufstand, an dem sich sowohl das Bürgertum als auch das rasch wachsende Industrieproletariat beteiligten. Nach blutigen Zusammenstößen mit den in der Stadt stationierten Truppen willigte König Friedrich Wilhelm IV., ein wohlwollender Reaktionär, schließlich darin ein, Wahlen abzuhalten. Er ernannte zudem eine liberale Regierung. Die Liberalen bildeten eine »Bürgerwehr«, die mehr als nur zufällige Ähnlichkeiten mit der Landwehr der Befreiungskriege aufwies, und wählten anstelle der schwarz-roten Fahne des alten Regimes das schwarz-rot-goldene Banner der vorrevolutionären Radikalen als Flagge. Diese hofften nun auf ein neues Preußen in einem vereinigten Deutschland mit einem demokratischen, freien Berlin als Zentrum.
Doch erneut erlebten die Optimisten eine Enttäuschung. Die Bürgerwehr wurde gegen Arbeiter eingesetzt, die neben der politischen auch eine soziale Revolution forderten. Seit Jahrhunderten hatten die Berliner mehr oder weniger freiwillig bürgerliche Freiheiten gegen Sicherheit eingetauscht, und es gab Anzeichen dafür, dass sie der demokratischen Experimente bereits überdrüssig wurden.
Die Reaktionäre, die sich in den Schmollwinkel ihrer Anwesen zurückgezogen und Rachepläne geschmiedet hatten, sahen ihren Augenblick gekommen. Im November 1848 rief der König die aus Berlin abgezogenen Truppen zurück, und Anfang Dezember löste er die neu gewählte Nationalversammlung auf. Angesichts der Truppen des königstreuen Generals Friedrich von Wrangel erklärte der Kommandeur der das Parlament verteidigenden Bürgerwehr, er weiche »nur der Gewalt«, worauf Wrangel trocken erwiderte: »Dann sollten Se jetzt weichen, Herr Major, de Jewalt is nämlich da.« Fortan sollte die Gewalt in Berlin stets »da sein«, ob von rechts oder später von links.
Preußen erhielt ein Parlament eigener Art, das aufgrund des Wahlrechts vom Erb- und Geldadel dominiert wurde und nicht befugt war, Minister zu ernennen. Die neue Leidenschaft Friedrich Wilhelms IV. für die deutsche Einheit verflüchtigte sich angesichts des Widerstands der Habsburger. Noch fast 20 Jahre lang sollte der Kaiser in Wien das Geschehen in Deutschland bestimmen, auch wenn sich die politische und wirtschaftliche Machtverteilung längst zugunsten Preußens verlagert hatte.
Es bedurfte eines weiteren Reaktionärs, des cleversten in der deutschen Geschichte, um diese Tatsache in machtpolitische Fakten umzusetzen. 1862 wurde Otto von Bismarck Ministerpräsident von Preußen. Knapp ein Jahrzehnt später sollten die Deutschen eine geeinte Nation haben, allerdings unter völlig anderen Bedingungen, als die Berliner Revolutionäre von 1848 es sich vorgestellt hatten, und ganz gewiss nicht die, die sie sich gewünscht hatten.
Als Friedrich Wilhelm IV. im Januar 1861 starb, war sein Bruder, der ihm als Wilhelm I. auf dem Thron folgte, mit einem Verfassungskonflikt konfrontiert. Obwohl das Wahlrecht die besitzenden Schichten begünstigte, hatten die Liberalen (die »Fortschrittlichen«) seit 1848 die Parlamentsmehrheit erobert, und sie verlangten Machtbefugnisse, die ihnen die herrschende Elite nicht zu geben bereit war. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, verweigerten sie dem jährlichen Staatshaushalt, der unter anderem die Mittelzuteilung für eine Heeresreform enthielt, ihre Zustimmung.
Wilhelms Lösung bestand darin, anstelle eines Liberalen den 46-jährigen Otto von Bismarck, einen raubeinigen pommerschen Landjunker und glühenden Verfechter der göttlichen Rechte des Königs, zum Ministerpräsidenten zu ernennen. Als ehemaliger Botschafter in Russland und Frankreich kannte Bismarck das Spiel der Politik, und er fand einfallsreiche Mittel, um das Etatproblem zu umgehen. Anderthalb Jahre stand er auf diese Weise durch, von allen gehasst, aber mit der Rückendeckung des Königs.
Sein Durchbruch kam, als nach dem Tod des damaligen dänischen Königs ein internationaler Streit über den Status der an Dänemark angrenzenden Herzogtümer Schleswig und Holstein entbrannte, die zwar in Personalunion von der dänischen Krone regiert wurden, aber formal dem Deutschen Bund angehörten. Der dänische Thronfolger schlug vor, Nordschleswig ganz in sein Königreich einzugliedern. Die Deutschen lehnten dies ab. 1864 besetzte Preußen im Namen aller deutschen Staaten gemeinsam mit Österreich die beiden Herzogtümer. Das Einvernehmen mit Wien hielt ungefähr ein Jahr, dann zerstritt man sich in der Frage des endgültigen Schicksals der besetzten Gebiete. Die Folge war 1866 ein Krieg, in dem die meisten anderen deutschen Staaten auf der Seite Österreichs standen. Die preußischen Armeen trugen einen raschen Sieg davon. In nur sieben Wochen zerschmetterten sie die Truppen Österreichs und seiner Verbündeten. Unmittelbar nach dem Sieg nutzte Bismarck die Welle der nationalen Begeisterung und hielt Wahlen ab. Die Fortschrittlichen erlitten eine schwere Niederlage, sodass sich der konservative Ministerpräsident nunmehr auf eine konservative Parlamentsmehrheit stützen konnte.
Die formale Einigung Deutschlands kam 1871 nach dem letzten von Bismarcks siegreichen Kriegen zustande, den er diesmal gegen Frankreich geführt hatte. Wilhelm I. von Preußen wurde Kaiser Wilhelm I. – und Bismarck sein Reichskanzler. 1862 hatte er im Parlament in Berlin mit grimmiger Miene gesagt: »Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden […], sondern durch Eisen und Blut.« Tragischerweise hatte er nur allzu Recht, und zwar nicht nur hinsichtlich des 19., sondern auch des 20. Jahrhunderts.
Damit war die Bühne bereitet für ein Geschehen, das manche als »Revolution von oben« bezeichnen sollten. Architekt dieser ebenso faszinierenden wie ominösen neuen Entwicklung war Bismarck. Berlin sollte sich im Verlauf der Umwandlung des Landes in Gebiete ausdehnen, die jahrhundertelang als unbewohnbare, nicht sehr vielversprechende und unersprießliche Ansammlung von Sand und Seen gegolten hatten, und zu einer großen, glitzernden Weltstadt werden.
2.
Die Roten
Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war Berlin die zweitgrößte Stadt Europas. Seit der Reichsgründung 1871 hatten eine massive Industrialisierung, eine atemberaubende Ausweitung der Bautätigkeit und eine gewaltige Zunahme des Wohlstands, insbesondere für die Mittel- und Oberschicht, die deutsche Hauptstadt in eine mit San Francisco und Chicago vergleichbare boomende Stadt verwandelt.
Große, häufig aus dunkelgrauem Stein erbaute Wohnblocks breiteten sich von der Stadtmitte immer weiter in die peripheren Stadtteile aus, insbesondere in Richtung Osten. Diese Mietskasernen, wie sie genannt wurden, besaßen zumeist mehrere hintereinander liegende Innenhöfe. Je weiter man nach innen kam, desto weniger Licht und Luft kam herein, und die Wohnungen wurden immer kleiner und billiger. Im Westen, außerhalb des historischen Zentrums, fraßen sich gleichzeitig die Viertel für Wohlhabende in die Felder und schluckten die Seenlandschaft der Umgebung. Die neureichen Bürger und Akademiker verlangten nach Platz und Natur. In Bezirken wie Grunewald, Wilmersdorf und Zehlendorf entstanden immer mehr attraktive Wohnhäuser, die sich einander im Stil, sei es in Form von klassischen, mit Säulen geschmückten Villen oder von mittelalterlichen Burgen mit Erkern und Türmchen, zu übertreffen versuchten.
Während Bismarcks langer Amtszeit als erster Kanzler des zweiten Deutschen Reichs (1871 bis 1890) erlosch die liberale Flamme, die in der Mitte des Jahrhunderts so hoch aufgelodert war, fast völlig. Viele Liberale schlossen sich seiner reaktionären Politik an; um ihren Standpunkt deutlich zu machen, nannten sie sich Nationalliberale. Das deutsche Bürgertum begnügte sich damit, anstelle einer wahrhaft repräsentativen Regierung Wohlstand, Macht und Ansehen zu erhalten.
Nach der Reichseinigung war ein nationales Parlament, der Reichstag, geschaffen worden. Bismarck ließ ihn auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts von Männern wählen und verlieh ihm damit einen demokratischen Anstrich, enthielt seinen Abgeordneten aber jede Mitsprache bei der Bildung der Reichsregierung vor. Diese blieb das Vorrecht des Kaisers. Wer wie viel Mandate gewann, war daher kaum von Bedeutung. Diese Form der autoritären Regierung war Bismarcks problematischste Hinterlassenschaft.
Die »Verpreußung« Deutschlands ging mit Riesenschritten voran. Ein großes nationales Wehrpflichtigenheer nach preußischem Vorbild sorgte dafür, dass jeder deutsche Mann von militärischen Werten geprägt wurde. Das neue Regime verwandelte den liberalen Gedanken der Landwehr geschickt in ein den autoritären Status quo stärkendes Element. Der Offizier in Uniform wurde nicht nur in kleinen Garnisonstädten, sondern auch im großen, kosmopolitischen Berlin zu einer geachteten Figur mit vielen Privilegien. Zwar mochten Offiziere in der Öffentlichkeit nicht mehr Soldaten schlagen, wie sie es im 18. Jahrhundert noch getan hatten, aber sie mussten sich in Geschäften nicht anstellen und bekamen in Restaurants immer einen Tisch. Besonders ausländischen Besuchern fiel ihre Haltung arroganter Unangreifbarkeit unangenehm auf.
Das Berlin des Jahres 1914 war freilich nicht nur ein großer Militärstandort, sondern auch Weltmetropole und bedeutende Industriestadt. Besonders die neuen, dynamischen Branchen wie die Elektro- und die Chemieindustrie waren vertreten. In dieser »zweiten industriellen Revolution« zog Deutschland, ebenso wie im Werkzeugbau und in der Stahlerzeugung, rasch an Großbritannien vorbei. Das Deutsche Reich war die größte und leistungsstärkste Wirtschaftsmacht Europas, die weltweit nur den Vereinigten Staaten den Vorrang lassen musste. Zugleich erlebte es eine literarische und journalistische Blüte, die in Europa ihresgleichen suchte.
Wo also lag das Problem? Warum wurde das 20. Jahrhundert, das in Deutschland und Europa mit so viel Hoffnung und Dynamik begonnen hatte, die katastrophalste Periode der Geschichte?
Gewiss hatte das kaiserliche Deutschland seine Neurosen. Aber die hatten Großbritannien und Frankreich auch; man denke nur an die Dreyfusaffäre. Gewiss war Deutschland chauvinistisch und unsicher. Aber auch in Großbritannien und Frankreich war ein widerwärtiger Hurrapatriotismus verbreitet, und die Städte waren Brutstätten bedrohlicher sozialer Ängste und einer Vielzahl an politischen Bewegungen, die niedere Instinkte bedienten.6 Die deutsche Gesellschaft war militaristisch, aber auch in der britischen gab es solche Tendenzen, wie man beispielsweise an der Popularität der britischen Pfadfinderbewegung ablesen kann, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Militär in Diensten des Empire ins Leben gerufen worden war und letztlich nichts anderes war als eine Organisation zur militärischen Ausbildung von Jungen.
Als Gegengewicht zur nationalistischen Fremdenfeindlichkeit war in Deutschland überdies der marxistische Internationalismus zu einer überaus mächtigen politischen Kraft herangewachsen. Die 1875 gegründete Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD), die spätere SPD (ab 1890), wurde zur bestimmenden Massenbewegung der rasch wachsenden deutschen Arbeiterklasse. Noch bevor die britische Labour Party überhaupt existierte, zählte die sozialistische Bewegung in Deutschland bereits über eine Million Mitglieder und war durch eine große Zahl von Abgeordneten im Reichstag vertreten. Das Netz der von ihr unterhaltenen Klubs, Debattiergesellschaften, Selbsthilfegruppen, Gewerkschaften und Fürsorgeeinrichtungen bildete geradezu eine Parallelgesellschaft zur herrschenden Gesellschaft.
1881 hatte Bismarck die erste umfassende staatliche Sozialversicherung geschaffen, vor allem, um dem sich unter den deutschen Arbeitern ausbreitenden Sozialismus die Spitze zu nehmen. Er rang dem Kaiser die Zustimmung zu einem beitragspflichtigen Versicherungssystem ab, das die Arbeiter vor den schlimmsten Armutsfolgen von Krankheit und Alter schützte. Auf diese Weise hoffte er, die Massen an den autoritären Status quo zu binden. Doch während er Deutschland durch die Einführung der Sozialversicherung gegenüber der übrigen Welt einen Vorsprung von Jahrzehnten verschaffte, beging er gleichzeitig einen schweren Fehler, für den das Land weit über das Ende seiner Kanzlerschaft hinaus zahlen musste: Er versuchte die sozialistische Bewegung zu unterdrücken. Deren Mitglieder bezeichnete er als »Reichsfeinde« und »Ratten«, die man vernichten müsse.
Nachdem der Kaiser 1878 zwei Attentaten entgangen war, ergriff Bismarck die Gelegenheit und erließ das so genannte Sozialistengesetz, das die SAPD verbot. Zeitungen mussten ihr Erscheinen einstellen, Wohnungen und Büros wurden durchsucht, Aktivisten und Redakteure ins Gefängnis geworfen oder ins Exil getrieben (insbesondere nach Amerika). Dennoch konnte Bismarck nicht verhindern, dass einzelne Sozialisten bei Wahlen antraten oder Gewerkschaften gegründet wurden, solange sie formal keinerlei Verbindungen zu der verbotenen Partei hatten.
Das Sozialistengesetz, dessen Gültigkeitsdauer regelmäßig vom Parlament verlängert wurde, war bis 1890 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt saßen gleichwohl 35 Sozialdemokraten als Vertreter einer illegalen Partei trotzig im Reichstag. Tatsächlich hatte die Unterdrückung die sozialistische Bewegung stärker, aufmüpfiger und selbstbewusster gemacht. Bismarcks Versuch, die politische Entwicklung aufzuhalten, war nach zwölf Jahren katastrophal gescheitert.
Im März 1888 starb, wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag, Kaiser Wilhelm I. Sein Nachfolger, Friedrich III., war ein enthusiastischer Liberaler, worin ihn seine Frau, die britische Prinzessin Viktoria, bestärkte. Tragischerweise war er bei seiner Thronbesteigung bereits an Kehlkopfkrebs erkrankt, und die Krankheit setzte seiner Regentschaft schon nach 99 Tagen ein Ende. Sein Sohn und Nachfolger, Wilhelm II., sollte 30 Jahre lang herrschen und das prosperierende, vereinigte, dynamische Deutschland, das er vorfand, in eine unvorstellbare Katastrophe führen. Er war sowohl vom Gottesgnadentum seiner Herrschaft als auch von Deutschlands ebenso gottgegebener Vormachtstellung in der Welt überzeugt. Nach seiner Ansicht hatte es aufgrund seiner neuen Stärke Anspruch auf einen »Platz an der Sonne«.