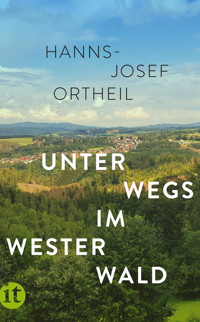11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im heißen Sommer des Jahres 1967 geht Hanns-Josef Ortheil zusammen mit seinem Vater auf große Fahrt. Sie führt auf einem schwer beladenen Frachtschiff von Antwerpen durch die Meerenge von Gibraltar ins Mittelmeer und weiter bis nach Griechenland und Istanbul. Mit an Bord ist – vom Steward über den Funker bis zum Kapitän – eine ganze Gesellschaft im Kleinen. Und auch die Angst fährt im Bauch dieses Ungetüms aus Eisen und Stahl, das auf hoher See in schwere Stürme gerät, beständig mit.
Der junge Hanns-Josef Ortheil begegnet dem auf seine Weise: er beobachtet, reflektiert, schreibt. Zwischen Kommandobrücke, Frachtraum und Schiffsbibliothek beginnt seine Suche nach Fixpunkten und dem, was für ihn zählt und weiterhilft: Die Lektüre Homers? Die neusten Songs der Beatles? Das Klavierspiel? Die Arbeit an der Bordzeitung? Die Freundschaft mit einer jungen Griechin? Oder die Aussteigerfantasien eines Besatzungsmitglieds? Immer reichhaltiger und intensiver wird die abenteuerliche Reise in unbekannte Gewässer, weit über frühere Ideen und Fantasien hinaus: der große Roman einer Odyssee ins Erwachsenenleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 877
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Im heißen Sommer des Jahres 1967 geht Hanns-Josef Ortheil zusammen mit seinem Vater auf große Fahrt. Sie führt auf einem schwer beladenen Frachtschiff von Antwerpen durch die Meerenge von Gibraltar ins Mittelmeer und weiter bis nach Griechenland und Istanbul. Mit an Bord ist – vom Steward über den Funker bis zum Kapitän – eine ganze Gesellschaft im Kleinen. Und auch die Angst fährt im Bauch dieses Ungetüms aus Eisen und Stahl, das auf hoher See in schwere Stürme gerät, beständig mit.
Der junge Hanns-Josef Ortheil begegnet dem auf seine Weise: er beobachtet, reflektiert, schreibt. Zwischen Kommandobrücke, Frachtraum und Schiffsbibliothek beginnt seine Suche nach Fixpunkten und dem, was für ihn zählt und weiterhilft: Die Lektüre Homers? Die neusten Songs der Beatles? Das Klavierspiel? Die Arbeit an der Bordzeitung? Die Freundschaft mit einer jungen Griechin? Oder die Aussteigerfantasien eines Besatzungsmitglieds? Immer reichhaltiger und intensiver wird die abenteuerliche Reise in unbekannte Gewässer, weit über frühere Ideen und Fantasien hinaus: der große Roman einer Odyssee ins Erwachsenenleben.
Zum Autor
HANNS-JOSEF ORTHEIL wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den beliebtesten und meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis und dem Hannelore-Greve-Literaturpreis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
HANNS-JOSEF ORTHEIL
Die Mittelmeerreise
Roman eines Heranwachsenden
LUCHTERHAND
Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning
On an ever-spinning reel
Like a snowball down a mountain
Or a carnival balloon
Like a carousel that’s turning
Running rings around the moon
Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes of its face
And the world is like an apple
Whirling silently in space
Like the circles that you find
åIn the windmills of your mind
(in remembrance of Noel Harrison, 1968)
Die Ankunft
Um 8.48 Uhr kamen Papa und ich in Antwerpen an. Wir waren die Nacht durch gefahren, von Köln über Brüssel (dort waren wir umgestiegen). Im Bahnhof von Antwerpen tranken wir zunächst einen Kaffee, wir waren sehr müde, denn wir hatten während der Nachtfahrt keine Minute geschlafen. Papa sagte, er wünsche sich Seife und eine Dusche, sein Gesicht fühle sich verspannt und verklebt an und außerdem störten ihn die Bartstoppeln. Ich betrachtete sein Gesicht genauer und konnte weder etwas Verspanntes noch Verklebtes erkennen, Bartstoppeln dagegen waren sehr viele zu sehen. Papa sah aus wie ein Mann, der sich tagelang nicht rasiert hat, denn Papas Bart wächst sehr schnell, so dass man ihn, wenn man ihn bändigen will, jeden Morgen rasieren muss.
»Ich sehe scheußlich aus, nicht wahr?« fragte er, und ich antwortete, es sei halb so schlimm, lediglich der Bart sei etwas auffällig. »Halb so schlimm ist schlimm genug«, antwortete Papa, und dann sagte er, er werde sich sofort den Bart rasieren lassen, koste es, was es wolle. Mit so einem scheußlichen Bart werde er die Stadt Antwerpen nicht betreten, und erst recht werde er sich damit nicht auf dem Schiff präsentieren. Was sollten der Kapitän und die Mannschaft an Deck von ihm denken, wenn er mit einem solchen Bart erscheine? Man werde ihn für einen Hafenarbeiter halten, der nächtelang nicht geschlafen, sondern durchgefeiert habe.
»Aber was sollte der Hafenarbeiter gefeiert haben?« fragte ich, und Papa antwortete: »Er hat das Wochenende durchgefeiert, heute ist Montag.« – »Richtig«, sagte ich und schaute Papa wieder an, »heute ist wirklich Montag!«, und Papa lachte und tat so, als wäre ihm etwas Unerwartetes, Geniales eingefallen. Ich musste auch lachen, und dann gingen wir durch den Bahnhof und suchten nach einem Friseur, der Papa den Bart rasieren würde.
Jeder von uns hatte einen Koffer (Papa einen halbgroßen, ich einen leichten, kleineren) sowie einen Rucksack dabei. Wir hielten das nicht für viel Gepäck, und es war auch wahrhaftig kein Mordsgepäck, sondern leicht zu tragen. »Gut, dass wir kein schweres Gepäck mitgenommen haben«, sagte Papa, »wenn es nach Deiner Mutter gegangen wäre, hätte jeder von uns mindestens zwei Reisetruhen mitnehmen müssen, auf jeder Schulter eine.«
Er lachte wieder, denn er war anscheinend trotz der Müdigkeit guter Laune. Ich war nicht ganz so guter Laune, und das kam daher, dass ich zu aufgeregt für eine entspannte, gute Laune war. Ich musste an das Schiff, den Kapitän und die Mannschaft denken, die uns jetzt im Hafen erwarteten, und mir wäre es am liebsten gewesen, wir wären sofort dorthin gefahren, anstatt vorher noch Papas Bart auf Vordermann oder sogar ganz zum Verschwinden zu bringen.
Papa aber entdeckte dann wirklich einen Friseur und stürmte sofort in den Laden, »in zehn Minuten kannst Du wieder vorbeikommen«, rief er. Wir verstauten unser Gepäck in dem Friseurgeschäft, und ich drehte eine kleine Runde durch den Bahnhof, was mich aber nicht beruhigte, sondern eher noch aufgeregter machte. »Verdammt nochmal«, sagte ich mehrmals zu mir, »sei doch nicht so nervös! Es geht ja schließlich nicht um Leben und Tod!«
Den Spruch, dass »es nicht um Leben und Tod gehe«, hatte ich von Papa übernommen. Er sagte das häufig, denn er mochte es überhaupt nicht, wenn Menschen in seiner Umgebung nervös waren oder sich übermäßig aufregten. Er selbst blieb fast immer gelassen, ich kannte keinen anderen Menschen, der so gelassen blieb, und ich bewunderte das sehr, denn natürlich wäre auch ich viel lieber so gelassen gewesen, weil man als gelassener Mensch alles viel deutlicher und gründlicher erlebt. Die Nicht-Gelassenen bringen sich wegen ihrer Nicht-Gelassenheit oft um die starken Eindrücke und zappeln nur so durch die Welt, von einer Aufregung zur nächsten, während die Wirklich-Gelassenen vom Leben viel mehr mitbekommen.
Um mich zu beruhigen, setzte ich mich auf eine Bank und versuchte, die Menschen in meiner Umgebung zu beobachten. Was fiel mir an ihnen auf? Was war anders als zu Hause? Ich gab mir Mühe mit solchen Beobachtungen, aber ich bemerkte nichts wirklich Interessantes, wahrscheinlich war ich viel zu müde für das genaue, gescheite Beobachten. Blöderweise ging mir auch Papas Hafenarbeiter nicht aus dem Kopf, seine Erscheinung spukte durch mein Hirn, und mir waren vor lauter Müdigkeit fast die Augen zugefallen, weil sich der Antwerpener Hafenarbeiter dort festgesetzt und die Traumphase eingeleitet hatte.
Der Hafenarbeiter (10. Juli 1967, ohne Uhrzeit)
Henri hatte den gestrigen Sonntag und auch den Tag zuvor durchgefeiert. Fast all seinen Lohn hatte er für Bier und Schnaps ausgegeben, und außerdem hatte er sich etwas Gutes zu essen gegönnt. Sonntagnacht hatte er nicht mehr nach Hause gefunden und stattdessen im Hafengelände geschlafen. Im Hafengelände fühlte er sich wohler als in seinem wirklichen Zuhause, denn dieses wirkliche Zuhause bestand nur aus einem einzigen Zimmer am anderen Ende der Stadt. Nicht einmal einen Kühlschrank besaß er und nicht einmal einen Herd, er war ein armer Teufel, der sich unterwegs von Sachen ernährte, um die er bettelte oder die er mitgehen ließ, wenn einer der Wurstverkäufer einmal nicht aufpasste oder nicht schnell genug war. Henri tat dann so, als wollte er zahlen, ließ sich aber zunächst die Wurst geben. Hielt er sie in Händen, rannte er so schnell wie möglich davon. Kein Wurstverkäufer hatte ihm je folgen können, denn alle hatten ja bei ihrem Stand bleiben und ausharren müssen. Wäre aber einer von ihnen ihm dennoch gefolgt und nachgelaufen, hätte er ihn mühelos abgehängt, denn Henri war mit seiner Größe von 1,80 Meter und einem Gewicht von 70 Kilo ein guter Sprinter, den so schnell niemand einholen konnte …
Ich wachte wieder auf, Herrgott, ich war wirklich eingeschlafen und hatte von Papas Hafenarbeiter geträumt. So etwas passierte mir oft, ich hörte mit dem anstrengenden Beobachten der Welt auf und begann stattdessen zu träumen – und dann träumte ich manchmal von bestimmten Menschen, als wäre ich der Regisseur eines Films und als hörte ich meiner eigenen Erzählung zu, die wie ein ruhiger Monolog parallel zu den Bildern lief. Die Bilder waren immer schwarz-weiß, ohne Ausnahme, alle meine Träume waren Schwarz-Weiß-Filme, und ich verstand nicht, warum es mir nicht wenigstens einmal gelang, in Farbe zu träumen. Es war eben so, und ich konnte tun, was ich wollte, es gelang einfach nicht.
Ich stand rasch auf und ging zu dem Friseurladen zurück, Papa stand vor einem Spiegel und fuhr sich mit der rechten Hand durchs Gesicht. »Wo bleibst Du denn?« fragte er, »Du bist ja schon über eine halbe Stunde weg.« Ich starrte ihn an, denn er sah ganz anders aus, als er je ausgesehen hatte. Die Haare glänzten und lagen eng am Kopf, und er roch stark nach einem Rasierwasser, als hätte der Friseur eine halbe Flasche über das gesamte Gesicht verteilt. »Was schnüffelst Du denn so?« fragte Papa, und ich sagte, dass ich ihn kaum noch wiedererkenne, so verändert sehe er aus. »So ein Unsinn!« antwortete er, »ich sehe aus wie immer!«
Ich sagte nichts mehr zu seinem Aussehen und dem starken Duft, den er verbreitete, sondern wartete, was als nächstes geschehen würde. Papa aber wartete auch, ich vermutete, dass er auf meine Antwort wartete, ich antwortete aber nichts mehr, denn ich musste den seltsamen Eindruck, den Papa hinterließ, erst einmal verarbeiten. Hätte ich etwas gesagt, so hätte ich behauptet, er sehe aus wie ein italienischer Mafiaboss, der jeden Tag zu seinem Friseur geht und sich mit Rasierwasser und anderen Duftwässerchen überschütten lässt.
Als wir beide einige Zeit darauf gewartet hatten, was der andere noch sagen würde, sagte Papa: »Ich habe mit dem Agenten der Reederei telefoniert. Er hat mir die Nummer des Liegeplatzes gegeben, an dem unser Schiff festgemacht hat. Wir nehmen jetzt ein Taxi und fahren hin, dann sehen wir weiter.« Ich nickte kurz, dann griffen wir nach unserem Gepäck und verließen den Bahnhof.
Unterwegs sagte Papa, der Friseur habe ihn gut und rasch rasiert und ihm sogar noch die Haare gewaschen. Er habe sie geföhnt und getrocknet und mit einem Haarwasser parfümiert, und dann habe er die Haare noch gegelt und das Gesicht mit einem Rasierwasser behandelt. Niemand habe ihn darum gebeten, aber der Friseur habe nichts zu tun gehabt, und so habe er sich eine Sonderbehandlung ausgedacht. »Fast umsonst«, sagte Papa und lachte schon wieder. Als ich nicht mitlachte, drehte er sich nach mir um und fragte: »Sieht es schlimm aus?« Ich schüttelte den Kopf und antwortete: »Nein, nicht schlimm, nur anders, sehr anders.«
Da sagte Papa zunächst nichts mehr, und wir stiegen in ein Taxi, und Papa versuchte, sich mit dem Taxifahrer zu verständigen. Auf Deutsch ging es natürlich nicht, auf Französisch auch nicht, da sprach Papa Englisch, und ich hörte ihn zum ersten Mal seit vielen Jahren Englisch sprechen. (Wann hatte ich ihn das letzte Mal Englisch sprechen hören, wann genau war das gewesen? Ich überlegte krampfhaft, aber ich kam nicht darauf. Schließlich vermutete ich sogar, dass ich ihn noch nie in meinem Leben hatte Englisch sprechen hören.)
»Worüber denkst Du nach?« fragte Papa, als das Taxi losfuhr. Er saß vorne neben dem Fahrer, und ich saß hinten, mit unseren beiden Rucksäcken. Die Frage überrumpelte mich, denn ich wollte nicht sagen, dass ich über Papas Englisch nachgedacht hatte, und so antwortete ich: »Ich bin ziemlich aufgeregt. Und ich bin sehr gespannt, wie unser Schiff aussieht.« Papa lachte noch einmal, und da wusste ich, dass er auch etwas aufgeregt war und laufend lachte, um die Aufregung zu überspielen. »Du bist auch etwas aufgeregt, oder?« fragte ich, da drehte Papa sich zu mir um und sagte: »Ehrlich gesagt: Ja, bin ich.« – »Sonst bist Du niemals aufgeregt«, antwortete ich. – »Wirklich nicht?« sagte Papa, und dann drehte er sich wieder um und schaute stumm auf die Straße, so dass ich annehmen musste, er überlege gerade selbst, wie es mit seiner Aufregung im Allgemeinen und im Besonderen bestellt sei.
Wir erreichten dann die Einfahrt zum Hafengelände. Dort mussten wir uns als Passagiere des Frachtschiffes Albireo ausweisen, das einer Reederei in Bremen gehörte und morgen von Antwerpen nach Istanbul auf große Fahrt gehen würde. Die Hafenkontrolleure warfen auch einen Blick in unsere Rucksäcke, während die Koffer sie seltsamerweise nicht interessierten. Dann wurden wir durchgewunken, und das Taxi schlich langsam durch das immer größere, riesige Hafengelände.
Ich hatte ein solches Gelände mit seinen Kränen, Masten, Schuppen und Speichern noch nie gesehen, es machte einen gewaltigen Eindruck auf mich. Überall wurden schwere Güter verladen, und ich erkannte auf den Decks der Schiffe und unten, an den Kais, kleine Gruppen von Hafenarbeitern, die mich sofort an Henri erinnerten. Die Frachtschiffe, die ich zu sehen bekam, waren so viel größer als die Touristendampfer in Köln, auf denen ich schon mehrmals den Rhein entlang gefahren war, dass man diese beiden Schiffstypen gar nicht miteinander vergleichen konnte. Es wäre so gewesen, als hätte man einen Riesen mit einem lächerlichen Gartenzwerg verglichen, ja, so ungefähr wäre es gewesen.
Papa drehte sich wieder nach mir um und fragte: »Na, wie findest Du es hier?« Ich schluckte und antwortete: »Das verschlägt einem die Sprache.« – »Wie bitte?!« sagte Papa da, etwas lauter und beinahe drohend. Und ich antwortete schnell: »Ich versuche später mal, es genau zu beschreiben. Ich brauche noch etwas Zeit.«
Papa hasst kaum etwas so sehr wie die Redensart, dass einem etwas »die Sprache verschlägt«. Oder »dass man keine Worte für dies und das findet«. Oder »dass sich das alles nicht in Worte fassen lässt«. Rede ich so, nennt er es »eine Bankrotterklärung«. »Bankrotterklärungen« dieser Art entstehen (wie Papa meint) nur aus Faulheit oder aus Dummheit oder aus Ignoranz und haben daher mit absolut schlechten Eigenschaften zu tun. »Alles, aber auch alles lässt sich beschreiben, und zwar von gut bis sehr gut bis zu genial«, ist einer von Papas Grundsätzen, die er mir gegenüber ungezählte Male wiederholt hat. Gelingt es einem nicht, etwas zu beschreiben, muss man es erneut (und wieder und wieder) versuchen, so lange, bis man zumindest eine halbwegs gute Beschreibung hinbekommen hat. »Diese Anstrengung ist man sich selbst und der Sprache schuldig«, sagt Papa meistens noch, was sich so anhört, als wäre die Sprache eine große Mutter, die man nicht im Stich lassen dürfe, sondern als deren eifriges Kind man sich beweisen müsse.
Schließlich fuhr das Taxi durch große Halden abgesägter, mächtiger Baumstämme, und der Fahrer verlangsamte das Tempo immer mehr, bis er den Liegeplatz entdeckt hatte. Er deutete auf das überdimensionale Schiff, das am Kai lag und gerade beladen wurde, und Papa und ich zogen die Köpfe ein und schauten durch die Fenster des Taxis. Als erstes erkannten wir vorne rechts am Bug den Namen des Schiffes: ALBIREO. Er stand dort wie der Name eines Königreichs, so mächtig und herrschaftlich, dass meine Aufregung überhand nahm und mein Herz stark zu klopfen begann.
Papa fragte den Fahrer nach dem Preis für die Fahrt, dann bezahlte er (umständlich und langsam), und schließlich stiegen wir aus, während der Taxifahrer unsere Koffer aus dem Kofferraum holte und sie am Kai abstellte. Wir stellten unsere Rücksäcke daneben, und der Taxifahrer winkte noch einmal und fuhr davon.
Da standen wir also. Wir standen und reckten die Hälse hoch und lasen immer wieder die königliche Fanfare: ALBIREO! Wir bewegten uns nicht, und als ich einen flüchtigen Blick auf unser Gepäck warf, kam es mir (angesichts der immensen Größe des Schiffes) so vor, als begännen unsere Koffer und Rucksäcke langsam zu schrumpfen. Ja, wirklich, sie machten sich klein und immer kleiner und sahen schließlich so aus, als schämten sie sich, zu uns zu gehören, oder als hätte sie etwas von der kalten Furcht, die uns gerade befiel, ebenfalls befallen.
Es war der 10. Juli1967, es war ein heißer Sommertag, der Himmel war glattblau, keine Wolken waren zu sehen – und doch wurde mir plötzlich kalt. Ich hatte eindeutig Angst vor diesem Riesen direkt vor meinen Augen, ich empfand ihn als fremd, nichts, aber auch gar nichts hatte ich mit seinem Königreich zu tun. Nicht einmal ein Wort kannte ich, um seine Bestandteile zu benennen, höchstens »Bug« und »Heck« kamen mir in den Sinn, doch die richtigen Wörter, die Fremd- und Fachworte, mit denen man die Glieder seines Reichs bezeichnete, die kannte ich nicht.
Würden Papa und ich dieses Monstrum betreten, würde es uns allmählich verschlingen und gar nicht erst erlauben, mit seinen Einzelteilen Kontakt aufzunehmen. Es bestand aus Eisen und Stahl, damit kannten wir uns nicht aus. Wir waren Witzfiguren, jawohl, nichts anderes waren wir. Dieses weit über menschliche Maße hinausgewachsene und unheimliche Schiff, das gerade Tonnen von Fässern und Eisenringen in seinem Schlund bunkerte, würde sich einen Spaß mit uns machen. Irgendwo würde es uns abschütteln und über Bord kippen, im Golf von Biskaya oder kurz nach Gibraltar, ich ahnte es.
»Was ist mit Dir los?« fragte Papa, »ist Dir nicht gut?« – »Nein«, antwortete ich, »mir ist schlecht.« – »Wieso denn das?« – »Wir kommen mit diesem Schiff bestimmt nicht zurecht, es ist zu groß.« – »Hast Du etwa Angst?« – »Ja.« – »Ach was«, sagte Papa, »wir haben doch keine Angst. Wir freuen uns auf das Schiff. Albireo ist ein schöner, klangvoller Name. Für die nächsten Wochen wird die Albireo unsere neue Heimat, Du wirst sehen.«
Dann deutete er auf die Gangway (wenigstens dieses Wort kannte ich schon), griff nach seinem Koffer und dem Rucksack und ging mir voraus auf die heruntergelassene Gangway zu. Ich ging langsam hinter ihm her und fixierte die Gangway, in meinen Augen hatte sie etwas Tückisches und nur scheinbar Harmloses, während sie in Wahrheit wohl der wacklige Fußpfad in ein Reich war, das uns nach seinem Betreten sofort zu seinen Gefangenen erklären würde. Der Weg über die Gangway führt in die Gefangenschaft, dachte ich wirklich, aber ich sagte nichts, sondern blieb vor der Gangway stehen.
Sie mit einem Koffer in einer Hand und einem Rucksack auf dem Rücken hinauf zu gehen, war nur schwer möglich, sie war zu schmal, und wir hatten keine Erfahrung darin, die Balance auf dieser hin und her schwankenden Höllenleiter zu halten und gleichzeitig noch unser Gepäck zu schleppen. Papa schien das auch erkannt zu haben, denn er setzte Koffer und Rucksack ab, und dann tat ich es ihm gleich: Ich setzte auch meinen Koffer und meinen Rucksack ab. Wie aber sollte es weitergehen?
»Einer von uns sollte die Gangway hinauf steigen und sich oben an Deck umschauen. Der andere wartet hier unten mit dem Gepäck«, sagte Papa. Leider hatte er nicht gesagt, wer von uns beiden die gefährliche Besteigung des Riesen in Angriff nehmen sollte, ich ahnte aber, dass er insgeheim längst an mich dachte. Ich (und damit niemand anderes als sein eigener Sohn) sollte mich auf den Weg in das Eisen- und Stahlreich machen, denn ich war der Jüngere, Leichtfüßigere, der es wie Jungsiegfried mutig mit jedem Drachen aufnimmt. »Also – was ist?« fragte Papa nach, und ich antwortete, dass ich gerne hier unten mit dem Gepäck warten würde. Für den ersten Kontakt mit der Mannschaft an Deck wäre er wohl der richtigere. »Neinnein«, antwortete Papa da unerwartet schnell, »es macht mehr Eindruck, wenn Du zuerst an Deck erscheinst. Neugierig, wissensdurstig – Du kannst es gar nicht abwarten, an Deck zu erscheinen. So sollte es sein.«
So sollte es vielleicht sein – es war aber nicht so. Ich wollte weder den Neugierigen, Wissensdurstigen noch den kämpferischen Jungsiegfried spielen. Am liebsten wäre mir gewesen, wir hätten von der Albireo ein paar Fotos gemacht und wären dann zurück in die wunderschöne belgische Stadt Antwerpen gefahren, um sie zu besichtigen. Danach wären wir wieder nach Köln aufgebrochen und hätten die Albireo ihrem Schicksal und einer mehrwöchigen, gefährlichen Mittelmeerreise überlassen.
Papa und ich standen am Fuß der Gangway und kamen nicht voran. Die beiden Koffer und Rucksäcke warteten ängstlich, kleinlaut und zusammengeschrumpft neben uns, es hätte mich nicht gewundert, wenn sie vor lauter Furcht die Kurve gekratzt und einfach geflohen wären. Nun gut, etwas musste geschehen, und es sollte nicht so sein, dass wir nicht einmal mutiger waren als unser Gepäck. Ich packte mir meinen Rucksack, lud ihn auf meinen Rücken und stieg langsam, Schritt für Schritt, die mit jedem Schritt stärker schwankende (und gegen die Schiffswand schlagende) Gangway hinauf. »Bravo!« rief Papa hinter mit her, ich empfand das aber nicht als ein Lob oder als Aufmunterung, sondern eher als zynisch. Jedenfalls handelte es sich nicht um ein astreines »Bravo«, sondern um eines, das Furcht und Angst abgetrotzt war. So hörte es sich (in meinen Ohren) an.
Oben angekommen, stieg ich an Deck und schaute mich um. Zwei Männer der Schiffsmannschaft saßen in blauer Arbeitskleidung oberhalb der weit geöffneten Ladeluken und schauten zu, wie die Ladung langsam in die dunkle Rachentiefe des Schiffsrumpfes befördert wurde. Sie saßen mit dem Rücken zu mir und bemerkten mich deshalb nicht, niemand sonst war zu sehen, das Schiff wirkte wie ein Geisterschiff, das seine Mannschaft verstoßen hatte.
Ich traute mich nicht, in die Nähe der Ladebäume zu gehen, deshalb rief ich mehrmals »Hallo!«, bis die beiden blau gekleideten Männer sich beinahe zugleich umdrehten und mich erkannten. Einer von ihnen rief mir etwas in einer Fremdsprache, von der ich kein einziges Wort verstand, zu, und ich winkte kurz und rief auf Deutsch zurück: »Mein Vater steht unten mit dem Gepäck. Wir sind die Passagiere.«
Ich glaubte nicht, dass die beiden Männer mich verstanden, das Wort »Passagiere« schienen sie aber doch verstanden zu haben, denn einer von ihnen wiederholte es laut, stand auf und kam auf mich zu. Er begrüßte mich nicht, er sagte kein Wort, sondern ging einfach an mir vorbei und stieg eine weiße, schmale Treppe hinauf. Oben verschwand er in einer offenen Tür und kam nach kaum einer halben Minute wieder zurück. »Steward kommt!« rief er mir zu und kümmerte sich nicht weiter um mich.
Ich wartete und schaute zu Papa hinab. Vom Deck aus betrachtet, erschien er so klein wie eine Maus, die den Sprung an Deck nie schaffen würde. Da hörte ich hinter mir Schritte und sah einen Mann jene weiße Treppe herunterkommen, die eben der blau gekleidete Mann hinauf- und wieder hinabgegangen war. Er begrüßte mich, gab mir die Hand, nannte seinen Namen und sagte, er sei der Steward. Ich begrüßte ihn auch, nannte ebenfalls meinen Namen und sagte, mein Vater und ich seien die beiden Passagiere, die für heute hierher bestellt worden seien.
»Hast Du kein Gepäck?« fragte der Steward, und ich erklärte ihm, dass mein Vater unten, am Fuß der Gangway, mit dem Gepäck warte. Da machte sich der Steward sofort auf den Weg die Gangway hinab und rief Papa zu, er sollte unten bleiben und nach ihm die Gangway hinauf steigen. Das Gepäck werde er, der Steward, hinauf tragen.
Ich schaute wieder herunter, auch der Steward verwandelte sich auf der Gangway langsam in eine kleine Maus, aber in eine springlebendige, unglaublich agile. Ich sah (mit einiger Bewunderung), wie geschickt sich der Steward bewegte, die Gangway schwankte überhaupt nicht, und als er sie mit den beiden Koffern wieder hinaufstieg, sah das so leicht und locker aus, als wäre er ein Tänzer und ein Liebling des schweren Riesen, der mir so fremd erschien. Papa kam (mit seinem Rucksack auf dem Buckel) schwerfällig hinter ihm her, machte aber keine einzige Pause, sondern schaffte es, das Deck in einem einzigen, langen Anlauf zu besteigen.
Endlich standen wir zu zweit oben, in der Zone der Ladebäume und Ladekräne, das war schon etwas anderes, nämlich ein kleiner Schritt in Richtung Mittelmeerreise. Papa und der Steward unterhielten sich auch sofort, als wären sie alte Bekannte, Papa bot wieder sein Lachen auf, das er so gut beherrschte, und der Steward lachte sogar dann und wann mit, als wäre er auf Papas besonderen Humor vorbereitet.
Ich selbst verfolgte die Unterhaltung aber nicht, ich stand noch an der Reling und damit etwas im Abseits. Was mir als erstes auffiel, war, dass der Steward ganz ähnlich gegelte Haare wie Papa hatte. Sie lagen in schweren, dichten Strähnen eng an, als hätte man ihn gerade aus dem Hafenbecken gezogen. Er trug eine beige, leichte Hose und ein blütenweißes Hemd, und er war viel kleiner als Papa und ich, höchstens ein Meter sechzig. Ich vermutete, dass er nicht älter als höchstens dreißig Jahre alt war, aber ich konnte mit dieser Schätzung auch sehr falsch liegen, denn sein Gesicht (und nur das Gesicht) wirkte älter, während der gesamte sonstige, sehr drahtige Körper jünger wirkte.
Um irgendetwas zu tun, öffnete ich meinen Rucksack und nahm die Kamera heraus, und dann begann ich, die Ladevorgänge an Deck zu fotografieren. Der Steward fragte mich, ob ich mit in unsere Kabine kommen wolle, da rief ich zurück, dass ich erst einige Fotos machen und später nachkommen werde. Ich fotografierte, was das Zeug hielt, und schaute manchmal mit einem Auge zur Seite, um mitzubekommen, wo der Steward und Papa verschwanden. Ich wollte sie nicht gleich begleiten, sondern mir Zeit lassen, ja, ich brauchte Zeit, mich an die Bilder an Deck (weit oben, in beträchtlicher Höhe) zu gewöhnen. Wir hatten den schlafenden Riesen bestiegen, immerhin das hatten Papa und ich jetzt geschafft.
Nachdem ich eine Menge Bilder gemacht und die Ladevorgänge an Deck dokumentiert hatte, ging ich dem Steward und Papa hinterher. Ich kletterte die weiße, schmale Treppe hinauf und ging durch die offen stehende Tür auf einen Gang, der anscheinend direkt zu unserer Kabine führte. Ich hörte, dass Papa und der Steward sich weiter unterhielten, Papa lachte anormal viel, anscheinend amüsierte ihn das, was der Steward gerade ausführlich erzählte.
Ich spürte sofort, dass Papa sich gut mit ihm verstand, ohne Umwege hatte er das Eis bereits gebrochen (wenn es denn überhaupt so etwas wie ein Eis gegeben hatte). Papa hat einen besonderen Instinkt für andere, fremde Menschen, so dass es ihm meistens leicht fällt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Mit dem Steward kam er anscheinend sofort zurecht, während ich unsicher war, ob ihm das auch mit dem Kapitän so rasch und einfach gelingen würde. Mit Menschen, die sich aufspielen oder die geringste Spur von Angeberei zeigen, kann Papa nichts anfangen. Er legt sich nicht mit ihnen an, sondern ignoriert sie, doch das ist fast ebenso schlimm wie ein Streit oder sonst ein Disput, denn Angeber vertragen kaum etwas so schlecht wie das Ignoriertwerden. Ich nahm mir vor, Papa bei seinen Kontakten mit der Mannschaft an Deck genau zu beobachten, diese Kontaktanbahnungen konnten spannend werden (und das vor allem auch deshalb, weil ich oft ahnte, was in Papa während solcher Kontaktanbahnungen im Einzelnen vorging).
Von der Einrichtung und dem Aussehen der Kabine war ich sehr verblüfft. Es war so, als befände man sich nicht mehr auf dem Riesen aus Eisen und Stahl, sondern in einem geräumigen und noblen Hotelzimmer. Die Wände waren aus schimmerndem, feinem Holz, und durch die Bullaugen konnte man wie ein Adler von seinem sicheren Horst aus nach draußen schauen. Sowohl das Holz als auch die Bullaugen (und die vor allem!) flößten mir ein starkes Vertrauen ein, und ich wurde sofort ruhiger. In dieser Kabine waren wir wohl einigermaßen sicher, mochte draußen an Deck auch ein wilder Sturm nach dem andern an dem Riesenschiff zerren und reißen.
Zwei breite und bequeme Betten standen links, an der Wand, und rechts, unterhalb der Bullaugen, gab es eine Sitzgruppe mit einem großen, runden Tisch. Darauf standen zwei weiße Teller mit geschälten Apfelsinen, es roch stark nach ihrem Duft, und der Duft der Apfelsinen konkurrierte mit dem Duft von Papas Rasierwasser. Es gab jedoch noch einen dritten Duft, den anscheinend der Steward verströmte, ich konnte ihn jedoch noch nicht exakt orten oder benennen, sondern bemerkte vorerst nur, dass es auch so etwas wie einen Steward-Duft gab.
Jetzt, als wir zu dritt dicht nebeneinander in der Kabine standen, erschien mir der Steward (als wäre er ein Teil der Kabinenmöblierung) als ein erster Vertrauter, er war doch jünger als dreißig, und er hieß, wie er uns mitteilte: Denis. Denis war vierundzwanzig Jahre alt und kam vom Land, aus der Nähe von Bremen. Seit fünf Jahren fuhr er zur See, und er kannte, wie er sagte, »nichts Schöneres«.
Er lächelte einige Male etwas verlegen, vielleicht wusste er noch nicht, wie genau er mit Papa und mir umgehen sollte. Ich fand ihn aber sehr freundlich und umgänglich, und ich vermutete, dass ich mich während der langen Fahrt gut mit ihm verstehen würde. Er sagte, dass der Kapitän einige Tage Urlaub genommen habe und am morgigen Vormittag zurückkommen werde. Dann machte er einige Schritte rückwärts, auf die Kabinentür zu, und zog sich langsam zurück. Er werde uns nun allein und in Ruhe lassen, sagte er noch, um uns zuletzt noch daran zu erinnern, dass er genau um 12 Uhr das Mittagessen servieren werde. »Wo servieren Sie denn das Mittagessen?« wagte ich zu fragen. »Im Salon«, antwortete Denis, »den habe ich Deinem Vater schon gezeigt.« Er lächelte noch einmal verlegen, dann verschwand er endgültig.
Sofort machte Papa sich daran, seinen Koffer auszupacken. Er legte ihn auf sein Bett (direkt an der Wand), und ich tat es ihm gleich und legte auch meinen Koffer auf mein zukünftiges Bett (von Papas Bett durch einen schmalen Gang getrennt). Die Apfelsinen dufteten immer stärker, und ich fragte, ob der Steward sie eigens für uns geschält habe. Papa entgegnete: »Ja, zu unserem Empfang. Denis ist ein feiner Kerl, mit dem kommen wir gut zurecht.«
In diesem Moment hatte ich überhaupt keine Zweifel, dass wir zumindest mit Denis gut zurechtkommen würden, ja, das würde bestimmt klappen. Einen ersten Verbündeten haben wir also schon gewonnen, dachte ich und grübelte, gegen wen wir uns eigentlich gerade mit dem Steward verbündet hatten. Gegen den Riesen und seine Willkür, dachte ich noch, doch dann hörte ich sofort mit dem Grübeln auf und hörte Papa zu, der mir erzählte, wovon ihm nun wiederum der Steward gerade erzählt hatte: Von Ehepaaren und von notorischen Einzelgängern. Einen Vater mit seinem Sohn habe es als Passagiere noch nie gegeben, wir seien die ersten, sagte Papa, und dann lachte er wieder, als wären wir Komödianten oder Clowns, die dazu bestimmt waren, die anderen Männer an Bord auf möglichst komische oder lustige Weise zu unterhalten.
Als ich meinen Koffer ausgepackt und den Inhalt in Schränken und Fächern (die ebenfalls aus leuchtendem Holz gemacht waren) verstaut hatte, setzte ich mich auf einen Sessel der Sitzgruppe. Papa hatte mir zuvor noch das ebenfalls noble Bad mit dem glitzernden Waschbecken und der Dusche gezeigt, auch im Bad gab es Bullaugen, die sogar noch beruhigender wirkten als die im Kabinenraum. Er hatte sich entschlossen, gleich einmal zu duschen, und so saß ich allein und in Ruhe auf einem (extrem nobel) samtbezogenen Sessel. Sofort meldete sich aber erneut die Müdigkeit, und ich geriet wieder ins Träumen.
Der Steward (10. Juli 1967, ohne Uhrzeit)
Denis, der Steward, hatte seit dem frühen Morgen schon einige Zeit auf die neuen Passagiere gewartet. Er wusste, dass ein Vater mit seinem Sohn kommen würde, eine seltene Kombination, denn sonst gingen meist Ehepaare oder notorische Einzelgänger mit auf Reisen. Die Ehepaare taten so, als wäre die Fahrt mit einem Frachtschiff der Reise mit einem Luxusdampfer gleichzusetzen. Sie pochten die ganze Fahrt auf extremen Genuss, auf ausgedehntes Frühstücken, Liegen auf dem Sonnendeck, ein Mittagessen mit mehreren Gängen … Die notorischen Einzelgänger dagegen waren oft Kenner, die Daten unzähliger Frachtschiffe im Kopf hatten. Täglich kommentierten sie die Fahrt, warnten vor diesen oder jenen Gefahren und bereiteten dem Kapitän nichts als Ärger. Jeder Kapitän hasste die notorischen Einzelgänger und versuchte, die notorischen Ehepaare, so gut es ging, zu übersehen. Ein Vater mit Sohn dagegen war noch nie mit auf Reisen gegangen. Denis, der Steward, hatte sich Gedanken darüber gemacht, was auf ihn zukommen würde. Er war für das Wohl der Passagiere zuständig, das war eine seiner wichtigsten Aufgaben. Wenn sie das Schiff nach der Reise verließen, schrieben sie ihre Eindrücke auf und schickten sie an die Reederei. Von dort bekam Denis später zu hören, wie es den Passagieren gefallen hatte. Meist versuchte er, sich in ihre Marotten hineinzudenken, doch mit der Kombination Vater und Sohn kannte er sich nicht aus. Er hatte überlegt, wie er den beiden direkt nach ihrer Ankunft eine Freude machen konnte, aber ihm war nichts Rechtes eingefallen. Und so hatte er begonnen, ein Kilo Apfelsinen zu schälen. Zwei Teller mit geschälten und filetierten Apfelsinen hatte er vorbereitet, als eine erste Kostprobe zum Empfang.
Als ich wieder zu mir kam, verließ Papa gerade das Bad. Seine Haare waren nicht mehr gegelt, sondern anscheinend mit einem Handtuch getrocknet worden. Sie standen ein wenig ab, als hätten sie das Gel erfolgreich abgeschüttelt und beschlossen, sofort wieder aufzublühen. Ich begann, meinen Rucksack auszupacken, und richtete mir einen kleinen Tisch, der etwas seitwärts stand, als Schreibtisch ein.
»Denis sagte, dass viele Passagiere sich während der Fahrt langweilen. Die meisten unterschätzen anscheinend, dass während der Fahrt auf dem Meer kaum mal etwas Neues zu sehen ist. Einige sollen sogar durchgedreht sein, sie haben die Langeweile nicht mehr ertragen.« – »Das kann uns nicht passieren«, sagte ich. – »Nein«, antwortete Papa, »wir könnten monatelang unterwegs sein und fänden doch immer noch neuen Stoff, über den wir reden und schreiben würden.« – »Monatelang? Wäre das nicht etwas lang?« fragte ich. – »Na hör mal«, antwortete Papa, und ich merkte, dass Papa wahrscheinlich sogar davon überzeugt war, wir könnten uns jahrelang (ohne einmal an Land zu gehen) gut unterhalten.
Als wir kurze Zeit später den Salon zum Mittagessen betraten, sah ich, was Papa in diesem Glauben bestärkt hatte. Eine ganze Wand des Salons war nämlich als Bibliothek eingerichtet. Hunderte Bücher standen dort, gut geordnet, in Reih und Glied, neue und alte, und es gab sogar kleine Schilder, auf denen die Themen der einzelnen Büchergruppen notiert waren. »Mittelmeer, geographisch und historisch« konnte ich lesen, »Antike Mythologie«, »Athen« – alles war handschriftlich mit blauer Tinte geschrieben. »Bis wir das alles gelesen haben«, sagte Papa, »haben wir die Erde einige Male umrundet.«
Um Himmels willen, dachte ich, ich will die Erde auf keinen Fall einige Male auf diesem Schiff umrunden, ich werde im Stillen jubeln, wenn wir das griechische Festland erreichen. Andererseits war ich aber nicht nur erstaunt, sondern auch froh, dass es eine solche Bibliothek gab. »Ein früherer Passagier, der die Route Antwerpen-Istanbul gut kennt, soll die meisten dieser Bücher gestiftet haben«, sagte Papa, »die anderen hat die Reederei auf seine Empfehlungen hin gekauft. Was Bücher betrifft, sind wir perfekt ausgestattet.«
Vor unserer Abfahrt hatte auch ich eine kleine Liste mit Büchern für die Lektüre während der Reise angelegt. Wegen ihres beträchtlichen Gewichts hatten wir aber nur eine kleine Zahl mitgenommen, Fach- und Sachliteratur für Papa, Erzählliteratur für mich. Als ich die große Bibliothek sah, wuchs mein Vertrauen in ein Gelingen der Reise noch einmal erheblich.
Wenn die wilden Stürme loslegten oder wenn das Riesenschiff seinen Zorn an uns ausließ, würde ich mich mit einem Haufen Bücher in den Salon oder in unsere Kabine zurückziehen. Ich würde lesen, lesen und nochmal lesen – und so tun, als gingen mich die Stürme und die Macken des Schiffes nichts an. Die kalte Schulter würde ich meiner näheren Umgebung zeigen und mich stattdessen in die fernen Welten der Bücher vertiefen.
»Einige Bücher könnten wir zumindest teilweise zusammen lesen«, schlug ich vor. – »Wie soll das gehen?« fragte Papa. – »Ich könnte Dir aus ihnen vorlesen, und wir könnten uns später darüber unterhalten.« – »Und welche schlägst Du vor?« fragte Papa (und ich spürte, dass er skeptisch war). – »Die Odyssee zum Beispiel«, sagte ich, »die könnte ich in Altgriechisch und in deutscher Übersetzung vorlesen.« – »Die Odyssee …«, murmelte Papa, »… Homer …«. Er sagte das so nachdenklich, als stiegen diese Namen aus dem hintersten Dunkelbereich seines Kopfes erst allmählich wieder ans Tageslicht. Als wären sie verschollen gewesen, und als hätte ich sie (durch lautes Aussprechen) wieder hervorgelockt. »Einverstanden?« fragte ich nach, und Papa antwortete so, wie ich es nie erwartet hätte. Er sagte nämlich »mal sehen«, und genau das überraschte mich wirklich, weil Papa die Wendung »mal sehen« ausgesprochen hasst.
»Mal sehen gibt es nicht«, hat er viele Male gesagt, »mal sehen ist etwas für die ganz lauen Naturen. Entweder-oder, das gibt es, das ist vernünftig und klar und wohlüberlegt, mal sehen dagegen ist etwas für diejenigen, die ein Leben auf dem Abstellgleis führen. Warten, warten und nochmal warten, bis der Zug endgültig vorbeigebraust ist. Hauptsache: Mal sehen!«
Mir ging diese seltsame Wende in Papas Wertschätzungen noch durch den Kopf, als der Steward bereits zu servieren begann. Er hatte längst für zwei Personen gedeckt, und als er Suppe und Mineralwasser brachte, sagte er, dass wir in den kommenden Tagen jeweils im Beisein des Kapitäns, des Ersten Offiziers und des Ingenieurs essen würden. »Anders als heute also«, sagte er, »in kleiner Runde.« »Sehr schön!« antwortete Papa und begann, die Suppe (eine Rindfleischbrühe mit viel Gemüse) zu löffeln. – »Das freut Dich doch sicher auch, dass wir bald in kleiner Runde essen?« fragte er leise, als der Steward nach draußen verschwunden war. – »Mal sehen«, antwortete ich.
Papa stockte kurz und ließ den Löffel über der Brühe schweben, dann tauchte er ihn wieder ein und sagte: »Nicht mal sehen, sondern: entweder-oder. Entweder es freut Dich, oder es freut Dich eben nicht.« – »Vorerst freut es mich nicht«, antwortete ich. – »Und warum nicht?« – »Weil ich es anstrengend finde, jede Mahlzeit zusammen mit Erwachsenen einzunehmen. Die unterhalten sich nur über Themen, die mich nicht interessieren, und ich muss dumm rumsitzen und zuhören.« – »Das musst Du auf keinen Fall«, sagte Papa, »ich verstehe genau, was Du meinst. Lass mich bloß machen, wir werden eine Lösung finden.«
Nach der Rindfleischbrühe gab es Jägerschnitzel mit Pilzen und Kartoffeln und danach zum Nachtisch einen Apfelsinenpudding. »Heute ist wohl Apfelsinentag«, sagte Papa zu dem Steward (und lachte). Das fand Denis aber anscheinend gar nicht so lustig, sondern verstand es als leise Kritik. »Wenn Sie Apfelsinen nicht mögen, sagen Sie es nur. Wir kochen gezielt für die Gäste.« – »Wir lieben Apfelsinen«, sagte Papa, »wir essen normalerweise selbst jeden Tag welche.« Auch das schien dem Steward aber nicht so recht zu gefallen, denn er antwortete: »Dann sollten wir vielleicht bald einmal für Abwechslung sorgen.«
Wir aßen alles auf, was serviert worden war, und dann gingen wir in unsere Kabine zurück. Papa hatte eine Beschreibung Griechenlands (angeblich bereits aus dem klassischen Altertum) in der Bibliothek entdeckt, und ich hatte wahrhaftig gleich mehrere Übersetzungen der Odyssee gefunden. Mit diesen Büchern legten wir uns schlafen, das heißt: Jeder von uns zog Hose und Hemd aus und legte sich (nur noch mit einer Unterhose bekleidet) aufs Bett.
Ich bemerkte, dass Papa sein Buch aufschlug und darin zu blättern begann. »Diese Beschreibung Griechenlands ist von Pausanias«, sagte er laut – und machte sofort weiter: »Sie ist wohl in der zweitenHälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus entstanden … – hier steht, sie sei für jeden Altertumsfreund eines der wichtigsten Werke der antiken Literatur!« – »Habe ich noch nie von gehört«, sagte ich. – »Ich auch nicht«, antwortete Papa, »aber wir sind ja auch keine Altertumsfreunde, oder?« – »Momentan noch nicht«, sagte ich.
Papa blätterte weiter, und dann erklärte er, dass die Beschreibung Griechenlands mit einer Beschreibung von Piräus beginne. »In wenigen Tagen sind wir dort«, sagte er, »dann lese ich Dir vor, wie Pausanias Piräus beschrieben hat.«
Ich wollte auch etwas zu diesem Thema beisteuern, deshalb schlug ich eine alte Homer-Übersetzung auf. Es war genau jene Übersetzung, die wir im Altgriechisch-Unterricht neben anderen, neueren Übersetzungen gerade lasen. Sie war (ich wusste es ganz genau!) von Johann Heinrich Voß, und ich kannte den Anfang der Odyssee (in dieser alten Übersetzung) sogar auswendig.
Ich schlug aber dennoch die erste Seite auf und tat, als läse ich vor: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, / Welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja Zerstörung … – Ich ließ das Buch sinken, ich war plötzlich gerührt (wieso eigentlich?) – jedenfalls begann ich noch einmal von vorn, indem ich jetzt auswendig zitierte: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, / Welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja Zerstörung, / Vieler Menschen Städte gesehn und Sitte gelernt hat / Und auf dem Meere so viel unnennbare Leiden erduldet, / Seine Seele zu retten und seiner Freunde Zurückkunft …
Papa reckte sich auf und schaute zu mir herüber: »Du kennst das auswendig?« – »Ja«, antwortete ich. – »Respekt!«, sagte er, aber ich merkte, dass ihn noch etwas anderes beschäftigte. »Dieser Anfang der Odyssee ist großartig«, sagte ich, aber Papa hakte nach: »Heißt es wirklich vielgewandert? Wieso denn vielgewandert? Odysseus ist doch keinen Meter zu Fuß gegangen, sondern war mit dem Schiff unterwegs. Oder?« – Ich überlegte kurz, natürlich, Papa hatte recht, ich hatte über das vielgewandert bisher noch nicht nachgedacht. – »Und wie ist das mit der Seele gemeint?« fragte Papa weiter, »an welche Seele haben die alten Griechen geglaubt?«
Herrgott, ich wusste so etwas auch nicht, aber das war mir im Moment sehr egal. Auf mich hatte der Anfang der Odyssee immer großen Eindruck gemacht, und zwar deshalb, weil von einer Muse (wie von einer Göttin) die Rede war und Homer sie so eindringlich beschwor, ihm beim Dichten beizustehen. Ohne Muse gab es anscheinend kein Dichten! Und danach hatte Homer die ganze dann folgende (lange) Geschichte kurz zusammengefasst, und zwar, wie ich fand, auf ergreifende Weise.
»Tut mir leid«, sagte ich (etwas gereizt), »aber ich habe keine Lust, an diesem Anfang der Odyssee herumzumäkeln, ich finde ihn nämlich ergreifend und feierlich. Ganz knapp wird die ganze Geschichte zusammengefasst: Ein alter Mann findet nach einem großen Krieg nicht mehr heim, erfährt unnennbare Leiden und sehnt sich nach nichts mehr als nach der Heimkehr. Welche Seele er dabei retten wollte, interessiert mich jetzt gerade mal nicht.«
»Stimmt«, antwortete Papa, »der Anfang ist ergreifend, das gebe ich zu. Und über die Seele des Odysseus können wir ja bald mehr in Erfahrung bringen, bei dieser großen Bibliothek!«
Danach waren wir beide still und lasen noch einige Minuten in unseren Büchern. Ich überlegte, warum mich der Anfang der Odyssee derart gerührt hatte, kam aber (wegen der starken Müdigkeit) so schnell zu keinem Ergebnis. Als ich sah, dass Papa sein Buch sinken gelassen hatte, legte ich die Odyssee in der alten Übersetzung von Johann Heinrich Voß beiseite. Dann schlief ich ein.
Einige Stunden später wurden wir durch das Klopfen des Stewards an unsere Kabinentür geweckt. »Es gibt Kaffee, Tee und Kuchen«, rief Denis. Ich schaute auf die Uhr, es war früher Nachmittag. Papa setzte sich auf und sagte, dass er sehr gut, nein, sogar »ausgezeichnet« (als müsste er sogar noch das Schlafen mit Noten bewerten) geschlafen habe. Es stimmte aber, ich hatte auch »ausgezeichnet« geschlafen, tief und (zum Glück) ohne zu träumen.
Wir zogen uns rasch an, und ich sah, dass Papa die Kleidung wechselte. Als wir wieder in den Salon gingen, trug er eine helle Hose und ein weißes Hemd. »Du siehst aus wie ein Kapitän«, sagte ich. – »Wieso denn das?« fragte Papa. – »Genauso stelle ich mir einen Kapitän vor«, sagte ich, »mit heller Hose und weißem Hemd mit langen Ärmeln, es fehlt nur noch die Schiebermütze und natürlich das Fernglas.« – »Der Kapitän läuft mit Schiebermütze und Fernglas herum?« lachte Papa. – »Immer!« sagte ich, »Tag und Nacht!« – »In Ordnung«, sagte Papa, »das kann ich bieten.«
Ich wusste, dass Papa ein Fernglas mitgenommen hatte, eine Schiebermütze hatte er aber noch nie getragen. »Ich bin gespannt«, sagte ich.
Wir setzten uns wieder an den ovalen, langen Esstisch im Salon, und Denis kam herein und servierte Kaffee, Tee und ein kleines Sortiment Kuchen. »Obstkuchen«, sagte er, »garantiert ohne Apfelsinen!« – »Gibt es jeden Tag so viele Mahlzeiten?« fragte Papa. – »Frühstück, Mittagessen, nachmittags Kaffee und Kuchen, Abendessen. Wenn Sie es wünschen, können Sie sogar noch ein zweites Frühstück bekommen.« – »Nein danke«, sagte Papa, »das ist wirklich nicht nötig. Wer soll denn das alles essen?« – »Es gibt Passagiere, die verlegen sich während der Fahrt auf das Essen und bestellen rauf und runter, was zu bekommen ist. Manche verlassen das Schiff nicht einmal, wenn wir irgendwo anlegen. Weil sie keine Mahlzeit verpassen wollen.« – »Aber das ist doch idiotisch«, sagte Papa. – »Ist es«, antwortete Denis, »ich kann stundenlang von idiotischen Spleens der Passagiere erzählen, Sie würden sich wundern. Es ist nicht zu fassen, was manchen so alles eingefallen ist.« – »Das interessiert mich«, sagte Papa, »davon müssen Sie unbedingt mehr erzählen.« – »Mach ich«, sagte Denis.
Als er verschwunden war, fragte Papa mich (leise): »Die Geschichten von den idiotischen Passagieren interessieren Dich doch auch, oder?« – »Geht so«, sagte ich. – »Du könntest einige in Deinen Reisebericht aufnehmen«, fuhr er fort. – »Es wird kein Reisebericht und auch kein Reisetagebuch, es wird eine Reiseerzählung«, sagte ich. – »Und worin besteht der Unterschied?« – »Ein Reisebericht enthält alle wichtigen trockenen Fakten, ganz unbedingt. Ein Reisetagebuch enthält vor allem die Empfindungen und Gefühle, die eine Reise auslöst und hinterlässt. Die Reiseerzählung schließlich enthält einige Fakten, aber keineswegs alle, und einige Empfindungen und Gefühle, aber auch keineswegs alle. Sie ist vor allem eine Geschichte mit vielen Figuren, fast wie ein Roman.« – »Mit welchen Figuren?« fragte Papa. – »Mit dem Steward, dem Kapitän, dem Ingenieur – mit Dir und mir … – das sind einige der Figuren.« – »Ich bin eine Figur?« fragte Papa. – »In der Reiseerzählung schon«, antwortete ich. – »Und im Reisebericht?« – »Da bist Du keine Figur, sondern Du selbst, Herr Ortheil aus Köln.« – »Und im Reisetagebuch?« – »Da bist Du Papa, mein Vater.« – »Das mit der Figur verstehe ich nicht«, sagte Papa. – »In der Reiseerzählung kann ich Dich in eine Figur verwandeln: In einen Reisenden, der zugleich Passagier ist sowie Papa oder Vater sowie noch vieles andere, das ich mir ausdenke.« – »Aha«, antwortete Papa, »jetzt kapiere ich es. Du denkst Dir was aus, Du berichtest also nicht faktentreu.« – »Wenn die Fakten interessant genug für meine Erzählung sind, nehme ich sie in die Erzählung auf, sonst aber nicht«, sagte ich. – »Ich verstehe«, sagte Papa, »ich hoffe nur, Deine Reiseerzählung ist nicht zu frei erfunden. Nicht dass wir uns auf einer Fahrt in die Arktis befinden und mit dem Fernglas Eisbären beobachten. Etwas in der Art fände ich nämlich nicht gut.« – »Keine Sorge«, antwortete ich, »sich etwas auszudenken und es mit den Fakten zu verbinden, bedeutet ja nicht: zu spinnen. Spinnen werde ich nicht, bestimmt nicht.« – »Gut«, sagte Papa, »ich werde auf jeden Fall zur Sicherheit auch ein paar Notizen machen – trockene Fakten, ausschließlich, also wohl: Reisebericht.« – »Das kann ja nicht schaden«, antwortete ich. – »Nein«, sagte Papa, »kann es nicht. Nur zur Sicherheit, ich will Dir nicht in die Quere kommen.« – »Du kommst mir bestimmt nicht in die Quere«, sagte ich, »im Gegenteil!« – »Na gut, dann hätten wir das geklärt. Prima! Und rechtzeitig, noch vor der Abfahrt. Wirklich prima!« – »Du notierst zur Sicherheit die trockenen Fakten«, sagte ich abschließend, »und ich notiere zur Sicherheit auch noch etwas Reisetagebuch. Damit die Empfindungen und Gefühle nicht zu kurz kommen. Und wenn wir zurück in Köln sind, schreibe ich die lange Reiseerzählung.« – »Gut«, sagte Papa, »das wäre ideal – und wir wären mit dem Notieren und Schreiben komplett!«
Wir aßen jeder ein Stück Obstkuchen, Papa trank Kaffee, ich Tee, dann überlegten wir, ob wir noch einmal an Land gehen sollten. Denis sagte, dass unsere Abfahrt auf morgen Abend festgelegt sei. Morgen, am späten Abend, würden wir »die Anker lichten«. »Dann können wir vorher noch an Land gehen und uns Antwerpen anschauen«, sagte Papa. – »Mal sehen!« antwortete ich. – »Wir bleiben auf dem Schiff – oder wir machen einen Landgang, entweder – oder«, sagte Papa. – »Ich bleibe heute lieber auf dem Schiff, wir sind ja erst gerade angekommen«, sagte ich. – »Was hast Du denn vor?« fragte Papa. – »Ich schaue mir die Bibliothek etwas genauer an«, antwortete ich, »ich stöbere ein bisschen herum.« – »Mach das«, sagte Papa, »und ich treibe mich mal etwas auf Deck herum, um ein paar trockene Fakten zu sammeln.«
Ich ging kurz in unsere Kabine und holte einen Stift und einen Notizblock. Dann kam ich zurück in den Salon und ging die bunten Reihen der Bibliothek, oben links, anfangend, Titel für Titel durch. Ich überlegte, welche ich in eine Leseliste aufnehmen sollte, das war nicht leicht, schließlich sagten mir die meisten Titel und die Namen der Autoren nichts. Während ich noch nachdachte, kam Denis ebenfalls in den Salon. »Was machst Du?« fragte er. – »Ich suche einige Bücher aus, die mein Vater und ich vielleicht lesen werden.« – »Es gibt eine Liste sämtlicher Titel«, antwortete Denis, »willst Du die haben?« – »Prima«, sagte ich, »das wäre eine große Hilfe.«
Denis verschwand kurz und kam dann mit einem Leitz-Ordner wieder. Er klappte den oberen Deckel zur Seite und zeigte mir, wie die Listen mit all ihren Titeln auf vielen Seiten gegliedert waren: »Einmal nach Themen- und Sachgebieten. Dann nach Titeln, alphabetisch. Und schließlich nach Autorennamen, wieder alphabetisch.« – »Da war ein Profi am Werk«, sagte ich. – »Ja, ich kenne ihn sogar persönlich«, sagte Denis, »er gliederte alles nach Listen, er hatte sogar eine Liste der Siebensachen dabei, die er in seinem Reisegepäck hatte. Danach führte er weitere Listen: Was es zu essen gab, welche Mitbringsel er an Land kaufte und so weiter, er war ein Listenfanatiker.« – »Erzähl davon bloß nicht meinem Vater«, antwortete ich. – »Warum nicht?« fragte Denis. – »Mein Vater ist ein Faktensammler«, sagte ich, »er könnte auf die Idee kommen, ebenfalls Listen anzulegen. Listen aller Art, mit lauter trockenen Fakten.«
Denis reagierte nicht. Ich hatte erwartet, dass er lachen oder wenigstens lächeln oder zumindest grinsen würde, aber er blickte ernst auf die Listen der Bibliothek. »Du verstehst Dich gut mit Deinem Alten, oder?« – Ich war von der unerwarteten Frage etwas überrascht. Wieso fragte er mich so etwas? Und erwartete er wirklich, dass ich einem Menschen, den ich gerade erst kennen gelernt hatte, länger darauf antwortete? – »Ja«, sagte ich, »wir verstehen uns ziemlich gut.« – »Ich glaube, sogar sehr gut«, antwortete Denis. – »Na und?« antwortete ich, »ist doch okay, wenn wir uns gut verstehen.« – »Weiß nicht«, sagte Denis, »ich kenne wenige Jungs in Deinem Alter, die sich mit ihrem Alten gut verstehen. Viele finden ihren Alten zum Kotzen. Ich zum Beispiel. In Deinem Alter fand ich meinen Alten zum Kotzen.« – »Und warum?« – »Warum?! Das war einfach klar, da musste ich nicht mal drüber nachdenken. Ich fand meinen Alten daneben, alles an ihm fand ich daneben: Seine Zigaretten, seine Musik, selbst sein Auto fand ich daneben. Ich wäre nie mit ihm auf Reisen gegangen.« – »Schade«, antwortete ich. – »Ach was, überhaupt nicht schade. Ich bin allein gereist, schon mit Vierzehn, es hat mich nicht interessiert, was mein Vater macht.« – »Welchen Beruf hatte Dein Vater denn?« – »Er hat den Bauern auf dem Land Maschinen für die Feldarbeit angedreht. Er wollte die armen Teufel profitabel von der alten Handarbeit befreien. So hat er sich jedenfalls ausgedrückt. Er war ein Schummler und Schwätzer.«
Denis steigerte sich in einen kleinen Rausch und wollte gar nicht mehr aufhören, seinen Vater in ein schlechtes Licht zu setzen. Es war peinlich, dass er plötzlich so loslegte. Fragte er sich keinen Moment, warum? Mich ging sein Vaterdrama nichts an, nein, ich konnte dazu nichts sagen, schließlich hatte ich seinen Vater nicht einmal gesehen. »Was macht Dein Vater heute?« fragte ich, um die Geschichte zu beenden. – »Er ist vergreist«, antwortete Denis, »ach was, reden wir nicht weiter darüber. Ich sehe ihn nicht mehr, ich will ihn nie mehr sehen.« – »Nie mehr?« – »Nie mehr.« – »Und Deine Mutter? Die auch nicht?« – »Ich rede nicht über meine Mutter, ist das klar?« – »Natürlich, entschuldige. Ich wollte nicht aufdringlich sein.« – »Ist schon klar. Du bist nicht aufdringlich.«
Ich sah, dass ihn seine Vater-Mutter-Geschichten beschäftigten. Sein Gesicht war leicht gerötet, und er war unverkennbar nervös. Noch vor wenigen Minuten hatte ich ihn für einen zurückhaltenden, halbwegs zufriedenen Menschen gehalten, jetzt aber wusste ich, dass diese Einschätzung falsch war. Reichlich verlegen blätterte ich in den Listen. »Okay«, sagte Denis, »ich lasse Dich jetzt mal mit dem Kram allein. Wenn Du Fragen hast, dann frag mich. Ich habe viele dieser Bücher gelesen oder zumindest mal reingeschaut, und ich habe eindeutige Favoriten.« – »Hast Du einen Topfavoriten?« fragte ich. – »Eindeutig«, antwortete Denis, »Henry Millers Griechenlandbuch. Das ist das Beste, was über Griechenland geschrieben wurde. Alles andere kannst Du vergessen, es ist fast immer dick aufgetragener Bildungskitsch.«
Er nahm ein Buch aus den gefüllten Reihen und zeigte es mir. Es hieß Der Koloss von Maroussi und war von Henry Miller.Ich hatte den Namen dieses amerikanischen Schriftstellers schon oft gehört, und ich wusste, dass er Romane mit so seltsamen Titeln wie Sexus oder Plexus oder Nexus geschrieben hatte. Zwei Jungs aus meiner Klasse hatten sie sogar gelesen und »fantastisch« gefunden, ich selbst hatte aber noch nicht angebissen, die Henry-Miller-Orgien standen mir noch bevor. Ich bedankte mich bei Denis für seinen Tip, dann nahm ich die vielen Blätter aus dem Ordner und begann, die Bücherreihen mit ihrer Hilfe langsam zu durchwandern. Denis beobachtete mich aus der Distanz (als machte er sich gerade so seine Gedanken, ich hätte gern gewusst, welche).
»Ich geh dann mal«, sagte er, »ach, noch was: Was trinkst Du denn so?« – »Nichts Besonderes.« – »Whisky? Gin?« – »Nee, trinke ich nicht.« – »Du trinkst überhaupt keinen Alkohol?« – »Höchstens mal ein Glas Kölsch.« – »Ein Kölsch!! Dass ich nicht lache! Ich habe für die Mannschaft feinsten Whisky gebunkert, heimlich natürlich. Der Kapitän hat Whisky an Bord verboten. Das ist den Jungs und mir aber egal. Wir trinken sowieso, was wir wollen. Der Whisky reicht bis Griechenland, da kaufen wir andere, feine Sachen! Du bist eingeladen, Sohnemann!«
Er machte sich lachend aus dem Staub, mir gefiel dieses Lachen nicht. Wenn er (wie gerade eben) mit mir sprach, verwandelte er sich in einen höhnischen und angeberischen Menschen, während er davor den netten, hilfsbereiten und sympathischen Steward gespielt hatte. Ich ahnte, dass er mich nicht nur für seltsam, sondern wahrscheinlich auch für bemitleidenswert hielt. Ein Junge in meinem Alter, der keinen Whisky trank, Henry Millers Romane nicht gelesen hatte und noch mit seinem Vater verreiste – so jemanden verachtete er.
Ich machte mir nichts daraus, sollte er doch von mir halten, was er wollte! Statt länger über ihn nachzudenken, vertiefte ich mich in die Bücher. Mit Hilfe der sorgfältig angelegten Listen verging die Zeit rasch. Ich schrieb einige Titel auf, die ich interessant fand, und ich las mich hier und da sogar fest.
Auch für Papa legte ich eine Liste an, ich wusste ja (zumindest ein wenig), mit welchen Themen er sich gerne länger beschäftigen würde. Dann stellte ich den Ordner mit den Listen in ein Regal und ging in unsere Kabine zurück. Papa war nicht da, er war anscheinend wirklich auf Deck unterwegs. Das Blättern und Lesen hatte mich auf viele Gedanken gebracht, am liebsten hätte ich sie aufgeschrieben. Ich ging aber zunächst nach draußen, um zu hören, was Papa in Erfahrung gebracht hatte.
Ich entdeckte ihn zuerst nicht, sondern erkannte nur die beiden älteren Männer, die sich noch immer um das Verladen der Fracht kümmerten. Auf Deck war weiter sonst niemand zu sehen, ich wollte schon wieder in die Kabine zurückgehen, als ich Papa oben auf der Höhe der Brücke stehen sah. Er hatte anscheinend darauf gewartet, dass ich mich umdrehte, denn er winkte mir sofort zu, und das so gespielt, als wäre er der Kapitän. Er trug noch immer seine helle Nachmittagskleidung und dazu eine weiße Schiebermütze sowie eine Sonnenbrille, und er stützte sich mit beiden Händen auf die Reling, als wollte er den Schiffsriesen fest zu packen bekommen.
Ich sah, dass er mir ein Zeichen gab, zu ihm hinaufzukommen, es war sonderbar, denn ich kam mir vor wie ein Jungmatrose, der vom Kapitän hinauf auf die Brücke gerufen wurde, um etwas für ihn zu erledigen. »Jetzt siehst Du wirklich aus wie der Kapitän«, sagte ich, als ich oben neben ihm stand.
»Also«, begann Papa, »ich habe die Albireo inzwischen vermessen. Die Länge zwischen den Loten beträgt circa einhundert Meter, die Breite auf Spanten circa fünfzehn Meter. Die Seitenhöhe des ersten Decks ist fast neun Meter und die des zweiten etwas über sechs. 3280 PS, 5000 Tonnen Ladekapazität, fünftausend!«
Ich wusste sofort, dass ich diese Zahlen schon wenig später wieder vergessen, dass Papa sie aber bis an sein Lebensende im Kopf behalten würde. »Wie hast Du die Albireo vermessen? Wie geht das?« fragte ich (um etwas Interesse zu zeigen). – »Na zu Fuß, ganz einfach, ich bin das Deck abgeschritten, von vorne nach hinten, und dann zu den Seiten. Das ist doch kein Problem.« – »Und die anderen Zahlen? PS und Ladekapazität? Woher hast Du die?« – »Auch ganz einfach. Die beiden Matrosen vor den Ladeluken wussten Bescheid.« – »Dann sind wir schon mal ein wenig im Bild«, sagte ich. – »Nicht ausreichend und nicht tiefgehend, aber ein wenig«, antwortete Papa, »sicher wird uns der zuständige Ingenieur bald den Motorraum zeigen. Der ist das Herz des Schiffes. Wenn wir den gesehen haben, wissen wir mehr.« – »Du weißt dann mehr«, sagte ich, »mir sagen die Zahlen nicht viel.« – »Das wird sich bald ändern«, sagte Papa, »die Reise wird einen richtigen Matrosen aus Dir machen. Mit Haut und Haar.«
Ich antwortete nicht. Dass die Reise aus mir einen Matrosen machen könnte (und das auch noch mit Haut und Haar), überstieg meine schlimmsten Befürchtungen. Ich stellte mir vor, wie mir ein Bart wachsen und das halbe Gesicht wie ein finsteres Geflecht überziehen würde, mit der Zeit würde ich dunkelblaue Matrosenkleidung tragen und mir mit einem klebrigen Lappen die ölverschmierten Hände abwischen. Mein Gehirn würde die viele Musik, die ich noch im Kopf hatte, gegen das Schiffsvokabular austauschen, schon bald wäre ich nur noch fähig, von Schiffs- und Seereisen und all den Abenteuern zu lesen, die sich damit verbanden.
Ich schwieg. »Warum bist Du so kleinlaut? Freust Du dich nicht mehr auf die Reise?« fragte Papa. – »Ich habe gemischte Gefühle«, antwortete ich, »und mit gemischten Gefühlen sieht man von einem Schiff nicht nur die Planken und Spanten, sondern auch die Kehrseite.« – »Das verstehe ich nicht«, sagte Papa. – »Na, ich sehe eben statt der Planken und Spanten eher den Rumpf. Die Teile unter Wasser. Die maroden Stellen. Die dunklen Laderäume. Die Heerscharen der grauen Ölfässer, die nicht alle ganz dicht sein könnten.«
Jetzt schwieg Papa. Er löste sich mit den Händen von der Reling und setzte die Schiebermütze ab. »Die habe ich auf den letzten Drücker noch in Köln gekauft«, sagte er. – »Steht Ihnen gut, Herr Kapitän«, antwortete ich. – »Na, ich weiß nicht«, sagte Papa. – »Doch, steht Dir gut. Kommst Du mit in unsere Kabine?« – »Ja, ich ziehe mich noch einmal um.« – »Schon wieder? Du hast Dich noch nie an einem einzigen Tag mehrmals umgezogen.« – »An Bord gehört sich das aber so«, antwortete Papa, »und außerdem gibt es gleich wieder etwas zu essen. Abendbrot.« – »Das wird kein Abendbrot sein, sondern ein Gelage mit rohem, gekochtem und gebratenem Fisch, zehn verschiedene Sorten. Der Essenshöhepunkt des ganzen Tages!«
Endlich lachten wir einmal wieder zusammen. Dann gingen wir in unsere Kabine zurück. »Ich vermute, ich werde während der Reise diese oder jene Mahlzeit ausfallen lassen«, sagte ich. – »Kein Problem«, sagte Papa, »wir sollten es Denis nur rechtzeitig sagen, sonst serviert er alles für Zwei, und der Tisch biegt sich vergebens.«
Wenig später saßen wir wirklich erneut im Salon, und der Tisch bog sich beträchtlich. Anders als am Mittag hatte Denis die Speisen bereits darauf verteilt, kalte Platten mit Braten, Wurst, Käse, Tomaten, Gurken und Eiern, Brotkörbe mit verschiedenen Sorten, Butter und Margarine, der ganze Tisch war voll davon.
»Das ist aber nicht Ihr Ernst, Denis«, sagte Papa (so zutraulich, als wäre Denis sein Sohn oder ein naher Verwandter oder zumindest ein guter Freund). – »Doch, das ist es«, antwortete Denis. Er spielte wieder den sympathischen, verlegenen Steward, der sich in die Marotten seiner Passagiere hineinzuversetzen versucht. »Sie trinken Bier, oder?« fragte er Papa. – »Gern«, antwortete Papa. – »Und der Sohnemann auch? – oder doch lieber ein gesundes Wässerchen?« – »Ich trinke Mineralwasser«, antwortete ich, ohne auf seine Spitzen einzugehen.
Papa bemerkte nichts. Ihm fiel nicht auf, dass es in mir brodelte, er konzentrierte sich ganz auf das Essen. Als Denis die Flasche Bier öffnete und ein großes Glas füllte, schaute er so begeistert, als hätte er seit Jahren kein gut gekühltes Bier mehr gesehen. »Ein gut gekühltes Bier«, sagte er, »bei dieser Hitze gibt es nichts Besseres!«
Er setzte das Glas an und leerte es bis zur Hälfte. Wie großkotzig, dachte ich plötzlich, und bemerkte, wie Papa sich gerade in einen alten Vater verwandelte, den ich zwar nicht »zum Kotzen« fand, zu dem ich aber auf Distanz ging. Vater trank zwei, drei, nein, sogar vier Gläser, er schien gar nicht genug zu bekommen, und dazu aß er mit einem Appetit, als hätte er die Albireo nicht mit ein paar Tippelschrittchen zu Fuß vermessen, sondern ihre schweren Motore mit eigenen Händen stundenlang bei größter Hitze geölt.
Niemand von uns beiden sagte etwas. Papa aß geradezu gefräßig, und ich pickte ein paar Scheiben Tomaten und Gurken zusammen und legte sie auf die bleichen Käsescheiben, von denen ich jeweils eine halbe auf eine Brotschnitte schob. Dazu trank ich Mineralwasser, es schmeckte scheußlich, denn es enthielt keine Kohlensäure.