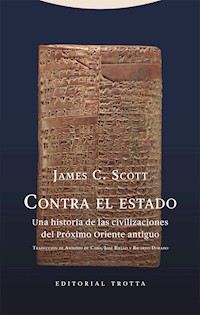21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie selbstverständlich gehen wir davon aus, dass die neolithische Revolution, in deren Verlauf Nomaden zu Ackerbauern und Viehzüchtern wurden, ein bedeutender zivilisatorischer Fortschritt war. James C. Scott entwickelt in seinem provokanten Buch eine ganz andere These: Die ersten Staaten entstanden aus der Kontrolle über die Reproduktion und errichteten ein hartes Regime der Domestizierung und Unterwerfung, das Epidemien, Ungleichheiten und Kriege mit sich brachte. Einzig die »Barbaren« – die heimlichen Helden dieses Buches – haben sich der Sesshaftigkeit sowie den neuen Besteuerungssystemen verweigert und sich damit gegen die Mühlen der Zivilisation gestemmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
3James C. Scott
Die Mühlen der Zivilisation
Eine Tiefengeschichte der frühesten Staaten
Aus dem Amerikanischen von Horst Brühmann
Suhrkamp
5Meinen Enkelkindern
Lillian Louise, Graeme Orwell, Anya Juliet, Ezra David und Winifred Daisy
auf ihrem Weg tiefer ins Anthropozän
6Die Schrift scheint für die Reproduktion des zentralisierten, hierarchisierten Staates notwendig zu sein. […] Es ist ein seltsam Ding um die Schrift. […] Das einzige Phänomen, das sie immer begleitet hat, ist die Gründung von Städten und Reichen, das heißt die Integration einer großen Zahl von Individuen in ein politisches System sowie ihre Hierarchisierung in Kasten und Klassen. […] Sie scheint die Ausbeutung der Menschen zu begünstigen, lange bevor sie ihren Geist erleuchtet.
Claude Lévi-Strauss, Traurige Tropen
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
7Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Inhalt
Vorwort
EINLEITUNG
Ein Narrativ in Trümmern: Was ich nicht wusste
Paradoxien der Narrative von Staat und Zivilisation
Den Staat in die Schranken weisen
Kurzer Vorausblick auf unsere Reise
EINS
Die Domestikation des Feuers, der Pflanzen und Tiere … und unserer selbst
Feuer
Konzentration und Sesshaftigkeit: Eine Feuchtgebiet-Hypothese
Feuchtgebiete und Sesshaftigkeit
Warum ignoriert?
Auf die Lücke achtgeben
Warum überhaupt anbauen?
ZWEI
Die Landschaft der Welt gestalten: Der Hauskomplex
Vom neolithischen Landbau zum floralen Zoo: Folgen der Kultivierung
Das Haus als ein Modul der Evolution
Von der Jagdbeute zum Pferch
Spekulationen über Parallelen beim Menschen
Die Domestikation unserer selbst
DREI
Zoonosen: Ein epidemiologisches Verhängnis
Die Mühsal und ihre Geschichte
Die neuen speziesübergreifenden Siedlungen des Spätneolithikums: ein epidemiologisches Verhängnis
Eine Anmerkung zu Fertilität und Population
VIER
Die Agroökologie des frühen Staates
Die Agrogeographie der Staatenbildung
Getreide macht Staaten
Mauern machen Staaten: Schutz und Gefangenschaft
Schrift macht Staaten: Buchführung und Übersichtlichkeit
FÜNF
Bevölkerungskontrolle: Knechtschaft und Krieg
Staat und Sklaverei
Sklaverei und Knechtschaft in Mesopotamien
Ägypten und China
Sklaverei als »Humankapital«-Strategie
Beutekapitalismus und Staatenbildung
Die Besonderheit der mesopotamischen Sklaverei und Knechtschaft
Eine spekulative Bemerkung zu Domestikation, Mühsal und Sklaverei
SECHS
Die Zerbrechlichkeit des frühen Staates: Zusammenbruch als Zerfall
Akute und chronische Morbidität früher Staaten
Krankheit: Hypersedentismus, Mobilität und der Staat
Ökozid: Abholzung und Versalzung
Politizid: Kriege und Ausbeutung der Kernzone
Lob des Zusammenbruchs
SIEBEN
Das goldene Zeitalter der Barbaren
Zivilisationen und ihre barbarische Grauzone
Geographie und Ökologie der Barbaren
Plündern
Handelswege und besteuerbare Getreide-Kernzonen
Heimliche Zwillinge
Ein goldenes Zeitalter?
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
9Vorwort
Was Sie hier finden werden, ist der Bericht von dem Erkundungsgang eines Grenzverletzers. Lassen Sie mich das erklären. 2011 wurde ich gebeten, zwei Tanner Lectures in Harvard zu halten. Die Anfrage war schmeichelhaft, aber da ich gerade ein anstrengendes Buch hinter mich gebracht hatte, genoss ich eine willkommene Zeit der »freien Lektüre«, ohne ein besonderes Ziel vor Augen zu haben. Was konnte ich realistischerweise in vier Monaten zustande bringen, das vielleicht von Interesse wäre? Als ich mich so nach einem überschaubaren Thema umsah, kamen mir die beiden einleitenden Vorlesungen in den Sinn, mit denen ich in den letzten beiden Jahrzehnten einen Graduiertenkurs über agrarische Gesellschaften zu eröffnen pflegte. Sie behandelten die Geschichte der Domestikationen und die agrarische Struktur der frühesten Staaten. Obwohl sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hatten, war mir klar, dass sie völlig überholt waren. Vielleicht, überlegte ich, könnte ich mich in die aktuelleren Arbeiten über Domestikation und die frühesten Staaten vertiefen und zumindest zwei Vorlesungen schreiben, die den Forschungsstand besser widerspiegelten und meiner anspruchsvollen Studenten würdiger wären.
Nie stand mir eine größere Überraschung bevor! Die Vorbereitung der Vorlesung erschütterte vieles von dem, was ich zu wissen glaubte, und konfrontierte mich mit einer Masse neuer Debatten und Ergebnisse, die ich in der Tasche haben musste, um dem Thema gerecht zu werden. So dienten die Vorlesungen, die ich dann tatsächlich hielt, mehr dazu, mein Erstaunen über die Menge der überkommenen, gründlich überprüfungsbedürftigen Meinungen zu bekunden, als dazu, diese Überprüfung selbst zu leisten. Homi Bhabha, mein Gastgeber, wählte drei scharfsinnige Kommentatoren aus – Arthur Kleinman, 10Partha Chatterjee und Veena Das –, die mich in dem Seminar, das den Vorlesungen folgte, davon überzeugten, dass meine Argumente eigentlich noch längst nicht präsentabel waren. Tatsächlich tauchte ich erst fünf Jahre später mit einem Manuskript wieder auf, das mir wohlbegründet und provokant schien.
Das vorliegende Buch reflektiert also meine Bemühung, tiefer zu schürfen. Es ist immer noch sehr das Werk eines Amateurs. Obwohl ich eingetragenes Mitglied der politikwissenschaftlichen Zunft bin und nur ehrenhalber als Anthropologe und Ökologe gelten darf, erforderte dieses Unternehmen das Arbeiten am Schnittpunkt von Vorgeschichte, Archäologie, Alter Geschichte und Anthropologie. Da ich auf keinem dieser Gebiete besondere Fachkompetenz habe, kann man mir mit gutem Recht Hybris vorwerfen. Meine Entschuldigung für diese Grenzüberschreitung – die gewiss noch keine Rechtfertigung darstellt – ist eine dreifache. Erstens ist die Naivität, mit der ich an das Unternehmen herangehe, auch ein Vorteil! Anders als ein Spezialist, der sich leicht in dem dichten Gestrüpp intensiver Debatten auf seinem Gebiet verfängt, begann ich mit überwiegend den gleichen unüberprüften Annahmen über die Kultivierung und Zähmung von Pflanzen und Tieren, über Sesshaftigkeit, frühe Bevölkerungszentren und die ersten Staaten, Annahmen, die diejenigen von uns, die den neuen Erkenntnissen ungefähr der letzten beiden Jahrzehnte keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben, für erwiesen zu halten geneigt sind. In dieser Hinsicht könnten mein Unwissen und meine anschließende Verblüffung darüber, wie viel von dem, was ich zu wissen glaubte, falsch war, vielleicht von Vorteil beim Schreiben für einen Adressatenkreis sein, der von den gleichen Fehlvorstellungen ausgeht. Zweitens habe ich mich als Wissenskonsument redlich bemüht, die neueren Erkenntnisse und Debatten in Biologie, Epidemiologie, Archäologie, Alter Geschichte, Demographie und Umwelthistorie, soweit sie diese Fragen betreffen, aufzunehmen. Und schließlich bringe ich als Hintergrund meine über zwei Jahrzehnte ausgedehnten Versuche mit, die Logik der modernen Staatsmacht (Seeing Like a State) sowie die Praktiken nichtstaatlicher Völker besonders in Südostasien zu 11verstehen, die es bis vor kurzem vermeiden konnten, von Staaten aufgesogen zu werden (The Art of Not Being Governed).
Dies ist also ein Projekt, das Wissen aus zweiter Hand zusammenstellt und sich dessen völlig bewusst ist. Es schafft keine eigenständigen neuen Erkenntnisse, sondern betrachtet es als sein ehrgeizigstes Ziel, bestehendes Wissen so zu verknüpfen, dass ein erhellendes oder suggestives Bild entsteht. Die erstaunlichen Fortschritte unseres Verständnisses im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte haben dazu gedient, das, was wir über die ersten »Zivilisationen« im mesopotamischen Schwemmland und anderswo zu wissen glaubten, radikal zu revidieren oder total umzustürzen. Wir dachten (jedenfalls die meisten von uns), die Domestikation von Pflanzen und Tieren habe direkt zu Sesshaftigkeit und feldgebundener Landwirtschaft geführt. Es zeigt sich aber, dass Sesshaftigkeit der nachgewiesenen Domestikation von Pflanze und Tier lange vorausging und dass es sowohl Sesshaftigkeit als auch Domestikation mindestens vier Jahrtausende lang gab, bis so etwas wie ein landwirtschaftliches Dorf auftrat. Sesshaftigkeit und das erste Erscheinen von Städten galten typischerweise als Folge von Bewässerung und Staatengründung. Stattdessen erweist sich, dass beide gewöhnlich das Produkt überreichlich vorhandener Feuchtgebiete sind. Wir glaubten, dass Sesshaftigkeit und Kultivierung direkt zur Staatenbildung geführt hätten, doch Staaten tauchten erst lange nach dem Erscheinen feldgebundener Landwirtschaft auf. Ackerbau, dachte man, sei ein großer Fortschritt, was Wohlergehen, Ernährung und Muße der Menschen angeht. Ungefähr das Gegenteil war zunächst der Fall. Der Staat und die frühen Zivilisationen galten oft als Magneten, die die Menschen dank ihres Luxus, ihrer Kultur und ihres Chancenreichtums angezogen hätten. In Wirklichkeit mussten die frühen Staaten einen Großteil ihrer Bevölkerung erbeuten und in Knechtschaft halten. Darüber hinaus wurden sie aufgrund des dichteren Zusammenlebens von Epidemien heimgesucht. Die frühen Staaten waren fragil und anfällig für Zusammenbrüche, doch die darauffolgenden »dunklen Zeitalter« dürften oft eine faktische Verbesserung des menschlichen Wohls bedeutet haben. Schließlich lässt sich mit 12guten Gründen behaupten, dass das Leben außerhalb des Staates – das Leben als »Barbar« – materiell gesehen häufig leichter, freier und gesünder war als das Leben innerhalb der Zivilisation – zumindest für die Nichteliten.
Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass meine jetzige Darstellung nicht das letzte Wort über Domestikation, frühe Staatenbildung oder das Verhältnis zwischen den frühen Staaten und den Bewohnern ihres Hinterlands sein wird. Mein Ziel ist ein doppeltes. Das bescheidenere lautet, das fortgeschrittenste Wissen, das wir über diese Dinge haben, kurz darzustellen und dann anzudeuten, was sich für die Bildung von Staaten und für die Auswirkungen der Staatsform auf Mensch und Ökologie daraus ableiten lässt. Allein das ist schon eine Riesenaufgabe, und ich habe versucht, den Maßstäben für dieses Genre zu genügen, die Autoren wie Charles Mann (Amerika vor Kolumbus) und Elizabeth Kolbert (Das sechste Sterben) gesetzt haben. Mein zweites Ziel, das meinen Gewährsleuten nicht zum Vorwurf gemacht werden sollte, besteht darin, weiterreichende Folgerungen oder vielmehr Mutmaßungen anzustellen, mit denen, wie ich meine, »gut zu denken« wäre. So schlage ich vor, Domestikation im umfassendsten Sinne – als Kontrolle der Reproduktion – nicht nur auf Feuer, Pflanzen und Tiere anzuwenden, sondern auch auf Sklaven, Staatsuntertanen und Frauen in der patriarchalen Familie. Ich vertrete die These, dass Zerealien einzigartige Merkmale besitzen, die sie im Grunde überall zu der für die frühe Staatenbildung unentbehrlichen »Hauptwährung« der Besteuerung werden ließen. Ich glaube, dass wir die Bedeutung der (ansteckenden) Krankheiten, die vom dichteren Zusammenleben begünstigt wurden, für die demographische Fragilität des frühen Staates womöglich grob unterschätzt haben. Anders als viele Historiker frage ich mich, ob die häufig nachgewiesene Preisgabe von Zentren der frühen Staaten nicht eher ein Segen für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Populationen war als der Beginn eines »dunklen Zeitalters«, das den Zusammenbruch einer Zivilisation anzeigte. Und schließlich frage ich mich, ob jene Populationen, die nach der Errichtung der ersten Staaten noch jahrtausendelang außerhalb 13der Staatszentren blieben, nicht vielleicht deshalb dort geblieben (oder dorthin geflohen) sind, weil sie dort bessere Lebensbedingungen vorfanden. All diese Folgerungen, die ich aus meiner Lektüre der Beweismittel ziehe, sind als Provokationen gemeint. Sie sollen zu weiterer Reflexion und Forschung anregen. Wenn ich um eine Antwort verlegen bin, weise ich offen darauf hin. Wenn die Beweislage dünn ist und ich in Spekulation abschweife, verfahre ich ebenso.
Ein Wort zur Geographie und zu den historischen Perioden ist noch angebracht. Mein Augenmerk liegt fast vollständig auf Mesopotamien und besonders auf dem »südlichen Alluvium« südlich der heutigen Stadt Basra. Der Grund für diese Fokussierung ist der, dass diese Gegend zwischen Euphrat und Tigris (Sumer) das Kernland der ersten »ursprünglichen« Staaten der Welt war – wenngleich nicht der Schauplatz, wo Sesshaftigkeit, kultivierte Anbaupflanzen oder gar proto-urbane Städte zuerst auftauchten. Die historische Periode, die meine Darstellung umfasst (wenn man von der Tiefengeschichte der Domestikation absieht), reicht von der Obed-Zeit, die etwa 6500 v. Chr. einsetzt, bis zur Altbabylonischen Zeit, die etwa 1600 v. Chr. endet. Üblicherweise wird diese Periode folgendermaßen untergliedert (einige frühere Daten sind umstritten):
Obed (6500-3800 v. Chr.)
Uruk (4000-3100)
Dschemdet-Nasr (3100-2900)
Frühdynastikum (2900-2335)
Akkad (2334-2193)
Ur III (2112-2004)Altbabylonische Zeit (2004-1595 v. Chr.)
Weitaus die meisten der Belege, die ich anführe, beziehen sich auf den Zeitraum von 4000 bis 2000 v. Chr., weil dieser sowohl die entscheidende Periode der Staatenbildung als auch der Schwerpunkt des Großteils der vorliegenden Forschung ist.
Hin und wieder beziehe ich mich kurz auf andere frühe Staaten wie die chinesische Qin- und Han-Dynastie, das frühe Ägypten, das klas14sische Griechenland, die römische Republik und das Römische Reich sowie sogar auf die frühe Maya-Zivilisation in der Neuen Welt. Solche Exkursionen dienen der Triangulation, wenn die Beweislage in Mesopotamien dünn oder umstritten ist, um auf der Basis von Vergleichen einige begründete Vermutungen über Strukturmuster anzustellen. Dies gilt besonders dort, wo es um die Rolle unfreier Arbeit in den frühen Staaten geht, um die Bedeutung von Krankheiten beim Zusammenbruch eines Staates, um die Folgen solcher Zusammenbrüche und schließlich um die Beziehung zwischen Staaten und ihren »Barbaren«.
Bei der Erläuterung der Überraschungen, die mich erwarteten und wohl auch meine Leser erwarten, habe ich mich auf Gebieten, mit denen ich nicht eng vertraut bin, auf eine große Zahl vertrauenswürdiger Gewährsleute verlassen, die Fährten zu lesen wissen. Die Frage lautet nicht, ob ich in fremden Revieren wildere; ich will wildern! Die Frage lautet vielmehr, ob ich in den Revieren der erfahrensten, sorgfältigsten, wegkundigsten und verlässlichsten Fährtenleser gewildert habe. Ich werde die Namen von einigen meiner wichtigsten Führer hier nennen, weil ich sie in dieses Unternehmen insoweit verwickeln möchte, als ihr Wissensschatz mir geholfen hat, meinen Weg zu finden. An der Spitze der Liste stehen Archäologen und Spezialisten des mesopotamischen Alluviums, die mir außerordentlich großzügig Zeit und kritischen Rat geschenkt haben: Jennifer Pournelle, Norman Yoffee, David Wengrow und Seth Richardson. Andere, deren Arbeiten mich inspiriert haben, sind – in keiner bestimmten Reihenfolge –: John McNeill, Edward Melillo, Melinda Zeder, Hans Nissen, Les Groube, Guillermo Algaze, Ann Porter, Susan Pollock, Dorian Q. Fuller, Andrea Seri, Tate Paulette, Robert McC. Adams, Michael Dietler, Gordon Hillman, Karl Jacoby, Helen Leach, Peter Perdue, Christopher Beckwith, Cyprian Broodbank, Owen Lattimore, Thomas Barfield, Ian Hodder, Joe Manning, K. Sivaramakrishnan, Edward Friedman, Douglas Storm, James Prosec, Aniket Aga, Sarah Osterhoudt, Padriac Kenney, Gardiner Bovingdon, Timothy Pechora, Stuart Schwartz, Anna 15Tsing, David Graeber, Magnus Fiskesjo, Victor Lieberman, Wang Haicheng, Helen Siu, Bennet Bronson, Alex Lichtenstein, Cathy Shufro, Jeffrey Isaac und Adam T. Smith. Besonders dankbar bin ich Richard Manning, der – wie ich entdeckte – einen guten Teil meiner Argumente zum Verhältnis von Zerealien und Staaten vorwegnahm und dessen intellektuelle Großzügigkeit so weit ging, dass er mir erlaubte, ihm den Titel seines Buches Against the Grain (2004) auszuspannen und zum ersten Bestandteil meines eigenen zu machen.
Auch wenn mich der Gedanke vorher etwas beklommen machte, erprobte ich meine Argumente vor Zuhörerschaften von Archäologen und Spezialisten in Alter Geschichte. Ich möchte ihnen für ihre Nachsicht und ihre hilfreiche Kritik danken. Zu den ersten Hörern, denen ich meine frühen Revisionen aufdrängte, gehörten viele meiner ehemaligen Kollegen an der Universität von Wisconsin, wo ich 2013 die Hilldale Lectures hielt. Danken möchte ich auch Clifford Ando und seinen Kollegen für die Einladung zu einer Konferenz über »Infrastrukturelle und despotische Macht in den Staaten des Altertums«, die 2014 an der Universität Chicago stattfand, sowie David Wengrow und Sue Hamilton für die Gelegenheit, 2016 die V. Gordon Childe Lecture am Institut für Archäologie in London zu halten. Teile meiner Argumentation wurden an der Universität von Utah (im Rahmen der O. Meredith Wilson Lecture), an der Schule für Orient- und Afrika-Forschung an der Universität London (Centennial Lecture), an der Universität von Indiana (Patten Lectures), der Universität von Connecticut, der Northwestern University, der Goethe-Universität Frankfurt am Main, der Freien Universität Berlin, im Workshop für Rechtstheorie an der Columbia-Universität sowie an der Universität Aarhus vorgetragen (und zerpflückt!). Letztere bot mir zudem den Genuss eines bezahlten Aufenthalts für die Zeit meines weiteren Forschens und Schreibens. Besonders dankbar bin ich meinen dänischen Kollegen Nils Bubandt, Mikael Gravers, Christian Lund, Niels Brimnes, Preben Kaarlsholm und Bodil Frederickson für ihre intellektuelle Freigebigkeit und für Einsichten, die meine Kenntnisse förderten.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand irgendwo jemals eine wertvol16lere und intellektuell unerbittlichere Forschungsassistentin hatte als ich – in Gestalt von Annikki Herranan, die inzwischen eine Laufbahn als Anthropologin eingeschlagen hat. Annikki stellte mir Woche für Woche ein intellektuelles »Verkostungsmenü« von üppigen Ausmaßen zusammen, das mich unfehlbar zu den saftigsten Bissen führte. Faizah Zakariah fahndete nach den Rechten für die Reproduktion der Abbildungen, die sich in diesem Band finden, und Bill Nelson fertigte sorgfältig die Karten, Grafiken und »Histogramme« an, die dem Leser Orientierung bieten sollen. Jean Thomson Black schließlich, meine Lektorin bei Yale University Press, ist der Grund meiner Treue und der vieler anderer Autoren zu diesem Verlag; sie verkörpert in ihrer Person das Niveau an Qualität, Aufmerksamkeit und Tüchtigkeit, von dem wir alle uns wünschen würden, dass es weniger selten vorkäme. Als es darum ging, dem endgültigen Manuskript möglichst alle Irrtümer, ungeschickten Formulierungen und Widersprüche auszutreiben, war Dan Heaton der »Vollstrecker«. Sein Drängen auf Perfektion wurde durch seine gute Laune und seinen Humor zum Vergnügen. Der Leser sollte wissen, dass alles dafür getan wurde, dass die verbliebenen Fehler definitiv die meinen sind.
17EINLEITUNGEin Narrativ in Trümmern: Was ich nicht wusste
Wie kam der Homo sapiens sapiens so spät in seiner Gattungsgeschichte dazu, in dichtbevölkerten, sesshaften Gemeinschaften zu leben, die mit domestiziertem Vieh und einer Handvoll Getreidesorten vollgestopft waren und von den Vorläufern dessen regiert wurden, was wir heute Staaten nennen? Dieser neuartige ökologisch-soziale Komplex wurde zum Muster fast der gesamten dokumentierten Geschichte unserer Spezies. Durch Bevölkerungswachstum, Wasser- und Zugkraft, Segelschifffahrt und Fernhandel außerordentlich verstärkt, blieb dieses Muster mehr als sechs Jahrtausende lang vorherrschend, bis es von der Verwendung fossiler Brennstoffe abgelöst wurde. Die folgende Darstellung lässt sich von der Neugierde auf die Entstehung, die Struktur und die Konsequenzen dieses agrarökologischen Komplexes leiten.
Gewöhnlich wird dieser Prozess als eine Geschichte des Fortschritts, der Zivilisierung und der öffentlichen Ordnung, verbesserter Gesundheit und zunehmender Muße erzählt. Im Lichte unserer heutigen Kenntnis ist vieles von diesem Narrativ falsch oder ausgesprochen irreführend. Das Ziel dieses Buches liegt darin, dieses Narrativ auf der Grundlage meiner Lektüre der Fortschritte in der archäologischen und historischen Forschung der letzten beiden Jahrzehnte in Frage zu stellen.
Die Gründung der frühesten Agrargesellschaften und -staaten in Mesopotamien ereignete sich in den letzten fünf Prozent unserer Geschichte als Spezies auf diesem Planeten. Und an dieser Elle gemessen, stellt die Ära der fossilen Brennstoffe, die gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts begann, nur das letzte Viertelprozent unserer Gattungsgeschichte dar. Aus alarmierenden, unübersehbaren Grün18den sind wir über die Spuren, die wir seit dieser Zeit in der Umwelt unserer Erde hinterlassen, zunehmend besorgt. Wie massiv dieser »Fußabdruck« geworden ist, lässt sich an der lebhaften Debatte um den Begriff »Anthropozän« ermessen, der eine neue geologische Epoche benennen soll, in der menschliches Handeln die Ökosysteme und die Atmosphäre des Planeten wesentlich beeinflusst hat.1
Während an den maßgeblichen Auswirkungen des heutigen menschlichen Handelns auf die Ökosphäre kein Zweifel besteht, ist die Frage umstritten, wann sie maßgeblich wurden. Einige Autoren schlagen vor, den Einschnitt auf den Zeitpunkt der ersten Atomtests zu legen, die zu einem dauerhaften und nachweisbaren Pegel an Radioaktivität auf der ganzen Welt geführt haben. Andere ziehen es vor, den Anbruch des Anthropozäns mit der industriellen Revolution und der massiven Nutzung fossiler Brennstoffe beginnen zu lassen. Begründbar wäre es auch, die Uhr in dem Moment in Gang zu setzen, als die Industriegesellschaft über die Werkzeuge – zum Beispiel Dynamit, Bulldozer, Stahlbeton (vor allem für Dämme) – verfügte, um die Landschaft radikal zu verändern. Von diesen drei Ereignissen liegt die industrielle Revolution nur zweihundert Jahre zurück, und die beiden anderen sind weitgehend noch in der Erinnerung der heute Lebenden gegenwärtig. Gemessen an der Spanne der etwa 200 000 Jahre unserer Spezies begann das Anthropozän demnach erst vor ein paar Minuten.
Ich schlage einen anderen Ausgangspunkt vor, der historisch viel weiter zurückliegt. Während ich der Prämisse eines Anthropozäns als eines qualitativen und quantitativen Sprungs im Ausmaß unserer Umwelteinwirkungen zustimme, schlage ich vor, dass wir mit der Nutzung des Feuers beginnen sollten, des ersten großen hominiden Instruments der Landschaftsgestaltung – oder vielmehr zum Bau einer Nische. Nachweise für die Nutzung des Feuers werden auf mindestens 400 000 Jahre und vielleicht in noch ältere Zeit datiert, in eine Zeit jedenfalls lange vor dem Erscheinen des Homo sapiens.2 Ständig bewohnte Siedlungen, Ackerbau und Weidewirtschaft, die vor etwa 12 000 Jahren auftauchten, bezeichnen einen weiteren Sprung in unserer Transformation der Landschaft. Wenn es um den historischen 19Fußabdruck der Hominiden geht, könnte man durchaus ein »schwaches« Anthropozän lange vor dem brisanten »starken« Anthropozän der jüngsten Zeit ansetzen; »schwach« vor allem deshalb, weil es so wenige Hominiden gab, die die Werkzeuge für eine solche Landschaftsgestaltung handhaben konnten. Im Jahr 10 000 v. Chr. betrug die Anzahl von uns Menschen weltweit zwischen kümmerlichen zwei und vier Millionen, weit weniger als ein Tausendstel unserer heutigen Population. Die andere maßgebliche vormoderne Erfindung war eine institutionelle: der Staat. Die ersten Staaten im mesopotamischen Schwemmland tauchen nicht früher als vor etwa 6000 Jahren auf, mehrere Jahrtausende nach den ersten Zeugnissen für Landwirtschaft und Sesshaftigkeit in der Region. Keine Institution hat mehr dazu beigetragen, in ihrem Interesse Techniken der Landschaftsveränderung in Gang zu setzen, als der Staat.
Eine Ahnung davon, wie es kam, dass wir zu sesshaften, getreideanbauenden, Nutztiere züchtenden Untertanen wurden, die von einer neuartigen Einrichtung regiert wurden, die wir heute Staat nennen, erfordert also einen Exkurs in die Tiefen der Geschichte. Nach meiner Auffassung ist Geschichte in ihrer besten Form die subversivste Disziplin, insofern sie uns sagen kann, wie Dinge, die wir für selbstverständlich halten, entstanden sind. Die Faszination einer Tiefengeschichte liegt darin, dass sie die vielen Kontingenzen aufdeckt, die zusammenkommen mussten, um beispielsweise die industrielle Revolution, die letzte maximale Gletscherausdehnung oder die Qin-Dynastie hervorzubringen. Damit antwortet sie auf die Forderung einer früheren Generation französischer Historiker, der Annales-Schule, nach einer Geschichte langfristiger Prozesse (la longue durée) anstelle einer Chronik der laufenden Ereignisse. Doch die aktuelle Forderung nach einer »Tiefengeschichte« geht noch einen Schritt weiter als die Annales-Schule, insofern sie etwas postuliert, was häufig auf eine Geschichte unserer Spezies hinausläuft. Dies ist die geistige Haltung, die ich teile und in der sicherlich die Maxime zum Ausdruck kommt, wonach »die Eule der Minerva erst in der Abenddämmerung ihren Flug beginnt«.3
Abb. 1 – Zeitachse: Vom Feuer zur Keilschrift
21Paradoxien der Narrative von Staat und Zivilisation
Eine Grundfrage der Staatenbildung richtet sich darauf, wie es dazu kam, dass wir (Homo sapiens sapiens) in beispiellosen Agglomerationen von Pflanzen, Tieren und Menschen lebten, wie sie für Staaten charakteristisch sind. Aus dieser Weitwinkelperspektive ist die Staatsform alles andere als natürlich oder gegeben. Homo sapiens erschien als eine Unterart vor ungefähr 200 000 Jahren und trat erst vor 60 000 Jahren außerhalb Afrikas und der Levante auf. Die ersten Nachweise für Kulturpflanzen und sesshafte Gemeinschaften sind annähernd 12 000 Jahre alt. Bis dahin – das heißt während 95 Prozent der Zeit des menschlichen Lebens auf der Erde – lebten wir in kleinen, beweglichen, zerstreuten, relativ egalitären Gruppen von Jägern und Sammlern. Wenn man sich für die Institution des Staates interessiert, ist es aber noch bemerkenswerter, dass die allerersten kleinen, stratifizierten, Steuern eintreibenden, von Mauern umgebenen Staaten in der Ebene zwischen Euphrat und Tigris erst um etwa 3100 v. Chr. auftraten, das heißt mehr als vier Jahrtausende nach den Anfängen des Getreideanbaus und der Sesshaftwerdung. Diese gewaltige Lücke stellt ein Problem für Theoretiker dar, die die Staatsform als selbstverständlich betrachten und annehmen, dass sogleich Staaten und Reiche als die logischen und effizientesten Einheiten einer politischen Ordnung entstehen, sobald mit Anbaupflanzen und Sesshaftigkeit die technischen beziehungsweise demographischen Voraussetzungen für eine Staatenbildung gegeben sind.4
Diese elementaren Tatsachen untergraben eine Auffassung der menschlichen Vorgeschichte, die die meisten von uns (und ich zähle mich hier dazu) unbedacht übernommen haben. Die historische Menschheit war hypnotisiert von dem Fortschritts- und Zivilisationsnarrativ, wie es von den ersten agrarischen Großreichen festgeschrieben wurde. Als neue und mächtige Gesellschaften waren sie entschlossen, sich so scharf wie möglich von den Populationen abzugrenzen, 23aus denen sie hervorgegangen waren und die an ihren Rändern immer noch lockten und drohten. In ihren Grundzügen war es eine Geschichte vom »Aufstieg des Menschen«. Landwirtschaft, so behauptete sie, sei an die Stelle der barbarischen, wilden, primitiven, gesetzlosen und gewalttätigen Welt der nomadisierenden Jäger und Sammler getreten. Feldgebundene Anbaukulturen seien dagegen der Ursprung von sesshaftem Leben, formaler Religion, Gesellschaft und Regierung nach Gesetzen. Wer es ablehnte, mit der Landbestellung zu beginnen, habe es aus Ignoranz getan oder wollte sich nicht ändern. In nahezu allen frühagrarischen Milieus wurde die Überlegenheit des Ackerbaus von einer umfangreichen Mythologie abgesichert, die davon erzählte, wie ein mächtiger Gott oder eine mächtige Göttin einem auserwählten Volk das heilige Korn anvertraute.
Abb. 2 – Geschätzte Weltbevölkerung
Ist die Grundannahme der Überlegenheit und Attraktivität feldgebundener Landwirtschaft gegenüber allen vorangegangenen Subsistenzformen einmal in Frage gestellt, so wird klar, dass diese Annahme ihrerseits auf einer tieferen und tiefer verwurzelten Annahme beruht, die so gut wie nie in Zweifel gezogen wurde. Und diese Annahme lautet, dass das sesshafte Leben als solches den mobilen Formen der Lebenserhaltung überlegen sei und anziehender wirke. Der Platz des »Hauses« (domus) und des festen Wohnsitzes ist im Zivilisationsnarrativ so tief verankert, dass er unsichtbar bleibt; Fische reden nicht vom Wasser! Man nimmt einfach an, der erschöpfte Homo sapiens habe es nicht erwarten können, sich endlich auf Dauer niederzulassen und Hunderttausende von Jahren der Mobilität und der saisonalen Wanderungen zu beenden. Es gibt jedoch überall starke Belege für den entschlossenen Widerstand mobiler Völker gegen permanente Ansiedlung, selbst unter relativ günstigen Umständen. Hirtenvölker und Jäger-und-Sammler-Populationen haben die dauernde Ansiedlung bekämpft und brachten sie, oft zu Recht, mit Krankheit und staatlicher Kontrolle in Verbindung. Viele indigene amerikanische Völker ließen sich erst nach militärischen Niederlagen in Reservate einsperren. Andere ergriffen die historische Gelegenheit, die der Kontakt mit den Europäern bot, um ihre Mobilität zu vergrößern; die Sioux und die Ko24mantschen begannen mit der Bisonjagd zu Pferde, wurden Händler oder Plünderer, und die Navajos wurden Schafhirten. Die meisten Völker, die mobile Existenzformen praktizierten – Hüten, Jagen, Sammeln von Wild- oder von Meeresfrüchten und sogar Wanderfeldbau –, haben sich dem modernen Handel zwar eifrig angepasst, die dauerhafte Ansiedlung jedoch erbittert bekämpft. Zumindest haben wir keinerlei Gewähr für die Annahme, dass die sedentären »Gegebenheiten« des modernen Lebens sich in der Menschheitsgeschichte auf ein universales Streben zurückverfolgen ließen.5
Das Grundnarrativ von Sesshaftwerdung und Landwirtschaft hat die Mythologie, die ihm ursprünglich als Freibrief gedient hatte, lange überlebt. Von Thomas Hobbes, John Locke und Giambattista Vico über Lewis Henry Morgan, Friedrich Engels, Herbert Spencer und Oswald Spengler bis hin zu den sozialdarwinistischen Darstellungen der Gesellschaftsentwicklung überhaupt war die Sequenz des Fortschritts vom Jagen und Sammeln zum Nomadentum und zur Landwirtschaft (und von der Horde zum Dorf, zur Stadt und zur Großstadt) gesicherte Lehrmeinung. Solche Auffassungen imitierten geradezu Julius Cäsars Evolutionsschema von Haushalten und Sippen über Stämme und Völker zum Staat (zu einem Volk, das unter Gesetzen lebt), mit Rom als Kulminationspunkt, während die Kelten und die Germanen dieser Entwicklung noch hinterherhinkten. Auch wenn sie sich im Einzelnen unterscheiden, geben solche Darstellungen den Zivilisationsverlauf wieder, wie er im pädagogischen Normalfall vermittelt und den Schulkindern auf der ganzen Welt eingetrichtert wird. Der Schritt von einer Subsistenzweise zur nächsten wird als scharf und endgültig betrachtet. Einmal mit den Techniken der Feldbebauung vertraut gemacht, würde niemand auch nur auf den Gedanken kommen, Nomade oder Sammler zu bleiben. Von jedem Schritt heißt es, er stelle einen epochalen Sprung für das Wohlergehen der Menschheit dar: mehr Muße, bessere Ernährung, längere Lebenserwartung und auf lange Sicht ein geregeltes Leben, das die Künste der Haushaltsführung und die Entwicklung der Zivilisation fördert. Die Verdrängung dieses Narrativs aus der allgemeinen Vorstellungs25welt ist nahezu unmöglich; das »12-Schritte-Programm«, das dafür nötig wäre, spottet aller Vorstellungskraft. Nichtsdestoweniger werde ich hier einen ersten Anfang machen.
Wie sich zeigt, muss der überwiegende Teil dessen, was wir als das Standardnarrativ bezeichnen könnten, im Lichte des anwachsenden archäologischen Beweismaterials aufgegeben werden. Entgegen früheren Annahmen ähneln die Jäger und Sammler – auch in den marginalen Refugien, die sie heute noch bewohnen – mitnichten den ausgemergelten, kurz vorm Hungertod stehenden Desperados der Folklore. In Wirklichkeit waren Jäger und Sammler nie in so guter Verfassung – was ihre Ernährungsweise, ihre Gesundheit und ihre Muße angeht. Ackerbauern hingegen sahen niemals so schlecht aus – was ihre Ernährungsweise, ihre Gesundheit und ihre Muße betrifft.6 Die gegenwärtige Mode der »paläolithischen« Diäten zeigt das Einsickern dieses archäologischen Wissens in die Populärkultur. Der Übergang vom Jagen und Sammeln zum Ackerbau – ein Übergang, der langsam, aufhaltsam, umkehrbar und manchmal unvollständig verlief – brachte mindestens ebenso viel Kosten wie Nutzen mit sich. Während die Anpflanzung von Getreide im Standardnarrativ als entscheidender Schritt hin zu einer utopischen Gegenwart anmutet, kann er denen, die ihn als Erste taten, nicht in dieser Weise erschienen sein: eine Tatsache, die sich für manche Gelehrte in der biblischen Geschichte der Vertreibung Adams und Evas aus dem Garten Eden niederschlägt.
Die Wunden, die dem Standardnarrativ von der gegenwärtigen Forschung geschlagen wurden, sind meines Erachtens für seine Existenz bedrohlich. Zum Beispiel wurde angenommen, dass ein fester Wohnsitz – die Sesshaftigkeit – eine Folge der Bewirtschaftung von Getreidefeldern sei. Erst der Getreideanbau habe es Populationen ermöglicht, sich an bestimmten Orten zu konzentrieren und niederzulassen und damit eine notwendige Bedingung für die Staatenbildung zu erfüllen. Zum Unglück für das Narrativ ist Sesshaftigkeit in Wirklichkeit bereits in ökologisch reichen und variationsreichen voragrarischen Umgebungen weit verbreitet – besonders in Feuchtgebieten am Rande saisonaler Migrationswege von Fischen, Vögeln und größerem 26Wild. Dort, im alten südlichen Mesopotamien (griechisch für »Zweistromland«), begegnet man sesshaften Bevölkerungen, sogar Städten von bis zu fünftausend Einwohnern mit wenig oder ohne Landwirtschaft. Auch die entgegengesetzte Anomalie ist anzutreffen: Getreideanbau verbunden mit Mobilität und verstreuter Population, abgesehen von einer kurzen Ernteperiode. Dieses letzte Paradox macht uns erneut auf die Tatsache aufmerksam, dass die implizite Annahme des Standardnarrativs – nämlich dass die Menschen es gar nicht abwarten konnten, ihre Mobilität ganz und gar aufzugeben und sich »niederzulassen« – ebenso falsch sein könnte.
Vielleicht das Verwirrendste von allem ist der zivilisatorische Akt im Mittelpunkt des ganzen Narrativs: Die Domestikation erweist sich unglaublich schwer fasslich. Schließlich haben Hominiden die Pflanzenwelt – weitgehend mit Hilfe des Feuers – bereits vor dem Auftreten des Homo sapiens gestaltet. Was soll als der Rubikon der Domestikation gelten? Ist es die Pflege der Wildpflanzen, das Jäten, ihr Transport an einen anderen Ort, das Ausbringen einer Handvoll Samen auf einen nährstoffreichen Schlamm, das Ablegen des einen oder anderen Samenkorns in einer Vertiefung, die mit einem Pflanzstock hergestellt wurde, oder das Pflügen? Es scheint hier kein Aha-Erlebnis gegeben zu haben, bei dem jemandem ein Licht aufgegangen wäre. Noch heute gibt es in Anatolien große Bestände von Wildweizen, aus denen man, wie Jack Harlan bekanntlich gezeigt hat, mit einer Feuersteinsichel in drei Wochen genügend Korn ernten kann, um eine Familie für ein Jahr zu ernähren. Lange vor der bewussten Ausbringung von Saatkorn auf gepflügten Feldern hatten Wildbeuter sämtliche Instrumente für die Ernte entwickelt: Worfel, Mahlsteine, Mörser und Stößel zur Verarbeitung von Wildgetreide und Hülsenfrüchten.7 Dem Laien erscheint das Einsenken von Saatkorn in eine vorbereitete Furche oder ein Loch als das Entscheidende. Aber zählt auch das Ablegen von Kernen einer genießbaren Frucht in einem Beet von Gemüsekompostabfällen in der Nähe eines Lagers, wenn man weiß, dass viele davon aufkeimen und gedeihen werden?
Für Archäobotaniker hing der Nachweis für domestiziertes Ge27treide davon ab, dass man Pflanzen mit festen, nicht spröden Ährenachsen (wie sie von den frühen Pflanzern absichtlich oder unabsichtlich bevorzugt wurden, weil die Fruchtstände die Samenkörner nicht sofort ausstreuten, sondern »warteten, bis jemand sie erntete«) und mit größeren Samenkörnern fand. Nun stellt sich heraus, dass diese morphologischen Veränderungen offenbar erst eingetreten sind, lange nachdem Getreidepflanzen kultiviert wurden. Und auch was bisher als unzweideutiger Skelettbeweis für vollständig domestizierte Schafe und Ziegen galt, ist inzwischen in Frage gestellt worden. Aus solchen Ambiguitäten lässt sich zweierlei folgern. Erstens wird damit die Feststellung einer singulären Domestikation ebenso willkürlich wie witzlos. Zweitens stärken sie die Argumentation mancher Autoren zugunsten einer sehr, sehr langen Periode, in der eine »Nahrungsproduktion auf niedrigem Niveau« mit Pflanzen stattfand, die nicht mehr ganz Wildpflanzen und noch nicht ganz Kulturpflanzen waren. Die besten Analysen der Pflanzenkultivierung verwerfen die Vorstellung eines singulären Domestikationsereignisses und nehmen stattdessen auf der Grundlage starker genetischer und archäologischer Belege Kultivierungsprozesse an, die in manchen Gegenden bis zu dreitausend Jahre gedauert und zu vielfachen, verstreuten Domestikationen der wichtigsten Erntepflanzen (Weizen, Gerste, Reis, Kichererbsen, Linsen) geführt haben.8
Während diese archäologischen Befunde von dem Standardnarrativ der Zivilisationsentstehung nichts als Trümmer hinterlassen haben, könnte man diese frühe Periode vielleicht als Teil eines langen, immer noch andauernden Prozesses begreifen, in den wir Menschen eingegriffen haben, um mehr Kontrolle über die Reproduktionsfunktionen der für uns interessanten Pflanzen und Tiere zu gewinnen. Selektiv züchten, schützen und nutzen wir sie. Wir könnten dieses Argument wohl auch auf die frühagrarischen Staaten und ihre patriarchale Kontrolle über die Fortpflanzung von Frauen, Gefangenen und Sklaven ausdehnen. Guillermo Agaze formuliert es noch kühner: »Die frühnahöstlichen Dörfer domestizierten Pflanzen und Tiere, die städtischen Institutionen in Uruk Menschen.«9
28Den Staat in die Schranken weisen
Eine Untersuchung über die Staatenbildung wie diese läuft per definitionem Gefahr, dem Staat einen privilegierteren Platz einzuräumen, als es ihm in einer ausgewogeneren Darstellung der conditio humana zukäme. Eben dies möchte ich vermeiden. Nach den Tatsachen, wie ich sie zu verstehen gelernt habe, würde eine unparteiische Gattungsgeschichte dem Staat eine weitaus bescheidenere Rolle beimessen, als sie ihm normalerweise zuerkannt wird.
Dass Staaten die archäologischen und historischen Zeugnisse dominieren, ist nicht verwunderlich. Für uns – das heißt für den Homo sapiens –, die wir es gewohnt sind, in der Größenordnung von einer oder ein paar wenigen Lebensspannen zu denken, erscheint die Permanenz des Staates und des von ihm verwalteten Raumes als unausweichliche Konstante unserer Existenz. Abgesehen von der totalen Hegemonie der Staatsform heute werden Archäologen und Historiker auf der ganzen Welt überwiegend vom Staat bezahlt, und was sie liefern, läuft häufig auf narzisstische Selbstporträts hinaus. Was diese institutionelle Schlagseite verstärkt, ist die bis vor kurzem lebendige archäologische Tradition, bedeutende historische Ruinen auszugraben und zu analysieren. Wenn man also steinerne Monumentalbauten errichtet und seine Überbleibsel passenderweise an einer einzigen Stelle hinterlässt, wird man wahrscheinlich »entdeckt« werden und in der Alten Geschichte eine prominente Rolle spielen. Wenn man andererseits mit Holz, Bambus oder Schilf baut, ist es viel weniger wahrscheinlich, dass man archäologische Spuren hinterlässt. Und wenn man einer von noch so vielen Jägern, Sammlern oder Nomaden ist und seinen biologisch abbaubaren Müll weit in der Landschaft verstreut, dann taucht man in den archäologischen Zeugnissen mit einiger Sicherheit überhaupt nicht auf.
Sobald schriftliche Dokumente – sagen wir in Hieroglyphen oder Keilschrift – unter den historischen Zeugnissen erscheinen, wird die 29Schlagseite sogar noch ausgeprägter, denn dies sind unweigerlich staatszentrierte Texte: Steuern, Arbeitseinheiten, Abgabenlisten, Königsgenealogien, Gründungsmythen, Gesetze. Hier sind keine opponierenden Stimmen vernehmbar, und Bemühungen, solche Texte gegen den Strich [against the grain] zu lesen, sind heroisch, stoßen aber auf außerordentliche Hindernisse.10 Je größer das hinterlassene Staatsarchiv, desto mehr Dokumente sind – allgemein gesprochen – diesem historischen Reich und seiner Selbstbespiegelung gewidmet.
Und doch waren die allerersten Staaten, die in dem windigen Schwemmland im südlichen Mesopotamien, in Ägypten und am Gelben Fluss auftauchen sollten, demographische wie geographische Petitessen. Sie waren nicht viel mehr als ein Fliegendreck auf der damaligen Weltkarte und ein bloßer Rundungsfehler in der Summe der Weltbevölkerung, die auf ungefähr 25 Millionen Menschen im Jahr 2000 v. Chr. geschätzt wird. Es waren winzige Knoten der Macht, umgeben von riesigen Gebieten, die von nichtstaatlichen Völkern – oder »Barbaren« – bewohnt wurden. Trotz Sumer, Akkad, Ägypten, Mykene, Olmeken und Maya, Harappa in Indien und Qin in China lebte der größte Teil der Weltbevölkerung sehr lange außerhalb des unmittelbaren Zugriffs von Staaten und ihrer Besteuerung. Ab wann genau die politische Landschaft endgültig staatendominiert ist, lässt sich kaum sagen, und jedes Datum wäre recht willkürlich. Bei großzügiger Lesart war bis vor vierhundert Jahren ein Drittel des Globus noch von Jägern und Sammlern, nomadischen Bauern oder Hirten und unabhängigen Gärtnern bewohnt, während Staaten, im wesentlichen Agrarstaaten, weitgehend auf jenen kleinen Teil des Globus beschränkt blieben, der sich für den Ackerbau eignete. Ein großer Teil der Weltbevölkerung war noch nie der Verkörperung des Staates schlechthin begegnet: dem Steuereintreiber. Viele, vielleicht eine Mehrheit, waren imstande, das Staatsgebiet zu betreten, es zu verlassen und ihre Subsistenzweisen zu verändern; sie hatten gute Chancen, sich der eisernen Faust des Staates zu entziehen. Wenn wir also das Zeitalter der endgültigen Hegemonie des Staates etwa mit dem Jahr 1600 n. Chr. beginnen lassen, kann man sagen, dass der Staat nur die 30letzten 0,2 Prozent des politischen Lebens unserer Spezies dominiert hat.
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nur auf die außergewöhnlichen Orte richten, an denen die frühesten Staaten entstanden, laufen wir Gefahr, die Schlüsseltatsache zu übersehen, dass es bis vor recht kurzer Zeit in großen Teilen der Welt überhaupt keinen Staat gab. Die klassischen Staaten Südostasiens sind grob gesagt zeitgenössisch mit dem Reich Karls des Großen, mehr als sechstausend Jahre nach der »Erfindung« der Landwirtschaft. Die Staaten der Neuen Welt sind mit Ausnahme des Mayareiches sogar noch jüngere Schöpfungen, und auch sie hatten bescheidene Ausmaße. Außerhalb ihrer Reichweite gab es große Konglomerate von Populationen, die – wie Historiker vielleicht sagen würden – »unregiert« in Stämmen, Stammesfürstentümern und Horden zusammenlebten. Sie bewohnten Zonen ohne oder nur mit verschwindend geringer, allenfalls nomineller Staatlichkeit.
Die fraglichen Staaten entsprachen nur selten und dann nur ganz kurz dem Bild jener gewaltigen Leviathane, als welche sie in der Beschreibung ihrer Blütezeit zumeist erscheinen. Vielfach waren Interregna, Zerfall und »dunkle Zeitalter« eher an der Tagesordnung als Zeiten gefestigter, effektiver Herrschaft. Auch hier wieder stehen wir – und die Historiker ebenso – im Bann der Zeugnisse für die Gründung einer Dynastie oder für ihre Hochzeit, während Perioden des Zerfalls und der Unordnung wenig oder keinerlei Spuren hinterlassen. Griechenlands vier Jahrhunderte andauerndes »dunkles Zeitalter«, in dem die Kenntnis der Schrift offenbar verloren gegangen war, gleicht einem leeren Blatt in der Geschichte, verglichen mit der riesigen Literatur zum griechischen Theater und zur griechischen Philosophie der klassischen Zeit. Dies ist völlig verständlich, wenn der Zweck der Geschichtsschreibung darin besteht, die kulturellen Leistungen zu betrachten, die wir verehren, doch übersieht man dabei die Sprödigkeit und Zerbrechlichkeit von Staatsformen. In einem erheblichen Teil der Welt war der Staat, selbst wenn er robust war, eine saisonale Institution. Noch bis in jüngste Zeit schrumpfte während der alljährlichen Monsunperiode in Südostasien die Fähigkeit des 31Staates, seine Macht zu entfalten, auf den Bereich innerhalb der Palastmauern zusammen. Entgegen dem Selbstbild des Staates und seiner zentralen Stellung in den meisten Standardgeschichtswerken ist es wichtig, zu erkennen, dass er noch Jahrtausende nach seinem ersten Auftreten für einen großen Teil der Menschheit keine Konstante, sondern eine Variable war – und noch dazu eine sehr wacklige.
Noch in einem anderen Sinne ist diese Geschichte eine nichtstaatliche. Sie lenkt unsere Aufmerksamkeit auf all die Aspekte der Staatenwerdung und der Staatenzusammenbrüche, die in den Quellen entweder fehlen oder nur schwache Spuren hinterlassen haben. Trotz enormer Fortschritte in der Dokumentation von klimatischen Veränderungen, demographischen Verschiebungen, Bodenqualität und Ernährungsgewohnheiten gibt es viele Aspekte der frühesten Staaten, die man in den materiellen Überbleibseln oder in frühen Texten kaum findet, weil es sich um schleichende, langsame, vielleicht symbolisch bedrohliche oder gar nicht erwähnenswerte Prozesse handelt. Zum Beispiel kam es offenbar recht häufig zur Flucht aus den frühen Staaten in periphere Gebiete, aber da eine solche Flucht dem Narrativ des Staats als des zivilisierenden Wohltäters seiner Untertanen widerspricht, wird sie in obskure Gesetzeskodizes verbannt. Ebenso wie andere Autoren bin ich so gut wie sicher, dass Krankheiten ein Hauptfaktor für die Fragilität der frühen Staaten waren. Ihre Wirkungen sind jedoch schwer zu dokumentieren, da sie so plötzlich auftraten und so wenig verstanden wurden, zumal viele epidemische Krankheiten keine offensichtlichen Signaturen an den Skeletten hinterließen. Ähnlich ist auch das Ausmaß von Sklaverei, Knechtschaft und Zwangsumsiedlung nur schwer dokumentierbar, weil ohne Fesseln Sklaven und freie Untertanen nicht zu unterscheiden sind. Alle Staaten waren von nichtstaatlichen Völkern umgeben, doch aufgrund ihrer Verstreuung wissen wir herzlich wenig über ihr Kommen und Gehen, über ihre veränderliche Beziehung zu den Staaten und über ihre politischen Strukturen. Wenn eine Stadt bis auf die Fundamente niedergebrannt ist, lässt sich oft nur schwer sagen, ob die Ursache ein auf Fahrlässigkeit zurückzuführendes Feuer war, wie es sämtliche antike Städte bedrohte, 32die aus brennbaren Materialien errichtet waren, ob es einen Bürgerkrieg oder einen Aufstand gegeben hatte oder ob die Stadt Opfer eines Raubzugs geworden war.
So weit wie möglich habe ich versucht, meinen Blick von dem blendenden Glanz der staatlichen Selbstdarstellung abzuwenden, und habe nach historischen Kräften gesucht, die von dynastischen und schriftlichen Geschichtsdarstellungen systematisch übersehen werden und den archäologischen Standardtechniken widerstehen.
Kurzer Vorausblick auf unsere Reise
Das erste Kapitel wendet sich dem Thema der Zähmung des Feuers, der Züchtung von Pflanzen und Tieren sowie der Konzentration von Nahrungsmitteln und Menschen zu, die durch eine solche Domestikation möglich wird. Ehe wir zum Objekt einer Staatsbildung gemacht werden konnten, mussten wir uns in beträchtlicher Zahl und in der begründeten Erwartung, nicht unmittelbar Hungers zu sterben, sammeln – oder versammelt werden. Jede dieser Domestikationen ordnete die natürliche Welt neu in einer Weise, die den Radius einer Mahlzeit erheblich verminderte. Das Feuer, das wir unserem älteren Verwandten Homo erectus verdanken, war unsere beste Trumpfkarte, weil es uns die Möglichkeit eröffnete, die Landschaft so umzugestalten, dass fruchttragende Pflanzen – Nuss- und Obstbäume, Beerenbüsche – bessere Bedingungen vorfanden, und Weideland zu schaffen, das begehrte Beutetiere anziehen sollte. Das Küchenfeuer machte eine Vielzahl bis dahin unverdaulicher Pflanzen genießbar und zugleich nahrhafter. Wir verdanken unser relativ großes Gehirn und unser relativ kleines Gedärm (verglichen mit dem anderer Säugetiere, einschließlich der Primaten) offenbar der Hilfe der externen Vorverdauung, die uns der Kochvorgang bietet.
Die Domestikation von Getreidearten – in diesem Falle vor allem 33Weizen und Gerste – sowie von Hülsenfrüchten fördert diesen Konzentrationsprozess. In Koevolution mit den Menschen wurden die Sorten vor allem nach der Größe ihrer Früchte (Samen), ihrer bestimmten Reifung und ihrer Dreschbarkeit (der Eigenschaft, die reifen Körner im Fruchtstand festzuhalten und nicht sofort fallen zu lassen) selektiert. Sie lassen sich Jahr für Jahr um das Haus (domus, den Wohnsitz und seine unmittelbare Umgebung) herum anpflanzen und liefern eine recht verlässliche Kalorien- und Proteinquelle – entweder als Vorrat in einem schlechten Jahr oder als Grundnahrungsmittel. Domestizierte Tiere – hier vor allem Schafe und Ziegen – lassen sich unter demselben Gesichtspunkt betrachten. Sie leisten uns als vierfüßige (oder, was Hühner, Enten und Gänse angeht, zweifüßige) Sammler gefällige Dienste. Dank ihrer Darmbakterien können sie Pflanzen verdauen, die wir nicht finden und/oder abbauen können, und erstatten uns diese sozusagen in »zubereiteter« Form als Fett und Protein zurück, die wir sowohl benötigen als auch verdauen können. Wir züchten diese domestizierten Tiere wegen der Eigenschaften, die wir uns wünschen: rasche Vermehrung, Ertragen von Gefangenschaft, Fügsamkeit, Fleisch-, Milch- und Wollproduktion.
Die Pflanzen- und Tierzucht war, wie gesagt, für die Sesshaftwerdung keine strikte Notwendigkeit, schuf jedoch die Bedingungen für ein beispielloses Niveau der Nahrungs- und Bevölkerungskonzentration, zumal in den günstigsten agroökologischen Umgebungen: reiches Schwemmland oder Lößböden sowie ganzjährig Wasser. Deshalb wähle ich als Bezeichnung für solche Plätze »neue speziesübergreifende Siedlungen des Spätneolithikums« [late-Neolithic multispecies resettlement camps]. Wie sich zeigen sollte, boten diese neuen Siedlungen zwar ideale Voraussetzungen für die Staatenbildung, bedeuteten aber erheblich härtere Arbeit als Jagen und Sammeln und waren der Gesundheit ganz und gar nicht zuträglich. Warum jemand, der nicht durch Hunger, Gefahr oder physischen Zwang dazu veranlasst wurde, bereitwillig das Jagen, Sammeln oder Viehhüten zugunsten der Vollzeit-Landwirtschaft hätte aufgeben sollen, ist schwer vorstellbar.
Der Ausdruck »domestizieren« wird normalerweise als ein aktives 34Verb verstanden, das ein direktes Satzobjekt regiert, wie etwa in »Der Homo sapiens hat den Reis, das Schaf usw. domestiziert«. Dabei wird die aktive Handlungsmacht der Domestizierten übersehen. Es ist zum Beispiel nicht so eindeutig, inwieweit wir den Hund oder der Hund uns domestiziert hat. Und was ist mit den »Tischgenossen« – Spatzen, Mäusen, Kornkäfern, Zecken, Wanzen –, die nicht in die neuen Siedlungen gebeten worden waren, aber sich ungefragt einfanden, weil ihnen die Gesellschaft und die Nahrung zusagten? Und was ist mit dem »obersten Domestikator« Homo sapiens? Wurde er nicht seinerseits domestiziert, gefangen in der Tretmühle des Pflügens, Säens, Jätens, Mähens, Dreschens, Mahlens, alles um seines Lieblingsgetreides willen und zur Erfüllung der täglichen Bedürfnisse seines Viehs? Es ist fast eine metaphysische Frage, wer im Dienste wessen steht – zumindest so lange, bis es Zeit zum Essen ist.
Die Bedeutung der Domestikation für Pflanzen, Menschen und Tiere wird im zweiten Kapitel untersucht. Wie schon andere vor mir lege ich dar, dass Domestikation als expansiver Prozess verstanden werden sollte, als fortwährende Anstrengung des Homo sapiens, die gesamte Umwelt nach seinem Geschmack zu formen. Angesichts der geringen Kenntnisse des Menschen über das Funktionieren der natürlichen Welt könnte man sagen, dass diese Anstrengung in ihren unbeabsichtigten Folgen ergiebiger war als in ihren beabsichtigten. Während der Beginn des starken Anthropozäns von manchen Autoren mit dem weltweiten radioaktiven Niederschlag im Anschluss an den Abwurf der ersten Atombombe angesetzt wird, gibt es ein »schwaches« Anthropozän – wie ich es genannt habe –, das mit der Verwendung des Feuers durch den Homo erectus vor ungefähr einer halben Million Jahren beginnt und mit der Räumung von Anbauflächen und Weideland durch Brandrodung zu Entwaldung und Auflandung führt. Die Auswirkungen und das Tempo dieses frühen Anthropozäns wachsen Hand in Hand mit der Weltbevölkerung, die im Jahr 2000 v. Chr. auf ungefähr 25 Millionen Menschen anschwillt. Es gibt keinen besonderen Grund, auf dem Etikett »Anthropozän« zu beharren – ein Ausdruck, der zurzeit ebenso sehr in Mode wie umstritten ist –, 35doch es gibt viele Gründe, auf den globalen Wirkungen der Domestikation des Feuers, der Pflanzen und des Weideviehs auf die Umwelt zu insistieren.
Die »Domestikation« veränderte die genetische Konstitution und die Morphologie der Getreidepflanzen wie auch der Tiere rings um das Haus. Die Ansammlung von Pflanzen, Tieren und Menschen in landwirtschaftlichen Siedlungen schuf eine neue und weitgehend künstliche Umgebung, in der der darwinsche Selektionsdruck neue Adaptationen förderte. Die neuen Getreidesorten wurden zu »Pflegefällen«, die nicht ohne unsere beständige Aufmerksamkeit und Obhut überleben konnten. Weitgehend das gleiche galt für domestizierte Schafe und Ziegen, die kleiner und gutmütiger wurden, weniger auf ihre Umgebung achteten und deren sexueller Dimorphismus sich zurückbildete. Ich frage mich in diesem Zusammenhang, ob es wahrscheinlich ist, dass ein ähnlicher Prozess uns selbst betraf. Wie wurden auch wir von unserem Haus, von unserer Bindung an einen Ort, von der wachsenden Populationsdichte, von den verschiedenen Mustern unserer physischen Tätigkeit und sozialen Organisation domestiziert? Und wenn man schließlich die Lebenswelt der Landwirtschaft – die nun einmal dem Takt einer vorherrschenden Getreideart gehorchen muss – mit der Lebenswelt der Jäger und Sammler vergleicht, so möchte ich behaupten, dass das Leben der Bauern an Erfahrungen viel beschränkter und in kultureller wie ritueller Hinsicht ärmer ist.
Die Belastungen im Leben der Nichteliten in den frühesten Staaten, Thema des dritten Kapitels, waren beträchtlich. An erster Stelle stand, wie schon bemerkt, die Mühsal der Arbeit. Es besteht kein Zweifel, dass – eventuell mit Ausnahme der Schwemmlandwirtschaft [décrue agriculture] – der Ackerbau sehr viel beschwerlicher war als das Jagen und Sammeln. Wie Ester Boserup und andere bemerkt haben, gibt es in den meisten Umgebungen keinen Grund, warum ein Wildbeuter zur Landbestellung übergehen sollte, es sei denn, er würde durch den Bevölkerungsdruck oder irgendeine Art von Zwang dazu genötigt. Eine zweite große und ungeahnte Belastung beim Übergang 36zum Ackerbau waren die unmittelbaren epidemiologischen Folgen der Konzentration nicht bloß von Menschen, sondern von Vieh, Getreide sowie der erheblichen Menge von Parasiten, die in ihrem Gefolge mit ins Haus zogen oder sich dort entwickelten. Krankheiten, mit denen wir heute vertraut sind – Masern, Mumps, Diphterie und andere Ansteckungskrankheiten – traten zum erstenmal in den frühen Staaten auf. Es scheint fast sicher, dass ein Großteil der frühesten Staaten in der Folge von Epidemien – analog der Antoninischen oder der Justinianischen Pest im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung oder dem Schwarzen Tod im vierzehnten Jahrhundert in Europa – zusammenbrach. Es gab aber noch eine weitere Seuche: die Plage der Steuern, die der Staat seinen Untertanen in Form von Getreideabgaben, Arbeits- und Kriegsdiensten über die drückende landwirtschaftliche Arbeit hinaus abverlangte. Wie gelang es dem frühen Staat unter solchen Umständen, seine Population zusammenzubringen, zusammenzuhalten und zu vermehren? Manche Autoren haben sogar die Meinung vertreten, dass die Staatenbildung ausschließlich dort möglich gewesen sei, wo die Bevölkerung zwischen Wüsten, Gebirgen oder einer feindseligen Peripherie eingezwängt war.11
Das vierte Kapitel ist dem gewidmet, was man als die »Getreidehypothese« bezeichnen könnte. Es ist zweifellos verblüffend, dass im Grunde alle klassischen Staaten auf Getreide (einschließlich der Hirse) basierten. Die geschichtlichen Quellen berichten von keinen Maniokstaaten, keinen Sago-, Yamswurzel-, Taro-, Mehlbananen-, Brotfrucht- oder Süßkartoffelstaaten (»Bananenrepubliken« sind etwas anderes!). Meine Vermutung ist, dass sich Getreide am besten zu konzentrierter Produktion, Steuerschätzung, Aneignung, Katastererfassung, Vorratshaltung und Zuteilung eignet. Auf geeignetem Boden bietet Weizen die agroökologischen Voraussetzungen für dichte Konzentrationen von Menschen.
Im Gegensatz dazu wachsen die Knollen der Cassava (auch als Maniok oder Yucca bekannt) unter der Erde, brauchen wenig Pflege, sind leicht zu verstecken, reifen binnen eines Jahres und können, was das Wichtigste ist, ohne weiteres in der Erde gelassen werden, wo sie 37zwei weitere Jahre lang genießbar bleiben. Wenn der Staat kommt und einem die Cassava abnehmen will, wird er eine Wurzelknolle nach der anderen ausgraben müssen, und er hat dann eine Fuhre von geringem Wert und großem Gewicht zu transportieren. Wenn wir Nutzpflanzen aus der Sicht eines vormodernen »Steuereintreibers« zu bewerten hätten, würden die Hauptgetreidearten (vor allem bewässerter Reis) zu den bevorzugtesten und Wurzeln und Knollen zu den am wenigsten präferierten Arten gehören.
Daraus folgt meiner Ansicht nach, dass die Bildung von Staaten nur möglich wird, wenn es wenig Alternativen zu einer von kultivierten Getreidearten dominierten Ernährung gibt. Solange die Subsistenz sich über mehrere Nahrungsnetze verteilt, wie es bei den Jägern und Sammlern, bei den Brandrodungsbauern, bei den Sammlern von Meeresfrüchten usw. der Fall war, ist das Entstehen eines Staates unwahrscheinlich, insofern es kein leicht zu besteuerndes und leicht zu erlangendes Grundnahrungsmittel gibt, das als Basis staatlicher Aneignung dienen könnte. Vorstellbar wäre, dass alte domestizierte Hülsenfrüchte – etwa Erbsen, Sojabohnen, Erdnüsse oder Linsen, die sämtlich nahrhaft sind und sich zur Lagerung trocknen lassen – für die Naturalsteuer in Frage kämen. Das Hindernis liegt in diesem Fall darin, dass die meisten Hülsenfrüchte unbestimmte Erträge liefern, weil sie sich pflücken lassen, solange sie wachsen; sie haben keinen bestimmten Erntezeitpunkt, etwas, worauf der Steuereintreiber angewiesen ist.