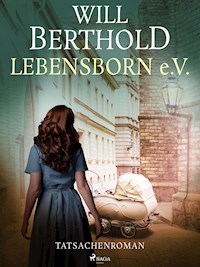Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es sind fünf herrliche Tage, die Lefty Meiler auf der Paradies-Insel Bali mit der faszinierenden Vanessa verbringt. Doch dann beordert man ihn nach Bonn. Sein Auftrag: Im Untergrund den Sperber, einen "Maulwurf" in der Umgebung des Stasi-Generals Lupus, aufzuspüren. Lefty war mit sieben Jahren mit seinem Vater, einem Raketenforscher aus Peenemünde, in die USA übergesiedelt und gerät in diesem neuen Fall natürlich sofort in die Frontlinie des deutsch-deutschen Dschungels. Erpressung, Mord, Menschenhandel – der Strudel aus Lüge und Täuschung reißt Lefty immer weiter hinunter. Und noch ehe sich der Deutschamerikaner versieht, begegnet er auch Vanessa wieder: Diesmal geht es allerdings nicht um heiße Liebeleien, sondern um Leben und Tod. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Die Nacht der Schakale
Die ehrenwerten Diebe
Roman
SAGA Egmont
Die Nacht der Schakale
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass,
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).
Originally published 1982 by Heyne Verlag, Germany.
All rights reserved
ISBN: 9788711726938
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
1
Er war groß und extrem hager, meistens ging er leicht gebeugt, mühselig, als müßte er sich anschieben. Er wirkte weit älter als er war, ein harter, strenger Mann mit schleppender Sprechweise. Mitunter glich seine Diktion einer Schnecke, die nie ans Ziel kommen wird. In der Presse wurde Thomas E. Gregory fast nie erwähnt; hinter Washingtons Kulisse jedoch als einer der einflußreichsten Männer Amerikas gehandelt. Der ›große Gregory‹ war ein Mann, der im Weißen Haus jederzeit Zutritt zu Mr. President hatte.
Er galt als rücksichtslos, zäh und durchtrieben, ein scharfer Analytiker mit dem Gesicht einer Mumie, Vicedirector des weitläufigen Hauptquartiers im Wald von Langley, US-Staat Virginia. Tarnung und Bluff waren Gregory so zur Gewohnheit geworden, daß er sich vermutlich vor dem Spiegel bereits selbst austrickste. Heute gab er sich wie ein in den Sielen verbrauchter Manager, dessen Pensionierung überfällig war, aber mich legte er mit dieser Masche nicht mehr herein.
»Nett von Ihnen, daß Sie so rasch hergekommen sind«, begrüßte er mich, als wäre ich freiwillig angereist. »Guten Flug gehabt, Lefty?«
»Einen langen Flug, Sir«, erwiderte ich, »achtzehn Stunden, vier Zwischenlandungen und dreimal umsteigen.«
Ich schaffte es nicht ganz, meinen Groll auf den Mann zu unterdrücken, der aus Vanessa und mir Romeo und Julia gemacht hatte – wenn auch nicht in Verona, sondern auf der Paradiesinsel Bali. Als ich bei seinem nächtlichen Anruf Gregorys Stimme erkannt hatte, verwünschte ich den Umstand, daß ich selbst im Urlaub im entlegensten Winkel der Welt jederzeit erreichbar bleiben mußte. Schon nach den ersten Worten war mir klargeworden, daß meine Stunden mit der bezaubernden Engländerin von der Kanalinsel Jersey gezählt waren – und das genau in jenem Moment, da der Mond den Strand versilberte, die Nacht Mitternachtsblau trug und meine Hände dabei waren, auf Vanessas Haut ein Zuhause zu finden.
Es war mein erster richtiger Urlaub seit elf Jahren gewesen: Hongkong, Manila, Singapur, indonesische Inselwelt und Bangkok. Und Vanessa war mir so unerwartet zugefallen wie der Haupttreffer im Lotto, den man auch nicht gleich am Sonntagabend kassiert. Ich sagte ihr, ich müßte dringender Dienstgeschäfte wegen eine Stippvisite in die USA unternehmen, und bat sie, im Hyatt meine Rückkehr abzuwarten, womit sie nach einigem Zögern auch einverstanden war.
Auf der langen Reise – über Manila, Tokio, San Francisco – hatte ich in einer Zeitung gelesen, daß nach einer Untersuchung der bekannten US-Psychologin Dr. Joyce Brother sich der amerikanische Durchschnittsmann zwischen 25 und 40 sechsmal pro Stunde erotische Vorstellungen macht, und Männer über 40 immerhin noch alle 30 Minuten. Aber ich brach unterwegs wohl die Rekorde aller Altersklassen: Während des ganzen Flugs spürte ich Vanessas imitierte Gegenwart, und das war für einen Mann in meinem Metier eigentlich absurd, ungewöhnlich und indiskutabel, aber es schien mir, als wäre ich bereits in eine neue und schönere Zukunft umgestiegen.
Vanessa hatte mich zum Airport begleitet, und natürlich waren mir die richtigen Worte erst eingefallen, als ich bereits im Jet saß. Ich nahm mir vor, zu halten, was ich noch gar nicht versprochen hatte. Ich war wohl von Vanessa genauso überrumpelt worden wie sie von mir. Wenn ich künftig in Bonn lebte, wäre es am Wochenende nur ein Luftsprung von eineinhalb Stunden nach London, und von London zum Bonner Regierungsflughafen Köln-Wahn wäre es auch nicht weiter. Halb im Scherz, doch mit ernstem Unterton hatten wir davon gesprochen, daß an den geraden Wochenenden ich sie und an den ungeraden sie mich besuchen würde. Ich war Vanessa gegenüber – nur ein wenig der Wahrheit vorauseilend – als US-Diplomat aufgetreten.
»Mir wäre selbstverständlich die Insel des Lichts auch lieber als unser düsteres Headquarter«, wiegelte der große Gregory ab. »Aber schließlich kann ich Ihnen geheime Unterlagen nicht nach Bali nachschicken – und überhaupt …« Er zitierte Hemingway ohne Quellenangabe: »Life is not a cocktail-party.«
Auch er war keine Cocktail-Party, ein Puritaner in jeder Hinsicht, Nichttrinker, Nichtraucher, Vegetarier bei Tisch und wohl auch im Bett, aber bei ihm dachte man an andere Dinge als ans Bett. Der Vice hatte einst als Donovans junger Mann begonnen; und Donovan war der erste und vermutlich bislang beste Chef des US-Geheimdienstes gewesen. Seitdem hatte die Nachfolgeorganisation Central Intelligence Agency (CIA) in bunter Reihe Hochs und Tiefs, Hits und Flops erlebt, aber Gregory war unangefochten durch die Skandale Kuba, Vietnam, Chile und sogar Watergate gekommen, und genauso würde er wohl auch den Falkland-Konflikt, den israelischen Einfall im Libanon und den irakisch-iranischen Grenzkrieg überleben, zumal er nichts damit zu tun hatte.
»Nun beenden Sie schon Ihren balinesischen Abschiedsschmerz, Lefty«, spottete der Vice. »Ich hab Sie ja nicht wegen einer Laune oder Lappalie in unser Headquarter gebeten.« Einen Moment lang betrachtete er mich wie ein Waidmann das durch Blattschuß erlegte Wild. »Ich spüre, daß ein Fall auf uns zukommt, der jede Dimension sprengt, und ich denke, daß wir bei der Klärung Sie hinzuziehen müssen, auch wenn Sie sich Ihre Laufschuhe bei uns bereits aufgeschnürt haben sollten. Wir bieten Ihnen eine Chance, Ihre tadelsfreie Karriere durch einen einmaligen Coup zu krönen«, lockte Gregory, griff mit welken Händen nach einem Dossier und zeigte mir den Köder vor wie einem Hund die Wurst: »Erinnern Sie sich noch an den Fall Guillaume?« fragte er überflüssig.
»Und ob«, erwiderte ich. »Der Spion, der einen deutschen Regierungschef stürzte. Ein Maulwurf im Bonner Bundeskanzleramt.«
»Es sieht so aus, als erlebten wir gerade eine Neuauflage.« Über sein von den Jahren angefressenes Gesicht lief ein Lächeln wie Salzsäure. »Diesmal allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Darauf habe ich jahrelang gewartet.«
»Ein Maulwurf auf der anderen Seite?« fragte ich überrascht. »In Ost-Berlin?«
»Sieht so aus.«
»Wo? In der Regierung? Im SED-Zentralsekretariat?«
»Jedenfalls ganz oben.« Mit diesen Worten umschrieb Gregory offensichtlich, daß er es selbst noch nicht wußte.
Klappern gehört zum Handwerk, freilich klapperte ein Mann wie er sonst viel verhaltener. Er schlug das Dossier auf und las die Unterlagen, als kenne er sie nicht schon längst auswendig. Er schnitt dabei ein Gesicht wie ein Voresser, der einem widerspenstigen kleinen Jungen den Lebertran schmackhaft machen möchte. Aber mit 43 war ich den Kinderschuhen längst entwachsen und zudem entschlossen – koste es, was es wolle –, auf die Insel der Götter und Dämonen zurückzufliegen und meinen Urlaub fortzusetzen.
Gregory würde es mir nicht leichtmachen, aber selbst er müßte einsehen, daß ich mich drei Wochen vor dem Ausscheiden aus seinen Diensten nicht noch verschleißen lassen wollte. Von privaten Gründen einmal ganz abgesehen, müßte eine Panne – kurz vor Torschluß – auch meine neue Tätigkeit als Diplomat bei der Bonner US-Botschaft in Mehlem gefährden.
Ich machte mich auf einen harten Schlagabtausch gefaßt und war doch schon zu diesem Zeitpunkt in die Operation ohne Namen verstrickt, später sollte sie die Presse als Die Nacht der Schakale bezeichnen, während sie bei uns hausintern weiterhin die Operation No Name blieb und auf der anderen Seite der Fall Sperber hieß.
Der Mann, der mir – damit ich ja keine Zeit versäumte – bei seinem nächtlichen Anruf bereits die Abflugzeit der nächsten Maschine vom Airport Ngurah Rai, südlich der Bali-Hauptstadt Denpasar, genannt hatte, benahm sich jetzt, als sei ich nur gerufen worden, ihm in seinem Büro im siebten Stock eines 65-Millionen-Dollar-Komplexes zuzusehen, wie er – entsprechend seiner Gewohnheit – Sägeböcke und Fragezeichen in das Dossier malte.
Daß ich ihm hier gegenübersaß, war die Folge eines ziemlich ungewöhnlichen Lebenslaufs. Als Siebenjähriger nach dem Zweiten Weltkrieg (natürlich ungefragt) mit meinen Eltern in die USA ausgewandert, hatte ich nur noch wenige Erinnerungen an meine frühe Kindheit in Ostpreußen und dann später auf der Ostseeinsel Peenemünde. Königsberg, die Stadt Immanuel Kants, des vielleicht größten deutschen Philosophen, der einst den kategorischen Imperativ formuliert hatte, Ostpreußens Kleinod mit der berühmten Albertus-Universität, heißt heute Kaliningrad und gehört zur Sowjetunion. Revanchegelüste liegen mir ebenso fern wie Kreuzzugsgedanken, aber ich empfand es als den kategorischen Imperativ unserer Zeit, zu verhindern, daß ganz Europa eines Tages das Schicksal meiner Heimatstadt teilen müßte.
Mein Vater hatte während des Krieges zur Crew des Raketenforschers Wernher von Braun gehört und war bei Kriegsende nebst Familie in die Staaten geschanghait und später dort eingebürgert worden. Er hätte sich sicher auch freiwillig zur Auswanderung gemeldet, wenn auf seiner Weste nicht einige braune Flecken gewesen wären – das V-Waffen-Team hatte schließlich geschlossen der Hitler-Partei angehört.
Den USA waren die Raketenforscher des Dritten Reiches genauso willkommen wie der Sowjetunion, die sich jene Wissenschaftler schnappte, die die Amerikaner nicht rechtzeitig genug aufgestöbert hatten. Die 11015 V-Waffen-Einschläge in der englischen Hauptstadt waren vergessen und begraben. Jetzt ging es um Raketenziele in der Sowjetunion oder in den Vereinigten Staaten, je nachdem, von welcher Abschußrampe aus man es betrachtete. Und die neuen Nuklearraketen trugen Mehrfachsprengköpfe und würden – so man sie losließe – den 65000 England-Toten der ›konventionellen‹ Kriegführung ein paar massenmörderiséhe Nullen hinzufügen, und zwar auf beiden Seiten.
Die Übersiedlung in die Staaten war meine erste Begegnung mit der Machtpolitik gewesen, aber damals war ich noch zu jung, um den ihr innewohnenden Zynismus zu erfassen.
Später begriff ich, daß es eine weit schlimmere Zweckpolitik gibt, als Washington sie sich leistete, in diesem wie auch in anderen Fällen.
Ich wuchs in Cap Canaveral in Florida zweisprachig auf, ein als geborener Deutscher in die Neue Welt hineinwachsender Yankee: Baseball stand mir näher als Fußball, ich betrieb wie alle Halbwüchsigen Amerikas Petting als Lieblingssport, Hamburgers zog ich einem Schweinebraten mit der typischen deutschen Beilage vor, deretwegen mich meine Mitschüler als ›Kraut‹ hänselten. Aber ähnlich erging es wohl einem berühmten US-Außenminister, der aus Fürth in Bayern stammte.
Als US-Präsident Kennedy in das Vietnam-Debakel hineinschlitterte, war ich Absolvent der Rechtswissenschaft an der Harvard University gewesen, und als seine Nachfolger den Dschungelkrieg zur Katastrophe ausufern ließen, holte man mich als Soldat und später Offizier auf die Reisfelder Südostasiens. Als Pilot eines Kampfhubschraubers wurde ich abgeschossen und hatte eine kurze, aber brutale Zeit in der Gefangenschaft der Vietkong zu überstehen, bevor ich zusammen mit ein paar Dutzend anderen Amerikanern durch ein Kommandounternehmen aus der Bambushölle herausgeholt wurde, krank, halbverhungert, angeekelt von der Zeit mit ihrer kriminellen Politik.
Die Gehirnwäsche der Roten hatte ich heil überstanden, und selbst der meiner Befreier konnte ich mich verhältnismäßig lange widersetzen. Ich teilte die typische Aversion des Amerikaners gegen Argwohn, Arglist und Lüge. Die Dreckarbeit an der unsichtbaren Front hatte mich schon angewidert, bevor ich sie kannte. Gewiß, die Intelligence-Branche muß sein, wie die Müllabfuhr oder die Arbeit einer Abdeckerei – aber dafür würde ich mich ja auch nicht freiwillig melden. Es gibt eben Berufe, die nötig, aber unbeliebt sind, und ich wollte so wenig Akteur des Untergrunds werden wie Leichenwäscher, Gerichtsvollzieher, Toilettenmann, Steuerfahnder oder Lohnschlächter. Alles notwendige und sicher achtbare Beschäftigungen, aber ich war für die freie Berufswahl.
Da kramten die CIA-Werber Trick 17 aus der Mottenkiste und überzeugten mich, daß die ganze Vietnam-Katastrophe vermeidbar gewesen wäre, wenn die US-Regierung nicht auf eine Fehleinschätzung ihres von zweitrangigen Leuten betriebenen Geheimdienstes hätte hereinfallen müssen. Was die Viets nicht geschafft hatten, gelang nach ein paar Monaten den Männern der Central Intelligence Agency: Ich quittierte schließlich die Direktive NSC 10/2, die auf den einen Satz hinauslief:
»Sie tun es, und deshalb müssen wir es auch tun.«
Ich bin immer in kritischer Distanz zu meiner Tätigkeit geblieben, und ich weiß, daß sie einen miserablen Ruf hat. Ich habe auch nicht die Absicht, als ihr Pflichtverteidiger aufzutreten. Trotzdem komme ich um die ketzerische Feststellung nicht herum, es sei in erster Linie der Spionage zu verdanken, daß trotz ständiger Explosionen rund um den Globus der dritte Weltkrieg noch nicht ausgebrochen ist. Westen wie Osten stützen sich ausschließlich auf das ausgekundschaftete Wissen um die Stärke des Gegners.
Es ist traurig, daß nicht Einsicht, Menschlichkeit, Erfahrung, Gesittung, Religion oder Moral eine dritte und letzte Katastrophe in diesem Jahrhundert verhindert haben – wenigstens bislang –, sondern die Angst – oder besser: das atomare Patt. Trotz SS-II-Raketen, Marschflugkörper, Neutronenbombe, chemischer und biologischer Massenvernichtungsmittel blieb der Menschheit – verdammt nahe am Abgrund – bisher der Untergang erspart. Und das heißt für mich: Gegenspionage muß sein, ein notwendiges Übel, bei dem die Regierung dafür Sorge tragen sollte, daß es nicht übler als notwendig eskaliert.
Ich wurde für den Untergrund abgerichtet, wie ein Hund für die Jagd – es war ein Überlebenstraining ohne Garantie, Man verschliß mich nicht im Routinedienst auf einer entlegenen Außenstelle unseres Geheimdiensties, und man verheizte mich auch nicht bei Wahnsinnseinsätzen. Ich erhielt Spezialaufträge, vorwiegend in Europa, dem Erdteil, für den ich prädisponiert war, denn hier konnte ich ebenso glaubhaft als Amerikaner wie als Deutscher auftreten. Ich fiel oder flog nie auf, wurde nie entlarvt, ja nicht einmal verdächtigt, als einer von Washingtons geheimen Außenposten zu arbeiten.
Nach jedem Einsatz kam mein Paß in den Reißwolf, ich mußte dann bald wieder in eine neue Identität steigen und die Legende – die Lebensgeschichte meines Namensgebers – auswendig lernen wie ein Schauspieler seine Rolle. Allerdings gab es keinen Souffleurkasten in meinem Fach; ein Versprecher oder Aussetzer konnte den Tod bedeuten.
Das Rollenstudium brachte mir meinen Spitznamen ein, der innerhalb unseres Clubs nur wenigen ganz oben an der Spitze Angesiedelten bekannt war: ›Lefty‹. Das heißt Linkshänder und bezog sich auf eine Zeit, als ich mich mit großen Schwierigkeiten herumquälen mußte, um bei einem Einsatz hinter dem Eisernen Vorhang meiner Legende wegen als solcher aufzutreten. Ich hatte einige Wochen trainiert und es dabei nicht weitergebracht als ein Rechtshänder, der ohne Schrecksekunde bewußt die linke Hand verwendet. Der Name war mir geblieben; sollte mein Spitzname durchsickern – was bisher nicht der Fall gewesen war –, würde er mich, zumindest beim ersten Verdacht, sogar schützen.
Meinen Widerwillen gegen die Untergrundtätigkeit bewertete Gregory sogar als Pluspunkt, da Skeptiker vorsichtig und intelligenter seien als Fanatiker. Ich war dem Mann, dem ich jetzt gegenübersaß, bald aufgefallen und von ihm gefördert worden. Seine Patronage reicht sogar so weit, daß er mir als Geheimnisträger das Ausscheiden aus dem CIA erlaubte und die Übersiedelung in die Dienste des US-Außenministeriums befürwortete. Hätte er mich jetzt nicht aus dem Urlaub zurückgeholt, wäre der Stellungswechsel problemlos und ohne Zeitverlust über die Bühne gegangen.
Er war mit dem Aktenstudium fertig.
»Sorry, Lefty«, sagte er. »Ich hab schließlich mehr Dinge im Kopf und mußte den Fall noch einmal rekapitulieren.« Es hörte sich seltsam an; zwei Eigenschaften des Vice waren in Langley hinreichend bekannt: sein phänomenales Gedächtnis und seine intuitive Art, die Gedanken seiner Gesprächspartner zu erraten.
Seine Hände lagen auf dem Dossier, so als müßten sie es noch zusätzlich hüten, bevor er es mir endgültig übergäbe, nicht ohne seinen Bleistift-Marginalien noch ergänzende Empfehlungen hinzugefügt zu haben. »Wie gesagt, eine Chance wie vielleicht noch nie zuvor. Die Sache ist schon seit einiger Zeit am Dampfen«, erklärte er. »Sie hat eigentlich ganz undramatisch begonnen: Sindelfingen kann ich bei Ihnen als bekannt voraussetzen?« fragte er.
Bei der deutschen Tochtergesellschaft eines US-Riesen der elektronischen Branche waren drei Mitarbeiter als Ostagenten entlarvt worden. So etwas geschieht immer wieder, und häufig genug kommen Wirtschaftsspione aus dem Westen und wirken für die Konkurrenz. Deshalb haben sich Firmen, die Wert auf ihre Produktionsgeheimnisse legen, einen wachsamen Werkschutz zugelegt.
»Aber Sindelfingen war doch wohl eine reine Routinesache?« vergewisserte ich mich.
»Es sah so aus – und das sollte es auch«, erwiderte der große Gregory. »Aber der Tip, der zur Entlarvung der Ostagenten geführt hat, stammte aus dem Osten.«
»Und zwar von dem großen Unbekannten persönlich«, spottete ich, »für wie sicher halten Sie eigentlich Ihr Material, Sir?«
»Für so unsicher wie nur möglich«, antwortete der Vice. »Ich habe Sie ja hergebeten, um den Fall zu analysieren. Sagen Sie mir mit einer gewissen Sicherheit, wieviel an der Sache stimmt, und der Fall ist für Sie erledigt. Wir scheiden mit Händedruck, und ich wünsche Ihnen alles Gute.«
Es klang vernünftig und bieder und war vielleicht doch nur schierer Hohn.
»Das Dossier wurde von unseren Leuten erarbeitet?« fragte ich.
»Zusammengestellt«, erwiderte der Vice. »Erarbeitet wurde es vorwiegend in Pullach.«
»Der Bundesnachrichtendienst hat uns die Informationen überlassen?«
»Kommen Sie endlich herunter von Ihrer Trauminsel, Lefty«, erwiderte Gregory ungehalten und lächelte hämisch. »Ein Verbindungsmann zur BND-Zentrale hat Wind von der Sache bekommen und uns einen Wink gegeben. Daraufhin sind wir über den offiziellen CIA-Kontaktmann in Pullach vorstellig geworden und haben von den BND-Leuten eine – sagen wir mal – zurückhaltende Bestätigung erhalten.« An seinen ausgedörrten Lippen hing der Spott wie winzige Speicheltröpfchen. »Wir sind übereingekommen, daß wir, wenn es spruchreif sein wird, mit Pullach eng zusammenarbeiten. Das ist sozusagen die offizielle Seite.«
»Und spruchreif wird es nie sein oder vielleicht zu spät«, warf ich ein.
Das Telefon unterbrach unser Gespräch; wenn es durchgestellt wurde, mußte es ein wichtiger Vorgang sein. Ich erhob mich, um den Raum zu verlassen, aber Gregory gab mir einen Wink zu bleiben. Er war Profi genug, um nur mit ja oder nein zu antworten, so daß ich zuhören konnte, ohne zu erfassen, worum sich der Anruf drehte.
Das Telefongespräch zog sich in die Länge, und meine Gedanken streunten umher. Auf einmal saß ich wieder auf der Kawasaki, jagte über die Insel der Götter und Dämonen, und sie blieben uns gnädig gesonnen, obwohl wir ihnen das Lächeln gestohlen hatten: Vanessa saß auf dem Sozius im Damensitz. Sonst machten wir uns beide nichts aus dem heißen Stuhl, aber jetzt lüfteten wir unsere Persönlichkeit im Fahrtwind aus; er löste ihre Frisur auf. Sobald ich mich umdrehte, berührten mich ihre Haarspitzen, und ich sah kleine Funken und spürte elektrische Schläge auf der Haut. Wir jagten auf der 5500 Quadratkilometer großen Insel von einem Ende zu anderen, vom Indischen Ozean bis zur Bali-See auf der anderen Seite, überholten zahlreiche Colts, wie man die Minibusse nennt, und freuten uns auf den Abend an Samurs Strand oder in einem Dancing im Gammelviertel von Kuta.
Vanessa war mittelgroß, eher zierlich und maßvoll kapriziös. Sie hatte einen beschwingten Gang, dunkle, kufzgeschnittene Haare und leuchtende, kobaltblaue Augen, die jedenfalls mehr Interesse für die Tempel und Kunststätten Ostasiens als für die Teilnehmer der Reisegesellschaft, inklusive der männlichen, aufbrachten, zu der sie gehörte.
Ich kannte Vanessa erst fünf Tage, aber es kam mir vor, als wären es bereits Monate, wenn nicht Jahre. Sie war mir in der Hotelhalle sofort aufgefallen, ohne daß sie es provoziert hätte. Sie stand ein wenig abseits von ihrer Gruppe, wirkte distanziert, ohne arrogant zu sein. Sie war nicht zimperlich oder prüde, legte aber ihre weiblichen Reize auch nicht für jedermann ins Schaufenster.
Ich machte mich an die Engländerin heran. Sie ließ es zu und wehrte mich doch gleichzeitig ab, ohne verletzend zu wirken. Man konnte sich ohne weiteres bei Vanessa einen Korb holen und sich dafür auch noch herzlich bedanken. Sie war intelligent, ohne blaustrümpfig zu wirken, und erzählte, daß sie nach der Reise als Juniorpartner in eine Londoner Anwaltsfirma eintreten würde.
Selbst im Urlaub galten für mich noch die Usancen eines oft verwünschten Berufs, und so mußte ich – wie bei allen Menschen, die mir näher begegnen – meine Firma anläuten und bitten, Vanessas Identität zu klären. Unser Mann in Djakarta ließ die Daten, soweit ich sie ihm geben konnte, sowie Vanessas Personenbeschreibung durch den Computer laufen. Die elektronische Clearing-Operation endete, wie ich es nicht anders erwartet hätte, und das hieß, daß mein Verein keine Einwände gegen die Engländerin vorzubringen hatte; sie war, geheimdienstlich gesehen, ein unbeschriebenes Blatt.
Der Weg zu ihr schien frei zu sein, aber ich näherte mich behutsam dem Ziel. Von vornherein stand für mich fest, daß Vanessa mehr sein würde als der übliche Ferienbonus. Ich mag Frauen, aber schon von Berufs wegen bin ich ihnen gegenüber auf der Hut, und so ist mein Umgang mit dem schönen Geschlecht ziemlich defizitär.
Es blieb mir nur wenig Gelegenheit, geschlechtsspezifische Fähigkeiten zu entfalten. Ich eroberte, was man auf der Durchreise in ein paar Stunden eben so aufreißen kann, und das war, gemessen an Vanessa, dritte oder vierte Besetzung an Frau, Talmi, Plunder, Imitat. ›Weder Fräulein, weder schön‹ – und schon gar kein Gretchen (aber ich war schließlich auch kein Faust).
Bei Frauen bin ich eher Skeptiker. Die Sicherheitsbestimmungen machen CIA-Angehörige und ihre Familienmitglieder zu einem geschlossenen Verein. Hier bedurfte es keiner elektronischen Recherche, in dieser Art Ghetto kannte man jedes Gesicht. Flirt, Verlobung, Ehebruch, Scheidung, Wiederverheiratung spielten sich im gleichen Kreis ab. In dieser Plantage der Monotonie wußte man alles voneinander, kannte sich letztlich selbst im Intimbereich wie nach einer Gruppensexparty.
Selbstverständlich sind die Menschen in Quarantäne nicht leichtfertiger oder unmoralischer als alle anderen, nur die Langeweile ist größer. Viele bleiben trotzdem resistent und führen selbst noch in der Isolation ein normales, bürgerliches Leben. Bei anderen freilich kommt es in puncto Freizeitgestaltung zu einer Art unzüchtigem Inzest, was sicher dazu beitrug, daß ich noch immer Junggeselle bin.
Gregory hatte sein Telefonat beendet, er sah einen Moment lang ins Leere und legte dann auf. »Sorry, Lefty«, entschuldigte er sich, »aber wir sind bereits wieder einen Schritt weiter: Ein neuerlicher Hinweis aus Ostberlin. Die gleiche Quelle. Wiederum stichhaltig. Freilich kann es auch raffiniertes Spielmaterial sein – trotzdem sehe ich erstmals seit langem eine Chance, den DDR-Staatssicherheitsdienst auszunehmen wie einen Thanksgiving-Truthahn.« Die Falten in seinem Gesicht probten ein seltsames Fixierspiel; es sollte wohl ein Lächeln sein. »Natürlich ist es noch zu früh, um über eine Stasi-Schlappe zu jubilieren, aber wenn die Affäre hält, was sie verspricht, ist der Fall Guillaume ein vergleichsweise kleiner Fisch.«
Es waren erst Mutmaßungen, aber der Vice war ein ausgekochter Profi mit seiner somnambulen Witterung für Zusammenhänge.
»Wenn ich Sie recht verstehe, Sir«, erwiderte ich, »befindet sich No Name Case im Anfangsstadium?«
»Unsere Chance, Lefty«, entgegnete Gregory. »Da ist wenigstens noch nichts verpfuscht worden. Lesen Sie die Unterlagen, durchdenken Sie die Fakten und teilen Sie mir so rasch wie möglich Ihre Bewertung mit.« Gregory erhob sich. »Ich hoffe, der Appetit kommt mit dem Lesen«, setzte er hinzu und geleitete mich sogar in den Nebenraum, der nur von seinem Office aus zu erreichen war.
Ich sah schon beim ersten Blick in die Akten, was auf mich zukam.
Mit einer Art Trotz setzte ich noch immer auf den Rückflug nach Bali, wiewohl ich wußte, daß man mit geplatzten Hoffnungen die Wände des riesigen CIA-Komplexes tapezieren könnte.
Einen Moment kämpfte ich gegen den Impuls, Vanessa im Hyatt anzurufen. Aber Bali, der »Morgen der Welt‹, war der US-Ortszeit weit über einen halben Tag voraus, und drei Stunden nach Mitternacht wollte ich meine Feriengefährtin nicht aus dem Schlaf reißen – eine Rücksicht, die ich Stunden später bereuen sollte.
Nur mühselig gelang es mir, mich von Fernost loszureißen und auf Ostberlin zu konzentrieren, auf die Geheimbesprechung des Untergrund-Generals Lupus in der Spionagefabrik an der Normannenstraße; sie hatte vor zehn Tagen stattgefunden, und der große Gregory verfügte über unbestätigte Teilunterlagen.
Ich hätte gerne gewußt, wie zutreffend sie waren, wieweit man sie als vollständig betrachten konnte und woher wir sie bekommen hatten. Aber solcherlei Fragen werden weder gestellt noch beantwortet.
In der Normannenstraße war ich seit Jahren gewissermaßen zu Hause, trotzdem blieb für mich die Stasi-Festung ein Labyrinth mit vielen Fallen und Stolperdrähten. Wir kannten unsere Gegenspieler, aber vieles, was wir über sie wußten, war eher unsicher als bewiesen, und von der Differenz zwischen Annahme und Tatsache leben alle Nachrichtendienste der Welt.
2
Gegen Mittag riß der Wind den niedrigen Himmel über Berlin auf. Aus der Wolkenwand rieselte das Licht wie Sägemehl aus einer überfahrenen Stoffpuppe. Die Iljuschin aus Moskau landete pünktlich auf die Minute und spuckte ihre Passagiere aus. Einige trugen trotz des Frühlings warme Pelzmützen, aber der Lenz stand an diesem Tag nur auf dem Kalenderpapier. Eine angeheiterte Betriebsgruppe des VEB Leuna schwenkte lärmend Papierfähnchen mit Hammer und Sichel. Der Wodka sorgte für sozialistische Fröhlichkeit.
Aus dem Rudel, das von einer Bodenstewardeß zu dem Omnibus neben der Landetreppe geleitet wurde, scherte ein schlanker Zivilist aus, ein Mann Ende fünfzig, der wesentlich jünger aussah; er ging an den stramm grüßenden Vopos vorbei und auf die dunkle Limousine zu, die – entgegen der Vorschrift – auf dem Flugfeld zwischen den Versorgungsfahrzeugen stand.
Der Vorzugspassagier mit der getönten Brille wirkte wie ein sportiver Bankdirektor oder auch wie ein Grundstücksmakler, dem man vertrauen konnte, aber sein Handelsgut waren Menschen, ihre Schicksale, ihre Verhaftung, ihr Freikauf. Im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war er zuständig für Subversion, Diversion und Desinformation. Hinter diesen Fachausdrücken des Untergrunds verbargen sich die Einschleusung von DDR-Agenten in die Bundesrepublik, die Unterwanderung der dortigen Parteien und Gewerkschaften, die Ausspähung militärischer Einrichtungen der Bundeswehr, der Blick hinter die Bonner Regierungsmaschine, der Schacher mit Menschen, die – unverschuldet oder schuldig – in den Gewahrsam der sogenannten Arbeiter-und-Bauern-Republik geraten waren, und die systematische Verbreitung von Falschinformationen, mit deren Hilfe die Gegenspieler im Westen düpiert werden sollten.
Keiner der Passagiere hatte den Untergrund-General Alexander Lupus erkannt, auch der schwankende Funktionär nicht, der ihn während des Flugs in seiner Schnapslaune wiederholt und zwecklos zum Mittrinken genötigt hatte. Vom Chef des russischen Geheimdienstes (KGB) in Moskau war dem Besucher der Rückflug zum Ost-Berliner Regierungsflughafen Schönefeld in einer sowjetischen Militärmaschine angeboten worden, aber es entsprach der Auffassung von Sparsamkeit dieses Großverbrauchers an Steuergeldern, unnötige Repräseritationskosten zu vermeiden.
Für den Aufwand gab er nur Geld aus, wenn er ihn aus der eigenen Tasche bezahlte, für englische Zigaretten der Marke Navy Cut zum Beispiel, für Antiquitäten, Orientteppiche, Seidenhemden und Anzüge aus englischem Tuch. Er ließ sie in Londons Saville Row anfertigen, in der der begüterte britische Gentleman schneidern läßt. Dabei erschien er freilich nie zur Anprobe. Bis auf seine Rumpfpuppe war den westlichen Geheimdiensten bis vor kurzem keinerlei Identitätshinweis auf den General Lupus in die Hände gefallen.
Sabotka holte seinen Vorgesetzten ab, aus dessen Gang der Vertraute des Generals sofort schloß, daß der neue Chef des sowjetischen Geheimdienstes – und Lubjanka-Hausherr am Dschersinskiplatz – dem brisanten Vorschlag zugestimmt und damit den Fall Sperber abgesegnet hatte.
»Verdammt kalt in Berlin«, sagte Alexander Lupus, den seine Freunde ›Sascha‹ nannten. »Und in Moskau herrscht schon Frühsommerwetter.« Er reichte seinem persönlichen Referenten im Majorsrang, der auch die Limousine fuhr, die Hand. »Nach Lichtenberg«, setzte er hinzu.
Er hatte eine angenehme Stimme, die nicht lauter wurde, wenn sie Befehle gab, schon weil sie auch so gehört und peinlich genau befolgt wurde. Lupus war als Chef der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) der zweitwichtigste Mann im Staatssicherheitsministerium an der Normannenstraße, das die DDR-Bürger die Firma ›Horch und Guck‹ nannten.
»Bis auf Oberst Grewe, der noch in Bulgarien Ferien macht, werden die Genossen um vierzehn Uhr zur Stelle sein«, meldete Sabotka. »Wir hätten noch Zeit, in Niederschönweide vorbeizufahren.«
»Nein, danke, Sabotka«, erwiderte Lupus. »Ich werde meine Frau vom Büro aus anrufen.«
Der in Moskau aufgewachsene Sohn eines deutschen Emigranten, in den Kommunismus so natürlich hineingewachsen wie Nackenhaare in den Hemdkragen, führte ein mustergültiges Familienleben. Seine Passionen waren bescheiden: Er spielte Tennis, ging gern auf die Jagd und schätzte klassische Musik ebenso wie das Fußballspiel. Da er wenig Zeit hatte, war einer seiner Leute beauftragt worden, Video-Aufzeichnungen über die Höhepunkte der gerade in Spanien stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft zu machen.
Der Mann mit den dunkelblonden, leicht angegrauten Haaren beschäftigte 17000 feste Mitarbeiter sowie weitere 100000 ehrenamtliche Spitzel – und nach Schätzung seiner westlichen Gegenspieler 10000 bis 20000 Agenten in der Bundesrepublik.
Die schwere, fast lautlos fahrende Limousine hatte den Ostberliner Stadtteil Lichtenberg erreicht und bog in die Normannenstraße ein; sie wurde von einem riesigen Gebäudekomplex beherrscht. Aus dem früheren und erweiterten Finanzamtsgebäude einem Haus von seniler Stabilität, war ein Untergrund-Silo geworden, eine Agentenzentrale, die innerhalb der DDR über 16 Bezirks- und 220 Kreisverwaltungen verfügte und vier Fünftel aller je festgestellten Spionage-Aktivitäten in der Bundesrepublik betrieb. Auf deutschem Boden hatten die subversiven Zauberlehrlinge ihre sowjetischen Auftraggeber auf der schrägen Fahrbahn längst überholt, waren dabei aber getreue Erfüllungsgehilfen geblieben.
Der Generaloberst, von seinen Männern meist nur im landesüblichen Abkürzungsfimmel ›BvJ‹ (›Boß vons Janze‹) genannt, eilte über den Gang, durchschritt hastig eine Flucht von Vorzimmern, nahm sich aber die Zeit, mit seiner Sekretärin ein paar Worte zu wechseln. Während er dann in sein Büro ging, blieb Major Sabotka bei ihr im Vorzimmer zurück; er wußte, daß der Chef jetzt mit seiner Frau und seinen Söhnen sprechen wollte.
Sobald er aufgelegt hatte, entnahm der Major einem Tresor eine Auswahl von Meldungen, die während der Blitzreise des Untergrund-Generals angefallen waren, und legte sie vor. Während Lupus sie überflog, bat er die Vorzimmergenossin, aus der Kantine ›irgend etwas Eßbares‹ kommen zu lassen, eine für ihn ungewöhnliche Aufforderung, denn ›Bevaujot‹ war ein Feinschmecker, wenn er auch dafür sorgte, daß sich die Leckerbissen nicht an seiner Figur vergingen.
»Sie haben auch das SED-Zentralkomitee verständigt, Sabotka« fragte der General. »Und unsere Leute in den Ministerien?«
»Selbstverständlich, Genosse Lupus«, erwiderte der Major. »Und wie ich höre, ist der Genosse Lemmers bereits im Haus.«
Der ›Gruftspion‹, so nannte man ihn hinter seinem Rücken – war fast jeden Tag in der Spionage-Zwingburg, in wörtlicher Auslegung des alten marxistischen Spruchs: »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser‹. Obwohl der Minister, dessen Stellvertreter Lupus war, dem Zentralkomitee selbst angehörte, hatte das Politbüro zusätzlich noch einen internen Sicherheitsrat etabliert. Vom Standpunkt eines totalitären Staates aus gesehen war das üblich, aus der Optik eines Untergrundstrategen jedoch bedenklich: Sicher dachte niemand daran, daß ausgerechnet im Spitzengremium der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) ein Maulwurf sitzen könnte, der für den Westen arbeitete – aber je mehr Mitwisser es gab, desto durchsichtiger und pannengefährdeter wurde die subversive Schlagkraft.
Als erster, schon fünf Minuten vor der angesetzten Konferenzzeit, war Gelbrich zur Stelle, der bullige, hemdsärmlige Chef von HVA VIII, ein Kommunist alter Schule, der in Spanien und dann in deutschen Gefängnissen seinen Kopf so oft hingehalten hatte, daß er nach Meinung seiner feineren Stasi-Kollegen davon eine weiche Birne bekommen hatte. Gelbrich war ebenso unentbehrlich wie unbeliebt, einer, der dazu neigte, ständig auf ungehobelte Art Stunk zu machen. Der Proletarier vom Dienst stammte noch aus der ersten Führungsgarnitur nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war Leiter der Abteilung, die Sabotageaktionen in Westdeutschland vorbereitete. In seinem Fach war er tüchtig und somit unersetzlich.
Ohnedies duldete der über den Dingen stehende General Lupus höchst unterschiedliche Männer in seiner Umgebung, die nur die eine Gemeinsamkeit aufwiesen, daß sie lupenreine, hochkarätige Kommunisten waren, ob sie es nun stets betonten wie der Genosse Gelbrich oder nie davon sprachen wie Laqueur, ein alter Hugenottensproß, als Ressortleiter von HVH VI für die Einschleusung von Ostagenten in den Westen verantwortlich; er sah aus wie ein gealterter Herrenreiter, der noch gut bei Fuß ist.
Herbert Brosam war der Verbindungsmann zum Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und im grauen DDR-Einerlei ein ebenso buntschillernder Paradiesvogel wie der 45jährige Max Konopka, der als Spitzenmann im DDR-Ministerium für Außenwirtschaft heimlich die Wirtschaftsspionage im Westen dirigierte. Er genoß die besondere Gunst des Generals, und die brauchte er auch, denn sein wildes Privatleben hatte ihm das Etikett ›volkseigener Casanova‹ eingebracht. Irgendwie lebte der Agent ständig zwischen den Ehen, den eigenen wie den fremden.
Sowohl Brosam wie Konopka hatten ihre Laufbahn unter General Lupus begonnen und waren nur Leihgaben an die Ministerien, Funktionäre mit Diplomatenpässen, und das schloß automatisch die Westgenehmigung ein. Brosam, der ›Genosse Kammgarn‹, nach den dunklen Anzügen benannt, die er fast immer trug, richtete in aller Welt DDR-Botschaften ein. Sein Pendant Konopka verhandelte mit westdeutschen Wirtschaftsführern und Vertretern der Bundesbehörden zum Beispiel auch über den zinslosen Warenkredit, ›Swing‹ genannt.
Auf der Tagesordnung der Geheimbesprechung stand nur ein Punkt: die Klärung plötzlicher Einbrüche, die Pullach in einige Außenstellen der ostdeutschen Spionage-Fabrik gelungen war. Schlagartig und unerwartet. Referent war Ludwig Lipsky von HVA I (Politspionage in Westdeutschland), der, gestützt auf außergewöhnliche Vollmachten, im Auftrag des Generals drei peinliche Pannen untersucht hatte. Der Referent war bei der Aufklärung der denkbar geeignetste Mann, weil er zugleich in Personalunion die Abteilung X (Dokumentation) leitete.
»Ich glaube, ich kann euch eine Wiederholung dieser unerfreulichen Vorgänge ersparen, Genossen«, begann er. »Ihr wißt, daß in Sindelfingen bei Stuttgart drei unserer besten, für einen Elektro-Konzern arbeitenden Männer aufgeflogen sind und fast gleichzeitig in Bonn eine unserer erfolgreichsten Quellen, eine Sekretärin im Auswärtigen Ausschuß, entlarvt wurde. Kurz danach ist bei einem Flugzeugkonzern in München einer unserer Perspektiv-Agenten überraschend hochgegangen.«
Ludwig Lipsky, der Berichterstatter, stammte aus Leipzig. Er versuchte fast gewaltsam, seinen heimatlichen Dialekt zu verbergen, die Konsonanten härter und die Vokale weniger breit auszusprechen; es mißlang gründlich, und so sächselte ›Phimoses‹ – wie man ihn hinter seinem Rücken nannte – erst recht drauflos. Im Dienst war er wie eine Maschine; privat hatte Lipsky Hemmungen, da er an einer Vorhautverengung litt, die von Fall zu Fall operativ behandelt werden mußte. Um die Eingriffe hinauszuschieben, wurde der Spezialist der unsichtbaren Front medikamentös behandelt, und zwar mit einer roten Salbe, deren Penetranz mit der Zeit jedes Textilgewebe durchdrang: es hatte dem Leipziger den verhaßten Spitznamen eingebracht.
Man brauchte, so man ihn aus der Fassung bringen wollte, nur auf den roten Punkt an einer pikanten Stelle zu starren; andererseits brachte ihn die bemühte Art, in der seine Kampfgefährten daran vorbeisahen, auch wieder durcheinander. Phimoses flüchtete wegen seiner persönlichen Unbill so ausschließlich in die Dienstgeschäfte, daß er nur noch die BRD-Spionage kannte – und dir rote Salbe! »Das Ziel meiner Untersuchungen, zu der mir alle Möglichkeiten zur Verfügung standen, war, die Fehlerklärung, ob es zwischen ihnen einen Zusammenhang gibt. Ich habe«, zählte der Berichterstatter umständlich auf, »insgesamt siebzehn Zeugen vernommen und mit Hilfe unserer Abteilung Neun und Zehn Meldungseingänge und Befehlsausgänge überprüft.« Er warf einen Blick auf General Lupus und dann auf die Männer am runden Tisch. Er stellte mechanisch fest, daß Brosam, der hektische Nichtraucher, wild an seiner Zigarettenattrappe zog und Lungenzüge imitierte. »Ich konnte keinerlei Unregelmäßigkeiten feststellen. Die Nachrichtenübermittlung ging nach dem gleichen System vor sich, das sich in unzähligen anderen Fällen bewährt hat. Es ist auch seit diesen – sagen wir mal – diesen Unglücksfällen nicht geändert worden und funktioniert reibungslos. In allen drei Fällen waren verschiedene Führungsoffiziere im Einsatz, sie hatten untereinander keinen Kontakt, kannten sich nicht einmal. Auch die Betroffenen wußten nichts voneinander. Im Fall Sindelfingen ist einer unserer Leute durch seinen Übereifer dem Werkschutz aufgefallen. In Bonn dürfte ein Kurier beobachtet worden sein, als er einen toten Briefkasten leerte. Von ihm aus verfolgte der Verfassungsschutz dann die Spur zum Büro; in dem unsere Kundschafterin arbeitete, sie wurde von uns gewarnt und konnte sich im letzten Moment in die DDR absetzen.« Lipsky sprach, als hätte er die Pfeife zwischen den Lippen, deren steter Gebrauch ihm einen schiefen Mund eingebracht hatte. »In München scheint einer der Beteiligten im Suff geschwatzt zu haben, und das ausgerechnet gegenüber einem BND-Mann.«
Brosam fummelte an seiner mustergültig sitzenden Krawatte herum. Lemmers vom Zentralkomitee schien ausschließlich darauf bedacht zu sein, keine Regung auf seinem Gesicht erkennen zu lassen. Konopka, der vielbeschäftigte, kämpfte gegen seine Schläfrigkeit, und Laqueur blieb auch noch beim Zuhören ein Gentleman, der Aufmerksamkeit zeigte, ob es ihn nun anödete oder nicht.
»Selbstverständlich haben wir die Vorkommnisse auch vom Computer analysieren lassen«, fuhr Lipsky fort. »Die elektronische Datenauswertung hat nur bestätigt, daß jeder der Fälle anders gelagert ist und als Panne für sich bewertet werden muß. Keinerlei Hinweis auf eine undichte Stelle. Nicht einmal Fahrlässigkeit konnte festgestellt werden. Und ein Vergleich aller Fakten läßt sogar den Schluß zu, daß selbst menschliches Versagen auszuschließen ist. Ihr kennt ja das Problem, Genossen: Ihr könnt mustergültige Autofahrer sein und am Steuer eines Wagens in tadellosem Zustand, ohne eigene Schuld verunglükken.«
Er sah wieder Lupus an; der General nickte ihm zu.
»Ich möchte noch sagen, daß der Genosse Lipsky einen minutiösen Bericht von fast zweihundert Seiten angefertigt hat, den ich unter Verschluß halte«, erklärte er dann. »Jeder von Ihnen kann ihn in meinem Büro jederzeit einsehen.«
»Habt ihr noch Fragen, Genossen?« übernahm Lipsky wieder seinen Part.
»Dreimal also dasselbe, und das innerhalb von vierzehn Tagen«, entgegnete Konopka, der seine Schläfrigkeit abgeschüttelt hatte. »Da ist ja wohl ziemlich häufig höhere Gewalt, oder?«
»Stimmt«, antwortete Phimoses, »aber an den Tatsachen ist nun nicht zu rütteln.«
»Lauter Zufälle«, stellte Lemmers, der Apparatschik, fest und erlaubte sich eine Art Witz: »Ich nehme an, daß wir selbst am besten wissen, wie man Zufälle herstellt.«
»Bleiben wir bei der Sache«, erwiderte Lipsky leicht ungehalten. »Ich habe von Generaloberst Lupus die Order erhalten, die Tatsachen zu untersuchen, nicht jedoch Folgerungen aus ihnen zu ziehen.« Da er saß, konnte niemand auf den roten Punkt starren, und so wirkte Phimoses sicherer als sonst. »Um solche zu erörtern, sind wir ja schließlich hier zusammengekommen.«
»Ich verstehe nicht, was dieser ganze Quatsch soll, Genossen!« polterte Gelbrich los. »Der Fall ist doch wohl klar wie eine Regenpfütze und läßt nur zwei Auslegungen zu: Entweder hat der Genosse Lipsky einen Bock geschossen – reg dich nicht auf, Ludwig, jeder von uns hier weiß doch, wie gründlich du arbeitest«, besänftigte er Phimoses, bevor der Referent hochschießen konnte. »Oder wir müssen den Mann suchen, und zwar hier im Haus, der den Zusammenhang zwischen den drei Pleiten im Westen …«
»Hier im Haus?« unterbrach ihn Brosam gereizt. »Das ist doch wohl gewaltig weit hergeholt, Gelbrich.«
»Ich geh’ sogar weiter«, stieß Gelbrich noch brutaler zu. »Jeder von uns hier im Raum könnte, zumindest theoretisch, die undichte Stelle sein.« Es sah ihm ähnlich, als einziger auszusprechen, was jeder von ihnen sich längst gedacht hatte, aber daß Gelbrich die Verdächtigung bis ins Dienstzimmer von General Lupus vortrieb und die alten Genossen und Kampfgefährten des Verrats bezichtigte, machte sie selbst gegenüber einem Berufsproleten zornig. Sogar der höfliche Laqueur schüttelte den Kopf, Konopka grinste bissig, der Blutdruck steigerte sich sichtbar in Brosams Gesicht; es sah aus, als müßte der anschwellende Kopf des Genossen Kammgarn gleich platzen. Auch der farblose Lemmers, der Gruftspion, wirkte einen Moment entsetzt, über die kommunistische Majestätsbeleidigung. Wellershoff, der Besonnene, schlug mit der Faust auf den Tisch und erhob sich: »Das geht mir nun wirklich zu weit, Genosse Gelbrich«, konterte er. »Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese ungeheure Pauschalverdächtigung uns irgendwie weiterbringen …«
»Ich bitte um Ruhe«, beendete General Lupus die ortsunübliche Turbulenz. »Ich danke Ihnen, Genosse Lipsky, für Ihre vorzügliche Arbeit. Ich sehe keinen Grund, an Ihrer peniblen Exaktheit zu zweifeln.« Er sah zu dem Mann von gestern auf dem Stuhl von heute hin, dem Scharfmacher im Haus, dem alles viel zu langsam vorankam und der die bourgeoisen Sitten haßte, die selbst hier im Ministerium bereits eingerissen waren. »Und Ihnen, Genosse Gelbrich, danke ich für Ihre sozialistische Wachsamkeit«, fuhr er ohne Spott oder Vorwurf fort. »Ich weiß zum Glück, daß Ihr Verdacht unbegründet ist; trotzdem trafen Ihre Worte ins Schwarze. Sie haben nur ausgesprochen, was unsere Gegenspieler in Pullach zur Zeit annehmen: ein Verräter in der Normannenstraße! Und wenn diese Schlafmützen aus dem Camp im Isartal schon aufgewacht sind, dann sollten wir ihre Munterkeit nutzen und ihnen mit beiden Händen servieren, was sie haben möchten.« Um seinen knappen Mund spielte ein böses, schmallippiges Lächeln und war schon weggewischt, bevor es deutlich wurde. »Was ich Ihnen jetzt sage, Genossen, ist keine Vermutung: Seit den mißlichen Ereignissen der letzten Wochen träumt man im Pullacher Camp von einer späten Rache für Guillaume. Das verräterische Phantom, das bei uns herumgeistern soll, trägt in der unmittelbaren Umgebung des BND-Präsidenten bereits den Codenamen der Sperber« Lupus griff sich eine ›Navy Cut‹; der neben ihm sitzende Konopka gab ihm Feuer. »Wenn wir konsequent und schlüssig nachstoßen, können wir diesen Sperber als unseren Jagdfalken dressieren.«
Offensichtlich begriff Laqueur, der Schnelldenker, als erster, daß der General daran dachte, aus drei Einzelpannen eine Elefantenfalle zu errichten, und er lächelte geringschätzig, weil er diese Dickhäuter auf der anderen Seite nur zu gut kannte. Da ihm aber auch die Methoden des HVA-Chefs vertraut waren, begann sich Laqueur zu fragen, ob die Schlappen von Sindelfingen, Bonn und München nicht bereits zur Inszenierung des Generals Lupus gehört und ob nicht womöglich – als Start eines bedachten, wenn auch bedenkenlosen Vabanquespiels – Verrat auf Geheiß vorlag.
»Wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie also für die Gegenseite einen falschen Maulwurf in kolossaler Größe aufbauen, Genosse Lupus«, gab Konopka dem Untergrund-General ein Stichwort.
»Erraten, Konopka«, erwiderte er. »Zunächst einmal: Das Politbüro der SED ist bereits verständigt. Unsere sowjetischen Freunde in Moskau sind – wie ich bei meinem Besuch soeben feststellen konnte – mit einer solchen Operation nicht nur einverstanden, sie drängen mich geradezu, sie voranzutreiben. Außer den schon Informierten und den hier Anwesenden wird niemand von dem Plan erfahren. Ich möchte noch einmal betonen: Der Fall Sperber hat sich von selbst entwickelt. Ohne unser Zutun. Inzwischen erhielten die Amerikaner bereits Wind von der Sache, sie setzen Pullach unter Druck, um beteiligt zu werden. Wie ich die Yankees einschätze, bleibt es nicht dabei; sie werden die ganze Affäre an sich ziehen. Damit steigt der Fall Sperber aus dem nationalen Bereich zu internationaler Dimension auf. Wenn wir den richtigen Köderfisch an den Haken hängen«, konstatierte der subversive General, in seiner Freizeit auch ein leidenschaftlicher Angler, »werden sie daran ersticken – wir können Pullach und die CIA gleichzeitig in einer noch gar nicht übersehbaren Größenordnung fertigmachen. Nun möchte ich mit Ihnen im einzelnen durchsprechen, welche Szenen wir unseren Gegnern in das Drehbuch schreiben.«
Major Sobotka, der jederzeit Zutritt auch zu Geheimgesprächen hatte – als Nachahmer des Generals von den anderen mit dem Spottnamen Lupusculus bedacht –, saß im Nebenraum und stellte fest, daß die Signallampe aufleuchtete, die mit den Tonbandgeräten gleichgeschaltet war. Diese direkte Nachrichtenverbindung über eine Magnetaufzeichnung gab es nur für Informationen aus dem DDR-Raum; falls sie mitgehört würden, wäre der Adressat in der Normannenstraße zugleich Lauscher. Der Referent des Generals wartete, bis das Kontrollämpchen erloschy dann spulte er das Band zurück und tippte den Text mit zwei Fingern selbst in die Schreibmaschine: Klabautermann.
So nannte der Anrufer sein Codewort. Seine Stimme lief über Verzerrer, der jede Möglichkeit ausschloß, sie zu identifizieren. Es war nicht einmal der Rückschluß möglich, ob der Informant alt oder jung, männlich oder weiblich war; eine Kunststimme ohne Charakter.
Martin Keil hat soeben aus Bonn eine strengvertrauliche Mitteilung über den Rahmen der bevorstehenden Swing-Verhandlungen erhalten. Demnach ist die BRD-Regierung entschlossen, trotz Protestesder Opposition – selbst bei bisheriger Hohe des Pflichtumtausches bei der Einreise von BRD-Bürgern – den zinslosen Warenkredit der DDR weiterhin zu gewähren. Aus kosmetischen Gründen soll der Betrag, künftig jährlich kündbar, vorübergehend von 850 auf 600 Millionen verringert werden. Bonns Unterhändler haben Anweisung erhalten, den DDR-Behörden gegenüber äußerst unnachgiebig und energisch aufzutreten. Sollten sie dabei keinen Erfolg haben, ist mit dem Abschluß eines neuerlichen Swing-Abkommens auf der neuen Basis in etwa 14 Tagen zu rechnen.
Sabotka nahm das Blatt aus der Schreibmaschine, überlegte kurz. Die Nachricht erschien ihm wichtig genug, sie General Lupus in die Geheimbesprechung hineinzureichen, zumal Brosam und Konopka daran teilnahmen, deren Dienstbereich die Information betraf.
Er öffnete die Tür, blieb stehen. Lupus sah zu ihm hin, nickte ihm zu. »Was gibt’s?« fragte er seinen persönlichen Referenten.
Der Major reichte ihm die Meldung. Lupus las sie aufmerksam durch und beugte sich zu dem neben ihm sitzenden Konopka: »Ich brauche Sie anschließend noch.« Dann drehte er sich zu Brosam um: »Sie bitte auch.«
Er schob die Meldung in die Tasche. »Wir werden also den Sperber hier im Haus genau nach den Vorstellungen, Wünschen und Träumen unserer Gegenspieler aufbauen«, erklärte er dann. »So wie die Pullacher und Amerikaner ihn sich wünschen, sollen sie ihn auch haben, und …«
»Und wer soll das sein, Genosse Lupus?« fiel ihm Gelbrich ins Wort.
»Einer von uns«, erwiderte der General. »Ich sehe keine andere Lösung, wenn wir Nägel mit Köpfen machen wollen.«
»Einer der hier Anwesenden?« fragte der empfindliche Gelbrich betroffen.
»Warum nicht – wenn es uns weiterhilft.«
»Und an wen denken Sie dabei, Genosse Lupus?« fragte Gelbrich weiter.
»Wir haben noch Zeit, uns auf einen geeigneten Pappkameraden zu einigen«, besänftigte Lupus den Proleten vom Dienst. »Sie jedenfalls nicht, Gelbricht. Aber einer der anderen Genossen hier im Raum muß in den sauren Apfel beißen und vorübergehend diese Dreckarbeit übernehmen.« Er lächelte schief. »Es ist eine Laiendarstellung mit einer Stargage.«
»Es wird nicht so einfach sein«, erinnerte Laqueur. »Ein solcher Mann wirkt im Westen erst dann glaubhaft, wenn er einen glaubhaften Beweggrund vorzeigen kann, und wir hier sind ja wohl alle bewährte und überzeugte Genossen.«
Beweggründe, die DDR zu verlassen, gab es viele, und 3,1 Millionen Menschen hatten sie genutzt, als es noch möglich war, um in den Westen zu entschlüpfen. Aber die Vorstellung, einer der führenden Männer der Spionagefabrik, die sich seit Jahren an der Frontlinie des Untergrunds mit ihren Gegenspielern herumschlug, könnte sich an einer Volksabstimmung mit den Füßen‹ beteiligen, schien absurd und abwegig.
»Ganz recht, Genösse Laqueur«, erwiderte der General. »Wir müssen ihnen ein überzeugendes Motiv bieten, und das haben wir auch.« Einen Moment lang war sein intelligentes Gesicht in Spott getaucht. »Wir nehmen ihren Höchstwert: Geld. Geld schlechthin. Vom Geld verstehen diese Kapitalisten etwas«, sagte er mit spitzen Lippen. »Um Geld dreht sich doch alles bei ihnen, und je gieriger desto glaubhafter wird ein Judas mit dem SED-Abzeichen sein. Fangen wir an mit einer halben Million Dollar. Sicher wollen die Pullacher und Amerikaner einige Vorleistungen haben. Dafür wird der Sperber sorgen und den Preis erhöhen und erhöhen und die Übergabe immer gewichtigeren Materials in Aussicht stellen.«
»Und das nehmen die uns ohne weiteres ab?« fragte Gelbrich weiter.
»Nicht ohne weiteres, aber wenn wir die Mischung richtig dosieren, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Gewöhnliches Spielmaterial tut’s in diesem Fall natürlich nicht. Hier brauchen wir Ungewöhnliches, und das heißt, daß wir schon mal ans Eingemachte heranmüssen. Bei der Zusammenstellung bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen, Genossen.«
Laqueur hatte erkannt, daß der General den neuralgischen Punkt seines Plans erreicht hatte: Mit Speck fängt man Mäuse, aber die Mäuse hatten viel dazugelernt. Sie waren ziemlich resistent geworden und unterschieden längst zwischen Delikatesse und Gift. Man mußte ihnen schon eine besondere Nahrung zuführen, wenn sie sich zu Tode fressen sollten, und das hieß: mehr oder weniger eigene Leute ans Messer liefern, Agenten im Einsatz, die bisher unergiebig gewesen waren und die man deshalb abdrehen konnte. Die übliche Tour: Dem Gegner Geheimnisse enthüllen, die er bereits kannte oder ahnte, würde versagen. Hier hieß es opfern, nicht spenden.
Laqueur überlegte bereits, welche seiner Leute verzichtbar wären, und die anderen würden es wohl ebenfalls tun. Befehl ist Befehl, und der Zweck heiligt die Mittel, auch bei den kommunistischen Jesuiten. Die Hexenjagd nach der Laus im eigenen Pelz, die BND und CIA mit Sicherheit bald vorgespielt werden würde, hätte noch den Nebeneffekt, die größte Spionagefabrik Mitteleuropas, die Resultate wie vom Fließband lieferte, auf Pannenquellen und säumige Mitarbeiter abzutasten und noch sicherer zu machen, als sie es bereits war.
Sie erwärmten sich langsam, dann aber bis zum Siedepunkt. Brosam machte an seiner Zigarettenattrappe gesundheitsneutrale Lungenzüge. Der besonnene Konopka pflückte bereits Vorschußlorbeeren. Der Optimismus Laqueurs, des Herrenreiters, ritt Galopp. Gelbrich nörgelte nicht mehr herum, sondern wirkte wie der Bauer, der sein Huhn im Topf hat. Nur Phimoses, der Berichterstatter, war traurig wie der Mann, der ein letztes Mal seinen Hund spazierenführt, bevor er ihn zum Einschläfern bringen muß.
Nach einer Stunde endete die Geheimbesprechung in Sachen Sperber. Die Teilnehmer hatten sich auf den Mann geeinigt, der die Rolle des Maulwurfs übernehmen sollte. Alle waren zufrieden, und Gelbrich, der Prolet vom Dienst, klopfte den roten Gentlemen Brosam und Konopka auf die Schulter, obwohl er sonst ihre feine Art nicht ausstehen konnte. Selbst Phimoses hatte in der Aufregung vorübergehend den verräterischen Rotpunkt vergessen. Lemmers, der Gruftspion, trug schwer an seiner Wichtigkeit, er hatte es eilig.
Lupus hatte für jeden ein Lächeln und einen Händedruck. Er mußte müde sein, aber der Fall Sperber hielt ihn auf Trab.
»Sehen Sie sich das an«, sagte er zu Konopka und reichte ihm die Tonbandabschrift. »Was halten Sie davon?«
»So ähnlich habe ich es mir vorgestellt«, erwiderte der rote Gigolo. »Manchmal wundere ich mich wirklich, was unsere Gegenspieler für Einfaltspinsel sind.«
»Häufig«, schränkte der subversive Militär ein.
»Und die Nachricht ist zuverlässig, Sascha?« fragte Konopka.
»Wie immer«, bestätigte der General.
Bevaujots Günstling fragte nicht nach der Herkunft der Mitteilung. Sie war nicht die erste und würde nicht die letzte sein, die aus der gleichen Quelle stammte.
Einem Fachmann wie ihm war von vornherein klar, daß sie nur vom Bonner Außenministerium oder aus der inoffiziellen Botschaft der Bundesrepublik in Ostberlin kommen konnte.
Konopka setzte auf die Hannoversche Straße – nicht erst seit heute.
3
Auf der Insel des Lichts war es schon Freitag, 7 Uhr 55 Ortszeit, als ich am Donnerstagnachmittag aus dem Headquarter von Langley – wo ich ein Gäste-Apartment bewohnte – im Bali Hyatt am Strand von Samur an der südlichen Westküste anrief, um Vanessa einen guten Morgen zu wünschen und sie zu bitten, meine Rückkehr abzuwarten, selbst wenn sie sich um ein, zwei Tage verzögern sollte.
Die Verbindung kam nicht so glatt zustande, wie ich es mir wünschte. Ständig war die Vorwahlnummer belegt. Endlich kam ich durch, hörte aber zunächst nur Balis ewige Gamelan-Musik. Das Hyatt, ein internationales Ferienhotel, war in der Saison fast immer voll ausgebucht, aber der Mann, der sich schließlich meldete, vermutlich ein Hausboy bei der Reinigungsarbeit, sprach nur dürftiges Pidgin-Englisch.
Als er endlich begriff, was ich wollte, war die Leitung wieder zusammengebrochen.
Ich begann von neuem mit meinem Geduldsspiel, geriet dabei in Zeitnot, denn in 20 Minuten wollte mich der große Gregory sprechen, und der CIA-Vice haßte Unpünktlichkeit – ich übrigens auch. Schließlich kam ich durch; jetzt war am anderen Ende der Leitung auch der zuständige Rezeptionist auf dem anderen Kontinent: »Good morning, Sir«, sagte er, als ich mich gemeldet und um Verbindung mit Miß Vanessa Miles gebeten hatte. »Just a moment, Sir.«
Ich freute mich schon auf Vanessas Stimme und auf ihre Verblüffung. Ich sah sie ein paar Sekunden lang vor mir, in einem Nichts von weißem Nighty auf ihrer gebräunten Haut, die so appetitlich duftete, daß sie mich verwirrte und überwältigte. Ich spürte wieder ihre Haarspitzen wie kleine, elektrische Schläge an meiner Gesichtshaut. Einen Moment lang wurde ich von einer Art Glücksgefühl überflutet, das mich beinahe eifersüchtig auf mich selbst machte.
Es war, als wollte ich alles, was ich an Gefühlsregungen bei anderen Frauen eingespart hatte, in die Ferien-Gefährtin der Trauminsel ›Morgen der Welt‹ verschwenden.
»I am sorry, Sir«, meldete sich der Hotelbedienstete wieder. »Ich kann Sie nicht verbinden, Miß Miles ist leider schon abgereist.«
»Abgereist?« rief ich mit einer Stimme, über die ich selbst erschrak. »Aber ihre Gruppe fliegt doch erst morgen nach Bangkok weiter.«
»Sorry, Sir«, wiederholte er. »Miß Miles ist vor einer Stunde zum Airport gefahren. Wie war Ihr Name, Sir?«
Ich wiederholte ihn.
»There is a message for you«, entgegnete der Portier.
Ich wußte sofort, daß die Notiz, die Vanessa für mich hinterlassen hatte, eine Hiobsbotschaft war.
»Hören Sie«, fuhr der Mann am Telefon fort, »Miß Miles mußte plötzlich in einer dringenden Familienangelegenheit nach Großbritannien zurückfliegen. Vielleicht können Sie Miß Miles noch am Airport erreichen.«
Ich ließ mir die Telefonnummer vom Flughafen Ngurah Rai geben und Vanessa dort ausrufen. Vergeblich. Ich grübelte erfolglos darüber nach, was vorgefallen sein mochte. Schmerzlich und in Raten begriff ich, daß es für mich, ganz gleich, wie mein Gespräch mit Thomas E. Gregory ausgehen würde, keinen Rückflug auf die Paradiesinsel gäbe. Es war ein Absturz in Raten.
Es gelang mir nicht einmal festzustellen, mit welcher Fluglinie Vanessa abgereist war. Es gab mehrere Möglichkeiten mit verschiedenen Zielorten. Es war wenig sinnvoll zu hadern, daß sie in der Aufregung offensichtlich vergessen hatte, einen Hinweis für mich zu hinterlassen. Irgendwann müßte es ihr einfallen, und dann würde sich Vanessa mit Sicherheit bei mir melden, unter der Deckadresse, die ich ihr für alle Fälle übergeben hatte; die Frage war nur, wo ich mich dann wirklich aufhielt.
Ich witterte förmlich, wie mich der große Gregory bereits zwischen seinen Klauen festhielt. Ich wehrte mich dagegen, aber ich spürte eine Unruhe – auch was Vanessa betraf – und stemmte mich dagegen. Es war schwer, mich auf den Fall No Name zu konzentrieren, obwohl er es in sich hatte.
Quer durch Deutschland verlief die Ost-West-Teilung und machte mein Geburtsland zu einem Schlachtfeld des Untergrunds. Niemand konnte sagen, wie viele Stasi-Agenten sich im Westen eingeschlichen hatten, mit Sicherheit Tausende, und die meisten von ihnen waren Überzeugungstäter, die mit üblichen Mittel nicht zur Strecke gebracht werden konnten.
Wenn einer Geld nimmt und auf großem Fuß lebt oder einer auf ihn angesetzten Frauen verfällt, durch Spiel- oder Wettschulden in Bedrängnis gerät, so hinterläßt er für die Fahnder deutliche Spuren. Keinen Hinweis auf seine subversive Absicht gibt jedoch ein überzeugter Kommunist, der sich verstellt und womöglich noch auf den Osten schimpft, dem er gestohlene Geheimnisse ausliefert.
So war es bei einem gewissen Maier, einem tüchtigen Mitarbeiter der Forschungsabteilung eines Elektrokonzerns in Sindelfingen. Jeder, der ihn kannte, war der Meinung, er würde innerhalb der Firma sehr rasch Karriere machen. Dann kam ein anonymer Anruf an den Werkschutz: Der Mann heiße gar nicht Maier, sondern Kettenstroh und sammle zugunsten des Ostens Produktionsgeheimnisse, Der Konzern verständigte den Verfassungsschutz, der Meier alias Kettenstroh beschattete und auf zwei weitere Komplizen stieß. Alle drei wurden festgenommen und durch Indizien hinreichend überführt. Von dem Anrufer freilich, der den Wink gegeben hatte, fehlte jede Spur. Vermutlich hatte er durch eine Plastikfolie über der Sprechmuschel seine Stimme unkenntlich gemacht.
Szenenwechsel: Wieder ein Anruf in Bonn. Im Bundeskanzleramt. Wieder eine unkenntliche Stimme, aber diesmal nannte der Anonymus sich Sperber und behauptete, entscheidend zur Aufklärung des Falls Sindelfingen beigetragen zu haben. Es konnte ein Spinner sein oder ein Wichtigtuer, aber tatsächlich führte sein Anruf zur Enttarnung einer Ost-Agentin in einer Schlüsselstellung, die freilich im letzten Moment entkommen konnte.
Und dann hatte sich wieder ein Anrufer gemeldet: in München. Die Flügelschläge des Sperbers verwandelten Pullach in ein Hornissennest.
Es kam freilich immer wieder vor, daß auf der anderen Seite ein Spion absprang, um sich dadurch eine goldene Nase zu verdienen. Aber in allen diesen Fällen waren zuerst Geldforderungen gestellt und dann die Informationen geliefert worden. Wer sich hinter dem Decknamen Sperber auch verbergen mochte, hatte ein neues Verfahren erfunden: die nachträgliche Honorierung.
Im Camp waren inzwischen die drei Fälle verglichen und vom Computer ausgewertet worden. Falls das Ergebnis stimmte, handelte es sich um drei voneinander unabhängig operierende Agentenringe. Untergeordnete Chargen im Staatssicherheitsdienst konnten Kenntnis von einer Organisation haben; wer alle drei kannte, mußte Zugang zu sämtlichen Vorgängen der obersten Geheimhaltungsstufe haben und damit in unmittelbarer Umgebung von General Lupus sitzen.
Das war ein elektrisierender Schluß, so fern er stimmte. Aber die vielen Fragezeichen, die blieben, konnten einem Mann wie Thomas E. Gregory nicht entgangen sein. Wenn er sich trotzdem bereits in diesem Stadium mit Verve auf die Affäre stürzte, mußte er noch Material in der Hinterhand haben, das im Dossier nicht enthalten war.
Es fiel mir schwer, die Operation No Name sachlich zu werten und mich auf Pullach zu konzentrieren, denn Bali stand mir im Moment näher. Ich sah auf die Uhr; es war Zeit, dem CIA-Vice gegenüberzutreten. Ich betrachtete mich im Spiegel und versuchte, mein Gesicht zu ordnen.
Der große Gregory saß an seinem Schreibtisch und löffelte einen Natur-Joghurt mit dem Behagen, das ein normaler Mensch beim Verzehr eines saftigen Steaks empfindet. »Sit down, Lefty«, forderte er mich gutgelaunt auf.
Ich ließ mich nieder und schob ihm in einem verschlossenen Umschlag das Dossier des Falls No Name zu.
»An appetizer, is’nt it?« fragte der große Gregory, für seine Verhältnisse fast vergnügt.
»Sure, Sir«, erwiderte ich.
Ich wollte ihm nicht gleich sagen, daß mir seine Delikatessen auf den Magen geschlagen waren. Er sah es mir vermutlich an. Wiederum hatte ich – wie schon bei der Lektüre der Materialsammlung – das unbestimmte Gefühl, in eine Art Verschwörung geraten zu sein. Bevor ich mich mit der Qualität der Unterlagen befaßte, hatte ich bereits festgestellt, daß das Kuckucksei im Pullacher Nest schon vor meinem Abflug in die Ferien ausgebrütet worden sein mußte.
»Schießen Sie schon los, Lefty«, forderte mich mein zweifelhafter Gönner auf und sah mich an wie ein Chirurg den Patienten, den er gleich unter das Messer nehmen wird. »Sie haben natürlich anhand der Eingangsstempel sofort gesehen, daß uns die ersten Hinweise bereits vor Wochen erreicht haben«, versuchte er mein Grimm zu entmannen.
»Richtig, Sir«, bestätigte ich. »Und ich frage mich, warum Sie mich jetzt partout an diesen Fall setzen wollen, nachdem Sie mich damals nicht hinzugezogen hatten.«
»Aus zwei Gründen«, antwortete der Vice, ungewöhnlich geduldig. »Erstens erreichte uns der wichtigste Teil der Informationen erst, als Sie bereits in Ihr schlitzäugiges Abenteuer aufgebrochen waren, und dann wurden Sie inzwischen von einem unserer besten Männer angefordert – Sie persönlich, Lefty!«
»Ich werde mir die Blumen ins Knopfloch stecken«, spottete ich.
»Cassidy«, nannte Gregory den Namen in der Manier des großen Magiers, der die nackte Jungfrau aus dem Kasten zaubert. »Sind Sie nicht sein Freund?«
»Hoffentlich bleibe ich es auch«, entgegnete ich. »Was hat Steve eigentlich mit dem Camp im Isartal zu tun?«
»Eine ganze Menge«, erwiderte Gregory. »Wir haben ihn vorübergehend als unseren Sonderbevollmächtigten in die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes entsandt.«
Er sah mich mit seinen kleinen starren Augen an, die wie hineingedrückt in tiefen Höhlen steckten. »Ich garantiere Ihnen, daß ich nichts damit zu tun habe, wenn Ihr Freund zu der Auffassung gelangt ist, daß er Sie unbedingt braucht, Lefty.«
Er konnte sagen, was er wollte. Gregory wußte ziemlich genau, daß ich kaum eine Möglichkeit hatte, eine Anforderung Steves auszuschlagen. Es gab eine stattliche Reihe von CIA-Leuten, mit denen ich recht gut auskam – und mindestens genauso viele, die ich nicht ausstehen konnte. Aber Steve war mein einziger Freund, und das nicht grundlos. Er hatte mich bereits zweimal aus der Klemme geholt und mir dabei einmal mit Sicherheit das Leben gerettet. Cassidy würde sich eher die Zunge abbeißen, als mich daran zu erinnern, daß noch eine Dankesschuld bestand. Er brauchte es auch nicht, denn das besorgte schließlich der Vice Director von Langley.
»Kommen wir endlich zur Sache«, forderte mich der große Gregory zu einer Analyse auf, die ebensogut er wie jeder andere Deutschland-Spezialist im Hause erstellen konnte. »Was halten Sie von diesen Vorgängen?«
»Es ist noch zu früh, um etwas davon zu halten«, erwiderte ich. »In diesem Stadium stehen noch viele Möglichkeiten offen. Zunächst einmal sieht es aus wie die ein wenig unübliche Eröffnung eines gewöhnlichen Geheimdienstspiels, in einer allerdings beträchtlichen Größenordnung. Es ist unübersehbar, daß Pullach in der Tat in rascher Folge drei ungewöhnliche Einbrüche in SSD-Agentenringe gelungen sind, vermutlich durch Hinweise von der anderen Seite, womöglich in allen drei Fällen dieselbe Quelle. Sie liegt im dunkeln. Wer der Informant auch sein mag, er hat keinen Namen, kein Gesicht, keine Dienststelle – und was noch weit mehr zählt, vorderhand auch kein Motiv.«
»Stimmt«, erwiderte mein Gegenüber »aber wenn er das Spiel fortsetzen will – wenn er es nicht wollte, hätte er es mit Sicherheit nicht eingeleitet –, mußte er umgehend und irgendwie aus dem Dunkel heraustreten und uns eine Gegenleistung abverlangen, und dann erfahren wir auch das Motiv und können uns mit ihm beschäftigen.«
Gregory hatte natürlich recht, und ich mußte ihm zustimmen. »Es gibt gewisse Hinweise, die eine Mutmaßung rechtfertigen, der große Unbekannte säße in unmittelbarer Nähe des Stasi-Generals Lupus«, sagte ich, »und damit beginnt bereits die Schweinerei: Die Hinweise können konstruiert sein, Leimruten, auf die wir kriechen sollen.« Ich suchte die Augen des großen Gregory. »Entweder haben Sie mir in dem Dossier Material vorenthalten, Sir, oder Sie setzen neuerdings in einer Art Wunschdenken auf gewaltige Spekulationen.«
»Bleiben Sie nur kritisch, Lefty«, fing er meine Spitze ab. »Sie wissen ja, wie sehr mir voreiliger Überschwang zuwider ist.«
»Gut«, erwiderte ich. »These Nummer eins: Es kann sich bei den Enttarnungen um ein zufälliges Zusammentreffen von Abwehrerfolgen handeln.«
»Möglich, doch unglaubhaft,«
»Das ist es eben, Sir. Wir sind so sehr in unsere Kabalen verstrickt, daß uns die Banalitäten und Eventualitäten des täglichen Lebens entgehen. Sie wissen, was ich meine, Sir?«
»Nein«, entgegnete Gregory. »Das sollten Sie mir schon genauer erklären.«
»Ein Arzt wittert überall Bazillen, ein Pfarrer Sünden, ein Bankdirektor Pleiten, eine Nutte Freier, und wir – wir sehen in jeder Zufälligkeit einen Fallstrick der Gegenseite.«
»Und Ihre These Nummer zwei?« überging der CIA-Gewaltige meine saloppe Ausdrucksweise.
»Ich will nur noch sagen: Wenn es wirklich Zufälle waren – das Gegenteil ist noch nicht bewiesen und vielleicht auch nie beweisbar –, droht die Gefahr, daß wir mit Kanonen auf Spatzen schießen. Vielleicht wäre es das beste, die Akten zu schließen, Sir, und auf weitere Glücksfälle zu warten.«
»Und bis sie eintreten, soll ich Sie wieder auf Ihre Paradies-Insel zurückschicken.«