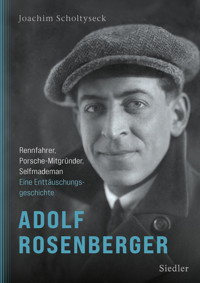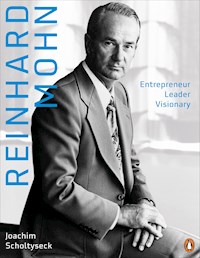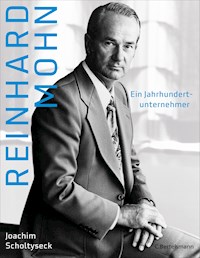30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die National-Bank wurde 1921 in Essen als Bank der christlichen Gewerkschaften gegründet. 100 Jahre später hat sie sich zu einer bedeutenden Regionalbank gewandelt. Joachim Scholtyseck zeichnet ihre in der deutschen Bankenlandschaft wohl einmalige Geschichte auf dem neuesten Stand der Forschung nach.
Die National-Bank blickt im Grunde auf drei Unternehmensgeschichten zurück, die unterschiedlicher nicht sein könnten: eine erste Periode, in der sie als Einrichtung der christlichen Gewerkschaften bis 1933 als Bank für die "kleinen Leute" in der Weimarer Demokratie arbeitete; eine zweite Periode, in der sie als eine personell völlig umgewandelte Mittelstandsbank im Dienste des "Dritten Reiches" agierte; eine dritte Periode seit 1945, in der sie nach den materiellen Zerstörungen des Kriegs, anknüpfend an manche Traditionen der vorherigen Jahrzehnte, als bedeutende Bank regionalen Zuschnitts eine Facette der "Erfolgsgeschichte" der Bundesrepublik Deutschland repräsentiert. Ihre von Brüchen und Kontinuitäten zugleich geprägte Geschichte sucht in der deutschen Bankenlandschaft ihresgleichen und ergänzt das klassische deutsche Drei-Säulen-Prinzip – private Geschäftsbanken, öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und Kreditgenossenschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Joachim Scholtyseck
Die National-Bank
Von der Bank der christlichen Gewerkschaften zur Mittelstandsbank 1921–2021
C.H.Beck
Zum Buch
Die National-Bank wurde 1921 in Berlin als Bank der christlichen Gewerkschaften gegründet. Kurze Zeit später verlegte sie ihren Sitz nach Essen, das industrielle Herz der Weimarer Republik. Heute ist sie eine der führenden konzernunabhängigen Regionalbanken für anspruchsvolle Privat- und mittelständische Firmenkunden. Anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums zeichnet Joachim Scholtyseck ihre in der deutschen Kreditwirtschaft wohl einmalige Geschichte entsprechend dem neuesten Stand der Forschung nach.
Die National-Bank blickt im Grunde auf drei Unternehmensgeschichten zurück, die unterschiedlicher nicht sein könnten: eine erste Periode, in der sie als Einrichtung der christlichen Gewerkschaften bis 1933 als Bank für die «kleinen Leute» in der Weimarer Demokratie arbeitete; eine zweite Periode, in der sie als eine personell völlig umgewandelte Mittelstandsbank im Dienste des «Dritten Reiches» agierte; eine dritte Periode seit 1945, in der sie nach den materiellen Zerstörungen des Kriegs, anknüpfend an manche Traditionen der vorherigen Jahrzehnte, als bedeutende Bank regionalen Zuschnitts eine Facette der «Erfolgsgeschichte» der Bundesrepublik Deutschland repräsentiert. Ihre von Brüchen und Kontinuitäten zugleich geprägte Geschichte sucht in der deutschen Bankenlandschaft ihresgleichen und ergänzt das klassische deutsche Drei-Säulen-Prinzip – private Geschäftsbanken, öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und Kreditgenossenschaften.
Über den Autor
Joachim Scholtyseck ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Bei C.H.Beck sind vom ihm zuletzt erschienen: Der Aufstieg der Quandts (22011), Die Geschichte der DZ BANK (zus. mit Timothy Guinnane u.a. 2013), Freudenberg (2016), Merck (22018), Der Bank- und Börsenplatz Essen (2018) sowie die Geschichte der Baden-Badener Unternehmergespräche (2020).
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Eine Bank der christlichen Gewerkschaften: 1921 bis 1933
Der Bankplatz Essen vor Gründung der National-Bank
Vorbedingungen einer christlichen Gewerkschaftsbank
Die Idee der Gewerkschaftsbanken im nationalen und internationalen Kontext
Die konkreten Überlegungen zur Gründung der Deutschen Volksbank
Die ersten Schritte der Bank
Stolpersteine: Aufbauarbeit in den schwierigen Inflationsjahren
Die Deutsche Volksbank in der Phase der Währungsstabilisierung
Politische Querelen über den Kurs der christlichen Gewerkschaften
Aus den Kinderschuhen herausgewachsen? Die Deutsche Volksbank in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre
Die Weltwirtschaftskrise
Die Politik der christlichen Gewerkschaften in der Krise der Deutschen Volksbank
Die Deutsche Volksbank in der Agonie: Ein vorprogrammiertes Ende trotz aller Sanierungspläne?
Eine Bank im Bann des Nationalsozialismus: 1933 bis 1945
Die Umwandlung der Deutschen Volksbank in die National-Bank
Ein organisatorischer Neubeginn
Der Alltag der National-Bank nach 1933: Im Dienst der «nationalen Aufgabe»
Die Rolle der National-Bank bei der «Arisierung» des Bankhauses Simon Hirschland
Die National-Bank im Zweiten Weltkrieg: Die ersten Kriegsjahre
Die Fusion mit dem Duisburger Bankverein
Die National-Bank im Zeichen des «Totalen Krieges»
Eine Mittelstandsbank in der Demokratie: 1945 bis 2021
Stunde Null? Die National-Bank im Wiederaufbau
Die Schließung der National-Bank? Überlebensfragen und Entnazifizierung
Es geht wieder aufwärts: Die Währungsreform
Ein Neubau am Theaterplatz
Der Bankalltag nach 1945
Die National-Bank im «Wirtschaftswunder»
Keine Panik: Die erste Rezession 1967
Die National-Bank in den Jahren nach dem Boom
Der langsame Abschied vom Provisorium der Bundesrepublik: 1982 bis 1989
1990: Die National-Bank im wiedervereinigten Deutschland
Euro-Zeiten – im Zeichen der Globalisierung
Fazit
Nachwort
Anhang
Anmerkungen
Einleitung
Eine Bank der christlichen Gewerkschaften: 1921 bis 1933
Eine Bank im Bann des Nationalsozialismus: 1933 bis 1945
Eine Mittelstandsbank in der Demokratie: 1945 bis 2021
Archivverzeichnis
Gedruckte Quellen und Dokumentationen
Literaturverzeichnis
Quellen
Memoiren und Forschungsliteratur
Mitglieder des Vorstands
Mitglieder des Aufsichtsrats
Bildnachweis
Namenregister
Unternehmens-, Banken- und Institutionenverzeichnis
Vorwort
Die Gründung unserer NATIONAL-BANK jährt sich. Einhundert Jahre sind vergangen, seit mutige Männer der christlichen Gewerkschaftsbewegung den Entschluss gefasst hatten, in Berlin unsere Bank zu errichten, um ihren Sitz – planmäßig – kurze Zeit später nach Essen zu verlegen. Es ist ein besonderes Ereignis, über das wir uns freuen dürfen. Es markiert einen Abschnitt, den wir bei aller Bescheidenheit als erfolgreich bezeichnen dürfen.
Es ist zugleich der Anlass, die Geschichte unserer NATIONAL-BANK erneut wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Nicht etwa, weil in der Vergangenheit etwas vergessen oder übersehen worden ist, sondern weil die historische Forschung, auch bei als aufgeklärt oder erklärt geltenden Sachverhalten über den Lauf der Zeit zu neuen Erkenntnissen gelangt. Dabei ist die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, gerade in einem Umfeld politischer und wirtschaftlicher Umbrüche, von substanzieller Bedeutung, denn jeder, der am Wirtschaftsleben teilnimmt, weiß um die Notwendigkeit des ständigen Erneuerns. Sprach Martin Luther einst von der «ecclesia semper reformanda», so gilt heute angesichts des sich rasch und in Quantensprüngen verändernden Umfelds das Gebot der «economia semper reformanda».
Diese Einstellung haben wir uns zu eigen gemacht. Als mittelständisch geprägtes Institut ist die NATIONAL-BANK seit Jahrzehnten profitabel und rentabel. Dividendenkontinuität ist für uns ebenso der Anspruchsbeweis wie der sorgsame Umgang mit unserem Ruf. Wir schützen ihn wie ein Juwel, eine Selbstverständlichkeit für jeden ordentlichen Kaufmann. Dennoch, Demut kommt vor Hochmut. Wir wissen um die Verantwortung, die uns in die Hände gelegt worden ist. Und wir wissen um die Aufgabe, sie eines fernen Tages in die Hände der uns folgenden Generation zu legen. Bis dahin gilt es, weiterhin nachhaltig und mit Augenmaß zu wachsen, um die Bank in einem noch besseren Zustand zu übergeben, als wie sie ohnehin schon übernehmen durften; alles stets in der Gewissheit, dass wir keine Gutsherren, sondern Gutsverwalter sind. Diese Einstellung prägt nicht unser unternehmerisches Selbstverständnis, sondern es ist Teil unserer kulturellen Identität.
Sowohl für die Erforschung als auch die Dokumentation unserer Geschichte war die wissenschaftliche Unabhängigkeit eine conditio sine qua non. Es ging nicht darum, die Bank illuminieren zu lassen, denn auch wir haben in der Vergangenheit Fehlentscheidungen getroffen und Risiken unzutreffend eingeschätzt. Zum Glück war das Allermeiste jedoch das Ergebnis kluger Analysen und Entscheidungen, auch wenn manches von Zufälligem geprägt und rückblickend betrachtet tatsächlich nur weniges die Folge falscher Urteile gewesen ist. Eine Untersuchung unserer einhundertjährigen Geschäftstätigkeit, eingebettet in die politischen und wirtschaftlichen, sozialen und regionalen Verhältnisse ihrer Zeit, war deshalb unser Ziel.
Diese Arbeit steht neben dem wichtigen Werk «Der Bank- und Börsenplatz Essen», das, 2018 erschienen, aus historischer Perspektive die finanzwirtschaftlichen, infrastrukturellen und wettbewerblichen Rahmenbedingungen der Ruhrmetropole unter die Lupe genommen hat. Beide Forschungsprojekte wurden von uns initiiert und finanziert. Sie sind nicht nur Ausdruck eines starken kulturellen und gesellschaftlichen Engagements unserer NATIONAL-BANK, sondern ein Reflex auf die geschichtliche Verantwortung in der Führung eines Unternehmens. Daneben ist es die Bedeutung des Gewesenen für das Verständnis des Heutigen. Geschichte können wir nicht vermeiden, Geschichtsbewusstsein zu entwickeln ist deshalb unverzichtbar. Zu oft scheint vergessen: Nicht alles, was alt ist, ist unmodern. Das gilt besonders für die Geschichte – zumal die eigene. Dies umso mehr, als die Erkenntnis, «Zukunft braucht Herkunft» in einer von Umbrüchen gekennzeichneten Zeit unverändert Bestand hat.
Unser Dank gilt Herrn Professor Dr. Joachim Scholtyseck von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der sich dem Anspruch gestellt hat, die einmalige Geschichte unserer NATIONAL-BANK noch umfassender zu erforschen und zu dokumentieren. Die Zusammenarbeit war gleichermaßen erbaulich wie konstruktiv wie bei der gemeinsam mit Patrick Bormann M. A. verfassten Geschichte des Bank- und Börsenplatzes Essen. Einen weiteren Dank schulden wir unseren Eigentümerinnen und Eigentümern, denen unsere Bank gehört und die uns die Grundlage unserer Geschäftstätigkeit, das Kapital, zur Verfügung stellen. Ihr seit Jahren großer Zuspruch ist ein Privileg für uns, über das wir uns freuen. Unser großer Dank gilt aber auch unseren Kundinnen und Kunden, die uns vertrauen und mit denen wir gemeinsam weiter wachsen. Das Versprechen «Mehr. Wert. Erfahren.» wird für uns auch zukünftig Anspruch und Verpflichtung sein. Schließlich danken wir allen aktiven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unsere NATIONAL-BANK zu dem gemacht haben, was sie heute ist: eine von Solidität, Stabilität und Zuverlässigkeit getragene Bank in Nordrhein-Westfalen und eine der erfolgreichsten unabhängigen Regionalbanken in Deutschland.
Ad multos annos!
Der Vorstand
Ein Blick in die Schalterhalle der National-Bank am Theaterplatz in den 1970er Jahren. Gut zu erkennen ist der Zugang zur «Stahlkammer» für Wertpapiere, die für den Neubau des Jahres 1952 eingerichtet worden war. Diese Räumlichkeiten wurden angesichts der Expansion der Bank inzwischen überwiegend von der Verwaltung genutzt.
Einleitung
Die National-Bank blickt, wenn sie im Jahr 2021 ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, im Grunde auf drei Unternehmensgeschichten zurück, die unterschiedlicher nicht sein könnten: eine erste Periode, in der sie 1921 als Bank der christlichen Gewerkschaften gegründet wurde und in dieser Rolle bis 1933 als Bank für die «kleinen Leute» in der Weimarer Demokratie arbeitete; eine zweite Periode, in der sie als eine personell völlig umgewandelte Mittelstandsbank im Dienste des «Dritten Reiches» agierte, und schließlich eine dritte Periode seit 1945, in der sie nach den materiellen Zerstörungen des Kriegs, anknüpfend an manche Traditionen der vorherigen Jahrzehnte, als bedeutende Bank regionalen Zuschnitts eine Facette der «Erfolgsgeschichte» der Bundesrepublik Deutschland repräsentiert.
Diese in der deutschen Bankenlandschaft wohl einmalige Geschichte, die das klassische deutsche Drei-Säulen-Prinzip – private Geschäftsbanken, öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und Kreditgenossenschaften – in mancher Hinsicht ergänzt, ist einen näheren Blick wert. Sie wissenschaftlich auf dem neuesten Stand der Forschung darzustellen und die Brüche und Kontinuitäten zu skizzieren, soll mit dieser Studie geleistet werden. Sie knüpft an zwei Vorarbeiten an: erstens an die im Jahr 2011 erschienene und inzwischen in zweiter Auflage vorliegende Geschichte zum 90-jährigen Bestehen der Bank[1] sowie zweitens an die Geschichte des Bank- und Börsenplatzes Essen, die 2018 auf den Markt kam und die Finanzwelt der Stadt seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in den Blick nimmt und kontextualisiert.[2]
Der Vorstand der National-Bank hatte sich im Jahr 2008 aus eigenem Erkenntnisinteresse entschlossen, erstmals die historischen Wurzeln und die Entwicklung der Bank freizulegen und wissenschaftlich nachzeichnen zu lassen. Zuvor hatte es immer wieder aus der Bank heraus Vorstöße gegeben, die eigene Geschichte besser zu erforschen. Aus verschiedenen Gründen war diesen Bemühungen kein Erfolg beschieden gewesen: Zu groß war nach 1945 die Sorge, mit der eigenen Vergangenheit der Jahre zwischen 1933 und 1945 konfrontiert zu werden. Selbst der Name National-Bank konnte in diesem Sinn zu eher unangenehmen Erinnerungen Anlass geben, ja es war gelegentlich sogar überlegt worden, diesen in der Bundesrepublik scheinbar nicht mehr zeitgemäßen Namen abzulegen und durch eine unverfänglichere Neuschöpfung zu ersetzen.
Sich nicht allzu intensiv mit der eigenen Geschichte zu befassen, hatte durchaus Tradition. Industrieunternehmen und Banken haben bis in die 1990er-Jahre hinein oftmals eher unkritische Bestandsaufnahmen vorgelegt, in der unliebsame Kapitel der eigenen Geschichte bisweilen recht diskret abgehandelt wurden oder gar ganz wegfielen. All dies mündete in eine weitverbreitete «Exkulpationssolidarität».[3] Die Festschriften polierten häufig die Geschichte auf, hatten hagiographischen Charakter und entsprachen eher dem Genre einer Jubelschrift als geschichtswissenschaftlichen Studien – wenn sie nicht ohnehin Arbeiten waren, deren Zweck eher in der glorifizierenden Selbstdarstellung als in der kritischen Analyse bestand.[4] Wirklich unabhängige Bankgeschichten waren selten, weil man in den Chefetagen der Bankinstitute das Risiko scheute, mit unangenehmen Ergebnissen ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu treten. Freien Zugang zu den Quellen gewährte man niemandem, «der sich nicht als ideologisch absolut zuverlässig» erwies.[5]
Auf dem Feld der Bankengeschichte brachte erst die unabhängige Studie über die Geschichte der Deutschen Bank in den 1990er-Jahren einen Durchbruch.[6] Der unabhängige Zugang zu den Akten der düsteren Kapitel des «Dritten Reichs» kam einem Paradigmenwechsel gleich: Er führte dazu, dass die Offenlegung der eigenen Vergangenheit entgegen früheren Befürchtungen als ein Zeichen von Transparenz verstanden wurde. In der Folge haben zahlreiche weitere Bankinstitute ihre Archive geöffnet. Die Literatur zur Bankgeschichte, so ist kürzlich konstatiert worden, «hat in den vergangenen Jahren geradezu rasant an Umfang gewonnen».[7]
War noch im Jahr 1998 in einem einschlägigen Findbuch zu den Archiven der deutschen Kreditwirtschaft zu lesen, bei der National-Bank sei die Benutzung der Archivbestände «nicht gestattet»,[8] so hat sich dies inzwischen vollständig geändert. Für die Zeit vor 1945 ist die Überlieferung zu ihrer Geschichte befriedigend, obwohl nicht alle Vorgänge auf Aktenbasis nachvollzogen werden konnten. Von den Geschäftsberichten fehlen im Archiv der National-Bank lediglich diejenigen aus den Jahren 1923 bis 1930. Die Sitzungsprotokolle des Aufsichtsrats sind aus der Zeit seit der Umbenennung der Bank am 18. Dezember 1933 vollständig vorhanden. Zu zahlreichen Aufsichtsratsmitgliedern finden sich Schriftverkehr und Korrespondenz: Zu ihnen zählen Wolfgang Müller-Clemm, Adolf Friedrichs, Walter Pelletier, Eugen Vögler, Friedrich Vogt, Max Schroeder, Ferdinand Schraud, Karl Hitzbleck, Ernst Hitzbleck, Franz Blücher, Maximilian Freiherr von Brachel und Alfred Pott. Zudem sind Schriftstücke zu Dr. Wilhelm Bötzkes und Wilhelm Marotzke im Archiv überliefert. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind zudem verschiedene, seit 1939 erstellte Wirtschaftsprüfungsberichte, die ebenfalls aufbewahrt wurden.
Für den Gründungsprozess haben sich Dokumente und Denkschriften, die sich im Nachlass Adam Stegerwalds im Archiv für Christlich-Demokratische Politik (ACDP) der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sankt Augustin bei Bonn befinden, als hilfreich erwiesen. Die Bestände der IHK Essen, der Bergarbeiter-Gewerkschaft Köln, der Landeszentralbank (LZB) und Unterlagen zur Reichsbank im Bundesarchiv geben Aufschlüsse über die Bankhistorie. In den National Archives in College Park und in der Dwight D. Eisenhower Library finden sich Dokumente zur amerikanischen Bankenpolitik nach 1945; in den britischen Akten der National Archives in Kew sind zentrale Bestände über die britische Bankenpolitik in der von ihr besetzten Zone erhalten geblieben.
Schwieriger stellt sich dagegen die Situation für die Nachkriegszeit dar. Hier ist die Quellenlage besonders dünn für zahlreiche Aspekte vor allem jenes Zeitraums, in dem Willi Wohlrabe (1948–1959) und Fritz Dertmann (1951–1981) die Geschicke der National-Bank im Vorstand ganz wesentlich lenkten. In diesen Jahren wurden zahlreiche neue Geschäftsverbindungen geknüpft und ein weitgespanntes Filialnetz aufgebaut. Manches Atmosphärische über Persönlichkeit, Führungsstil und Unternehmensphilosophie jener Jahre ließ sich noch im Werk zur 90-jährigen Geschichte der Bank mithilfe von Zeitzeugeninterviews rekonstruieren. Diese waren auch nützlich, als es darum ging, aus der Essener Perspektive über die technologische Revolution im Bankwesen zu berichten: die fast vollständige Umstellung auf EDV und Computertechnik, die seit den 1960er-Jahren tiefgreifende Auswirkungen auf den Bank-Alltag hatte.
Die Zeit nach 1970, also jene Jahre, in der die Zeit des geradezu stürmischen Aus- und Aufbaus von regionalen Geschäftsstellen zunächst einmal vorbei war, ist zwar durch Geschäftsberichte und andere Quellen gut erschlossen. Allerdings mangelt es weitgehend an Dokumenten, die jenseits des reinen Zahlenmaterials Auskunft über die Alltagspraxis und die spezifischen Aspekte jener Periode geben. Für die historische Erschließung der späteren Entwicklung erweist es sich als besonders hinderlich, dass ein originäres Archiv nicht vorhanden war und erst in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts mit der systematischen und professionellen Erschließung der vorhandenen Bestände begonnen wurde.
Eine an heutigen wissenschaftlichen Maßstäben orientierte Geschichte der National-Bank und ihrer Vorläufer gab es, wie eingangs erwähnt, bis zum Jahr 2011 nicht. Einer der langjährigen Mitarbeiter und Direktoren, Karl Richter, hatte 1978 eine stark persönlich eingefärbte, chronikartige Darstellung der Bank vorgelegt,[9] die allerdings nicht veröffentlicht wurde und in mehreren verschiedenen Fassungen im Archiv der National-Bank vorhanden ist. Daneben existiert eine Mitarbeiterschrift für den bereits erwähnten Fritz Dertmann, die zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum im Jahr 1976 erstellt, aber ebenfalls nicht publiziert wurde. Diese Mitarbeiterschrift ist in vielen Partien jedoch nur eine Zusammenstellung verschiedener Passagen der erwähnten Chronik von Karl Richter sowie von Auszügen aus den Geschäftsberichten. Von besonderem Interesse ist darüber eine kleine, unveröffentlichte «Geschichte und Entwicklung der National-Bank AG» von Karl-Heinz Nellessen, die dieser im Jahr 1996 abgeschlossen hat. Allerdings musste der Autor auf die schlechte Überlieferung verweisen: «Festschriften existieren nicht, Originalunterlagen, Bilanzen o.ä. aus dem Zeitraum vor dem Zweiten Weltkrieg sind in den Kriegswirren weitgehend untergegangen, so daß hier nur Sekundärquellen zur Verfügung stehen.»[10] Manche Hinweise, nicht zuletzt zum Sozialgefüge und Arbeitsalltag der National-Bank, finden sich in der achtseitigen Aufzeichnung vom Maximilian Dilling, der 1994 eine kleine Studie über seine eigenen Erinnerungen seit seinem Eintritt in die Bank im Jahr 1952 verfasste.[11]
Die National-Bank
Essen war eine Hochburg der christlichen Gewerkschaften. Abgebildet ist das Alfredus-Haus, das Vereinshaus der christlichen Gewerkschaften in der Frohnhauserstraße.
Eine Bank der christlichen Gewerkschaften: 1921 bis 1933
Der Bankplatz Essen vor Gründung der National-Bank
Essen bietet für die im 19. Jahrhundert eintretende grundlegende «Verwandlung der Welt» (Jürgen Osterhammel) und den gewaltigen Entwicklungsschub ein besonders gutes Beispiel. Die hier ansässige Familiendynastie Krupp war nur eines von zahlreichen Industrieunternehmen aus dem Montan- und Stahlbereich, die das Gesicht der Stadt prägten und zahlreiche beschäftigungssuchende Arbeiter anzogen. Schon 1896 erreichte die Zahl der Einwohner die Großstadt-Grenze von 100.000 und wuchs in den folgenden Jahren beständig an. Im Zuge der Industrialisierung entstanden in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Stadt weitere bevölkerungsstarke Großgemeinden: Altendorf wuchs von 2000 auf 40.000 Einwohner, Borbeck von 5000 auf 30.000, Altenessen mit Karnap von 1100 auf 24.000 und Stoppenberg (mit Kray und Huttrop) von 2200 auf 30.000 Einwohner. Der Zuwachs konzentrierte sich im Wesentlichen auf die Stadtteile mit den neu entstehenden Mergelzechen und Eisenhütten sowie auf die Gebiete um das Krupp’sche Betriebsgelände. Rüttenscheid wurde erst nach 1895 von einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum erfasst. Die wirtschaftliche Umwälzung und die rasante Bevölkerungszunahme veränderten den sozialen Raum in recht chaotischer Weise, weil die einzelnen Gemeinden mit der Aufgabe, Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrsstrukturen zu schaffen, zunächst völlig überfordert waren.[1]
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurde Essen damit nicht nur im sekundären, sondern zunehmend auch im tertiären Wirtschaftssektor zum «Wirtschafts- und Verwaltungszentrum des Ruhrgebiets» par excellence.[2] Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts waren hier nicht zuletzt der Bergbauliche Verein und das Kohlen-Syndikat ansässig. Mit dem Beitritt des Koks- und des Brikett-Syndikats zum Kohlen-Syndikat wurde Essen im Jahr 1903 «endgültig zur Hauptstadt der Kohle».[3] Die Industrialisierung der Region war Krupp, aber auch Industriepionieren wie Franz Dinnendahl, Friedrich Harkort sowie Franz und Gerhard Haniel zu verdanken.
Bis zum Ersten Weltkrieg blieb die Ruhrmetropole in erster Linie eine Stadt der Montanindustrie und der Steinkohle. Über zwei Drittel der Essener gehörten der Arbeiterschicht an. Im Jahr 1907 waren von 130.000 Beschäftigten im Stadt- und Landkreis Essen 38 Prozent im Bergbau, 23 Prozent im Eisen- und Metallgewerbe und 14 Prozent im Baugewerbe beschäftigt.[4]
Mit dem aufkommenden 20. Jahrhundert entwickelte sich in der Altstadt ein neues Geschäftsviertel. Vom Markt und von der südlichen Viehofer Straße ausgehend, entstanden zunächst Einzelhandelsgeschäfte an der Burg- und Kettwiger Straße sowie der Limbecker Straße. Sie waren Folge des Anwachsens der Krupp-Betriebe, aber vor allem nach dem Ersten Weltkrieg Ausweis der zunehmenden Bedeutung des sekundären und tertiären Wirtschaftssektors. Verbunden war das Wachstum mit einer Diversifizierung: Aus «Gemischt-, Kolonial- und Manufakturwarenhandlungen» wurden Spezialgeschäfte. Im Textilgewerbe richtete sich die Nachfrage weniger auf hochwertige Konfektion als vielmehr auf preiswerte Fertigfabrikate. Vor allem den Textilwarengeschäften verdankte Essen in den 1930er-Jahren seinen Ruf als «wohlfeilste Stadt» im Ruhrgebiet. Er trug zu Umsatz, Geschäftserweiterungen und Neueinstellungen bei.[5]
Im Zusammenhang mit der stürmischen Aufbauphase von Industrie, Handel und Verwaltung, die Ende des 19. Jahrhunderts allmählich ein Ende fand,[6] entstand ein Bankwesen, das den steigenden Bedarf an Krediten decken konnte. Allerdings bildete sich die Bankenlandschaft zunächst erst zögerlich aus, weil Essen – anders als Krefeld, Köln oder Wuppertal – damals noch keine bedeutende Handelsstadt war. Zunächst dominierten relativ kleine Privatbanken, die aus dem Handelsgeschäft hervorgegangen waren. Die bedeutendste unter ihnen war die 1841 gegründete Simon Hirschland Bank, die beinahe 100 Jahre im Besitz der jüdischen Familie Hirschland blieb, bevor sie unter Mitwirkung der National-Bank 1938 «arisiert» wurde. Doch parallel zur explosionsartigen Entwicklung Essens erblühte im Laufe des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts in Essen ein lebendiges Finanz- und Bankgeschäft; an der Lindenallee konnte sich sogar ein eigenes Bankenviertel etablieren. Mit der 1871 gegründeten Essener Credit Anstalt, dem wichtigsten Institut am Platz, der Disconto-Gesellschaft und der Mitteldeutschen Creditbank wurde Essen schließlich zu einem wichtigen Bankenstandort,[7] gerade weil das «Ruhrgebiet» selbst zu dieser Zeit eher eine «gigantische Agglomeration mit höchst krankhaften und auf Dauer selbstzerstörerischen Zügen» war.[8]
In den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wandelte sich die Struktur des Essener Bankplatzes durch den Einzug der Berliner Großbanken in das später sogenannte Ruhrgebiet noch einmal grundlegend. Im Kaiserreich war die Finanzstruktur des Industriegebiets noch stark durch regionale Aktienbanken wie z.B. die Essener Credit-Anstalt sowie den Barmer Bankverein und auch kleinere Institute wie der Essener Bankverein oder die ebenfalls in Essen beheimate Rheinische Bank geprägt. Diese wurden nun nach und nach mitsamt dem Personal und den Kunden von den Berliner Großbanken übernommen, zuletzt 1925 die Essener Credit-Anstalt. Mit dem Wegfall der Regionalbanken ergaben sich im Mittelstandsgeschäft neue Handlungsfelder, die von Privatbanken, Genossenschaften oder Arbeitnehmerbanken genutzt werden konnten.[9] Im Zuge dieser dynamischen Entwicklung entstand das Vorgängerinstitut der heutigen National-Bank, die Deutsche Volksbank, obwohl ihre spezifischen Gründungszusammenhänge eine Besonderheit waren, wie im folgenden Kapitel erläutert wird.
Vorbedingungen einer christlichen Gewerkschaftsbank
Die Entstehungsgeschichte der Deutschen Volksbank ist ungewöhnlich, weil sie eine Gewerkschaftsgründung war. Im Gegensatz zur heutigen Gewerkschaftslandschaft existierten in Deutschland vor 1933 verschiedene Richtungsgewerkschaften: Nach Mitgliederzahl und Einfluss nahmen die sogenannten freien Gewerkschaften mit sozialistischer Ausrichtung zweifellos eine führende Rolle ein. Zur damaligen Zeit kam jedoch auch den christlichen Gewerkschaften eine erhebliche Bedeutung zu. Weniger bekannt und auch weniger bedeutend waren schließlich die «neutralen», liberal orientierten Gewerkschaften, die landläufig als «Hirsch-Dunckersche Gewerkvereine» bezeichnet wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg gingen diese Richtungsgewerkschaften daran, sich eigene Banken zu schaffen.
Für diese Einrichtungen bürgerte sich schließlich der Begriff «Arbeitnehmerbanken» ein, die nach dem Ersten Weltkrieg als «wirtschaftliche und soziale Neuerscheinungen» in der etablierten Bankenwelt Aufsehen erregten.[10] Als «Gewerkschaftsbank» war die Deutsche Volksbank daher ein Kind ihrer Zeit: Sie war zwar die erste, aber nicht die einzige Institution ihrer Art.
Nach dem Untergang der Hohenzollernmonarchie gab es mannigfache Gründe für eine Neuorientierung der gewerkschaftlichen Finanzen.[11] Schon seit dem 19. Jahrhundert hatte die Pauperisierung als Folge der Industriellen Revolution zu einem Umdenken geführt. Die «soziale Frage» erforderte und beförderte europaweit vielfältige Überlegungen zur Schaffung eigener Arbeitnehmerspareinrichtungen, die als «Hilfe zur Selbsthilfe» dienen sollten. Es entstanden sogenannte Spar- und Sterbekassen, die sich beispielsweise an Post- und Bahnbeamte oder Mitglieder des Deutschen Werkmeister-Verbands richteten. Diese Kassen zogen vom Monatsgehalt oder Wochenlohn einen geringen Beitrag ab, der verwahrt wurde und gegebenenfalls als eine Art Notgroschen für das Mitglied beziehungsweise die Nachkommen zur Verfügung stehen sollte.
Die größeren Privatbanken wollten sich mit den in der Regel kleinen Beträgen nicht abgeben, sodass diese Sparte des Bankwesens eine überschaubare Facette des Gesamtgeschäfts blieb. Die Verwaltungskosten der Vorläuferorganisationen der Arbeitnehmerbanken waren relativ niedrig, weil die Ämter häufig ehrenamtlich ausgeübt oder von den Verwaltungsabteilungen der Gewerkschaften kostenfrei übernommen wurden. Die eingezogenen Gelder wurden meist konservativ in mündelsicheren Wertpapieren, zum Teil aber auch bei etablierten Banken angelegt. Die Vergabe von Krediten an einzelne Mitglieder – etwa für Baumaßnahmen oder für Konsumanschaffungen – blieb bei diesen Einrichtungen, die doch nur rudimentär den Charakter einer traditionellen Bank hatten, zunächst die Ausnahme. Erst mit der Zeit wurden die Kreditgeschäfte bedeutender.
Im Zuge dieser Entwicklung wurde die bürgerliche Rechtsform des Vereins immer häufiger aufgegeben und nach und nach durch die Rechtsform der Genossenschaft mit beschränkter Haftung ersetzt. Zu den bekanntesten dieser Einrichtungen gehörten die Sparabteilung des Deutschen Werkmeister-Verbands und die Sparkasse des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbands (DHV) in Hamburg. Die größeren dieser «Sparabteilungen» gingen schließlich dazu über, den Giroverkehr zu unterhalten, den An- und Verkauf von Wertpapieren zu übernehmen und im Dienst der eigenen Organisation stehende Einrichtungen aufzubauen und zu finanzieren. Zu den Arbeitnehmerbanken in engerem Sinn zählten die sogenannten Beamtenbanken und die genossenschaftlich organisierten Institute, daneben die Bankabteilungen der Großeinkaufsgesellschaften der Arbeiter-Konsumvereine. Die großen Konsumgenossenschaften diversifizierten sich ebenfalls und gliederten sich eigene Sparkassen und Bankabteilungen an – eine weitere Wurzel der in den 1920er-Jahren gegründeten Arbeitnehmerbanken. Dennoch kam es zunächst nicht zur Gründung eigener Bankinstitute. Vor 1914 waren in dieser Hinsicht lediglich die in Düsseldorf ansässige Deutsche Werkmeister Sparbank AG, die Industriebeamten-Sparbank AG in Berlin und die oben erwähnte Sparkasse des DHV von einiger Bedeutung gewesen.[12] Zum einen fürchteten die Gewerkschaften die Macht der großen Privatbanken, die eventuell die unliebsame Konkurrenz boykottieren würden, zum anderen war die Sorge groß, dass über kurz oder lang Liquiditätsprobleme entstehen könnten, wenn vornehmlich Gewerkschaftsgelder verwaltet würden[13] – eine Sorge, die im Übrigen nicht unberechtigt war, wie die weitere Geschichte dieser Banksparte noch zeigen sollte.
Die christliche Gewerkschaftsbewegung war das Ergebnis einer spezifisch deutschen Entwicklung, die vor allem angesichts des Bedeutungszuwachses der konfessionell geprägten katholischen Zentrumspartei vor dem Hintergrund des «Kulturkampfes» zu verstehen ist. Im gerade gegründeten preußisch-protestantisch dominierten Deutschen Kaiserreich von 1871 hatte sich eine katholische Massenpartei gegründet, die von Reichskanzler Otto von Bismarck aufs Schärfste bekämpft worden war. Dieser «Kulturkampf», den er mit liberaler Unterstützung ausgefochten hatte, war nicht nur erfolglos geblieben, sondern hatte das politisch-katholische Lager sogar eher noch gestärkt. Das Zentrum und die mit ihm verbundenen sozialpolitischen Verbände wurden im Kaiserreich zu einer mächtigen politischen Größe, die man mehr als ernst nehmen musste. Dennoch waren die christlichen Gewerkschaften als ein wichtiges Segment dieser Bewegung nicht grundsätzlich und exklusiv an konfessionellen Grundlinien ausgerichtet. Die gewisse Staatsferne, die dem Zentrum aus verständlichen Gründen anhaftete, war den christlichen Gewerkschaftern fremd. Der Erfolg der Zentrumspartei zog eine Professionalisierung der Gewerkschaftsarbeit nach sich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Sitz des Gesamtverbands nach Köln verlegt, wodurch sich der Schwerpunkt der Tätigkeit in den Westen Deutschlands verlagerte. Die christlichen Gewerkschaften waren in drei Ebenen gegliedert: Gesamtverband, Einzelverband und auf lokaler Basis ein «Ortskartell».[14]
Nach 1914, als im Zuge der Kriegsanstrengungen der Gedanke des Laissez-faire durch einen immer deutlicheren staatlichen Dirigismus in der Kriegsökonomie an Kraft eingebüßt hatte, sollten die Interessen der Arbeiterschaft nicht aus den Augen verloren, sondern vielmehr angemessen berücksichtigt werden. Die Arbeiter, so zeigten sich die christlichen Gewerkschaften überzeugt, sollten jedoch in viel höherem Maße auf sich selbst vertrauen und sich von der Idee eines paternalistischen Staates verabschieden. Gerade nach der Niederlage 1918, die mit einer bis dahin nie dagewesenen politisch-sozialen Zerrissenheit einherging, wurde es als unwahrscheinlich angesehen, dass der geschwächte Staat die Interessen der Arbeiter gegenüber der Wirtschaft werde durchsetzen können. Eine eigene Bank der christlichen Gewerkschaften konnte vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit darstellen, die legitimen Bedürfnisse der Arbeiterschaft zu wahren und zu fördern. Man stützte sich dabei unter anderem auf Ideen, die Ferdinand Lassalle bereits in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte, indem er vorschlug, dass die Genossenschaften Staatskredite erhalten sollten; auf diesem Weg sollte ein Anker gefunden werden, um die Arbeiter auf ökonomischer Ebene stärker in den Staat zu integrieren.
Die christliche Gewerkschaftsbewegung wurde von willensstarken und selbstbewussten Persönlichkeiten geführt. Hierzu zählten der spätere Preußische Ministerpräsident Adam Stegerwald, der Bergarbeiterführer Heinrich Imbusch aus Essen, der Metallfacharbeitervorsitzende Franz Wieber aus Duisburg und Christian Winter, der Vertreter des DHV, der in der Kaiserzeit eine kaum zu unterschätzende Bedeutung hatte und knapp 300.000 Mitglieder zählte. Der DHV hatte einen starken völkisch gesinnten Flügel, der sich als «Gesinnungsgemeinschaft» zur Schaffung einer neuen «Volksgemeinschaft» verstand. Als Verband kooperierte der DHV mit konservativen und liberalen Parteien, aber auch mit dem Zentrum, um seine Interessen besser durchsetzen zu können.[15] Hier konnten sich also Strömungen eines «Gemeinschaftsideals» zusammenfinden, das eine gewisse Nähe zum schillernden Begriff der «Volksgemeinschaft» hatte, aber im katholischen Milieu weniger mystisch aufgeladen war als bei den Anhängern völkischer oder nationalsozialistischer Vorstellungen.[16]
Zum wichtigsten politischen Wegbereiter der Deutschen Volksbank wurde der 1874 bei Würzburg geborene Adam Stegerwald. Er kam aus dem Zentralverband christlicher Holzarbeiter und war «einer der aktivsten Christlichen Gewerkschafter».[17] Stegerwald hatte eine Tischlerlehre absolviert, an die sich Wander- und Gesellenjahre angeschlossen hatten. Ohne den Kolpingverein, so bekannte er später, wäre er Mitglied des sozialdemokratischen Holzarbeiterverbandes geworden.[18] Sein Biograph Rudolf Morsey hat die dominierenden Charakterzüge Stegerwalds anschaulich geschildert: «Tatkraft, Verantwortungsfreudigkeit, Mut, Organisationsgabe und persönliche Anspruchslosigkeit. Damit verbanden sich allerdings, ebenfalls lebenslang, Eigenschaften, die weniger geschätzt waren: starkes Selbstbewußtsein, Neigung zur Besserwisserei, rauher Umgangston.»[19] Stegerwald, eine kantige Persönlichkeit von Format, war neben Heinrich Brüning der wahrscheinlich einflussreichste und bekannteste Mann der christlichen Arbeiterschaft im 20. Jahrhundert.[20]
Eine kantige Persönlichkeit: Adam Stegerwald, hier auf einem Foto des Jahres 1929, war mächtiger Antreiber für den Aufbau einer Bank der christlichen Gewerkschaften.
Er wollte als Verfechter eines gegenwartsbezogenen Katholizismus der Arbeiterschaft einen angemessenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einfluss verschaffen: «Mein Ziel geht dahin», so formulierte er im Jahr 1924, «die Arbeiterschaft und ihre Vertretungskörper als einflußreichen und mitbestimmenden Faktor in den deutschen Wirtschaftsorganismus einzubauen. Dieses Ziel wird nicht zu erreichen sein, wenn nicht die Gewerkschaften selbst dazu übergehen, eine Anzahl wirtschaftlicher Unternehmungen sich anzueignen und sie zu leiten.»[21] Die Idee konfessioneller Gewerkschaften sollte langfristig überwunden werden, weil sie zu einer Isolierung der christlichen Arbeiterbewegung beitrug. Die Betonung eines nationalen Gemeinschaftsethos sollte einen Ausweg aus der konfessionellen Enge bieten. Es bestand dabei weitgehend Übereinstimmung darin, dass die Verbände ihren Weg unabhängig von Kirchen und Geistlichkeit finden müssten und eine Instrumentalisierung durch die politischen Parteien vermieden werden sollte. Das «Klassenkampfprinzip» hielt Stegerwald schon früh für unhaltbar: Wer den Klassenkampf als Regulator des Wirtschaftslebens anerkenne, habe kein Recht auf Entrüstung, wenn auch die Unternehmer zu Aussperrungen von Arbeitern übergingen. Die Klassenkampftheorie der Sozialdemokratie stünde «im Widerspruch mit dem christlichen Sittengesetz und äußert sich auch praktisch in den weitaus meisten Fällen zuungunsten der unteren Klassen».[22] Stegerwalds Aversion gegen die Sozialdemokratie wurde nicht von allen christlichen Gewerkschaftern und Funktionären der Deutschen Volksbank geteilt. Wiederholt kam es über diese heikle Frage zu heftigen Auseinandersetzungen.
Der beharrliche Stegerwald ging Konflikten nicht aus dem Weg. Dies zeigte sich in der Debatte über die Vereinbarkeit des römisch-katholischen Denkens mit der Interkonfessionalität einer Gewerkschaftsbewegung. Diese ließ sich nur in schweren Auseinandersetzungen mit den Bischöfen und dem Vatikan durchsetzen, die einer Mitgliedschaft von Katholiken in christlichen Gewerkschaften skeptisch gegenüberstanden. Erst 1913/14 kam es zu einer Art Waffenstillstand in diesem sogenannten Gewerkschaftsstreit.[23] Stegerwald war selbstbewusst genug, die Zusammenarbeit von Katholiken mit «Andersgläubigen» zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen gegen den dezidierten Kurs seiner Amtskirche durchzusetzen. Obwohl Kritiker ihm und seinen Mitstreitern, zu denen in dieser Frage Heinrich Imbusch gehörte, trotz des Einsatzes für die Interkonfessionalität eine vollständige Katholisierung der christlichen Gewerkschaften vorwarfen,[24] öffnete sich die Deutsche Volksbank später allen Konfessionen.
Dahinter stand eine Grundstimmung, die tief vom Gedankengut der katholischen Soziallehre durchdrungen war. Die reformerische Lehre propagierte ein – heute sicherlich antiquiert erscheinendes – organisches und «berufsständisches» System der Selbstverwaltung, dem auch der Kreditsektor folgen sollte. Unter diesen Bedingungen war ein Platz für fachspezifische Banken vorgesehen, die eine unterstützende Rolle innerhalb der ständestaatlichen Ordnung einnehmen sollten. Diese Vision, die in bewusster Abgrenzung zur liberalen Wirtschaftsordnung gedacht war, beschränkte sich im Übrigen nicht auf die christlichen Gewerkschaften und die katholischen Sozialreformer, sondern fand sich selbst in den Überlegungen der sozialistischen und marxistischen Organisationen der Zeit:[25] «Selbstversorgung» und «Autarkie» – so lauteten die Schlagworte und Parolen, die auf viele Zeitgenossen ausgesprochen anziehend wirkten.
Adam Stegerwald formulierte auf dem 4. Arbeiterkongress, der vom 28. bis zum 30. Oktober 1917 in Berlin tagte und als programmatisch wichtige Etappe bezeichnet werden kann, die innenpolitischen Forderungen der christlichen Arbeiterschaft im vierten Jahr des Ersten Weltkrieges: politische Gleichberechtigung aller Staatsbürger und Beseitigung des preußischen Dreiklassenwahlrechts, schließlich die Bildung von Arbeiterkammern.
Stegerwald war kein Hurrapatriot. Er formulierte schon während des Weltkrieges ketzerisch, dass breite Schichten des Volkes das Gefühl nicht loswürden, «daß der überspannte preußische Geist, wie er von bestimmten Kreisen vertreten» werde, an «unserer gegenwärtigen Weltlage nicht unschuldig» sei.[26] Die Lage des Kaiserreichs hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits zugespitzt: politische Unsicherheit und Versorgungsnöte, die den bevorstehenden «Steckrübenwinter» bereits andeuteten. Die sich der Zentrumspartei zugehörig fühlenden Arbeiter befürchteten, dass die politische Elite des Kaiserreichs nach dem Ende des Weltkrieges die unter dem Signum des «Burgfriedens» von 1914 stehenden, mühsam errungenen Erfolge der Arbeiterschaft zurückdrängen würde. Stegerwald hatte daher an zwei Fronten zu kämpfen: Einerseits musste er dafür Sorge tragen, den katholischen Arbeitern einen größeren Einflussradius auf die Politik zu sichern, andererseits musste er sich gerade angesichts der vielen Unwägbarkeiten in einer entscheidenden Phase des Krieges schärfer gegen die Sozialdemokratie wenden. Solange der Krieg andauerte, blieben die Differenzen noch subkutan, aber es war schon 1917 nicht unwahrscheinlich, dass die weltanschaulichen Gegensätze über kurz oder lang aufbrechen würden.
Die Novemberrevolution und der linksradikale Spartakusaufstand akzentuierten die Spannung des Zentrums und seiner gewerkschaftlichen Protagonisten zur Sozialdemokratie. Die christlichen Gewerkschaften fanden sich in diesem Milieu kaum genügend vertreten. Ein Deutsch-Demokratischer Gewerkschaftsbund (DDGB), der die nichtsozialistischen Gewerkschaften unter Einschluss der Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine umfasste, wurde am 20. November 1918 in Berlin gegründet.[27] Dieser Verbund war fortan gleichsam die Spitze einer mächtigen «Gegenbewegung» (Helga Grebing). Zu gemeinsamen Vorsitzenden des DDGB, der bei Kriegsende etwa 1,25 Millionen Arbeiter, Angestellte und Beamte vertrat, wurde neben Adam Stegerwald auch Gustav Hartmann von den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen gewählt. Schon wenige Wochen nach Gründung erfolgte eine Namensänderung in Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), um nicht in die Nähe der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) gerückt zu werden.
Politisch überlebte das Zentrum die Wirren des Kriegsendes und der Novemberrevolution, ja ging sogar gestärkt aus der Krise hervor. Die Partei hatte noch während des Krieges einen erheblichen Schwenk nach links gemacht. In der Weimarer Republik behielt sie eine ausgeprägte gewerkschaftliche Komponente, da sie sich auf die katholischen Arbeitervereine und auf die christlichen Gewerkschaften stützen konnte.[28]
Die Bedeutung Adam Stegerwalds war durch die dramatischen Kriegsereignisse in der zweiten Kriegshälfte eher gewachsen. 1917 war er als einziger Arbeiter ins Preußische Herrenhaus berufen worden. 1919 wurde er in die neu konstituierte Nationalversammlung und in die Preußische Landesversammlung gewählt, im folgenden Jahr in den Reichstag. Seit dem 25. März 1919 leitete er, gerade erst zum Vorsitzenden des DGB ernannt, für mehr als zwei Jahre das Preußische Wohlfahrtsministerium. Wenig später wurde er zugleich Preußischer Ministerpräsident.
Die Unterschiede zwischen denjenigen, die im gewerkschaftlichen Boden verwurzelt waren wie Stegerwald, Imbusch und Fahrenbrach, und jenen, die den Traditionen der katholischen Arbeitervereine entstammten wie Wilhelm Elfes, Johannes Giesberts, Anton Gilsing, Johannes Gronowski und Joseph Joos, waren frappierend. Während die erste Gruppe eher dem gewerkschaftlichen Gedanken näherstand, lagen der zweiten Gruppierung eher die katholischen Traditionen und trotz aller praktischen Distanz ihre Institutionen am Herzen.
Vor allem seitens der christlichen Gewerkschaften wurde das Spezifische ihrer Einrichtung gegenüber den sozialistischen Gewerkschaften betont: Unter der Devise «christlich, national, sozial» sollte eine neue gemäßigte Bewegung auf christlicher Grundlage geschaffen werden. Die christlichen Gewerkschaften wollten, wie selbstbewusst herausgestellt wurde, «immer mehr […] als eine bloße Lohn- und Tariforganisation» sein, nämlich eine «Gesinnungsgemeinschaft».[29] Dabei sah Stegerwald, dass manche negativen Eigenschaften der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, wie etwa das «spekulative Großkapital», der weiteren emanzipativen Öffnung der Arbeiterschaft im Wege standen.[30] Im April 1920 erklärte er in Dortmund: «Die Verstaatlichung der Wirtschaft lehnen wir ab.» Bei gleicher Gelegenheit sprach er sich gegen «Hochkapitalismus und Mammonismus» aus, um zu einer «sittliche(n) Kraftentfaltung» der Arbeiterschaft in gemeinwirtschaftlichem Sinne zu kommen. Der Marxismus sei «so tot, wie es überhaupt nur denkbar ist». Deshalb plädierte Stegerwald für einen christlichen «Mittelweg», der den Kapitalismus «in den Herzen der Menschen» zu überwinden in der Lage sei.[31]
Die Polarisierung, die sich in der Weimarer Republik nach der Novemberrevolution abzeichnete und sich im Erstarken links- wie rechtsradikaler Bewegungen zeigte, wurde als höchst gefährliche Entwicklung angesehen. Der Möglichkeit eines Abdriftens der Arbeiter auf die Seite des Bolschewismus, die sich in der Spartakusbewegung und bestimmten Tendenzen der linkssozialistischen Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) beziehungsweise der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) andeutete, sollte durch ökonomische Bindung an den Staat konterkariert werden. Stegerwald sah mit Sorge, dass sich die Mehrheitssozialdemokratie solchen Überlegungen gegenüber verschlossen zeigte.
Die Gründung gewerkschaftlicher Unternehmen und Banken erschien ihm als Möglichkeit, die befürchtete Radikalisierung zu verhindern:
«Ich bin fest davon überzeugt, daß ohne eine veränderte geistige Einstellung der Arbeiterbewegung ein dauernd besserer Staats- und Wirtschaftsaufbau wie ehedem nicht möglich ist. Solange die Arbeiterschaft bei einer engen klassenpolitischen Betrachtungsweise verbleibt, in der Gewerkschaftsbewegung nach wie vor sich überwiegend mit Fragen des Arbeits- und Lohnverhältnisses beschäftigt, und in politischer Hinsicht weltfremden Ideologen nachläuft, sich von den politischen Tagesströmungen oder wurzellosen intellektuellen Elementen hin- und herzerren lässt, wird sie in Wahrheit und im großen nur den Scharfmachern und der politischen Reaktion in die Hände arbeiten.»[32]
Eine solche aus den Zeitumständen durchaus nachvollziehbare Abwehrstellung gegenüber sozialistischen Experimenten und Rätebewegungen – aber auch gegenüber «völkischen» Bestrebungen – blieb in den folgenden Jahren eine Konstante des politischen Denkens Stegerwalds. Im Vordergrund stand jedoch die Wendung gegen den Sozialismus, der als Antagonist der christlichen Gewerkschaften diesen das Wasser abzugraben drohte. Stegerwald wurde nicht müde zu betonen, dass der Sozialismus überholt und Sozialisierung ein «überlebter Begriff» sei.[33] 1924 formulierte er, dass die christliche Gewerkschaftsbewegung zwar einen innen- wie außenpolitisch «machtvollen Staat» gutheiße, jedoch die «Staatsallmacht» verwerfe:
«Sie will nicht den Staat wie er vor 1914 war, der seine Macht nach innen und nach außen einseitig hervorkehrte und dabei die übrigen Kraftstationen der Politik, insbesondere die moralischen und teilweise auch die geistigen stark vernachlässigte. Ein Staat ohne Macht ist ein Unding, ein bloßer Machtstaat aber ist für die Dauer eine ebensolche Unmöglichkeit. Über der Macht des Staates steht das Naturrecht des einzelnen Menschen, des eigenen Volkes und auch der fremden Völker.»[34]
Christlich-nationale Untertöne waren den christlichen Gewerkschaften nicht fremd; man nahm hier Anleihen vor, die mitunter fast an nationalbolschewistische Parolen erinnerten, betrachtet man beispielsweise Paul Bröcker, einen eingefleischten DHV-Ideologen, der seinen Anhängern zurief: «Her mit dem Kapital!» Das eingeforderte Geld sollte eingesetzt werden, um letztlich dem «Profitkapitalismus» ein Ende zu bereiten.[35] Um diesem Ziel näher zu kommen und die Arbeiter an ein gemischtes Wirtschaftssystem zu gewöhnen, planten die christlich orientierten Wirtschaftsfachleute, einen größeren Sektor gewerkschaftlich verwalteter industrieller Produktion und Verteilung aufzubauen. Weder bei den Privatbanken noch den öffentlich-rechtlichen Geldinstituten sah man die Interessen der Arbeiterschaft genügend vertreten.
Die Idee der Gewerkschaftsbanken im nationalen und internationalen Kontext
Gerade die Weimarer Republik entwickelte sich zu einem Experimentierfeld dieser bankähnlichen Einrichtungen. In der Mitte der 1920er-Jahre bestanden neben der Deutschen Volksbank fünf weitere Gewerkschaftsbanken in Deutschland: die Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten AG in Berlin, die dem Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein zugeordnete Deutsche Wirtschaftsbank AG in Berlin-Zehlendorf, die Deutschgewerkschaftliche Bank AG in Berlin-Wilmersdorf, die Deutsche Landvolkbank AG in Berlin als Einrichtung des christlich-gewerkschaftlichen Zentralverbandes der Landarbeiter und schließlich die Reichsbund-Bank AG in Berlin. Mit der Deutschen Landvolkbank AG, der Deutschgewerkschaftlichen Bank AG sowie der Bayerischen Eisenbahner Bank AG stand die Deutsche Volksbank in Geschäftsverbindungen, ebenso mit der Schweizerischen Genossenschaftsbank in Sankt Gallen.[36]
Die Motive bei den Neugründungen nach 1918 waren ausgesprochen disparat. Es handelte sich letztlich «um weltanschaulich völlig heterogene und auch soziologisch jeweils völlig anders zusammengesetzte Gruppen, die politisch so gut wie nichts gemeinsam hatten».[37] Die Größe der neuen Einrichtungen war in der Regel wenig imponierend. Viele der neu gegründeten Institute konnten schon hinsichtlich ihres Geschäftsumfangs kaum als Bank bezeichnet werden; sie waren eher den Spar- und Darlehenskassen vergleichbar.
Drei Gründe waren dafür verantwortlich, dass die Idee von Arbeitnehmerbanken nach 1918 auf besonders fruchtbaren Boden fiel. Erstens erhöhte sich mit der Novemberrevolution die politische Macht der Gewerkschaften, was sich in einer kräftigen Steigerung der Mitgliederzahlen der organisierten Arbeiterverbände niederschlug. Ende 1922 waren bei den christlichen Gewerkschaften 1.881.060 Mitglieder eingeschrieben, die reichsweit außerordentlich gut organisiert und vernetzt waren. Ihre insgesamt 50 Verbände verfügten allein über 8252 Ortsgruppen.[38] Die in dieser vielverzweigten Organisation vorhandenen Gelder hatten einen beachtlichen Umfang, obwohl sie nicht an die Beträge der sozialistischen Gewerkschaften heranreichten. Im letzten Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs standen den christlichen Gewerkschaften an fest angelegten und liquiden Geldern in Form von Bankguthaben und Staatspapieren 3,9 Millionen Mark bei einem Gesamtvermögen von 6,1 Millionen Mark zur Verfügung.[39] Dieses Kapital sollte nicht allein den privaten Großbanken und den öffentlich-rechtlichen Instituten überlassen werden.
Zweitens wirkte die Inflation als eine bereits seit Langem drohende wirtschaftliche Folge des Ersten Weltkriegs dynamisierend. Die Geldentwertung betraf die beträchtlichen finanziellen Geldmittel der Gewerkschaften, die bislang als Depositenguthaben bei den Großbanken unterhalten wurden und nun durch die Inflation akut gefährdet schienen.
Drittens war der Aufbau von Arbeitnehmerbanken ein Trend der Zeit und nicht allein auf Deutschland beschränkt. Tendenzen der Globalisierung in einer sich weiter miteinander vernetzenden Welt waren unverkennbar.[40] Diese Entwicklung hatte schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingesetzt und verstärkte sich nach 1918. Im belgischen Gent war 1913 als älteste Arbeitnehmerbank überhaupt die Banque Belge du Travail/Belgische Bank van de Arbeid gegründet worden. In zahlreichen west- und nordeuropäischen Staaten wie Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Österreich wurden nach 1918 in rascher Folge ähnliche Institutionen eingerichtet. In den USA, in denen die gewerkschaftliche Bindung der Arbeiter traditionell nur schwach ausgebildet war, wurde im Frühjahr 1920 die Mount Vernon Savings Bank als Einrichtung der International Association of Machinists gegründet, was eine Welle weiterer Neugründungen nach sich zog. Überhaupt kam den Vereinigten Staaten, die in jenen Jahren Großbritannien als führende Weltmacht ablösten, eine Vorreiterfunktion in dieser Sparte zu: Schon 1926 bestanden in den USA 36 Arbeitnehmerbanken.[41] Die Kontakte zu den ausländischen Instituten können jedoch vernachlässigt werden, denn anders als zwischen den Großbanken gab es kaum Berührungspunkte und gemeinsame Aufgaben. Zudem hatte durch den Weltkrieg die internationale Solidarität der jeweiligen nationalen christlichen Gewerkschaftsverbände gelitten. 1920 mussten die deutschen Gewerkschaftsfunktionäre rückblickend feststellen: «Der Krieg zerriß die internationalen Beziehungen der Christlichen Gewerkschaften sozusagen vollständig», weil «hervorragende Vertreter der christlichen Arbeiterorganisationen der mit Deutschland im Kriege befindlichen Mächte sich in dem leidenschaftlichsten Gefühl gegen Deutschland» ergangen hätten.[42]
Einen Grundgedanken formulierte ein zukünftiges Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Volksbank, der Genossenschaftler Peter Schlack, bereits kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs in einem Beitrag für die Monatsschrift Deutsche Arbeit, die von den christlichen Gewerkschaften herausgegeben wurde. Er wies darauf hin, dass die Gewerkschaften nur dann greifbare Erfolge erzielen könnten, wenn ihr Kapital und das ihrer Mitglieder – man verfügte über rund 10 Millionen Mark – in ökonomische und politische Macht umgemünzt würden:
«Wie die Sparkassen, wie besonders die großkapitalistischen Banken die Gelder dieser arbeitenden Schichten verwenden, ob nicht mit diesem Gelde Grundstücks- oder Waren-Spekulationen mit dem Erfolge erhöhter Miet- und Warenpreise für die Konsumenten betrieben wird, darum kümmern sich bisher die Verwalter, die Vorstände […] im allgemeinen nicht. Der einzige Gesichtspunkt, nach dem die Anlage bisher erfolgte, war, einen möglichst hohen Zins herauszuschlagen. Eine Folge dieser Zinspolitik ist, daß zwar das Gemeinschaftskapital der Arbeiterorganisationen vielleicht um 1/8 oder 1/4 mehr anwächst, aber mit dem Erfolge, daß die Glieder dieser Organisationen das Hundertfache und mehr in ihrer Wirtschaft ausgeben müssen, als der vielleicht höhere Zins einbringt.»[43]
Mit der bisherigen Verwaltung der Gelder durch Sparkassen und Großbanken müsse daher «vollständig gebrochen» werden. Gleich den Angehörigen anderer Berufsstände mit ihren Großbanken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen und Darlehenskassen sollten die Arbeitnehmer und deren vielgestaltige Organisationen dafür gewonnen werden, die gesamten Gelder für die eigenen Standesbestrebungen nutzbar zu machen. Schlack forderte die Gründung einer Arbeitnehmer-Genossenschaftsbank, wobei noch unklar blieb, ob diese die Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung annehmen sollte. An ihr sollten alle Einzelorganisationen der christlichen Gewerkschaften beteiligt sein. Ziel war es, den Genossenschaften zu leichterem und billigerem Kredit zu verhelfen, als dies über die Großbanken gewährleistet werden konnte. Die Probleme verkannte Schlack dennoch nicht. Es werde nicht einfach sein, die Genossenschaftsmitglieder davon zu überzeugen, bei einer Bank der christlichen Gewerkschaften Gelder einzuzahlen, «wenn ihnen anderweitig ein etwas höherer Zinsgewinn winkt. Es müßte, um diese Bank sicher zu stellen, vielleicht eine gewisse Bindung erfolgen.»[44] Ebendiese «Bindung» war es später schließlich, die die Deutsche Volksbank elementar in ihrer Existenz gefährden sollte. Stegerwald dachte ganz ähnlich:
«Diese Erwägungen stützten sich vor allem auf den Gedanken, daß die Spargelder der Arbeiter, die Vermögen der Organisationen vor allem an jener Stelle in der Wirtschaft zum Einsatz gebracht werden sollten, wo sie dem Vorteil der Arbeiterschaft dienen. Diese Gewähr schien in keiner Weise gegeben bei den Privatbanken und auch nur in unzulänglichem Maße bei den öffentlich-rechtlichen Geldinstituten. Neben die organisierte Arbeiterschaft in den Gewerkschaften und die organisierte Kaufkraft in den Konsumgenossenschaften sollte die organisierte Sparkraft der Arbeiterschaft durch die eigene Arbeiterbank treten. Die Verwaltung der Arbeitergelder sollte in den Händen der Arbeiter selbst liegen. Nicht der höchste Zinssatz sollte bestimmend sein für die Anlage der Gelder, sondern die weitestmögliche Unabhängigkeit der Arbeiter – vor allem bei der Befriedigung ihrer äußeren Lebensnotwendigkeiten – von den nackten Gewinninteressen rein kapitalistisch geführter Unternehmungen.»[45]
Die konkreten Überlegungen zur Gründung der Deutschen Volksbank
Nach Kriegsende wurden diese Vorüberlegungen erheblich intensiviert. Der 10. Kongress der christlichen Gewerkschaften Deutschlands in Essen im Jahr 1920 bildete in vielfacher Hinsicht einen «Meilenstein»[46] in der Entwicklung der Bewegung. Dem Kongress lag ein Antrag vor, der die Gründung einer Volksbank für die Angehörigen des DGB forderte. Dieser basierte möglicherweise auf einem ganz ähnlichen Antrag, der schon auf der Bezirkskonferenz Nürnberg des Bayerischen Eisenbahnerverbandes gestellt worden war. Stegerwald machte jedenfalls in Essen die Mitteilung, dass für eine solche Gründung bereits erhebliche Vorarbeit geleistet worden sei, «um die wirtschaftlichen Kräfte der christlich-nationalen Arbeiter, Angestellten und Beamten und sonstiger, diesen nahe stehenden Kreise bei dem deutschen Wiederaufbau einheitlich zusammenzufassen und zur Geltung zu bringen».[47] Angesichts der steigenden Mitgliederzahl und des wachsenden Umfangs der Aufgaben und Geschäfte sollten die Gewerkschaften, so der Antrag Stegerwalds, nicht länger dem «großkapitalistischen Bankkonzern auf Gnade und Ungnade ausgeliefert sein». Daher müsse man dazu übergehen, eine eigene Zentralstelle für die Abwicklung dieser Aufgaben zu schaffen. Dahinter stand der Gedanke, dass die Sparer bislang kaum Kontrolle über die Verwendung ihres Sparkapitals besaßen. Eine Bank, die eine Mitsprache über die Verwendung der Geldmittel ermöglichte, sollte den christlichen Gewerkschaften «eine neue Waffe an die Hand geben», um die wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeiter zu verbessern.[48] Stegerwald hat dieses Streben nach Mitbesitz, Mitverantwortung und Mitbestimmung einige Jahre später wie folgt beschrieben:
«Durch die Pflege des berufsständischen Sparwesens mittels besonderer Banken müssen wir dahin gelangen, daß nicht mehr als 70 Prozent des deutschen Volkes bloße Lohn- und Gehaltsempfänger sind. Es müssen die organisierte Arbeitskraft und die organisierte Konsumkraft auf den großen Gedanken eingestellt werden, daß die Lohn- und Gehaltsempfänger weitgehend in den Mitbesitz und in die Mitverwaltung der Wirtschaft hineinwachsen.»[49]
Die zu gründende Bank sollte dem Antrag entsprechend insbesondere folgende Geschäftszweige umfassen:
«a) Verwaltung der Verbandsvermögen aller uns nahestehenden Korporationen und Privatgelder der Mitglieder derselben und fremder Personen und Körperschaften. b) Finanzierung von Baugenossenschaften und ähnlichen Unternehmungen. c) Finanzierung vorteilhafter Einkäufe. d) Die Bank soll auch als Großhändler bei der Warenvermittlung auftreten, um den Weg zwischen Produzenten und Konsumenten zu verkürzen und dadurch die Waren zu verbilligen. Es soll ein Sammelbecken für die Spar- und Kapitalkraft der deutschen Arbeitnehmer geschaffen werden.»[50]
Die Anlehnungen an das Genossenschaftswesen waren unübersehbar und spiegeln sich im Kreis der möglichen Kreditnehmer wider, wie er in den Statuten der Deutschen Volksbank umschrieben war: Die christlichen Konsumgenossenschaften und ihre Produktionsbetriebe, die gemeinnützigen Baugenossenschaften, die Siedlungsgenossenschaften sowie die Kranken- und Lebensversicherungen der christlichen Gewerkschaften sollten angesprochen werden. Daneben sollten die Aktien der Gewerkschaftsmitglieder verwahrt werden, um durch das Depotstimmrecht den sozialpolitischen Einfluss der christlichen Gewerkschaften zur Geltung zu bringen. Eine deutliche Abgrenzung erfolgte gegenüber den freien Gewerkschaften. Für Streiks und Arbeitskämpfe sollten die Mittel der Bank ausdrücklich nicht zur Verfügung stehen.[51] Auch Konsumkredite an einzelne Arbeitnehmer widersprachen den Zielen.[52]
Vor allem eine Initiative Stegerwalds auf einem Kongress der christlichen Gewerkschaften in Essen im November 1920 war hierfür symptomatisch. Die Genese der Idee einer gewerkschaftseigenen Bank stand im Zusammenhang mit einer parteipolitischen Umorientierung. Stegerwald hatte in den Vorjahren ein vorsichtig-distanziertes, aber doch verständigungsbereites Verhältnis zur SPD gepflegt. Ihn störte jedoch der vermeintliche Populismus der Sozialdemokratie. Mit «agitatorischen Schlagworten» lasse sich ebenso wenig Politik betreiben wie mit dem Versuch, den eigenen politischen Kurs «an der aufgeregten Straße zu orientieren».[53] Nach dem Essener Kongress wuchs die Kluft zur SPD weiter an. Nach Stegerwalds eigenem Empfinden rückte er während dieser Zeit stärker von der SPD ab, weil diese seiner Meinung nach inzwischen wieder den «rücksichtslosen Kampf» aufnahm.[54]
Essen war ein wichtiges Zentrum der christlichen Gewerkschafter; günstig war, dass die Stadt trotz aller Auseinandersetzungen «keineswegs eine Hochburg revolutionärer Gewerkschaften» war.[55] Bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 erlitten die Anhänger radikaler Gewerkschaftsforderungen eine eindeutige Niederlage. Mit weitem Abstand stärkste Kraft in der Arbeiterstadt Essen wurde das Zentrum, das sich gegen Sozialisierung und Säkularisierung stellte und auf dem Boden der Verfassung dank ihrer starken Verankerung in der Arbeiterschaft eine demokratische Durchsetzung von Arbeiterrechten anstrebte. Das Zentrum erhielt 38,6 Prozent der Stimmen, die Mehrheitssozialdemokratie landete abgeschlagen auf dem zweiten Platz mit 27,7 Prozent, während die USPD 8,8 Prozent erhielt. Die Ergebnisse wurden durch die Stadtverordnetenwahl am 2. März 1919 bestätigt, bei der das Zentrum zur «städtischen Verwaltungspartei» wurde, was umso wichtiger war, als im städtischen Parlament die Arbeiter und Gewerkschafter fortan politisch bestimmend wurden.[56] Unter dem parteilosen Finanzfachmann Hans Luther, der als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt in diesen schwierigen Jahren lenkte, wurde Christian Kloft zum Beigeordneten ernannt – ein Arbeitersekretär der katholischen Vereinsbewegung übernahm damit eine führende kommunale Funktion. Weil mit Martin Krolik ein Sozialdemokrat Sekretär des Bürger- und Arbeiterkonsumvereins Eintracht war, konnte Essen durchaus als Stadt der nichtrevolutionären Arbeiterbewegung gelten.
Stegerwalds programmatische Essener Kongressrede am zweiten Tag, dem 21. November 1920, wurde sozusagen die Geburtsstunde der Deutschen Volksbank, aus der die heutige National-Bank hervorging. Sie war der Höhepunkt des Kongresses und wurde als «politische Sternstunde» Stegerwalds bezeichnet.[57] Er referierte über «die christlich-nationale Arbeiterschaft und die Lebensfragen des deutschen Volkes» und systematisierte in diesem wegweisenden «Essener Programm», das in einer Auflage von 100.000 Exemplaren gedruckt verbreitet wurde, jene staats- und parteipolitischen Überlegungen, die bereits in den vorangegangenen Monaten den Spitzen der christlichen Gewerkschaften und den führenden Gremien der Zentrumspartei unterbreitet worden waren.[58]
Ausgangspunkt seines langen Vortrags war die Feststellung, dass sich angesichts der als katastrophal eingeschätzten ökonomischen Weltlage die fast zwei Millionen Mitglieder des DGB nicht länger auf ihr originär gewerkschaftliches Arbeitsfeld beschränken könnten, sondern aktiv in die Politik eingreifen müssten. Dabei zeichnete Stegerwald ein Krisengemälde, dem zufolge Mechanisierung, Materialisierung und Atomisierung das menschliche Zusammenleben der Wilhelminischen Zeit zerstört hätten, weshalb gerade die christlich-nationale Arbeitnehmerbewegung aufgefordert sei, «zur Offensive überzugehen», die nur in der rettenden «Wiedergeburt im Geiste des Christentums» liegen könne und der Stärkung der deutschen Nation zu dienen habe. Deswegen verlangte er außenpolitisch ein Ende der von «französischen Plutokraten» aufgezwungenen «Sklavenarbeit» der Deutschen. Im Sinne eines Primats der wirtschaftlichen Erholung lehnte Stegerwald die Sozialisierung als «Wahnsinn» ab und propagierte stattdessen die Einführung von Kleinaktien, die an die Stelle der «formalen Sozialpolitik» treten sollten.
Zur Herstellung der dringend benötigten «konstante[n] Linie der Politik» war es nach Stegerwald unabdingbar, das «Flimmersystem unserer bisherigen parlamentarischen Politik» abzuschaffen.[59] Dieses beruhe «auf dem Flugsand wechselnder Koalition[en]». Der DGB müsse seine parteipolitische Neutralität aufgeben und als treibende Kraft eine christlich-ethisch grundierte politische Einheitsfront schaffen, deren Außenprofil durch die vieldeutigen Schlüsselworte wie «deutsch», «christlich», «demokratisch» und «sozial» ein großes Identifikationsangebot anzubieten verspreche. Zur Herbeiführung dieser christlich-nationalen Volkspartei, die den Bogen vom Zentrum bis zur DNVP durch die «politische Zusammenfassung der positiven Kräfte im katholischen und evangelischen Lager» spannen und gesamtpolitisch Unstetigkeits- und Spannungsmomente beseitigen sollte, schlug Stegerwald jedoch lediglich die Wahl eines parlamentarischen Aktionskomitees aus den mehrparteilich gebundenen DGB-Abgeordneten vor, die den Kern für die nächsten Schritte darstellen sollten. Als nächstes konkretes Vorgehen kündigte der Gewerkschaftsvorsitzende zur Hebung des sozialen und nationalen «Gemeinschaftsgefühls» die Gründung einer eigenen Tageszeitung sowie einer Volksbank an, wobei Letztere die wirtschaftlichen Kräfte der christlichen Arbeitnehmerbewegung bündeln sollte. Stegerwalds wirtschaftspolitische Gedanken enthielten Versatzstücke des Korporatismus, zur damaligen Zeit in Europa ein durchaus attraktiv erscheinendes Modell des «organisch» konstruierten Staates.[60] Entsprechend kritisch fällt das heutige Urteil über Stegerwalds Staatsverständnis aus, zumal er auf ein deutliches Bekenntnis zur republikanischen Staatsform verzichtete und seine Feststellungen zur parlamentarischen Staatsform «dürr und knapp» ausfielen.[61]
Die innenpolitischen Krisen der frühen Weimarer Republik ließen eine vollständige Durchsetzung der Pläne Stegerwalds, der sich innerhalb der eigenen Reihen des Vorwurfs mangelnder Tatkraft zu erwehren hatte, nicht zu. In vielen deutschen Kommunen, besonders aber in den Großstädten war das Lager der gemäßigten Kräfte in der Revolutionszeit geradezu gelähmt und unfähig zu einer wirklichen politischen Aktion, obwohl man inzwischen weiß, dass die Revolution für das Bürgertum einen viel größeren Mobilisierungsschub bedeutet hat, als lange Zeit angenommen wurde.[62] Die Zusammenarbeit zwischen katholischer und demokratischer Bewegung, wie sie nun in der Notzeit realisiert werden konnte, war im 19. Jahrhundert noch nicht die Regel gewesen. Hier bestand jetzt die Chance, althergebrachte Antagonismen zu überwinden und als «Partner der Wahl» die politisch in getrennt auftretenden Gewerkschaften gespaltenen Arbeiter vor dem Hintergrund eines modernen Christentums in der Demokratie von Weimar miteinander zu versöhnen. Zunächst einmal waren dies die akuten Fragen der Politik. Welche Rolle sollte dem Staat in einer Gesellschaft zukommen, die nach dem Untergang der Hohenzollernmonarchie ihre Selbstsicherheit und ihre Überzeugungen der Vorkriegszeit unwiederbringlich verloren hatte? In welcher Weise konnten die Arbeiter angesichts der für viele verlockend erscheinenden sozialistischen und bolschewistischen Gegenentwürfe in den demokratischen Staat integriert werden? Wie sollten ein Volk und eine Nation zur Demokratie erzogen werden?
Als Stegerwald zum Preußischen Ministerpräsidenten gewählt wurde, war der Plan erst recht nicht mehr aktuell. Das Zentrum vollzog unter Joseph Wirth einen deutlichen Rechtsschwenk. Stegerwald wollte sich hingegen nicht nach einem einfachen Rechts-Links-Schema positionieren. In nationalen und kulturellen Fragen war er sicherlich ein Konservativer, aber in wirtschaftlichen und sozialen Fragen war für ihn in der nachrevolutionären Zeit der Weimarer Republik gar nicht so eindeutig, wie rechts und links überhaupt definiert werden sollten.
Als Initiator und treibende Kraft der Bankenidee hat Stegerwald drei Jahre nach der Gründung noch einmal das Leitmotiv für seine Initiative benannt: Die Deutsche Volksbank solle
«auf die Dauer einen umfassenden Geldaufsaugeapparat im Lande schaffen […], um einem großen Teil der deutschen Gehalts- und Lohnempfänger zu Einzel- und Kollektiveigentum zu verhelfen. Der Wege dahin gibt es viele: Produktionsgenossenschaften, Konsumvereine, maßgebende Beteiligung von Verbänden an Aktiengesellschaften, die für die Wirtschaft und die Gewerkschaften von großer Bedeutung sind usw. Daneben muß auch auf dem Wege der Gesetzgebung […] die Mitwirkung der Arbeitnehmer an der Verwaltung der Wirtschaft herbeigeführt werden.»
Stegerwald machte also klar, dass die Gründung der Deutschen Volksbank nur ein – wenn auch wichtiger – Baustein bei der Errichtung eines finanziellen Gesamtprojekts verstanden werden sollte:
«Den gleichen wie den umschriebenen Zielen sollen die Versicherungsunternehmen der christlich-nationalen Arbeitnehmerbewegung (Deutsche Volksversicherung, Deutsche Feuerversicherung, Aktiengesellschaft für Transport- und Rückversicherung) dienen. Die deutsche Volksbank ist als ein Unternehmen gedacht, bei dem die verschiedenen Wirtschaftszweige ineinandergreifen und wobei sich Kreditoren und Debitoren gegenseitig ergänzen.»[63]
Stegerwald hat Ende der 1920er-Jahre in einem programmatischen Artikel noch einmal – gleichsam rückblickend – die Beweggründe für die Schaffung einer Gewerkschaftsbank christlichen Zuschnitts beschrieben. Seine Pläne stützten sich
«auf den Gedanken, daß die Spargelder der Arbeiter, die Vermögen der Organisationen vor allem an jener Stelle in der Wirtschaft zum Einsatz gebracht werden sollten, wo sie dem Vorteil der Arbeiterschaft dienen. Diese Gewähr scheint nicht gegeben bei den Privatbanken und auch nur in unzulänglichem Maße bei den öffentlich-rechtlichen Geldinstituten. Neben die organisierte Arbeitskraft in den Gewerkschaften und die organisierte Kaufkraft in den Konsumgenossenschaften sollte die organisierte Sparkraft der Arbeiterschaft durch die eigene Arbeiterbank treten. Die Verwaltung der Arbeitergelder sollte in den Händen der Arbeiter selbst liegen.»
Dabei sei bei der Entwicklung der Deutschen Volksbank «bewußt alle Sprunghaftigkeit ausgeschaltet» worden:
«Der größte Wert wurde darauf gelegt, ein Höchstmaß von Liquidität zu besitzen. Das ist auch völlig gelungen. Einen nicht unerheblichen Teil ihrer Aufgaben löste die Bank durch die Finanzierung der Bautätigkeit gemeinnütziger Wohnungsgenossenschaften, vor allem durch die Gewährung der sogenannten Bauzwischenkredite. Auch als zentrales Geldinstitut für die Gewerkschaftskassen und die von den Gewerkschaften geförderten Genossenschaften der verschiedensten Art hat sich die Deutsche Volksbank AG durchaus dienlich erwiesen. Wie bei der Gründung der Bank, so sind allerdings auch heute die christlichen Gewerkschaften sich durchaus der Tatsache bewußt, daß ihre Bank immer nur einen Bruchteil der Gelder der Bewegung und ihrer Einrichtungen verwalten wird. Die Spareinrichtungen der Konsum- und Wohnungsgenossenschaften z.B. wird die Deutsche Volksbank AG nicht abzulösen vermögen, da die Warenausgabe- und Mieteinzugsstellen eine bequemere Art der Einzahlung von Spareinlagen bieten. In all diesen Fällen werden die Spareinlagen – ohne die Volksbank zu passieren – immer den direkten Weg zum Ausbau der genossenschaftlichen Eigenbetriebe oder der Förderung des Wohnungsbaus nehmen.»[64]
Die Gründung der Deutschen Volksbank war nicht nur gegen die großen Privatbanken gerichtet, sondern gegen die anderen Pfeiler des dreigliedrigen deutschen Bankensystems. Sie sollte zugleich eine Art Versicherung gegen den Staat sein, dem Stegerwald sozialpolitische Wundertaten nicht zutraute:
«Die Arbeiter dürfen […] auch in wirtschaftlicher Hinsicht nicht auf die Allmacht des Staates zu große Hoffnungen setzen. Die Wirtschaft hat in vielfacher Hinsicht ihre eigenen Gesetze und läßt sich auch nicht immer durch Parlamentsbeschlüsse dahin bringen, wohin sie der Gesetzgeber haben möchte. Es muß vielmehr der Gedanke der Selbsthilfe in Arbeiterkreisen durch Einrichtung von Eigenunternehmungen mit allem Nachdruck gepflegt werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist gegenwärtig daran, teilweise neue Wege auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Selbsthilfe-Bestrebungen der Arbeitnehmer einzuschlagen. Er hat zu diesem Zweck die ‹Deutsche Volksbank› gegründet. Durch sie sollen zunächst die Kapitalien der Gewerkschaften verwaltet werden. Die dem Deutschen Gewerkschaftsbund angeschlossenen Organisationen verfügen im Laufe dieses Jahres über eine Einnahme von mindestens 500 Millionen Mark.»[65]
Die ersten Schritte der Bank
Die Gründung der gewerkschaftseigenen Bank und der Tageszeitung des DGB machten schon bald gute Fortschritte. Adam Stegerwald beauftragte Heinrich Brüning, den späteren Reichskanzler, mit der Umsetzung dieser Pläne. Brüning, den Stegerwald seit 1919 kannte, war bereits einige Zeit im DGB tätig gewesen. Ihm gelang es nun, «die widerstrebenden Interessen der Landesverbände» in Einklang zu bringen; vielfältige Kontakte zu den führenden Politikern der bürgerlichen Parteien waren dabei eine große Hilfe.[66] Der DGB schuf sich mit der Zeitung Der Deutsche ein publizistisches «Kampforgan».[67] Parallel dazu hoben die christlichen Gewerkschaften am 24. Februar 1921 in Berlin die Vereinsbank für deutsche Arbeit AG aus der Taufe, die am 20. Mai 1921 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin eingetragen wurde. Diese hatte ihren Sitz zunächst in der Hähnelstraße 15 a in Berlin-Friedenau und war mit einem Stammkapital von 2 Millionen Mark ausgestattet.[68] Die Wahl fiel auf den Standort Berlin, weil sich hier die Zentrale des Gesamtverbands der christlichen Gewerkschaften und des DGB befand. Stegerwalds wichtigste Mitarbeiter hatten hier ebenfalls ihren Arbeitsplatz. Die Reichshauptstadt war gleichsam «das organisatorische und politische Hauptquartier».[69] Die Entscheidung war keineswegs so naheliegend, wie sie heute angesichts der Dominanz Berlins im politischen Kosmos scheinen mag. Der Schwerpunkt des katholischen Lebens lag im Westen des Reichs im Rheinland und in Westfalen. Heinrich Imbusch kritisierte noch 1928 den Umzug der Zentrale des DGB von Köln nach Berlin: «[Die] Leitung unserer Bewegung muß da sein, wo der Geist zu Hause ist, der in unserer Bewegung lebt; und das ist hier im Westen.» Die Berliner Umgebung beeinflusse die Menschen «ganz stark ungünstig», und wenn sich die christlichen Gewerkschaften «noch nicht ganz [hätten] verderben lassen, dann [liege] es daran, daß wir noch immer mehr im Westen als in Berlin sind».[70] Tatsächlich musste die Entscheidung zugunsten Berlins schon bald revidiert werden, da die Deutsche Volksbank ihre Geschäfte ganz überwiegend im Westen betrieb.
Die Bank sollte die wirtschaftlichen Kräfte des DGB, des christlich orientierten Reichsverbandes deutscher Konsum-Vereine e. V. und der konfessionellen Arbeitervereine zusammenfassen und den Einfluss der christlich-nationalen Arbeitnehmer auf das Wirtschaftsleben und den «Übergang zur Gemeinwirtschaft» beschleunigen. Zu Geschäftsführern der neuen Bankgesellschaft wurden zwei Direktoren der den christlichen Gewerkschaften verbundenen Gemeinnützigen Deutschen Lebensversicherung AG bestellt, der Regierungsrat Dr. Walter Pitschke aus Berlin-Steglitz und Josef Becker aus Berlin-Wilmersdorf. Adam Stegerwald hat später angemerkt, man habe diese Experten eingestellt, weil «zunächst die Vorarbeiten zur Aufnahme der Banktätigkeit zu leisten waren».[71] Ihre Aufbauarbeit blieb jedoch ein Intermezzo: Im Handbuch der Deutschen Aktiengesellschaften wurden sie zwar noch in der Ausgabe von 1923/24 erwähnt, aber schon im Geschäftsbericht der Deutschen Volksbank für das Jahr 1923 waren sie nicht mehr aufgeführt.
Die Bank nahm Mitte 1921 ihre Tätigkeit auf und firmierte bis zum 6. Juli 1921 unter ihrem ursprünglich eingetragenen Namen als Vereinsbank für deutsche Arbeit AG.[72] An diesem Tag erfolgte die Umbenennung in Deutsche Volksbank AG. Stegerwald wollte gerade angesichts der offenkundigen Schwäche der jungen Weimarer Republik die Lebensumstände der Arbeiter durch seine «Volksbank» verbessern. Die neue Bank sollte das Vermögen der christlich orientierten Arbeiter auf lange Sicht zum Aktienkauf verwenden: Auf diese Weise würden die Arbeiter Einfluss auf die Großunternehmen erhalten, ohne auf marxistische Methoden wie Sozialisierungen zurückgreifen zu müssen. Stegerwald ließ sich selbst vom skeptischen Heinrich Brüning nicht von seiner Überzeugung abbringen, dass die Bank «rasch» zu einem der «führenden Kreditinstitute des Reiches» aufsteigen werde.[73]
Die neue Bank begriff sich ausdrücklich als Sammelbecken für die Spar- und Kapitalkraft der christlich orientierten Arbeitnehmer. Zur Ankurbelung des Bankgeschäfts wurden Werbeinitiativen – vor allem in den Gewerkschaftsblättern – eingeleitet. Auf diese Weise entstand also neben den in vielfacher Hinsicht in ein verschärftes Konkurrenzverhältnis tretenden Sparkassen und den Kreditgenossenschaften ein weiterer Wettbewerber, der sich einer ganz spezifischen Klientel widmen wollte: Neben den eigentlichen Gewerkschaftszielen sollte die Kapitalkraft der Arbeiter in Eigenregie nutzbar gemacht werden.[74] Bis 1933 blieb diese neue Institution die eigentliche Verwaltungsbank der christlichen Arbeitnehmerverbände. Es war daher wenig verwunderlich, dass die neue Sparte in der Bankenlandschaft bei den Sparkassen und Genossenschaften mit gemischten Gefühlen betrachtet wurde. Sie sahen sich einer «wachsenden Konkurrenz» gegenüber, der sie mit einem «Kampf mit allen Mitteln» begegnen wollten, ohne damit erfolgreich zu sein – zunächst jedenfalls nicht.[75]
Das Grundkapital der neu gegründeten Bank setzte sich aus 800.000 Mark vinkulierten Namensaktien mit fünffachem Stimmrecht und weiteren 1.200.000 Mark Inhaberaktien zusammen, die im Freiverkehr an der Essen-Düsseldorfer Börse notiert wurden. Allerdings befand sich der größte Teil der Inhaberaktien im festen Besitz der angeschlossenen Organisationen. Die Vorzugsaktien waren zum ganz überwiegenden Teil im Besitz der Hauptverbände der christlichen Gewerkschaften; die Übrigen wurden von den Genossenschaften gehalten.[76