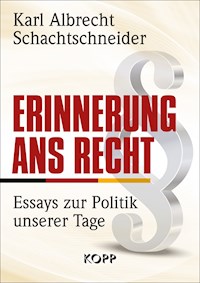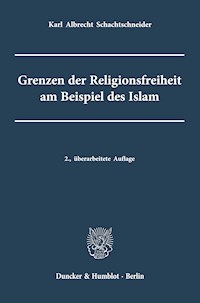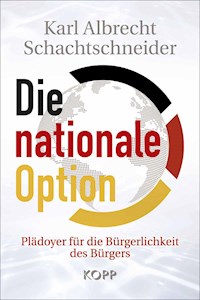
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Zerstörung des deutschen Nationalstaats - eine Chronik der Rechtsverstöße
Karl Albrecht Schachtschneider zeigt in diesem Buch, wie der deutsche Nationalstaat als Garant für Frieden und Freiheit einer Europäisierung und Globalisierung geopfert wird.
Schachtschneider sieht zwei Triebfedern, die für die fortschreitende Internationalisierung verantwortlich sind: das kapitalistische Geschäft und sozialistische Ideologien. Er zeigt, wie die Elite das Recht beugt, um ihre Ziele zu erreichen. Er bringt dabei in aller Deutlichkeit zum Ausdruck: Setzt sich die aktuelle Entwicklung fort, ist die Demokratie in höchstem Maße gefährdet.
Die Demontage des Rechtsstaates durch Kapitalisten und Sozialisten
Karl Albrecht Schachtschneider macht den Leser zunächst mit den Elementen vertraut, die für den demokratischen Rechtsstaat charakteristisch sind. Und er erläutert nachvollziehbar, warum diese Prinzipien seit jeher ein Garant für Frieden, Gerechtigkeit und freie Entfaltung des Bürgers sind.
Schachtschneider zeigt dann, wie die kapitalistisch und sozialistisch geprägte Elite diese Prinzipien verrät und wo sie klare Rechtsbrüche begangen hat. Schwerpunkte aus dem Inhalt sind unter anderem:
- die Maxime des »Einwanderungslands Deutschland«, die mit der Souveränität Deutschlands unvereinbar ist;
- der nicht rechtmäßige Beitritt Deutschlands zur Europäischen Union;
- die Arbeit der nicht demokratisch legitimierten Institutionen des EU-Parlaments und des Europäischen Gerichtshofs;
- die illegitimen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank;
- der »Freihandel« und die Öffnung der europäischen Märkte für multinationale Konzerne, die jeglichen rechtsstaatlichen Regelungen widersprechen.
Der Autor demonstriert aber auch, wie Parteien und Politiker unseres Landes ihre Vertretungsbefugnis missbrauchen. Dass die »Volksvertreter« nicht mehr bereit sind, den Willen der Bürgerschaft umzusetzen, führt uns der Autor mit Beispielen wie diesen vor Augen:
- Die Parteien verhindern Volksabstimmungen, wie sie zum Beispiel bei der Einführung des Euro nötig gewesen wären.
- Gemeinsam mit den Medien setzen sie Entscheidungen durch, die mit der öffentlichen Meinung nicht übereinstimmen.
- Sie kontrollieren soziale Medien und setzen sich damit über Meinungsfreiheit und Zensurverbot hinweg.
- Sie bekämpfen die freie Rede mit allen Mitteln der sanften Despotie. Diffamierung ist ein erfolgreiches Herrschaftsinstrument.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
1. Auflage Juni 2017 Copyright © bei: Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Stefanie Huber Lektorat, Satz und Layout: Thomas Mehner, c/o Agentur Pegasus, Zella-Mehlis ISBN E-Book 978-3-86445-482-0 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: info@kopp-verlag.de Tel.: (07472) 98 06-0 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Abkürzungen
Abkürzungen
Die folgenden Abkürzungen benutze ich um der Kürze willen im Text in Klammern mit den Seitenzahlen des Werkes. Bei den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts wie bei anderen Gerichten gibt die erste Zahl den Band an, die zweite Zahl die Anfangsseite, die Zahlen in der weiteren Klammer die Seiten, auf die hingewiesen wird, oder die Randnummer den Absatz der Entscheidung. Die weiteren Klammerhinweise sind aus sich heraus verständlich.
Kant, Immanuel, zitiert aus der Edition von Wilhelm Weischedel, 1968
KrV: Kritik der reinen Vernunft, 1781/1787
Idee: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 1784
GzMdS: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785/1786
KpV: Kritik der praktischen Vernunft, 1788
ÜdG: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, 1793
ZeF: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 1795/1796
MdS: Metaphysik der Sitten, 1797/1798
Rousseau, Jean-Jacques
Cs: Du Contract Social ou Principes du Droit Politique, 1762, Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts
Schachtschneider, Karl Albrecht
StUuPr: Staatsunternehmen und Privatrecht. Kritik der Fiskustheorie, exemplifiziert an § 1 UWG, 1986
Rprp: Res publica res populi. Grundlegung einer Allgemeinen Republiklehre. Ein Beitrag zur Freiheits-, Rechts- und Staatslehre, 1994
PdR: Prinzipien des Rechtsstaates, 2006
FridR: Freiheit in der Republik, 2007
Souveränität: Souveränität. Grundlegung einer freiheitlichen Souveränitätslehre. Ein Beitrag zum deutschen Staats- und Völkerrecht, 2015
Gerichte
BVerfG: Bundesverfassungsgericht mit Urteilsangabe, gegebenenfalls mit Aktenzeichen
BVerfGE: Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Amtliche Sammlung
BVerwGE: Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts, Amtliche Sammlung
BGHZ: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen, Amtliche Sammlung
BGHSt: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, Amtliche Sammlung
OVG: Oberverwaltungsgericht
Alle weiteren Abkürzungen sind meist allgemein bekannt, notfalls bitte ich deren Bedeutung einem allgemeinen oder juristischen Abkürzungsverzeichnis zu entnehmen. Manche sind auch im Text klargestellt.
Hinweis:
Das Buch wurde in der neuen, reformierten Rechtschreibung verfasst. Ausnahmen bilden Zitate, Gesetzes- und Urteilstexte, Buch- und Zeitschriftentitel sowie die Titel von Artikeln, die vor der Rechtschreibreform erschienen sind. Aus Gründen der Authentizität wurden sie in der alten Rechtschreibung belassen.
Vorwort
Vorwort
»Ich wünschte, ein Bürger zu sein«, hat Theodor Mommsen bekannt. Nur in einer Republik, einem Gemeinwesen der gleichen Freiheit, kann man Bürger sein. In der Republik ist jeder Bürger souverän und übt die Staatsgewalt, durch die Verfassung zu einem Volk vereint, mit allen anderen Bürgern gemeinschaftlich aus. Die politische Willensbildung des Bürgerstaates muss demokratisch sein. Die Idee der Freiheit gebietet ein gemeinsames Leben unter eigenen und zugleich allgemeinen Gesetzen. Dieses kann nur in hinreichender Homogenität der Bürgerschaft und in Kleinen Einheiten Wirklichkeit finden. Diese Voraussetzungen der Demokratie gewährleistet eine Nation, wie auch immer diese begründet ist.
Die herrschende Klasse betreibt mit aller Macht die Auflösung der Nationalstaaten, nicht nur mittels der Europäischen Union. Ihr Ziel ist the One World, die civitas maxima. Ein Weltstaat wird eine Herrschaft sein, die wenige Reiche über die vielen vereinzelten Armen ausüben. Widerspruch und Widerstand gegen die Tyrannen wird keine Chance haben. Die wirtschaftliche Globalisierung, als Freihandel beschönigt, ist das Geschäftsmodell des neoliberalen Kapitalismus, der internationale Egalitarismus die moralistische Vision der Sozialisten. Deren geschäftliche und politische Allianz ist vorerst sehr erfolgreich. Der forcierte Multikulturalismus lässt der für die politische Freiheit notwendigen Sittlichkeit, der praktischen Vernunft, keine Chance. Die Bürgerlichkeit wird darin zerrieben. Die Islamisierung Europas droht die jüdisch-christliche Kultur der Aufklärung zu vernichten.
Die nationale Option will ich mit diesem Buch freiheitlich und rechtlich, staats-, völker-, wirtschafts- und sozialrechtlich, ökonomisch und politisch fundieren. Das Buch ist zugleich ein Plädoyer für die Bürgerlichkeit der Bürger, für Freiheit und gegen Herrschaft, für die Republikanität und gegen Autokratie oder Oligarchie, sei diese theokratisch oder parteienstaatlich, für ein gemeinsames Leben der Völker im Recht, national und international.
Ich danke Jochen Kopp für die Aufnahme des Buches in seinen freiheitlich bewährten Verlag und ich danke Thomas Mehner für sein hilfreiches Lektorat.
Ich widme das Buch den deutschen Bürgern, die um eine freiheitliche Alternative der Politik ringen. Diese kann nur national sein.
Berlin, 14. Mai 2017
Karl Albrecht Schachtschneider
Einleitung
Einleitung
IKampf gegen die nationale Ordnung
1. Die Belastbarkeit der deutschen Nationalität ist auf eine schwere Probe gestellt. Sie wird zunehmend brüchig. Die deutsche Nationalität will man nicht nur dem Europäismus, sondern mehr noch dem Globalismus opfern. Sie scheint mit den großen Visionen einer internationalen Politischen Klasse unvereinbar. Der Globalismus wie auch der Europäismus haben zwei heterogene Triebfedern: zum einen das kapitalistische Geschäft, zum anderen den sozialistischen Egalitarismus. Den Kapitaleignern bietet die ökonomische Heterogenität der Völker und Staaten glänzende Verwertungsmöglichkeiten. Sie lassen in den Ländern produzieren, in denen die Arbeit nicht nur kaum etwas kostet, sondern der Ausbeutung der Arbeitskräfte so gut wie keine Hindernisse entgegengestellt werden. Die Produkte werden in den Ländern mit vergleichsweise hohem Wohlstand und damit hohen Preisen vertrieben. Die kostengünstige Transporttechnik macht es möglich.
Dieses Geschäftsmodell nennt man euphemistisch Freihandel, obwohl die wesentliche Voraussetzung komparativer Vorteile fehlt, die Auslastung aller Ressourcen aller an den Geschäften beteiligter Länder. Es ist unechter Freihandel, ein Ausbeutungsmodell. 1› Hinweis Die Gewinnspanne ist hoch. Für eine geringe Besteuerung sorgt der Steuerwettbewerb. Für die Arbeitslosen, deren Arbeitsplätze von den Wohlstandsländern in die Armutsländer verlegt wurden, sorgen die Sozialstaaten, nicht die international agierenden Unternehmen, die sich dieser Lasten zu entziehen wissen.
Der sozialistische Egalitarismus war immer internationalistisch. Die sozialistische Ideologie lässt keine materiellen Unterschiede gelten, nicht national und nicht international. Sie schürt auch und insbesondere den Hass gegen die nationale Option, die Ablehnung der Teilung der Welt in Völker und Staaten. Die internationalistische Ideologie ist das entscheidende Movens für den »Kampf gegen rechts«. 2› Hinweis Diversität ist das Motto. Multikulturalismus soll Lösung sein, koste es auch alle alteuropäischen Errungenschaften, vor allem die der Aufklärung, die bedenkenlos der Islamisierung preisgegeben werden. 3› Hinweis Diese unheilige Allianz bedrängt die Bürger in ihrer Bürgerlichkeit. Aber den Kapitaleignern sind ihre Geschäfte alles. Vorerst werden sie reicher und reicher. Sie werden an ihrem Reichtum ersticken. Die Sozialisten, die ewigen Jakobiner, wittern seit dem Ende der Ordnung des Kalten Krieges Morgenluft für ihren Weltenplan, the One World, die vereinte Menschheit, alles tugendhafte Menschen – unter ihrer Knute.
Die europäische Integration ist von Anfang an als Friedensprojekt propagiert worden. Die Völker Europas waren freilich nach dem Zweiten Weltkrieg und den vielen vorausgegangenen Kriegen der Fürsten in Europa das gegenseitige Töten und das Elend der Kriege endgültig leid. Allein schon der republikanische Impetus der Bürger ließ nur ein friedliches Miteinander der Völker Europas zu. Die Staaten waren nicht einmal fähig, Kriege zu führen, wirtschaftlich nicht und damit militärisch nicht, schon gar nicht das besiegte und gedemütigte Deutschland. Vor allem aber hatte die neue Weltmacht, die Vereinigten Staaten von Amerika, über Krieg und Frieden zu bestimmen. Erst der Kalte Krieg mit der Sowjetunion hat notgedrungen eine Kriegsvorbereitung erzwungen. Wesentlich als wirtschaftliches Bollwerk gegen die Sowjetunion ist die Europäische Gemeinschaft eingerichtet worden. Seit dem Zusammenbruch des Sowjetreiches hat die Europäische Union mit der Weltlage ihre Agenda allmählich verändert. Sie führt das Experiment eines entnationalisierten Großstaates durch, als Beispiel für einen künftigen Weltstaat, die angestrebte One World der globalen Oligarchie aus Kapitalisten und Sozialisten. Diese civitas maxima ist sicher kein Modell des ewigen Friedens.
Die Vereinigung der Staaten Europas kann durchaus dem Frieden dienen, wenn sie das Recht verwirklicht. Aber die Europäische Union ist das ersehnte Friedensmodell nicht. Die Europäische Union ist nicht freiheitlich, nicht demokratisch, nicht rechtsstaatlich und nicht sozial. Das wird in dieser Schrift näher dargelegt. Mittlerweile schürt sie Hass und Missgunst. Die Union ist auf Herrschaft einer »elitären« Politikerkaste über die Europäer angelegt, auf einen vormundschaftlichen Großstaat, der über Hunderte von Millionen Untertanen in egalitärer Armut gebietet. Sie ist politisch und ökonomisch gescheitert, aber wird mit allen Mitteln der Agitation und Propaganda, aber auch und wesentlich mit der Macht des Geldes von ihren Nutznießern verteidigt. Notfalls wird sie auf militärische Maßnahmen zurückgreifen, immer das wirksamste Mittel, um den Zerfall von politischen Herrschaftssystemen zu verhindern. Gründe dafür sammeln sich mehr und mehr an. Die innere Sicherheit der Mitgliedstaaten ist durch den Krieg mit dem Islam ruiniert, geradezu vorsätzlich durch Grenzöffnungen und Zuwanderung in die europäischen Länder geholt. Die vertraglichen Grundlagen für militärische Befriedung, als Polizeimaßnahmen verschleiert, sind längst geschaffen, einschließlich der Befugnis zum Töten und des Einsatzes der Todesstrafe.
Bekanntlich hatten auch andere Unrechtsstaaten wie die Sowjetunion jahrzehntelang Bestand, obwohl sie von vornherein ökonomisch zum Scheitern verurteilt waren und die Menschen in ihrem Machtbereich erbarmungslos unterdrückt hatten. Den Bestand der Europäischen Union hält derzeit mühsam die Europäische Zentralbank mit durchgehend vertrags- und verfassungswidrigen Maßnahmen aufrecht. Nach der Wahl 2017 in Deutschland wird man mittels einer verstärkten Sozialunion die Mehrheit der Mitgliedstaaten veranlassen, gegen alle Neigungen in der Union zu verharren. Dann bleibt den Völkern nur, den Briten zu folgen und aus der Union auszuscheiden. Den Deutschen wird vorsichtshalber nach wie vor, entgegen Art. 20 Absatz 2 des Grundgesetzes, der Volksentscheid über die wirklich wichtigen Fragen der Politik, die der Bund entscheidet, verwehrt. Der Austritt aus der Europäischen Union ist bittere Notwendigkeit, weil nicht zu erwarten ist, dass die Union sich revolutioniert, das heißt zum Recht befreit. Ein echter Bundesstaat der europäischen Völker, ein Modell des Friedens, sollte die Finalität eines Vereinten Europas sein.
2. Der Staat hat keine Vollmacht, die nationale Homogenität des Staatsvolkes zu verändern, wenn sich das Volk nicht in seiner Verfassung für eine die Nationalitäten übergreifende Staatlichkeit erklärt. Deutschland hat sich durch Art. 24 Abs. 1 GG und nunmehr erweitert durch Art. 23 GG weitgehend für eine gemeinschaftliche Staatlichkeit, für »supranationale Organisationen« einer »internationalen oder europäischen Friedensordnung«, durch »zwischenstaatliche Einrichtungen« (BVerfGE 89, 155 [182ff.], Maastricht-Urteil; BVerfGE 123, 267, LS 4, Rnn. 219, 225, 237 u. ö., Lissabon-Urteil) beziehungsweise in einer »Europäischen Union« entschieden, denen »Hoheitsrechte … übertragen« werden dürfen (BVerfG a. a.O.). 4› Hinweis Art. 23 GG ist die Grundlage der Europäischen Union. Das Bundesverfassungsgericht spricht fragwürdig von »supranationalen Organisationen« (a. a.O.). Die deutsche Staatlichkeit aufzugeben verbietet aber Art. 20 GG, der wegen Art. 79 Abs. 3 GG allenfalls durch eine neue Verfassung Deutschlands für ein zum Staat im existenziellen Sinne vereintes Europa geöffnet werden darf, durch die Deutschland die Souveränität seiner Bürgerschaft, des deutschen Volkes, ganz oder zum Teil aufgibt. 5› Hinweis Auch in ein »System gegenseitiger kollektiver Sicherheit« darf sich der Bund »zur Wahrung des Friedens … einordnen« und dafür in Beschränkungen seiner Hoheitsgewalt einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern (Art. 24 Abs. 2 GG). »Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten« darf der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten (Art. 24 Abs. 3 GG).
Das grundgesetzliche Prinzip der deutschen Staatlichkeit, das ausweislich der ursprünglichen Präambel – »Vom Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren (…) hat das Deutsche Volk in den Ländern (…) kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz (…) beschlossen« – national zu verstehen ist, verbietet ohne neue Verfassung die Entwicklung Deutschlands zum Einwanderungsland, 6› Hinweis wie in Teil 4 in Kapitel 4 noch näher dargelegt werden wird.
Den »beseelten Willen«, die »nationale Einheit« zu wahren, hat die verfassungsfälschende neue Präambel des Grundgesetzes nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 verschwiegen, ein schwerer Tort des damaligen verfassungsändernden Gesetzgebers, »befehligt« vom Bundeskanzler Helmut Kohl, gegen Deutschland und gegen das deutsche Volk. Der Verfassungsbruch war aber wegen Art. 79 Abs. 3 GG nicht wirksam. Die Staatsorgane, welche eine Verfassungsentscheidung des Volkes, die Identität der Verfassung (so BVerfGE 123, 267 Rnn. 219, 235ff., 249; BVerfG BvR 2728, 2729/13, Urteil vom 21. Juni 2016, Rnn. 120f., 137, 142ff., 153ff., 170ff., 188, 210) missachten, vermögen das Volk nicht zu verpflichten. Das gilt auch für den verfassungsändernden Gesetzgeber, wie die Unabänderlichkeitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG für die Art. 1 und 20 GG klarstellt. Diese Artikel verankern das Deutsche Deutschlands in der Verfassung der Deutschen. 7› Hinweis
Dass etliche Bürger die kulturelle Vielfalt begrüßen, rechtfertigt noch keine Staatspolitik der Entnationalisierung des Volkes, das eine nationale Verfassung hat. Kulturpluralismus ist das Gegenprinzip zur kulturellen Homogenität. 8› Hinweis Er würde in Deutschland die nationale Identität, immerhin ausweislich Art. 4 Abs. 2 EUV ein Prinzip der Europäischen Union (BVerfGE 123, 267 Rnn. 234, 304), und damit die deutsche Republik beenden.
»Das deutsche Volk ist auch als Kulturgemeinschaft vom Verfassungsgeber vorgefunden.« 9› Hinweis
– Paul Kirchhof
Gegen die Rechtsordnung kann sich keine Kultur entfalten. Die Rechtsordnung ist essenzieller Teil der Kultur, wenn der Kulturbegriff die Gesamtheit der Lebensverhältnisse erfasst. Fraglos wird der Begriff der Kultur auch für Elemente des Lebens benutzt, die sich im Rahmen der Rechtsordnung entfalten, meist als res privata. So gibt es unterschiedliche Ess- und Trinkkulturen in fast jedem Land. Die können multikulturell sein. Das ist ohne größere politische Relevanz, wenn auch insofern der Gesetzgeber Vorschriften machen kann und zu machen pflegt. Der Islam kennt etwa das Verbot, Schweinefleisch zu essen, dessen Verzehr in Deutschland nicht nur nicht verboten, sondern üblich ist. Im Kantinenwesen führt das zu Auseinandersetzungen und fragwürdigen Rücksichtnahmen, weil das Verbot religiös begründet wird. Viele Elemente der Kultur als gesamtheitlicher Begriff stehen rechtlich zur Disposition der Bevölkerung, viele aber auch nicht. Insofern kommt ein Multikulturalismus aus Rechtsgründen nicht in Betracht. Alle Bewohner des Landes müssen sich der Rechtsordnung fügen, welche die Bürger des Staates hervorgebracht haben.
Eine Politik der Veränderung des deutschen Volkes, also eine Einwanderungspolitik, durch die das Deutsche Deutschlands überwunden wird, ist mit der Souveränität der Deutschen unvereinbar. Die hinreichende Homogenität der Bürgerschaft ist Voraussetzung einer Republik als freiheitlichem Gemeinwesen. Anders finden demokratische Strukturen keine Wirklichkeit. Am besten wäre eine aufklärerische Homogenität der Staatsangehörigen, sodass andere Merkmale, wie etwa die Religion, irrelevant würden. Aber davon entfernen sich die Völker Europas zusehends. Einwanderungspolitik würde zumindest eine Verfassungsentscheidung der Deutschen durch Volksabstimmung voraussetzen. Auch eine solche Entscheidung ließe Bedenken entstehen, weil sie eine Mehrheitsentscheidung wäre, welche die Verfassung, die mit den Deutschen geboren ist, nämlich Deutsche in Deutschland zu sein und zu bleiben, aufheben würde.
Die vermeintliche Postmoderne, ein Bündnis der kapitalistischen Plutokraten mit den egalitaristischen Sozialisten, beide menschenverachtende Unterdrücker der Völker, will einen Weltstaat, the One World, durchsetzen und bekämpft mit allen Mitteln der Diffamierung die Nationalität, obwohl diese für eine freiheitliche Demokratie unverzichtbar ist. Als geeignete Ideologie haben ihre Protagonisten den antirepublikanischen Islam erkannt. Darüber hilft keine Habermas’sche postdemokratische Zivilgesellschaft hinweg, die ebenso demokratiefern wie rechts- und sozialstaatsvergessen ist. Die Souveränität der Bürger und Völker muss mit aller Kraft zur Geltung gebracht werden, wenn die Völker Europas wieder in Freiheit leben wollen. Es heißt wieder einmal, den aufrechten Gang zu üben. Ohne innere Souveränität jedes einzelnen Bürgers, ohne dessen Sittlichkeit also, ist die Republik ohne Chance. Die Bürgerlichkeit der Bürger ist das große Defizit des Deutschlands unserer Tage. 10› Hinweis
Dem zuwider betreibt die politische und mediale Klasse seit einiger Zeit sogar eine Veränderung der Bevölkerung Deutschlands, indem eine Massenzuwanderung, legal oder illegal, zugelassen wird, um die kulturelle Homogenität der Deutschen zugunsten eines »Multikulturalismus« aufzulösen. 11› Hinweis Der radikalste Angriff auf das Deutsche Deutschlands ist die These von den »neuen Deutschen«. Das frühere homogene Deutsche gäbe es nicht mehr. Die Pluralität der Bevölkerung, deren Vielfalt oder Diversität, mache den neuen Deutschen aus. Ein Volk ist diese diverse Bevölkerung nicht. Eine wesentliche Voraussetzung freiheitlicher Demokratie und Rechtlichkeit, nämlich die Homogenität, fehlt dieser Bevölkerung. Sie muss um des inneren »Friedens« willen mit harter Hand beherrscht werden. Das ist der Parteienoligarchie sicher genehm. Denn diese heterogene Bevölkerung tendiert zum Bürgerkrieg, zumal die große Scheide zwischen den alteuropäischen Kulturchristen und den neueuropäischen islamischen Muslimen verläuft. Die Bevölkerung Deutschlands sind nicht mehr nur deutsche Deutsche. Sie besteht aus Parallelgesellschaften, die untereinander keine Loyalität und Solidarität empfinden.
Die Muslime sind zuvörderst der Umma, der weltweiten Gemeinschaft der Muslime, verpflichtet. Die Verfassung, die mit ihnen geboren ist, ist die Scharia, in der Allah den rechten Weg vorgibt. Dagegen vermag Deutschland das Grundgesetz, das Verfassungsgesetz der Altdeutschen, das deren Persönlichkeit, deren Verfassung, die mit ihnen geboren ist, gemäß ist, nicht durchzusetzen. Es hat das bereits weitgehend aufgegeben. Zur gewaltsamen Verwirklichung der grundgesetzlichen freiheitlichen demokratischen Ordnung ist die politischen Klasse Deutschlands, längst islamisch durchsetzt, nicht bereit, ganz im Gegensatz zu den islamischen Neudeutschen, nicht allen, aber hinreichend vielen. Das genügt. Den Altdeutschen bleibt nur die Unterwerfung, wie sie Michel Houellebecq beschrieben hat; 12› Hinweis denn ihnen wird keine Chance zum Widerstand gegeben. Erstmalig geht es wirklich um die Abschaffung nicht Deutschlands, sondern des Deutschen. Selbst einst der Wissenschaft verpflichtete Professoren passen sich eifrig an. 13› Hinweis
Gegen einen, wie ich es nennen möchte, Alltagsmultikulturalismus ist wenig einzuwenden. Den gab es immer. Er wird in der Kunst, Literatur, Musik, Malerei, Bildhauerei, Baukunst, Filmerei usw., in der Gestaltung des Alltags, beim Essen, Trinken, in Sport und Unterhaltung usw. und auch in der Religion als Religionspluralismus seit eh und je mehr oder weniger gelebt. Es geht um die politische Kultur, welche die Rechtsordnung bestimmt. Es geht um das freiheitliche Gemeinwesen, um die Republikanität der Lebensverhältnisse, die diesen sanften Multikulturalismus überhaupt erst ermöglicht. Unter dem verschleiernden Begriff des Multikulturalismus dringt ein politisches System in Deutschland und Europa ein, das die freiheitliche Ordnung nicht zu leben fähig ist, der Islam. Er ist ein politisches System, das sich auch als Religion versteht und damit eine Verbindlichkeit beansprucht, die für Muslime unüberwindlich ist: »Der Islam ist die Lösung«, für alle Probleme der Welt. 14› Hinweis Solange die Muslime sich an die Rechtsordnung im Haus des Vertrages halten, die definitionsgemäß noch nicht islamische Staaten sind, aber die Chance bieten, das zu werden, mag man das religiöse Leben der Muslime zum religionspluralistischen Multikulturalismus ordnen. Aber dabei soll und wird es nicht bleiben, weil das den Geboten des Islam widerspricht, der alle Muslime zum Dschihad, also zur Ausbreitung der Umma über die ganze Welt, verpflichtet. 15› Hinweis Der Islam ist entgegen seiner von vielen Förderern dieses vermeintlichen Multikulturalismus verstärkten Propaganda nicht tolerant. 16› Hinweis Hinter dem Multikulturalismus verbirgt sich der harte Kampf der Kulturen. 17› Hinweis Der Islam nutzt die liberalen »Schwächen« des Pluralismus des Westens für seinen Kampf um die Weltherrschaft der Umma.
Die Rechtsordnung ist in ihren Grundlagen der wichtigste Teil der Kultur. Die freiheitliche demokratische Ordnung jedenfalls Deutschlands steht nicht zur Disposition. Sie ist nach dem Grundgesetz wirksam zu verteidigen, von allen Bürgern und allen Einrichtungen des Staates. Die Politik, die die freiheitliche demokratische Grundordnung Deutschlands vor allem durch illegale Massenzuwanderung von Muslimen gefährdet, verbindet sich mit dem Namen der langjährigen Bundeskanzlerin Angela Merkel, ohne dass sie allein dafür verantwortlich wäre. Sie bricht die Verfassung der Deutschen in den unveränderlichen Prinzipien, 18› Hinweis auch in dem Verfassungsprinzip des Deutschen Deutschlands.
Dieses Rechtsprinzip gehört nicht nur zur durch Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Identität des Grundgesetzes, die auch der verfassungsändernde Gesetzgeber unberührt lassen muss, sondern zur Identität der Deutschen, die auch nicht zur politischen Disposition eines neuen Verfassungsgesetzes steht. Die Deutschen sind als Deutsche geboren und haben ein Recht, in einem deutschen Staat zu leben. Dieses Recht ist mit ihnen geboren. Noch gibt es die spezifisch nationale Homogenität der Deutschen in ihrer großen Mehrheit. Der Kampf um diese Homogenität bestimmt die gegenwärtige Politik. Der innere Frieden ist durch die zunehmende Islamisierung Deutschlands gefährdet. Die islamischen Terrorakte in Deutschland und in anderen Ländern auch Europas sprechen für sich.
IIFreiheit als Weltrechtsprinzip
Der republikanische Freiheitsbegriff, den Kant entwickelt hat, ist der der Deutschen und der des Grundgesetzes, nämlich in Art. 2 Abs. 1. Dieser lautet:
»Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.«
Er steht nicht nur im Grundgesetz, er ist das Weltrechtsprinzip an und für sich. Ich will keineswegs dem Universalismus der Menschenrechte als einer Rechtfertigung humanitärer Intervention das Wort reden. Mögen andere Länder politisch ihren Religionen folgen. Ich spreche erst einmal von Deutschland und weiter von den Ländern, die sich der Freiheit verpflichtet haben. Ich scheue mich aber nicht zu sagen, dass die Ethik der Freiheit universalistisch ist. Ethik ist die Lehre von der Freiheit, weil das Sollen in der Freiheit gründet, allein in der Freiheit. Fast alle Völker haben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 zugestimmt, dessen Artikel 1 diese Ethik klassisch formuliert:
»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.«
Die gelungene Formel der aufgeklärten Freiheitslehre fasst die kantianische Ethik in wenigen Worten zusammen. Das deutsche Grundgesetz fußt auf dieser Erklärung. Die Deutschen mussten ihr nach dem verlorenen Krieg folgen, sind ihr aber auch aus Überzeugung gefolgt, weil der kategorische Imperativ das menschheitsbestimmende Prinzip ist, das ein deutscher Philosoph, freilich der bedeutendste, gedacht und formuliert hat. Die meisten deutschen Staatsrechtslehrer und erst recht die große Menge der Juristen in Deutschland können im Gegensatz zu den Lehrern der Philosophie mit dem Sittengesetz nichts anfangen, weil die erforderlichen Kant-Studien ihnen zu viel Mühe machen. Hauptgrund der Vernachlässigung des Sittengesetzes in dem politischen und rechtlichen Diskurs ist jedoch, dass das Bundesverfassungsgericht und die sonstige Rechtsprechung den Begriff auf eine materiale Sittlichkeit, etwa den der guten Sitten, minimierten (BVerfGE 6, 389 [434ff.]; 49, 286 [299]; BGHSt 5, 46 [52ff.]; BGHZ 5, 76 [97]; in der Sache auch BVerwG NJW 1982, 664f.; kritisch FridR, S. 266ff.), obwohl sie die praktische Vernunft, das Gebot des Sittengesetzes, stetig praktizierten, als Verhältnismäßigkeitsprinzip nämlich, als das uralte Rechtsprinzip der rechten Maßes.
Diesem philosophischen, weltrechtlichen, allein richtigen und zudem grundgesetzlichen Freiheitsbegriff sind andere Begriffe entgegengesetzt worden, die unsere politische Wirklichkeit bestimmen, nämlich der liberalistische Freiheitsbegriff (kritisch Rprp, S. 441ff.; FridR, S. 343ff.), der auch den Neokapitalismus trägt. Er beruht auf der Herrschaftspraxis und stellt dieser klägliche Rechte des Untertanen, genannt Grundrechte, gegenüber.
Das nationale Prinzip kann sich als Prinzip des Rechts, des Staatsrechts und des Völkerrechts, nur behaupten, wenn es durch die Freiheit geboten ist. Die folgende Lehre entwickelt das nationale Prinzip als ein solches Prinzip der Freiheit. Herrschaftliche Nationalstaaten, die es in Europa und in der übrigen Welt gab und gibt, haben das nationale Prinzip in Verruf gebracht. Die Identifizierung der Menschen mit sich selbst, die der Natur des Menschen entspricht, der sich zunächst mit sich selbst, mit seiner Familie, mit seinem Dorf, mit seiner Stadt, mit seinem Land, mit seinem Beruf, mit seiner Religion, mit seinem Staat, mit allem, was Nähe zu ihm hat, identifiziert, lässt sich trefflich für mancherlei Zwecke einsetzen, wenig anständig etwa für die Absatzwerbung, und sie lässt sich für die Stabilisierung von Herrschaft missbrauchen und wurde und wird meist dafür missbraucht. Identifizierung war und ist ein wesentliches Instrument der Macht, wenn nicht neben der Gewaltsamkeit das wichtigste. Demgemäß war und ist die politische Machtentfaltung, sei es in einem Staat nach innen als Herrschaft, also Despotie, wenn nicht gar als Tyrannis, wie nach außen gegen andere Völker und Staaten als Imperialismus, regelmäßig mit dem Missbrauch nationaler Identifikation verbunden. Der Grund aber ist die illegitime und illegale Herrschaft von Menschen über Menschen, die als eine Todsünde der Menschheit, nämlich geboren aus Habsucht und Maßlosigkeit, nur schwer Grenzen respektiert, nicht die Natur des Menschen zur Identifikation mit dem Seinen. Den Menschen diese Identifikation aberziehen oder gar verbieten zu wollen, ist selbst eine herrschaftliche Politik, die menschheitswidrige Zwecke verfolgt, meist eine andere Form von Herrschaft oder die Macht anderer Herrscher, jedenfalls nicht die Verwirklichung der Freiheit der Menschen. Wer die Freiheit verwirklichen will, muss die Menschen so nehmen, wie sie sind, in ihrer Dualität als homines phaenomenoi und als homines noumenoi, als fehlbare, von Neigungen bestimmte Wesen, nach aller Erfahrung der Freiheit nicht fähig, und zugleich als Vernunftwesen, deren Idee die Freiheit ist, wie das Kant mit der Dritten Antinomie in seiner Kritik der reinen Vernunft entwickelt hat (KrV, S. 426ff.; auch KpV, S. 222ff., 230ff., 243ff.; FridR, S. 36ff.).
Es gibt kein Recht ohne Freiheit, wie dargetan werden wird, und es gibt somit auch keinen Frieden unter den Völkern ohne Recht. Grundlage aller politischen Philosophie muss mithin die Freiheit sein. Die Frage ist: Kann es freiheitliche Gemeinwesen, Republiken, ohne die nationale Option geben? Meine Antwort ist: Nein. Der Republikanismus, der jedenfalls in Deutschland noch nie ernsthaft erprobt wurde, kann nicht mit geschichtlichen Katastrophen bekämpft werden, deren Grund Herrschaft und gerade nicht Freiheit war. Die freiheitsferne Unterdrückung der nationalen Option sollte niemanden entmutigen, der nach der politischen Form sucht, welche den Menschen und Völkern den »ewigen Frieden« zu bringen vermag, schon gar nicht, wenn die »Argumente« von denen kommen, die eine groß- oder gar weltstaatliche Tyrannis aufzubauen bemüht sind, meist aus niedrigen Beweggründen, wie dem der Macht und dem des Geschäftes, oft aus Weltfremdheit, der moralistischen Propaganda erlegen. Immanuel Kant hat in seiner Friedensschrift den Weg aufgezeigt. Der Erste Definitivartikel behandelt die Republikanität der Staaten, die auf Freiheit gründet: »Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein« (S. 204). Kants einleitende Sätze sind die Grundlage jeder Lehre, die zum Frieden führen soll; denn Frieden ist die allgemeine Freiheit. Sie lauten:
»Die erstlich nach Prinzipien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft (als Menschen); zweitens nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung (als Untertanen); und drittens, die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben (als Staatsbürger) gestiftete Verfassung – die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrages hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks gegründet sein muß – ist die republikanische« (ZeF, S. 204).
Die kantianische Freiheitslehre ist darzulegen, wenn das Plädoyer für die nationale Option nicht missverstanden werden soll.
Teil 1: Bürgerliche Freiheitslehre
Teil 1Bürgerliche Freiheitslehre19› Hinweis
Kapitel 1: Freiheit versus Herrschaft
Kapitel 1
Freiheit versus Herrschaft
Das monarchische Prinzip, das für den Konstitutionalismus ausweislich Art. 7 der Wiener Schlussakte des Deutschen Bundes als Leitprinzip der Verfassungen der Länder bestimmend war, ist durch die Revolutionen des Jahres 1918 in Deutschland und auch in Österreich beseitigt worden. Das monarchische Prinzip war ein Herrschaftsprinzip, aber es gibt in der Republik keinerlei Rechtfertigung für Herrschaft; denn Herrschaft ist das Gegenteil der Freiheit (Rprp, S. 71ff.; FridR, S. 115ff.; Souveränität, S. 247). Es gibt nach wie vor Herrschaft, aber das ist Unrecht. Das begreift die deutsche Staatsrechtslehre nicht, das Bundesverfassungsgericht schon gar nicht. Kein Urteil dieses Gerichts hat so oft das Wort Herrschaft benutzt wie das Lissabon-Urteil vom 30. Juni 2009 (Rnn. 213, 217ff., 250, 263, 268, 270, 272, 280, 294 u. ö.). Es ist noch nicht gelungen, dieses suggestive Wort und diesen diffusen Begriff aus den Köpfen der Staatsrechtslehrer und erst recht der Politiker zu drängen. Letztere sind sehr einverstanden damit, dass sie, scheinbar sogar demokratisch legitimiert, andere beherrschen, weil der Staat nun einmal ein Herrschaftsgebilde sei. Du sollst über einen anderen nicht herrschen wollen, hat ein bedeutender österreichischer Staatsrechtslehrer aus Salzburg postuliert, der leider viel zu jung durch ein Flugzeugunglück umgekommen ist, René Marcic. 20› Hinweis Auch einige wenige andere wussten das, etwa der Politikwissenschaftler Dolf Sternberger. 21› Hinweis Herrschaft ist der Gegenbegriff zur Freiheit. Max Weber hat die Herrschaft bekanntlich als die Fähigkeit definiert, den eigenen Willen auch gegen den widerstrebenden Willen eines anderen durchzusetzen. 22› Hinweis
Die Republik ist demgegenüber die Staatsform der allgemeinen Freiheit. Freiheit muss aber republikanisch verstanden werden, sonst kann das Republikprinzip nicht verwirklicht werden. Praktiziert wird ein liberalistisch irregeleiteter Freiheitsbegriff. Dieser steht hinter dem neoliberalen Kapitalismus, der auf diese Weise eine Stütze in fragwürdiger Rechtslehre findet. Ein Freiheitsbegriff, der nicht mehr leistet, als Herrschaft in Grenzen zu weisen, dogmatisiert lediglich Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat und verfehlt sowohl das demokratische Prinzip als auch die politische Form der Republik (Rprp, S. 441ff.; FridR, S. 243ff.). Mit dem liberalistischen Freiheitsverständnis, das Herrschaft nicht nur voraussetzt, sondern geradezu legitimiert, begnügt sich aber die europäische Integrationsentwicklung. Sie fällt damit in den vom monarchischen Prinzip gekennzeichneten Konstitutionalismus der Trennung von Staat und Gesellschaft zurück (Rprp, S. 159ff.; FridR, S. 207ff.). Freiheit muss rousseauisch und kantianisch begriffen werden, wenn der Begriff der Freiheit der Würde des Menschen und der Gleichheit aller in der Freiheit gerecht werden soll.
Die repräsentative Ausübung der Staatsgewalt wird vom Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 2, 1 [12f.]; 83, 37 [52]); 83, 60 [72]; 89, 155 [188ff.]; 95, 1 [15]; 123, 267 Rn. 213, 217ff., 250, 263, 268, 270, 272, 280, 294; 129, 124 Rn. 98) und fast der gesamten Staatsrechtslehre 23› Hinweis als Herrschaft (Kritik Rprp, S. 71ff.; FridR, S. 115ff.) oder gar Herrschaftsgewalt hingestellt.
Carl Friedrich von Gerber hat 1865 die Staatsgewalt mit der Beherrschung identifiziert. 24› Hinweis Georg Jellinek definiert im Jahre 1900: »Herrschergewalt hingegen ist unwiderstehliche Gewalt. Herrschen heißt unbedingt befehlen und Erfüllungszwang üben können.« »Herrschen ist das Kriterium, das die Staatsgewalt von allen anderen Gewalten unterscheidet.« 25› Hinweis Hermann Heller folgt: »Herrschen heißt Gehorsam finden, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der Gehorchende den Befehlen innerlich zustimmt oder nicht, vor allem unabhängig von der vom Gehorchenden vorgestellten Interessenförderung.« »Herrschaft bleibt aber immer eine Relation zwischen zwei Willen, Motivation des einen Willens durch den anderen; …« »Herrschen heißt: mit eignen Mitteln Fügsamkeit finden, gegebenenfalls den Gehorsam mit eignen Mitteln erzwingen können.« 26› Hinweis Fast alle orientieren ihren Herrschaftsbegriff, wenn sie überhaupt einen nennen, an Max Webers Begriff: »Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden.« 27› Hinweis Carl Schmitt hat die Entscheidung der Weimarer Verfassung für die Demokratie als Entscheidung für die Herrschaft des Volkes, nicht freiheitlich, sondern gleichheitlich, das heißt durch Führer und Akklamation, die liberal-rechtsstaatlich, also bürgerlich, durch den Schutz einer privaten Sphäre gemäßigt sei, verstanden. 28› Hinweis
Die deutsche Staatsrechtslehre schreibt, wenn nicht von Georg Jellinek, dann von Carl Schmitt ab, anstatt Immanuel Kant, den wegweisenden Freiheits- und Rechtslehrer und geistigen Vater des Grundgesetzes, und dessen besten Schüler Karl Jaspers zu studieren. Die Herrschaftsideologie hat im Modernen Staat Hegel nicht nur begründet, sondern tief in das Denken und Fühlen deutscher Eliten eingesenkt, mit verheerenden Wirkungen. Oboedientia facit imperantem ist die soziologisch richtige Erkenntnis. Faktizität ist nicht schon Recht. Aber ein Bürger gehorcht nicht, sondern folgt dem Gesetz; denn das ist auch sein Wille, als Vernunftwesen. Die rechtliche Gesetzlichkeit des gemeinsamen Lebens ist das Ethos der Freiheit. Es gibt keine Legitimation von Herrschaft, denn alle Menschen sind frei geboren.
Das Bundesverfassungsgericht führt im Lissabon-Urteil zu Randnummer 231 aus:
»Die Ermächtigung zur Übertragung von Hoheitsrechten auf die Europäische Union oder andere zwischenstaatliche Einrichtungen erlaubt eine Verlagerung von politischer Herrschaft auf internationale Organisationen.«
Das ist ein Satz, der weder mit der Freiheit noch mit der Souveränität des Volkes, welche das Gericht stetig hervorhebt, vereinbar ist. Der Staat ist kein Herrschaftsgebilde. Diese unter dem Grundgesetz niemals begründete Behauptung ist eine folgenreiche Verzerrung der Republik als freiheitlichem Gemeinwesen, der politischen Form der Freiheit (FridR, S. 115ff.). Dass sich der Parteienstaat oft, wenn nicht meist, herrschaftlich, ja diktatorisch gebärdet, wie gegenwärtig zunehmend die der Europäischen Union verpflichtete Bundesrepublik Deutschland, ändert nichts an der Dogmatik des freiheitlichen Staates, der Republik. Das ist vielmehr Missbrauch der Vertretungsbefugnis der Amtswalter, welche die Bürger nicht hinnehmen dürfen. Die Freiheit ist mit dem Menschen geboren. Sie ist nicht irgendeiner änderbaren Politik zu danken. Vielmehr muss der Staat die Verfassung der Freiheit durch sein Verfassungsgesetz und seine Gesetze bestmöglich der Lage gemäß verwirklichen (dazu Rprp, S. 71ff., FridR, S. 115ff.).
Eine Verfassung, welche die Ethik der Freiheit verbindlich macht, muss und kann uns niemand geben. Diese Verfassung ist mit uns geboren. Wir sind Menschen und haben deswegen Würde. »Die Würde ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt«, stellt Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG klar. Sie wird durch die »unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt« materialisiert, zu denen sich nach Art. 1 Abs. 2 GG das deutsche Volk bekennt. Die Menschenwürde ist ausweislich ihrer Unantastbarkeit nur transzendentalphilosophisch zu begreifen, nämlich als die Fähigkeit des Menschen zur praktischen Vernunft, die ihm, weil sie eine Idee ist, nämlich die Idee der Freiheit (KrV, S. 324ff., 335 ff., 426ff., 488ff., 492ff., 495ff., 671ff., 676ff.; GzMdS, S. 67f.; FridR, S. 36ff.), niemand nehmen kann.
Untrennbar mit den Menschenrechten oder mit der Menschlichkeit oder der Menschheit des Menschen verbunden ist ein politisches System, das dem gerecht wird. Ein solches System ist eine Republik. Diese republikanische Verfassung gibt uns kein Politiker, sondern steht uns zu, weil wir Menschen sind. Aber die Verfassungsgesetze, die nähere Materialisierung der Verfassung, sind eine Gestaltungsaufgabe, welche der jeweiligen Lage gerecht werden muss. Die Verfassung ist etwa das, was unabänderlich im Grundgesetz steht, jedenfalls so stehen sollte. Sie ist die Grundlage all der Prozesse, die ich in Sachen Europapolitik führe.
Kapitel 2: Gleichheit in der Freiheit
Kapitel 2
Gleichheit in der Freiheit
IFreiheit des Bürgers
Die Französische Revolution war eine Zeitenwende. Sie hat einen Bürgerstaat zu schaffen versucht und demgemäß eine bürgerliche Freiheitslehre hervorgebracht. Freiheit definiert die Erklärung des Menschen und des Bürgers von 1789 als das Recht, »alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet: die Ausübung der natürlichen Rechte jedes Menschen hat also nur die Grenzen, die den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuß ebendieser Rechts sichern«. »Diese Grenzen können nur durch das Gesetz bestimmt werden« (Art. 4). Was ein Schaden ist, bestimmen somit die Gesetze. »Das Gesetz hat nur das Recht, solche Handlungen zu verbieten, die der Gesellschaft schädlich sind« (Art. 5 S. 1). »Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens.« »Alle Bürger sind berechtigt, persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitzuwirken« (Art. 6 S. 1 und 2, Art. 4). Das Geniale dieser Erklärung, die, philosophisch von Rousseau vorbereitet, weitgehend Abbé Sieyès, dieser beraten von Kant, formuliert hat, ist die Verbindung dieser Freiheitsformel mit dem Prinzip des Gesetzes als dem allgemeinen Willen, der volonté générale. Vieles empfindet man als schmerzlich, und trotzdem ist es nach dem Rechtsprinzip kein Schaden. Die französische Definition erfasst die äußere Freiheit, nicht auch die innere, die Sittlichkeit. Kant hat die Freiheitslehre vertieft und die innere Freiheit als Tugendpflicht hinzugefügt.
Nach Kant ist die äußere Freiheit als die »Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür« »dieses einzige, ursprüngliche, jedem Menschen, kraft seiner Menschheit, zustehende Recht, sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann« (MdS, S. 345; dazu FridR, S. 67ff.). Freiheit verwirklicht sich in der Sittlichkeit, deren Triebfeder die Moralität ist (dazu FridR, S. 83ff.). Das Gesetz der Freiheit als der Autonomie des Willens (GzMdS, S. 63ff.; KpV, S. 144ff.) ist das Sittengesetz, der kategorische Imperativ (GzMdS, S. 43ff.; KpV, S. 142ff.). Weil Freiheit die Unabhängigkeit von der Natur des Menschen ist, nämlich eine Kategorie der Vernunft, ist der Wille aus sich selbst heraus Gesetz und somit Freiheit nichts anderes als die Autonomie des Willens (GzMdS, S. 74ff., 81ff.).
Es gibt keine innere Freiheit ohne äußere Freiheit, aber die äußere Freiheit findet ohne innere Freiheit, das heißt Sittlichkeit und Moralität, keine Wirklichkeit (FridR, S. 67ff., 83ff.). Die Freiheit hat darin ihre innere Bestimmtheit, nämlich das Rechtsprinzip, die Sittlichkeit oder praktische Vernunft. Rechtsprinzip, Sittlichkeit und praktische Vernunft sind aber nicht beschränkbar. Sie können nur verwirklicht oder missachtet werden. Sie werden durch allgemeine Gesetze und persönliche Maximen des Handelns verwirklicht, welche dem Recht genügen. Freiheit verwirklicht sich im vernünftigen Handeln jedermanns, also in der Praxis der Vernunft (FridR, S. 83). Diesen Begriff der Freiheit kann man als Beschränkung der äußeren Freiheit, der Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür, durch die innere Freiheit, deren Gesetz das Sittengesetz, der kategorische Imperativ, das Liebesprinzip ist, erfassen. Besser ist die Sittlichkeit als die Bestimmung der Freiheit zu verstehen. Die äußere und die innere Freiheit lassen sich nicht trennen. Sie bedingen einander, weil die Freiheit allgemein und gleich ist. Nur wer die Freiheit mit dem Recht verwechselt, zu tun und zu lassen, was beliebt, eine liberalistische Freiheit (dazu Rprp, S. 441ff., FridR, S., 343ff.), die es nicht gibt und die es unter Menschen mit gleicher Freiheit nicht geben kann, kann in den Gesetzen Schranken der Freiheit sehen. Liberalistische Grundrechte, die der Untertan der Obrigkeit entgegenhalten kann, um die Obrigkeit konstitutionalistisch einzuschränken, sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat (BVerfGE 7, 198 [204]). Der Mensch bleibt nach der liberalistischen Konzeption Teil einer vom Staat zu unterscheidenden Gesellschaft. Er wird zwar Bürger genannt, 29› Hinweis ist aber Bürger allenfalls insoweit, als er durch Wahlen die Ausübung der Staatsgewalt »legitimiert«, wenn nicht Abstimmungen der Bürger ermöglicht sind. Im Verhältnis zum Staat ist der Bürger nicht privat, sondern staatlich, Subjekt des Staats- und Verwaltungsrechts. Privat ist er nur gegenüber anderen Privaten, 30› Hinweis denen gegenüber er sich im Prinzip gerade nicht auf Grundrechte berufen kann, allenfalls mittelbar.
Richtig ist, dass Grundrechte, welche bestimmte freiheitliche Handlungen verfassungsrangig schützen, durch Gesetze beschränkt werden können, wenn das vorgesehen ist. Diese Gesetze verwirklichen wiederum die Freiheit, der ein übermäßiger Grundrechtsschutz bestimmter Handlungen entgegenstehen würde, weil diese Handlungen anderen schaden würden. Die Freiheit und die Grundrechte, welche sie schützen, müssen unterschieden werden. Die Souveränität ist aber kein eigenständig benanntes Grundrecht der Bürger oder des Volkes, sondern deren Freiheit selbst, die freilich durch den Grundrechtsschutz der allgemeinen Freiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG Rechtsschutz, zumal Verfassungsgerichtsschutz, beanspruchen kann. Die Menschenwürde als die Freiheit des Menschen hat alle staatliche Gewalt zu achten und zu schützen (Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG). Diese Würde ist die innere Freiheit, die »Autonomie eines vernünftigen Wesens« (GzMdS, S. 67ff., 69; FridR, S. 87). Daraus folgt kein subjektives Grundrecht auf Schutz der Menschenwürde, wie der Wortlaut des Art. 1 GG ergibt, aber nur nicht, weil sonst letztlich das Bundesverfassungsgericht die Menschenwürde höchstverbindlich materialisieren müsste und damit entgegen dem demokratischen Prinzip und dem Rechtsstaatsprinzip die Gewaltenteilung aushebeln müsste. Alle Rechtsprinzipien der Republik als dem Gemeinwesen der allgemeinen und gleichen Freiheit, insbesondere die benannten Grundrechte, sind zu achten, um die Menschenwürde zu verwirklichen. Sie sind die verbindliche Materialisierung des Menschenwürdesatzes. Die Praxis in Deutschland hat die politische Freiheit als fundamentales Recht der Menschen bisher nicht anerkannt, sondern nur in Ausschnitten akzeptiert, insbesondere im Recht der Meinungsäußerung (etwa BVerfGE 5, 85 [134, 199, 206f.]; 69, 315 [342ff.]; st. Rspr.; Rprp, S. 588ff.) und im Recht auf Volksvertretung oder Demokratie (insb. BVerfGE 89, 155 [171ff.], Maastricht-Urteil; 123, 267 Rn. 167ff., Lissabon-Urteil; BVerfGE 129, 124 [177] Rn. 100f.). Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat eine politische Freiheit als Grundrecht explizit zurückgewiesen (BayVerfGH, BayVBl. 1999, 719ff. [726]). Die dualistische Freiheitslehre kennt neben der politischen Freiheit im republikanischen Sinne eben diese liberalistische Freiheit (Rprp, S. 501ff., FridR, S. 391ff.).
Wenn das Schädliche durch die Gesetze bestimmt wird, bestimmen die Gesetze, der allgemeine Wille, die Grenzen der Handlungsbefugnisse. Die Gesetze können nur alle zusammen geben, denn sie sind der allgemeine Wille. Wenn sie nicht der Wille aller, also der Wille jedes Bürgers, sind, haben sie keine allgemeine Verbindlichkeit, weil nur der eigene Wille bindet. Das ist die Logik der politischen Freiheit. Die Gesetze werden je nach der Lage verändert, müssen allerdings immer die Würde des Menschen durch die Verwirklichung der Verfassung, insbesondere der Menschenrechte, achten. Jedenfalls gilt das neminem laede. Niemand darf durch sein Handeln anderen schaden. Freiheit verwirklicht sich somit in Gesetzen, die freilich dem Recht genügen müssen. Die Gesetzlichkeit sichert der Staat. Freiheit, Recht und Staat sind eine notwendige Einheit des bürgerlichen Gemeinwesens. Freiheitslehre ist zugleich Rechts- und Staatslehre.
Der Bürger, der citoyen, ist durch die Freiheit definiert. Er ist nicht Untertan, sondern seinem Begriff nach frei. Freiheit ist immer auch und wesentlich die politische Freiheit, die Freiheit in der πόλις. Der Bürger ist Mitglied einer Republik, eines Staates in der Verfassung der allgemeinen Freiheit, des Freistaates, eines Staates im eigentlichen Sinne, wie nach den Verfassungsgesetz die Bundesrepublik Deutschland. 31› Hinweis Die Bundesstaatlichkeit stärkt die Republikanität durch föderale oder vertikale Gewaltenteilung. Deutschland ist keine bündische Republik, sondern eine Bundesrepublik, so wie Deutschland seine Staatsform nennt.
IIGleichheit der Bürger in der Freiheit
Mit der Freiheit des Bürgers ist die bürgerliche Gleichheit verbunden. Die Freiheit ist immer die allgemeine Freiheit. Jeder Mensch hat als Mensch die gleiche Freiheit, aber nicht überall in der Welt die gleiche politische Freiheit (FridR, S. 405ff.). Die hat ein Mensch nur in seinem Staat, in dem er Bürger ist. Die Gleichheit in der Freiheit ist das Grundprinzip der Republik. Das führt zur Gleichberechtigung, zur Gleichheit in den Rechten, nicht etwa zu einem Rechtsprinzip der Gleichheit (PdR, S. 329ff.). Die Menschen sind alle sehr unterschiedlich. Niemand kann verlangen, dass ein Mensch gleich einem anderen Menschen ist oder gleich gemacht wird oder dass er gleich jedem anderen behandelt wird, jedenfalls nicht, wenn das Gleichbehandlungsgebot jede Unterschiedlichkeit ignoriert. Das Gleichheitsprinzip des Bundesverfassungsgerichts gebietet, Gleiches gleich und Ungleiches entsprechend der Ungleichheit ungleich zu behandeln, und wird demgemäß als Begründbarkeitsgebot praktiziert (BVerfGE 55, 72 [88] 58, 369 [374]; 60, 329 [346]; 70, 230 [239 f.]; 71, 39 [58f.]; 78, 249 [287], st. Rspr.; PdR, S. 329ff.; FridR, S. 411ff.). Das ist ein Gebot der Sachlichkeit und verbietet Willkür. Diese durchaus richtige Dogmatik folgt schon aus dem Freiheitsprinzip, weil die Freiheit allgemein und damit für alle Bürger gleich ist (FridR, S. 411ff.). Die äußere Freiheit ist, wie zitiert, »die Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür« (MdS, S. 345; FridR, S. 67ff.). Die Unterschiede der Menschen dürfen nicht verleugnet und missachtet werden. Der Egalitarismus ist menschenverachtend, zumal wenn er so weit geht, dass Menschen benachteiligt oder gar geschwächt werden, um nicht stärker oder besser zu sein als andere oder die anderen. Der Lissabon-Vertrag aber nennt in Art. 2 EUV als einen der »Werte, auf die sich die Union gründet«, »die Gleichheit von Frauen und Männern«. Das ist kaum aus Versehen geschehen, sondern liegt in der Logik des Genderismus, der unter anderem die »tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen« zum Ziel hat. Mit welchem Mann soll eigentlich welche Frau gleichgestellt werden? Dieses Gleichheitsprinzip hat zur Bevorzugung der Frauen durch Quotenregelungen für den Zugang zu mancherlei Aufgaben, insbesondere im Öffentlichen Dienst, geführt, die das verfassungsgesetzliche Leistungsprinzip des Art. 33 Abs. 2 GG verkennen (BVerfGE 32› Hinweis). Mann und Frau sind nicht nur von Natur aus wesensverschieden, sondern befinden sich regelmäßig auch in unterschiedlichen Lebenslagen. Dieser Genderismus, der über den Feminismus hinausgeht, führt zur Missachtung der Natur. Das Geschlecht eines Menschen ist trotz aller medizinischer Manipulationsmöglichkeiten keine politische oder soziale Zuordnung, sondern der Politik und dem Sozialen vorgegeben, die daraus die gebotenen, also die gleichheitlichen, Politiken zu folgern haben, etwa in der Arbeitsordnung, der Familienordnung, der Verteidigungsordnung. Die individuelle Manipulation ist ethisch allenfalls gerechtfertigt, wenn biologische Grenzfälle lebensmäßig erleichtert werden sollen. Demgegenüber lässt der patriarchalische Islam eine Gleichberechtigung der Frauen in vielen Bereichen, zumal in der Politik, nicht zu. Seine Ideologie wird in Deutschland und Europa entgegen den »Werten« der Europäischen Union zunehmend wirkungsmächtig, vornehmlich gefördert von den Kräften, die die überzogene Gleichheit von Mann und Frau betrieben haben.
Die Gleichberechtigung ist nur erträglich, wenn der Bereich der Privatheit so zugemessen ist, dass die Menschen sich hinreichend in ihrer Unterschiedlichkeit entfalten können. Gleichmacherei erstickt nicht nur die freie Entfaltung der Persönlichkeit, ein Menschenrecht (Art. 12 AEMR; Art. 2 Abs. 1 GG), sondern auch die Entwicklung des Gemeinwesens. Egalitarismus ist extremer Sozialismus und zwingt zum Totalitarismus. Von der Bürgerlichkeit des Bürgers lässt er nichts übrig.
Es gibt kein Spannungsfeld von Freiheit und Gleichheit, wie es allgemein, auch vom Bundesverfassungsgericht, mit dem Motto »Je mehr Freiheit, desto weniger Gleichheit und umgekehrt« vertreten wird (BVerfGE 5, 85 [206], ständig; kritisch FridR, S. 407ff.). Dieses Motto beruht auf dem Missverständnis von Freiheit. Es gibt gleiche Freiheiten, gleiche Rechte also, welche die Freiheit in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedlich schützen, beispielsweise Art. 4 Abs. 1 und 2 GG Freiheiten religiöser Menschen, nicht etwa eine Religionsfreiheit, 33› Hinweis oder Art. 5 Abs. 3 GG die Freiheiten der Kunst und die der Wissenschaft, der Forschung und Lehre.
Kapitel 3: Sittlichkeit und Moralität
Kapitel 3
Sittlichkeit und Moralität
Das Sittengesetz, der kategorische Imperativ, als das Gesetz der inneren Freiheit, der Sittlichkeit, steht in Art. 2 Abs. 1 GG: »Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.« Im mit »soweit« eingeleiteten Satzteil stehen keine Schranken der Freiheit, keine Schrankentrias, wie das Bundesverfassungsgericht meint (BVerfGE 6, 32 [36ff.]; 90, 145 [171]; 113, 88 [103]; st. Rspr.) und damit das Grundgesetz folgenreich verändert, sondern darin wird die Freiheit in der Republik, dem freiheitlichen Gemeinwesen, definiert (FridR, S. 256ff., 266 ff.). Die äußere Freiheit als die Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür setzt die innere Freiheit voraus, die Sittlichkeit. Die Verbindlichkeit des Sittengesetzes ist somit Definiens der Freiheit, wie das in Art. 2 Abs. 1 GG denn auch formuliert ist.
Sittlichkeit ist die praktische Vernunft, die unparteiliche Sachlichkeit. In einem Gemeinwesen, dessen politische Grundlage die Idee der Freiheit ist, also die der Gleichheit aller Menschen in der Freiheit, ist diese Sittlichkeit die Logik der Ethik und damit des Rechtsprinzips. Das Gesetz der Sittlichkeit ist das Sittengesetz. Die Entwicklung dieser Freiheitslehre danken wir ganz wesentlich dem Christentum. Das Sittengesetz ist nichts anderes als das Prinzip der Nächstenliebe, worauf Kant selbst hingewiesen hat (GzMdS, S. 25f.; KpV, S. 205f.).
Das Sittengesetz ist als Ethos des gemeinsamen Lebens in gleicher Freiheit das Prinzip der Brüderlichkeit, also das der Solidarität, nämlich das Sozialprinzip (Rprp, S. 234ff., FridR, S. 636ff.). 34› Hinweis Das Sittengesetz folgt gerade darin der Logik der allgemeinen Freiheit. Darin kommt die Einheit von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zum Ausdruck. Das Sittengesetz ist das Rechtsprinzip (FridR, S. 83ff., 424ff.).
Das Sittengesetz als der kategorische Imperativ ist die universalisierte Fassung der biblischen lex aurea (GzMdS, S. 25; KpV, S. 113; MdS, S. 586 ff.). Es ist die politische Formulierung des ethischen, zumal christlichen, Liebesprinzips: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; denn ich bin der Herr« (3. Mose 19,18). In der Bergpredigt hat Jesus mit der lex aurea das menschheitliche Prinzip der Gegenseitigkeit angesprochen. Das Sittengesetz bringt das Liebesprinzip auf die politische Formel. Es ist ein uraltes Gesetz, das der Gegenseitigkeit erwachsen ist, die im Menschen wie in allen Primaten, jedenfalls in deren Gruppe, stammesgeschichtlich angelegt ist. Ohne dieses Sittengesetz, ohne diese kooperative Haltung, würde die Menschheit schon wegen ihrer gegenläufigen Aggressivität zugrunde gegangen sein. Sittlichkeit ist das stetige Bemühen, das Gesetz hervorzubringen, unter dem alle gut leben und dem deswegen alle zustimmen können, ja zustimmen, sei es selbst oder vertreten, unter dem alle frei sind.
Das Sittengesetz ist das Gesetz des Sollens (KrV, S. 701). Das Sittengesetz hat drei Formeln, nämlich: die deontische Formel: »…: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde« (GzMdS, S. 51), oder: »Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne« (KpV, S. 140), die Naturgesetzformel: »…: Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte« (GzMdS, S. 51), und die Selbstzweckformel: »…: Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person jedes andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest« (GzMdS, S. 61). »Maxime ist das subjektive Prinzip des Wollens; das objektive Prinzip (d. i. dasjenige, was allen vernünftigen Wesen auch subjektiv zum praktischen Prinzip dienen würde, wenn Vernunft volle Gewalt über das Begehrungsvermögen hätte) ist das praktische Gesetz« (GzMdS, S. 27), oder: »Maxime aber ist das subjektive Prinzip zu handeln, was sich das Subjekt selbst zur Regel macht (wie es nämlich handeln will)« (MdS, S. 332).
Das Bundesverfassungsgericht hat sich bei seiner auf Günter Dürig zurückgehenden Interpretation der Menschenwürde an die Selbstzweckformel angelehnt, nämlich: »…, der einzelne soll nicht Objekt der richterlichen Entscheidung sein, …« (BVerfGE 9, 89 [95]), oder: »Es widerspricht der menschlichen Würde, den Menschen zum bloßen Objekt im Staat zu machen« (BVerfGE 27, 1 [6], Mikrozensus). Es hat damit verkannt, dass nach Kant der Mensch seine Würde in der Selbstgesetzlichkeit findet, also dadurch, dass er bei allem Handeln entweder dem Gesetz folgt, weil, wenn er Bürger ist, dieses auch sein Gesetz ist, oder seinem Handeln eine Maxime zugrunde legt, die fähig ist, allgemeines Gesetz zu sein (vgl. GzMdS, S. 67). Im Urteil zur lebenslangen Freiheitsstrafe (BVerfGE 45, 187 [228]) hat das Gericht hinzugefügt: »Der Satz ›der Mensch muß immer Zweck an sich selbst bleiben‹ gilt uneingeschränkt für alle Rechtsgebiete; denn die unverletzbare Würde des Menschen als Person besteht gerade darin, daß er als selbstverantwortliche Persönlichkeit anerkannt bleibt.« Somit ist die Staatsform der Republik, die demokratisch sein muss, 35› Hinweis durch die unantastbare Menschenwürde geboten; denn nur in dieser Staatsform bleibt der Mensch »Zweck an sich selbst« (Rprp, S. 1ff., 234ff.; PdR, S. 25f., 28ff., 35ff., 86ff., 94ff.; FridR, S. 4 f.). 36› Hinweis Dieser Zusatz ist kantianisch. Daraus folgt aber nicht, dass der Menschenwürdesatz des Grundgesetzes ein subjektives Recht jedermanns enthält, seine Würde zu achten, welches vom Bundesverfassungsgericht zu materialisieren wäre. 37› Hinweis Dieses erweist sich zunehmend als Selbstermächtigung des Bundesverfassungsgerichts zur Politik unabhängig von der vom Grundgesetz materialisierten Verfassung.
Die Sittlichkeit bedarf der Materialisierung in Gesetzen, die nur Gesetze des Rechts (Rechtsgesetze) sind, wenn sie praktisch vernünftig, nämlich unparteilich und sachlich, sind, also dem kategorischen Imperativ genügen.
Die Moral besteht kantianisch nicht aus materialen Vorschriften, wie sie die guten Sitten als Teil der Rechtsordnung enthalten (dazu StuPrR, S. 363ff.), auch nicht aus Vorschriften einer religiösen Lebensordnung, deren Verbindlichkeit göttlich fundiert ist, oder gar in der political correctness, deren Verbindlichkeit dem Zwang der öffentlichen Meinung erwächst. Das wäre der von Kant ebenso wie von der Weltrechtsordnung und dem Grundgesetz zurückgewiesene Moralismus (ZeF, S. 233). Vielmehr ist die Moralität ein formales Prinzip, welches keine materialen Vorschriften in sich trägt.
Moral bezeichnet die Triebfeder des guten Handelns. Moral bewirkt den Selbstzwang (MdS, S. 511ff., 525ff.; Rprp, S. 130ff., 279ff.; FridR, S. 67ff.), dessen Imperativ lautet: »Handle pflichtmäßig, aus Pflicht« (MdS, Tugendlehre, S. 521, 523). Die Triebfeder, bei allem Handeln die Sittlichkeit, die nichts anderes ist als das Rechtsprinzip oder die innere Freiheit, zu wahren, also Bürger unter Bürgern zu sein, der an der allgemeinen Gesetzgebung mitwirkt und die Gesetzlichkeit seines Handelns zu seiner Maxime macht, ist die Moralität. Diese bürgerliche oder republikanische Moralität darf nicht mit dem Moralismus verwechselt werden, unter dem wir alle leiden, der political correctness. Die Disziplinierung der Meinungsäußerungen über deren gesetzliche Grenzen hinaus, mit der die politische und mediale Klasse seit Jahren und zunehmend verstärkt die öffentliche Meinung zu beherrschen sucht, zerstört den Diskurs um Wahrheit und Richtigkeit und damit ein Konstituens der freiheitlichen Republik. Der Moralismus, der zum Tugendterror ausgeartet ist, ist genau das Gegenteil von Moralität. Gegen solches Unrecht muss sich jeder Bürger wehren. Wir brauchen »moralische Politiker«, nicht »politische Moralisten«, hat Kant klargestellt (ZeF, S. 233, 239). Deutschland ist, wie wohl alle Staaten dieser Welt, voll von politischen Moralisten. In den Parteien und in den Medien grenzt das ans Unerträgliche. Aber die Grenzen scheinen überschritten. Moralismus ist seit eh und je ein wirksames Herrschaftsmittel und verfolgt immer illegitime Interessen. Er ist der Freiheit zuwider und achtet die Würde des Menschen nicht, jedes Menschen, der das Recht wahrt. Moralismus verletzt ein Menschen- und Grundrecht, dessen Achtung Bedingung der Republik ist, die Redefreiheit, von Kant als eine Tochter der Freiheit eingestuft (MdS, S. 345f.). Moralische Legalität, die jeder Bürger selbst verantwortet, fordert: Unterwerfe dein Handeln immer dem Prinzip der Gesetzlichkeit, denn das gewährleistet die allgemeine Freiheit und damit die Würde aller Bürger. Die Legalität hat nach Kant ihre Materie juridisch in den allgemeinen Gesetzen und moralisch in den alleinbestimmten gesetzesfähigen Maximen. Diese sind, wenn sie gelungen sind und die allgemeine Freiheit verwirklichen, sittlich.
Die Pflichten folgen entweder aus den Gesetzen des Rechts, sind also Rechtspflichten, oder aus den Gesetzen der Tugend und sind damit Tugendpflichten. Die Rechtspflichten sind äußerlich und damit erzwingbar (MdS, S. 511ff., 525ff.), denn »das Recht ist mit der Befugnis zu zwingen verbunden« (MdS, S. 338f., 527; FridR, S. 100ff., 110ff.). Die Tugendpflichten sind material. Sie machen Zwecke verbindlich. Tugendpflichten sind aber nicht erzwingbar, sondern unterliegen dem Selbstzwang und sind darum bloß innerlich (MdS, S. 508ff.). Legalität ist nach Kant sowohl die Beachtung der Rechtspflichten als auch der Tugendpflichten (MdS, S. 318f., 323ff.). Die Moral verpflichtet auch zur Achtung des ius, der Rechtspflichten also, nicht nur, den Tugendpflichten zu folgen (MdS, S. 512). Moralität schließt somit juridische Legalität ein. Tugendpflichten können Rechtspflichten nicht aufheben. Keinesfalls rechtfertigt die Gewissensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 GG einen Rechtsverstoß (Rprp, S. 420; unklar BVerfGE 12, 45 [55]).
Ohne die formale Tugend, bei allem Handeln dem Rechtsprinzip zu genügen, die Sittlichkeit als die innere Freiheit auch des alleinbestimmten Handelns des Privaten, ist ein Gemeinwesen zu einem solchen Maß an Regulierung genötigt, dass es mit der Beweglichkeit die Bewegung einbüßt. Auch die Sittlichkeit im Privaten findet ihr Prinzip im Sittengesetz, das gebietet, nur Maximen zur Grundlage des Handelns zu machen, die sich als allgemeine Gesetze eignen. Sittlich handelt somit, wer sein Handeln am Gesetzesprinzip ausrichtet. Wenn es Gesetze gibt, bestimmen diese das Handeln, wenn es keine gibt, bestimmt der Handelnde die gesetzesfähige Maxime seines Handelns. Diese bestimmt er als Privater allein, während die Gesetze des Staates, die alle binden, von allen Bürgern gemeinsam gegeben werden (FridR, S. 455ff., 458ff.).
Moral gebietet nicht nur Legalität des Gesetzesvollzugs, sondern auch und vor allem die Beachtung des Sittengesetzes bei allen Handlungen, auch bei der Gesetzgebung. Zum Handeln gehört die Gesetzgebung für die Maximen des Handelns, die Maximenbildung selbst, welche die Zwecksetzung einschließt, und schließlich der Zweckvollzug (FridR, S. 311ff.).
Entgegen der Ethik dieses Freiheitsbegriffs gibt es kein Recht, sondern nur Unrecht.
Kapitel 4: Freiheit durch Gesetzlichkeit
Kapitel 4
Freiheit durch Gesetzlichkeit
IFreiheit durch selbst gegebene Gesetze
Freiheit ist, dem selbst gegebenen Gesetz zu gehorchen, hat Jean-Jacques Rousseau geschrieben (Cs, S. II, 3, 6, III, 15, S. 30ff., 39ff., 103f. u. ö.). 38› Hinweis Kant spricht von der »Idee der Würde eines vernünftigen Wesens, das keinem Gesetz gehorcht, als dem, das es zugleich selbst gibt« (GzMdS, S. 65ff., insb. S. 67; MdS, S. 432, 464f.; ZeF, S. 204; ÜdG, S. 148, 150). 39› Hinweis Frei ist der Mensch unabhängig von eines anderen nötigender Willkür (MdS, S. 345), aber auch unabhängig von den Neigungen, unabhängig von aller Determination, sagt Kant in der Dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft (S. 426ff.). Empirisch ist der Mensch gänzlich abhängig. Aber die Idee der Freiheit ist die Unabhängigkeit des Menschen als Vernunftwesen von allen Determinanten. Diese Idee der Freiheit ist um der Menschheit des Menschen willen notwendig. Ohne diese äußere Freiheit wäre Recht nicht denkbar.
Als geistiges Wesen ist der Mensch der praktischen Vernunft fähig. Der Dualismus als homo phaenomenon und homo noumenon bestimmt den Menschen. Der homo noumenon, das Vernunftwesen, ist nur eines: vernünftig. Er kann sich seines eigenen Verstandes bedienen. Nur als solcher hat er einen Willen, der gesetzgebend ist. »Von dem Willen gehen die Gesetze aus« (MdS, S. 332). Als homo phaenomenon hat der Mensch keinen freien Willen, was die Hirnforschung gegenwärtig zu beweisen unternimmt. Aber die Menschheit hat die Idee der Freiheit als der Fähigkeit der Kausalität des Handelns. »Alle Menschen denken sich dem Willen nach als frei« (KrV, S. 675). »Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum, in praktischer Hinsicht, wirklich frei« (GzMdS, S. 83; FridR, S. 27ff.). Freiheit ist Autonomie des Willens (GzMdS, S. 81ff., MdS, S. 318, 332ff.; Rprp, S. 279ff., 325ff.; FridR, S. 67ff.). Der Wille ist aus sich selbst heraus gesetzgebend. Ohne die Transzendentalphilosophie Kants kann das nicht verstanden werden.
Um der praktischen Vernunft, die auch empirisch erkennbar ist, der Autonomie des Willens also, fähig zu sein, muss der Mensch selbstständig sein. Kant ersetzt die dritte Maxime der Französischen Revolution, die Brüderlichkeit, durch das Prinzip der Selbstständigkeit (MdS, S. 432; ÜdG, S. 150ff.), völlig zu Recht. Nur wer selbstständig ist, kann unabhängig sein. Der Selbstständigkeit dient das Sozial(staats)prinzip (Rprp, S. 234 ff.; FridR, S. 243ff., 286f., 636ff.).
Die Idee der Freiheit macht die Würde des Menschen aus, die das die westlichen Verfassungsgesetze bestimmende Prinzip ist, etwa Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG, vor allem aber Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Die Menschenwürde ist der Grundwert, den auch Art 2 EUV aufgegriffen hat. Wir sagen das nicht nur, sondern versuchen, das zu leben. Freiheit ist somit Gesetzgebung, eigene Gesetzgebung, die zugleich allgemeine Gesetzgebung ist, Autonomie des Willens.
Zum Begriff eines Gesetzes gehört, dass das Gesetz für alle gilt, die auf einem Gebiet leben, dessen Bewohner sich mittels einer bürgerlichen Verfassung zu einem Staat vereinigt haben. Das Wesen des Gesetzes ist seine Allgemeinheit und Notwendigkeit. Das Gesetz, das für mich gilt, gilt für jeden, der mit mir zusammen in einem Gemeinwesen lebt, aus dem einfachen Grund, dass wir zusammenleben. Das Handeln jedes einzelnen Menschen hat Wirkung auf alle. Das ist im näheren Umfeld leicht einsichtig. Genau genommen ist die Wirkung des Handelns weltweit. Wer handelt, der verändert die Welt. Er beeinträchtigt durch sein Handeln die anderen Menschen, er nötigt die anderen in ein anderes Leben. Wo einer sitzt, kann kein anderer sitzen. Das Handeln kann nur nach dem Satz volenti non fit iniuria rechtens sein, wenn alle dem Handeln zustimmen, wenn das Gesetz, nach dem der Mensch handelt, das Gesetz aller ist. Die allgemeine Gesetzgebung ist die Logik der allgemeinen Freiheit, der Gleichheit in der Freiheit. Weil wir alle aufeinander einwirken, müssen wir unter einem allgemeinen Gesetz leben, das aber das Gesetz jedes Einzelnen ist. Das Gesetz ist der vereinigte Wille des ganzen Volkes.
IIGesetzlichkeit aller Handlungen
Die Bürger sind aber nur frei, wenn alles Handeln im Gemeinwesen ihrem Willen entspricht, das heißt ihre Gesetze achtet; denn alles Handeln hat Wirkung auf alle, oder alles Handeln ist Gewaltausübung. 40› Hinweis Alles Handeln verändert nämlich die Lebenswirklichkeit. Handeln, das nicht gemeinverträglich ist, weil es ausweislich der Gesetze dem Willen aller entspricht, verletzt die allgemeine Freiheit, ist also nicht demokratisch legalisiert. Diese republikanische Logik besagt nicht, dass alle Handlungen eng von den Gesetzen bestimmt sein müssen, sie müssen nur dem allgemeinen Willen, der in den Gesetzen beschlossen ist, genügen (Rprp, S. 387ff.; FridR, S. 449ff., 458ff., 612ff.). Wenn die Gesetze besonderen Maximen Verwirklichungschancen lassen, also dem Privatheitsprinzip (Rprp, S. 386ff.; FridR, S. 465ff.) 41› Hinweis genügen oder eben der besonderen Persönlichkeit des Menschen Entfaltungsmöglichkeiten geben, so entspricht das dem allgemeinen Willen, der im Übrigen durch die Menschen- oder Grundrechte als oberste Prinzipien einer Republik gebunden ist. Der Wille freilich, der die Gesetze gibt, ist nichts anderes als die praktische Vernunft und damit die Freiheit als das Vermögen zum Guten (GzMdS, S. 41, 81; KpV, S. 107ff., 141ff.; MdS, S. 329, 338; ZeF, S. 205; StUuPr, S. 138ff., 153ff.; Rprp, S. 140ff., 303ff., 413ff., 567 ff., 598ff., 655ff., 978ff. u. ö.; FridR, S. 83ff., 424ff., 440ff.; PdR, S. 18ff., 44ff.). Er materialisiert sich mittels des durch die Mehrheitsregel erzielten Konsens und ist darin Wille des Volkes (Rprp, S. 105ff., 119ff., 637 ff.; FridR, S. 150ff., 163ff., 318ff., PdR, S. 94ff.).
Das republikanische Freiheitsprinzip wird durch die Republik, den Staat des Rechts, den Rechtsstaat, verwirklicht. Dieser Staat muss um der allgemeinen Freiheit willen demokratisch sein. Die »Menge von Menschen« wird durch das Verfassungsgesetz zu einem Staat, einer civitas, vereinigt (MdS, S. 431). Diese Vereinigung zum Staat macht die Menge von Menschen zum Staatsvolk und begründet den Staat im weiteren Sinne. Der Staat im engeren Sinne ist die Organisation des Volkes für die Verwirklichung des gemeinen Wohls, des guten Lebens aller, also die Einrichtungen des Staates, seine Organe, Behörden und Gerichte.
Die Republik beansprucht die uneingeschränkte Hoheit des Volkes (i. d.S. BVerfGE 89, 155 [181ff., 191ff.; PdR, S. 58ff.]). 42› Hinweis Das Volk muss sich keine Handlungen gefallen lassen, welche es nicht will. Derartige Handlungen können nicht rechtens sein, weil sie sich nicht dem Willen des Volkes (der Bürgerschaft) fügen, der allein Recht als Erkenntnis des Richtigen für das gute Leben aller in allgemeiner Freiheit auf der Grundlage der Wahrheit hervorzubringen vermag, um den Staatszweck zu verwirklichen (Rprp, S. 350ff., 573 ff., 617ff., 990ff.; FridR, S. 60ff., 143ff., 163ff., 484ff. u. ö.; PdR, S. 19f., 167). Das Recht jedes Menschen auf Recht (Rprp, S. 290ff., 325ff., 494ff., FridR, S. 44ff., 281ff.; PdR, S. 56f.) wird verletzt, wenn er sich durch Handlungen nötigen lassen muss, die außerhalb des Rechts stehen. Dadurch würde das Gemeinwesen teilweise in den sogenannten Naturzustand zurückfallen, in den Zustand des Krieges aller gegen alle (MdS, S. 366ff., 374ff., 430ff.; ÜdG, S. 143ff.; ZeF, S. 203, 208f.). 43
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: