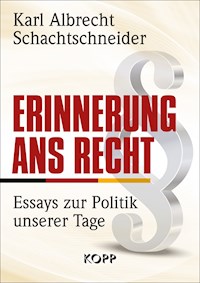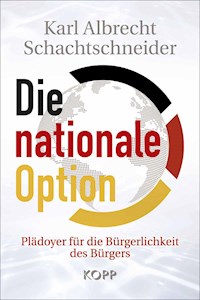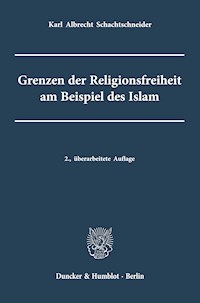
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Muslime wollen den Islam, ihre Religion, auch in Deutschland leben. Sie bauen Moscheen und Minarette, welche die Herrschaft Allahs propagieren. Musliminnen kleiden sich wie im Orient. Schon ruft der Muezzin zum Gebet. Die Scharia soll möglichst zur Geltung kommen. Dafür berufen sich die Muslime auf die Religionsfreiheit und werden darin, soweit irgendwie tragbar, von Politik, Rechtsprechung, Medien und Wissenschaft unterstützt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Freiheiten des Glaubens und des Bekenntnisses und die Gewährleistung der ungestörten Religionsausübung zu einem vorbehaltlosen Grundrecht der Religionsfreiheit zusammengefaßt und dieses nicht nur weit ausgedehnt, sondern auch in einen denkbar hohen Rang gehoben. Nur gegenläufigen verfassungsrangigen Prinzipien muß das Grundrecht, zu leben und zu handeln, wie es die Religion gebietet, weichen. Die schicksalhafte Dogmatik ist neu zu bedenken, weil der Islam eine verbindliche Lebensordnung ist, die mit westlicher Kultur schwerlich vereinbar ist. Die Säkularität ist ihm fremd. Der aufklärerische Vorrang des Staatlichen vor dem Religiösen ist religionspluralistisch zwingend. Grundrechte, die freiheitliche demokratische Ordnung umzuwälzen, kann es wegen des gegenläufigen Widerstandsrechts nicht geben. Auch die Religionsgrundrechte lassen es nicht zu, daß die Erste Welt, das Diesseits, von Vorstellungen einer Zweiten Welt, des Jenseits, beherrscht wird. Die Dogmatik der Religionsgrundrechte wirft Fragen nach Meinen, Wissen und Glauben, nach politischer Freiheit und religiöser Herrschaft, nach Diesseits und Jenseits, nach Staat und Religion auf, die Frage nach einer Republik, deren fundamentales Prinzip die Freiheit der Bürger ist, die demokratisch zum Recht finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
KARL ALBRECHT SCHACHTSCHNEIDER
Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2010
Alle Rechte vorbehalten © 2011 Duncker & Humblot GmbH, BerlinFremddatenübernahme: Process Media Consult GmbH, DarmstadtDruck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany
ISBN 978-3-428-13645-2 (Print)ISBN 978-3-428-53645-0 (E-Book)ISBN 978-3-428-83645-1 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ƀ
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort zur Zweiten Auflage
Diese Zweite Auflage hat vor allem dank der gründlichen Durchsicht von Wanja Dorner Mängel der Textverarbeitung beseitigt.
Berlin, 13. April 2011
Karl Albrecht Schachtschneider
Vorwort zur Ersten Auflage
Die Religionsgrundrechte entfalten schicksalhafte Wirkung. Religionen beanspruchen höchste Verbindlichkeit für die Gläubigen. Sie haben die Entwicklung der Menschen und Völker tiefgreifend beeinflußt und bestimmen diese nach wie vor wesentlich. Religionen schaffen Frieden, vielfach mittels Befriedung. Sie führen aber auch zu Kriegen – Staatenkriegen, Bürgerkriegen oder Neuen Kriegen. Seit Jahrhunderten sind viele Gemeinwesen nicht religiös homogen, vor allem die des weitestgehend christlichen Westens nicht. Aus den Religionskämpfen des 16. und 17. Jahrhunderts ist der Moderne Staat erwachsen, jedenfalls in Deutschland. Dieser ist durch immer offeneren Religionspluralismus gekennzeichnet. Die Französische Revolution hat die Macht der Kirchen trotz allen Staatskirchentums und aller Sonderrechte für die Kirchen gebrochen. Die Verfassungen der Völker Europas sind jetzt säkularistisch, wenn nicht laizistisch. Das Gesetz des Staates behauptet um des inneren Friedens willen allgemeine und vorrangige Verbindlichkeit. Der Staat, mehr oder weniger religiös geprägt, respektiert die Religiosität der Menschen und deren unterschiedliche Religionen, ohne sich mit einer oder mehreren derselben identifizieren zu dürfen. Es kann aber nicht gegenläufige höchste Verbindlichkeiten geben, die des Gesetzes des Staates und die einer Heiligen Schrift. Sonst wäre die Allgemeinheit der Gesetze aufgehoben. Demgemäß muß religiöses Handeln sich die Grenzen gefallen lassen, die der Staat um des gemeinen Wohls, freiheitlich gesprochen, um des Rechts willen, zieht.
Die Religionsverhältnisse sind wieder einmal im Wandel. Die Migration von Muslimen in die Staaten Europas hat den Islam zur Lebenswirklichkeit in Europa und auch in Deutschland werden lassen. Freilich kann der Islam weder in Deutschland noch sonst in einem europäischen Staat so gelebt werden wie in einem islamischen Land. Die Gesetze lassen das nicht zu. Aber die Möglichkeiten, nach den Geboten und Verboten des Islam zu leben, werden zunehmend ausgedehnt. Es werden Moscheen und Minarette gebaut, der Ruf des Muezzins ist zu hören, die Kleidung der Musliminnen genügt vielfach den islamischen Regeln und vieles mehr. All die Veränderungen werden mit einer Religionsfreiheit gerechtfertigt, ohne daß der politische Impetus dieser religiösen Unternehmungen gewichtet wird. Der Islam anerkennt die Säkularität von Re[6]ligion und Politik/Staat nicht, wenn auch etwa in der Türkei, in der ganz überwiegend Muslime leben und aus der die meisten Muslime in Deutschland unmittelbar oder mittelbar stammen, der Laizismus im Verfassungsgesetz verankert ist. Viele Menschen in Europa und Deutschland, nicht nur Christen, Juden und Atheisten, sondern auch Muslime, fürchten eine Islamisierung der Lebensverhältnisse. Diese Sorge hat aufgeregte Erörterungen im privaten und öffentlichen Bereich ausgelöst, deren Grundlage meist ein überdehnter Begriff von Religionsfreiheit ist. Eine Lebensordnung, wie sie der Islam vorschreibt, wäre mit der im Prinzip aufklärerischen Verfassungsordnung jedenfalls des Grundgesetzes, mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Deutschlands, schwerlich vereinbar.
Die Lage drängt, die religionsverfassungsrechtliche Grundfrage nach den religionsfreiheitlichen Rechten neu zu bedenken, die das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung nicht nur weit ausgedehnt, sondern auch, orientiert am Christentum, in einen denkbar hohen Rang gehoben hat. Allein schon die Zusammenfassung der Religionsgrundrechte zu einem Grundrecht der Religionsfreiheit, das mit den vorbehaltlosen Grundrechten der Freiheit des Glaubens und des religiösen Bekenntnisses identifiziert wird und allenfalls verfassungsrangigen Prinzipien anderer Art weichen muß, löst wegen des religionspluralistischen Vorranges des Staatlichen Bedenken aus, ganz abgesehen von der in das Grundgesetz inkorporierten Religionsverfassung Weimars. Grundrechte, die es zu rechtfertigen vermögen, die Verfassungsordnung umzuwälzen, kann es schon deswegen nicht geben, weil alle Deutschen das Recht zum Widerstand gegen jeden haben, der die Ordnung, die das Grundgesetz geschaffen hat, zu beseitigen unternimmt. Die Verfassungstreue ist eine Grenze jeden Grundrechts, nicht erst Schranke von Grundrechtsausübungen. Auch die Religionsgrundrechte lassen es nicht zu, daß die Erste Welt, das Diesseits, von Vorstellungen einer Zweiten Welt, des Jenseits, beherrscht wird.
Die Dogmatik der Religionsgrundrechte wirft die Fragen nach Meinen, Wissen und Glauben, nach Freiheit und Herrschaft, nach Diesseits und Jenseits, nach Grundrechten und Grundpflichten, nach Politik und Religion auf, die Frage nach dem Recht eines bürgerlichen Gemeinwesens in einem europäischen Europa, dessen fundamentales Prinzip die Einheit von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ist.
Professor Norbert Simon und Dr. Florian Simon haben die Studie über die Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam in ihr Verlagsprogramm aufgenommen und die Veröffentlichung in jeder Weise gefördert. Regine Schädlich hat wiederum wertvolle Hilfe geleistet. Dafür danke ich.
Meine Frau hat meine dogmatischen und unvermeidlich auch politischen Überlegungen mit steten Hinweisen auf den guten Willen vieler Muslime und noch mehr Musliminnen begleitet, in der westlichen Welt so zu leben, wie es dieser auf Grund ihrer ebenso humanistischen wie christlichen vor allem aber aufklärerischen Entwicklung entspricht. Das soll auch möglich sein und bleiben.
Nürnberg, 31. Oktober 2010
Karl Albrecht Schachtschneider
Inhaltsverzeichnis
Das Problem Religionsfreiheit
I. Religionsfreiheitliche Texte
II. Religionsfreiheit in der Praxis
III. Glauben, Meinen, Wissen
IV. Begriff der Freiheit
V. Freiheitliche Rechtlichkeit, Vorrang des Staatlichen und Religionstoleranz
VI. Neutralität/Nicht-Identifikation des Staates
VII. Grundrechtsschutz der pluralistischen Welt des Religiösen
VIII. Vorrang des Weltlichen vor dem Geistlichen als Gesetzesvorbehalt
IX. Negative Religionsfreiheit
X. Säkularisiertes Christentum – politischer Islam
XI. Freiheitliche demokratische Grundordnung versus religiöse Politik
XII. Traditionsverpflichtete Kulturpolitik
XIII. Vereinsrechtliche Aspekte politischer Religionen
XIV. Schlußfolgerungen
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Das Problem Religionsfreiheit
Die Dogmatik der Religionsfreiheit hat in den sechzig Jahren der Bundesrepublik Deutschland trotz respektabler Bemühungen nicht zu einer für den realen Religionspluralismus tragfähigen Lehre gefunden. Die Problematik wurde einseitig aus der Perspektive des Christentums betrachtet, weil es lange keine existentiellen Probleme der Religionsausübung in Deutschland gab. Diese sind erst durch die Zuwanderung von Muslimen entstanden1. Die Auseinandersetzung um die Kopftücher muslimischer Lehrerinnen (BVerfGE 108, 282 ff.), um die Befreiung vom Sportunterricht (BVerwGE 94, 82 ff.) und um das Schächten (BVerwGE 112, 227 ff.; BVerfGE 104, 337 ff.) haben schon grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Religionspluralismus wird zur existentiellen Zumutung, wenn Religionsausübung politisch wird, seit einiger Zeit auch in Deutschland. Die Dogmatik der Religionsfreiheit ist anhand vornehmlich der christlichen Religionen, namentlich der Fragen des Staatskirchenrechts, entwickelt und auf andere und andersartige Religionen angewandt worden. Die Dogmatik ist zu vertiefen, ja im Grundsätzlichen neu zu bedenken. Der Islam, der die Probleme aufwirft, ist fast allgemein als eine Weltreligion, eine der großen Weltreligionen, anerkannt2. Das sagt wenig über die Verfassungsrechtslage3, weist aber auf Artikel 4 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes, die sogenannte Religionsfreiheit, und auch Art. 140 GG hin, der die Religionsverfassung der Weimarer Reichsverfas[10]sung weitgehend in das Grundgesetz inkorporiert hat. Der Gegenstand der Religionsfreiheit und deren Grenzen müssen erfaßt werden.
1Ganz so St. Muckel, Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland, in: J. Isensee/W. Rees/W. Rüfner, FS Joseph Listl, 1999, S. 239 ff.; F. Schoch, Die Grundrechtsdogmatik vor den Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft, in: J. Bohnert u. a., FS A. Hollerbach, 2001, S. 149 ff. (155).
2Ch. Hillgruber, Der deutsche Kulturstaat und der muslimische Kulturimport, Die Antwort des Grundgesetzes auf eine religiöse Herausforderung, JZ 1999, 539; St. Muckel, Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland, S. 243.
3Ch. Hillgruber, Der deutsche Kulturstaat und der muslimische Kulturimport, JZ 1999, 540, hat „keinen Zweifel“ (wie viele), aus der Anerkennung des Islam als Weltreligion auf dessen Grundrechtsschutz aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG zu schießen; ebensowenigSt. Muckel,Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland, S. 243, der die religiösen Gehalte des Islam von den politischen zu unterscheiden versucht (passim), aber damit das Wesen desselben verkennt (dazu X. und XI.); ebensoSt. Muckel/R. Tillmanns, Die religionsverfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für den Islam, S. 235 („die alte Weltreligion des Islam“ „selbstredend“ eine Religion im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG; behauptete Selbstverständlichkeiten verbergen oft Problemferne); auch A. von Campenhausen/H. de Wall, Staatskirchenrecht. Eine systematische Darstellung des Religionsverfassungsrechts in Deutschland und Europa, 4. Aufl. 2006, S. 84 („selbstredend auch für die alte Weltreligion des Islam“, obwohl ihnen die Fragwürdigkeit des Islamismus vor allem wegen der islamischen Einheit von Religion und Staat wohl bewußt ist, S. 84 ff.).
I. Religionsfreiheitliche Texte
Aufschlußreich ist der Begriff der Religionsfreiheit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 (AEMR). In Art. 18 heißt es:
„Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung von Riten zu bekunden.“
Ähnlich, aber eher noch vorsichtiger, heißt es in Art. 18 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen vom 19. Dezember 1966 (IPbürgR), welcher die Menschenrechtserklärung näher entfaltet:
(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden.
(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde.
(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.
(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen.
In der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europarats vom 4. November 1950 (EMRK) heißt es enger in Art. 9:
(1) „Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen.
(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffent[12]lichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.“4
Das Menschenrecht5 der Religionsfreiheit umfaßt somit außer der Freiheit, eine Religion zu haben und zu wechseln, die Freiheit, seine Religion zu „bekunden“ bzw. zu „bekennen“. Das kann allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst oder Vollziehung von Riten (und auch Bräuchen), aber auch durch Unterricht geschehen. Es bleibt aber immer nur die Freiheit, die Religion zu bekunden oder zu bekennen. Hinzu kommt das Recht, die Religion weiterzugeben, also andere, insbesondere die Kinder, in der Religion zu unterrichten. Das macht Absatz 3 von Art. 18 IPbürgR genauso deutlich wie Absatz 2 des Art. 9 EMRK; denn nur für die Freiheit, die Religion zu bekunden und zu bekennen, wird überhaupt eine Einschränkung, die nur durch Gesetz erfolgen darf, geregelt. Eine allgemeine Religionsausübungsfreiheit kennen somit die Menschenrechtstexte nicht. Auch die in Art. 18 AEMR und Art. 18 IPbürgR genannte „Ausübung“ ist lediglich eine Form der Bekundung. In Art. 9 EMRK kommt das Wort Ausübung nicht vor. Das Menschenrecht der Religionsfreiheit ist somit auf das religiöse Bekunden oder Bekennen und das Unterrichten der Religion begrenzt und umfaßt nicht das Leben und Handeln nach der Religion.
Der Text des deutschen Grundrechts, das irreführend mit dem Schlagwort Religionsfreiheit belegt wird, weicht von diesen Formulierungen ab, ohne mehr Rechte einzuräumen. Art. 4 Abs. 1 GG erklärt
„die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses“ für „unverletzlich“.
Weniger präzise als die Texte der Menschenrechtserklärung ist Absatz 2 des Art. 4 GG, der lautet:
„Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet“.
Dieses Grundrecht schützt, wie unten zu II dargelegt wird, die Freiheit des Bekundens und Bekennens. Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses ist die Freiheit, das Credo, die Confessio selbst zu bestimmen, welche das Prinzip: Cuius regio eius religio, überwunden hat.
Der Text schließt an den Wortlaut des Religionsgrundrechts der Weimarer Reichsverfassung an. Art. 135 WRV lautete:
„Alle Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte Religionsausübung wird durch die Verfassung gewährleistet und steht unter staatlichem Schutz. Die allgemeinen Staatsgesetze bleiben hiervon unberührt.“
[13] Wichtig ist, daß die in diesem Grundrecht geschützte Gewissensfreiheit die tradierte religiöse Bekenntnisfreiheit ist (dazu II.). Diese Grundrechtsbestimmung wurde durch die Artikel 136 bis 141 WRV ergänzt, die außer Art. 140 WRV (Religionsausübung der Wehrmachtsangehörigen) durch Art. 140 GG in das Grundgesetz mit Verfassungsrang inkorporiert sind (BVerfGE 19, 226 (219, 236); 53, 366 (400); 70, 138 (167))6 und für die Religionsverfassung von bestimmender Relevanz sind, insbesondere Art. 136 Abs. 1 WRV, der lautet:
„Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.“
Diese Vorschrift klärt den Vorrang der staatlichen Rechtsordnung vor der Ausübung der Religionsfreiheit. Dieses Rangverhältnis wird durch Absatz 2 des Art. 136 WRV bestätigt:
„Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis“.
„Unter Religion oder Weltanschauung“ versteht das Bundesverwaltungsgericht „eine mit der Person des Menschen verbundene Gewißheit über bestimmte Aussagen zum Weltganzen sowie zur Herkunft und zum Ziel des menschlichen Lebens; dabei lege die Religion eine den Menschen überschreitende und umgreifende (,transzendente‘) Wirklichkeit zugrunde, während sich die Weltanschauung auf innerweltliche (,immanente‘) Bezüge beschränke“ (BVerwGE 90, 112 (115) mit Hinweis auf BVerfGE 32,98 (108); BVerwGE 37, 344 (363); 61, 152 (154, 156))7. Diese Definition ist eine unter vielen und bedarf für die folgende religionsverfassungsrechtliche Dogmatik keiner Kritik.
Eine Interpretation beider Absätze des deutschen Grundrechts ergibt, daß die Gewährleistung der ungestörten Religionsausübung nicht mehr Rechte gibt als die menschenrechtlichen Texte, nämlich das Recht zum religiösen Kultus, insbesondere zum Gottesdienst, das Recht, kultische Bräuche und Riten zu praktizieren, soweit das dem Glauben dient, aber auch die Religion durch Unterricht weiterzugeben, zusammengefaßt, öffentlich oder privat die Religion zu bekunden oder zu bekennen. Die Auslegung des Art. 4 GG muß mit Art. 136 WRV und im übrigen auch mit den weiteren aus der Weimarer Reichsverfassung in das Grundgesetz inkorporierten Artikeln übereinstimmen. Auch Art. 141 WRV handelt wiederum nur von dem „Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten“, nicht von sonstigen religiös bestimmten Handlungen.
Der Gegenstand der „Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses“, die Art. 4 Abs. 1 GG schützt, erschließt sich nicht ohne weiteres aus dem Wort „Bekenntnis“, das meist als das Bekennen im Sinne der Menschenrechtserklärungen (miß)verstanden wird, aber gemäß der Jahrhunderte alten „Gewissensfreyheit“ wie [14] auch noch in Art. 135 S. 1 WRV die „Gewissensfreiheit“8 die Freiheit der Konfession (confessio; credo) meint (dazu II.). Das Bekennen des Glaubens ist Schutzgegenstand des Grundrechts der ungestörten Religionsausübung des Art. 4 Abs. 2 GG (dazu II.). Die Freiheit des Gewissens hat erst im Grundgesetz einen neuen Begriffsgehalt gefunden.
4Dazu Th. Traub, Der Islam im Völker- und Europarecht, in: ders., Der Islam im öffentlichen Recht des säkularen Verfassungsstaates, 2008, S. 273 ff. (S. 278 ff.).
5J. Listl, Glaubens-, Bekenntnis- und Kirchenfreiheit, in: ders./D. Pirson, Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Erster Bd. 2. Aufl. 1994, § 14, S. 439 ff. (448).
6St. Muckel, Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland, S. 239 ff. (254).
7Zustimmend A. von Campenhausen/H. de Wall, Staatskirchenrecht, S. 55.
8G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919, Kommentar, 14. Aufl. 1933 (WRV. Komm.), Art. 135 Anm. 3 und 4, im Anschluß an Art. 12 der preußischen Verfassungsurkunde von 1850.
II. Religionsfreiheit in der Praxis
Die Praxis und herrschende Lehre in Deutschland verbinden die beiden ersten Absätze des Artikels 4 des Grundgesetzes zu einem einheitlichen Grundrecht der Glaubens- oder Religionsfreiheit (BVerfGE 24, 236 (245 f.); 32, 98 (106); 33, 23 (28); 41, 29 (49); 83, 341 (354); 93, 1 (15); 104, 337 (346 f.); 108, 282 (297); st. Rspr.; BVerwGE 94, 82 (83, 88 f., 91); 112, 207 (230))9 und dogmatisiert dieses Grundrecht nach Absatz 2 der Vorschrift, also gewissermaßen als Recht zur, nicht als Gewährleistung ungestörten/r Religionsausübung. Dieses Gesamtgrundrecht wird als Religionsfreiheit (BVerwGE 90, 112 (115 f.))10 „extensiv“11 entfaltet, „weil die Religionsfreiheit nicht mehr wie in Art. 135 WRV durch einen ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt eingeschränkt ist, …, nicht nach Art. 18 GG verwirkt werden kann und darüber hinaus durch verfassungsrechtliche Sonderregelungen geschützt ist (vgl. Art. 3 Abs. 3; Art. 33 Abs. 3 GG, Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 136 Abs. 3 Satz 1 WRV; Art. 136 Abs. 4 WRV; Art. 7 Abs. 3 Satz 3 GG, Art. 7 Abs. 2 GG)“ (BVerfGE 24, 236 (246); 33, 23 (29); 35, 366 (376); zum Argument Art. 135 WRV auch BVerfGE 44, 37 (49); zum fehlenden Gesetzesvorbehalt auch BVerfGE 52, 223 [16] (246 f.))12 . Dem (zu) weiten Schutzbereich setzt die Praxis gezwungenermaßen wenig bestimmte und damit beliebig einschränkbare oder erweiterbare Schranken entgegen. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG seien vorbehaltlos, aber wegen der „Einheit der Verfassung“ nicht schrankenlos (gute Skizze BVerfG, 2. Kammer des Ersten Senats, 1 BvR 536/03, vom 2. Oktober 2003, Rdn. 15, DVBl 2004, 263). Die Dogmatik der Schranken oder besser Grenzen der Religionsfreiheiten wird zu VIII. erörtert. Die Aspekte, welche das Bundesverfassungsgericht für die weite Interpretation des Religionsgrundrechts anführt, zwingen im Gegenteil zur engen Interpretation der religionsgrundrechtlichen Freiheiten und zum Vorrang des Weltlichen vor dem Geistlichen (dazu VIII.). Das Religionsgrundrecht soll das Recht schützen, so zu leben und zu handeln, wie es die Religion gebietet, d. h. sein gesamtes Verhalten an den Lehren des Glaubens auszurichten und den inneren Glaubensüberzeugungen gemäß zu handeln (BVerfGE 24, 236 (264); 32, 98 (106); 33, 23 (28); 41, 29 (49); 93, 1 (15); 108, 282 (297))13 . Das Bundesverfassungsgericht hat in der Kopftuchentscheidung ausge sprochen: