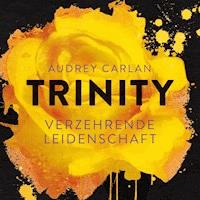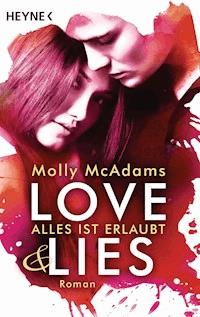3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Frankreich, Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Seit Jacques Dupin, der Marquis de Pollin, bei einem Jagdunfall zu Tode gekommen war, hatte sich das Leben auf seinem großen Anwesen mit dem stattlichen Herrenhaus deutlich verändert. Ein Unglück reihte sich an das nächste und trieb seine Witwe Babette Dupin in die Armut. Zusammen mit ihrer Nichte Justine trotzen die beiden Frauen allen Widrigkeiten und kämpfen um ihre Existenz. Als eines Nachts im Hof seltsame Geräusche zu hören sind, ändert sich für sie alles und sie schlittern in ein Abenteuer, das nicht nur herausfordernd wird, sondern auch für die sexuell unerfahrene Justine einiges an Überraschungen bereithält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Nichte der Madame Dupin
SAM SANDERS
Erstausgabe 2024
Erotischer Roman
Impressum
© 2024 SAM SANDERS
c/o AutorenServices.deBirkenallee 2436037 Fulda
Erste Auflage
Coverbild: KI-generiert
ISBN:
Kontakt: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Epilog
1
„Justine, Schatz, vergiss bitte nicht, die Schweine zu füttern“, schallte es über den Hof.
„Ja, Tante Babette, das mache ich gleich“, erwiderte sie und verdrehte die Augen.
Sie hatte noch nie vergessen, die Tiere zu füttern. Weder die Hühner noch die Pferde und schon gar nicht die Schweine, denn sie war gerade dabei, diese in den viel zu großen Stall zu treiben. Dort wartete der Eimer mit den eingeweichten Gemüseabfällen. Sie musste ihn nur noch in den Trog kippen und die Tür verriegeln, dann hatte sie das meiste für heute geschafft.
Justine mochte die Arbeit mit den Tieren, obgleich sie genau genommen keine Wahl hatte. Die junge Frau lebte seit ihrer frühen Jugend hier auf dem großzügigen Landgut ihrer Tante Babette und hatte sich längst an die tägliche Arbeit gewöhnt.
Seit ihr Onkel, Jacques Dupin, der angesehene und ehrenvolle Marquis de Pollin, bei einem Jagdunfall vor ein paar Jahren zu Tode kam, hatte sich hier sehr viel verändert.
Das leichte Leben, das sie vorher auf diesem weitläufigen Anwesen mit dem riesigen, schlossähnlichen Herrenhaus, den großzügigen Stallungen und den unzähligen Bediensteten geführt hatten, war auf einen Schlag vorbei gewesen und es hielt der bittere Ernst Einzug.
Als kinderlose Witwe hatte Babette Dupin plötzlich damit zu kämpfen, dass kein Geld mehr in die Kasse kam. Zwei schlechte Jahre mit kargen Ernten sorgten dafür, dass die Reserven schnell schwanden, und so blieb ihr irgendwann kein anderer Ausweg, als die meisten der Angestellten zu entlassen. Einige davon hatten selbst die meiste Zeit ihres Lebens auf diesem Landgut verbracht.
Zunächst hatte sie sich an den französischen König gewandt, der zwar im fernen Paris residierte, für sie, aufgrund der Stellung ihres Mannes, jedoch kein Unbekannter war. Zu ihrem Leidwesen verweigerte er ihr jegliche Unterstützung, da sie es vehement ablehnte, seinem Vorschlag zu folgen, Carlos Rachos, einen spanischen Edelmann zu ehelichen. Damit wären zwar ihre Geldsorgen passé gewesen, aber Babette sah in diesem Carlos einen widerlichen, ungehobelten Schmierlappen mit zweifelhaftem Ruf. Außerdem wollte sie vom König nicht als Schachfigur für politisch motivierte Spielchen missbraucht werden. Und nach Spanien würde sie schon zweimal nicht gehen.
Dafür war Babette Dupin, Witwe des Marquis de Pollin, viel zu stolz.
Natürlich zeigte der König wenig Verständnis für ihre Weigerung. Ohne weiteren Kommentar entzog er ihr sämtliche Titel sowie Privilegien und verstieß sie aus dem Kreise der feinen Gesellschaft. Damit war sie bei Hofe nicht länger erwünscht und konnte auch keinerlei Unterstützung anderer adeliger Häuser erwarten. Schließlich lebten sie im achtzehnten Jahrhundert. Da war jeder auf sich selbst angewiesen.
Es musste also ein anderer Plan her. Und der lautete: zu Geld machen, was sich zu Geld machen ließ. Stück für Stück verkaufte sie ihre Ländereien, bis nur noch zwei Felder übrigblieben, die sie nun hauptsächlich als Weideflächen für die verbliebenen Tiere, eine Handvoll Hühner, sechzehn Schweine, zwei Kühe und fünf Pferde nutzte.
Das Leben auf dem einst so prunkvollen Anwesen war hart geworden. Besonders für jemanden, der bisher recht sorglos die angenehmen Seiten des Lebens genießen durfte.
Doch Babette Dupin, eine Frau in ihren besten Jahren, die schon immer pragmatisch veranlagt war, nahm ihre neue Rolle an. Wahrscheinlich gelang es ihnen deshalb, mit Würde und Anstand über die Runden zu kommen.
Geblieben war außerdem noch Gustav. Einst Kammerdiener von Jacques Dupin. Über viele Jahre war er es gewesen, der seinem Herrn in den Frack half, täglich die Stiefel polierte und seine Uniform aufbügelte. Er war die treue Seele, die immer da war, wenn er gebraucht wurde.
Nach dem Tod des Marquis ließ er sich nicht wegschicken. Er wollte auf jeden Fall auf dem Anwesen bleiben. So viele Jahre hatte er die Familie begleitet und verdankte ihnen alles. Auch wenn sein Herr nun nicht mehr da war, wollte er weiter der Familie Dupin dienen. Notfalls auch ohne Bezahlung. Er war alleinstehend und hatte keine Verwandten in der Nähe.
Als junger Bursche kam Gustav aus dem Herzogtum Württemberg nach Frankreich. Durch Zufall begegnete er dem Marquis auf einem Pferdemarkt. Da er auf der Suche nach Arbeit war und nichts zu verlieren hatte, ging er einfach auf ihn zu. Seine Kühnheit wurde belohnt. Sie kamen ins Gespräch und tatsächlich bot der edle Herr dem aufgeweckten Deutschen, der in lumpiger Kleidung vor ihm stand und nicht besonders gut Französisch sprach, eine Anstellung auf dem Anwesen an.
Der Marquis machte allerdings zur Bedingung, dass Gustav für mindestens drei Jahre jeden Tag, außer sonntags, zwei Stunden am Unterricht des Hauslehrers teilnehmen müsse, um ein Mindestmaß an Bildung und Sprachkenntnissen zu erlangen. Was Gustav gerne annahm.
Jacques Dupin war der Meinung, dass in der Bildung der Schlüssel zu beinahe Allem liegen würde und diese nicht nur den Höhergestellten vorbehalten sein sollte. Daher wurden regelmäßig alle seine Angestellten vom Hauslehrer in den unterschiedlichsten Fächern unterrichtet. Vom Stallburschen bis zur Gouvernante.
Das war ein sehr moderner und nicht ganz ungefährlicher Ansatz für das achtzehnte Jahrhundert, denn der Klerus teilte keineswegs die Ansicht, dass der Pöbel unbedingt lesen und schreiben können müsse.
Gustav zeigte sich wissbegierig, lernte schnell und stellte sich geschickt an. Der immer freundliche und fleißige Bursche mit den wachen Augen gewann schnell die Herzen aller auf dem Anwesen. Und als die Zeit gekommen war, wurde ihm die verantwortungsvolle Aufgabe des Kammerdieners des Marquis de Pollin übertragen.
Seither waren viele Jahre vergangen. Und nun blieb er als einziger Mann auf dem Anwesen und packte mit an, wo immer er konnte.
2
Justine zog die Stalltür hinter sich zu und schob den Riegel davor. Fertig für heute, freute sie sich und schlenderte in der Dämmerung über den Hof zurück zum Haupthaus.
Der Sommer zeigte sich von seiner besten Seite. Die Luft roch herrlich nach Pinien und es war angenehm warm. Leider war es wieder einmal viel zu trocken. Wenn das so weiterginge, würde in diesem Jahr die Ernte erneut karg ausfallen. Es fehlte einfach der Regen. Die Wiesen sollten um diese Jahreszeit in sattem Grün stehen. Stattdessen wurden die braunen Flecken immer zahlreicher und die Tiere mussten sich ihr Futter mühsam suchen.
„Alles erledigt, Tante Babette“, sagte sie, als sie in die große Küche kam, wo Madame Dupin gerade am Herd stand und mit dem alten Holzlöffel die Suppe im Kupferkessel umrührte.
„Braves Kind“, erwiderte diese, wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab und stellte den Topf auf den Tisch. „Gerade rechtzeitig. Das Abendessen ist fertig. Schenk uns doch bitte etwas Wein ein und setz dich. Gustav ist noch unterwegs. Bei ihm wird es spät werden. Wir werden nicht auf ihn warten.“
Madame Dupin hielt wenig von gesellschaftlichen Konventionen. Zumindest nicht mehr seit dem Tod ihres Mannes. Früher war eine Trennung zwischen der Herrschaft des Hauses und den Bediensteten eine Selbstverständlichkeit. Jeder hatte seinen Bereich. In der Küche arbeitete das Küchenpersonal und sie selbst kam nur selten hierher. Es war die Aufgabe der Hausdame, Wünsche und Anweisungen in die Küche zu tragen.
Doch nun gab es kein Personal mehr. Babette und Justine mussten selbst kochen und so verloren auch die standesgemäßen Verhaltensnormen ihre Bedeutung. Und da Gustav inzwischen mehr Familienmitglied als Angestellter war, gesellte er sich zum Essen meistens zu ihnen.
Nach dem Essen saßen die beiden Frauen noch ein wenig in der Bibliothek zusammen und unterhielten sich. Das Feuer im Kamin war aus und so wurde es ihnen im Kerzenschein bald zu dunkel, sodass sie beschlossen, zu Bett zu gehen.
3
An diesem Abend lag Justine lange wach und konnte nicht so recht einschlafen. Unzählige Dinge gingen ihr durch den Kopf, und genau wie ihre Tante machte auch sie sich Sorgen um die Zukunft des Anwesens. Sollte die Ernte dieses Jahr tatsächlich wieder schlecht ausfallen, und im Moment sah es ganz danach aus, wären sie gezwungen, die Pferde zu verkaufen. Sie brauchten aber mindestens zwei Pferde für die Kutsche. Sollte dann eines davon ausfallen, dann wäre die Katastrophe perfekt. Die Schweine könnten sie auch verkaufen. Aber die wenigen, die sie hatten, reichten gerade für ihre Grundversorgung.
Justine wälzte sich hin und her. Sie dachte darüber nach, dass ihre Tante mit ihr darüber gesprochen hatte, vielleicht erneut zum König zu gehen, um sein Angebot doch noch anzunehmen. Aber ob das Aussicht auf Erfolg haben könnte, war aus mehreren Gründen äußerst fraglich. Zum einen lag sein Wunsch lange zurück. Der König hatte in der Zwischenzeit sicher eine andere Ehewillige für den spanischen Rüpel gefunden. Außerdem müsste sie demütig zu Kreuze kriechen. Sie wäre das Gespött der gesamten französischen Gesellschaft. Gut, damit könnte sie letztlich leben. Aber sie kannte den König. Er würde sich nicht so einfach erweichen lassen. Und wenn es ganz dumm laufen würde, dann könnten sie dabei alles verlieren. Das durften sie nicht riskieren.
Ein anderer Ausweg, das war Justine sehr wohl bewusst, wäre, wenn sie sich selbst mit einem wohlhabenden Mann vermählen könnte. Mit beinahe zwanzig Jahren war sie schließlich alt genug dafür. Ihr großer Traum war zwar eine Heirat aus wahrer Liebe, aber wenn sie damit das Anwesen und ihre Zukunft retten konnte, dann wäre sie für dieses Opfer gerne bereit. Das Problem war nur, dass derzeit weit und breit kein geeigneter Kandidat in Sicht war.
In Adelskreisen waren sie nicht mehr erwünscht. Keiner der höhergestellten Familien würde es auch nur in Betracht ziehen, seinen Erstgeborenen mit einer mittellosen, vom König verstoßenen zu vermählen. Das wäre ein gesellschaftlicher Abstieg. Noch nicht einmal für einen Zweit- oder Drittgeborenen käme das infrage.
Ach, wenn doch nur ihre Eltern noch leben würden.
Justine hatte nur sehr verblasste Erinnerungen an Christine und Joseph Blanche, denn sie war erst sieben Jahre alt gewesen, als beide bei einem Überfall getötet wurden. Ihr Vater war ein sogenannter Mittelsmann und oft im Auftrag des Marquis unterwegs. Genaueres wusste sie darüber jedoch nicht.
Eines Tages war er im Süden Frankreichs unterwegs, um irgendetwas nach Spanien zu bringen. Ihre Mutter begleitete ihn auf der weiten Reise. Als sie nicht am Zielort eintrafen, wurde nach einigen Tagen ein Suchtrupp losgeschickt. Dieser fand ihre völlig zerstörte Kutsche in einem kleinen Waldstück in der Nähe der spanischen Grenze. Offenbar waren sie in einen Hinterhalt geraten. Niemand hatte den Überfall überlebt. Alle Waren und Wertsachen, sowie die Pferde wurden gestohlen. Leider gab es keine Zeugen und somit konnte auch niemand dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Gerüchten zufolge könnten es in der Gegend lebende Gesetzlose gewesen sein.
Als Babette Dupin von dem Unglück ihres Bruders und seiner Frau erfuhr, zögerte sie keine Sekunde und setzte alle Hebel in Bewegung, um Justine schnellstmöglich zu ihnen auf das Anwesen zu holen. Das war eine harte Zeit für das kleine, zarte Mädchen. Aber hier kümmerte man sich liebevoll um sie.
Letztlich verbrachte sie auf dem Anwesen eine sehr schöne Kindheit. Und dank der unkonventionellen, modernen Einstellung ihres Onkels erhielt sie eine exzellente Schulbildung und lernte viele Dinge, die eine Frau Mitte des achtzehnten Jahrhunderts normalerweise nicht lernte.
Jetzt, wo sie beinahe zwanzig Jahre alt war, musste sie sich Gedanken um ihre Zukunft machen. Gleichzeitig fühlte sie sich in der Pflicht, alles zu tun, um den Hof ihrer Tante zu retten. Aber wie nur?
Es war ein Dilemma, das Justine regelmäßig den Schlaf raubte. Irgendwann begriff dann endlich ihr Verstand, dass sich dieses Problem auch in dieser Nacht nicht lösen lassen würde, und sie schlief ein.
4
„Was war das?“, fuhr sie erschrocken hoch und sah sich benommen im Zimmer um. Es war stockdunkel. Vorsichtig tastete sie nach dem Nachttisch, um ein bisschen Orientierung zu haben. Dann lauschte sie in die Dunkelheit.
Da war es wieder. Ein dumpfes Klappern. Sie brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass das Geräusch von draußen kam. Es klang, als ob einer der Holzeimer am Brunnen in der Mitte des Hofs umgefallen wäre. Vielleicht war es auch wieder dieser vermaledeite Fuchs, der bereits des Öfteren nachts versucht hatte, in den Stall zu gelangen. Sie mussten deshalb bereits die Türen und Fenster zusätzlich befestigen, um sicherzustellen, dass dem vierbeinigen Räuber ein Festmahl in ihrem Stall verwehrt bleibt.
Vorsichtig huschte sie aus dem Bett und tastete sich Richtung Fenster vor. Vielleicht war es Gustav, der jetzt erst nach Hause kam. Vielleicht aber auch nicht. Jedem in der Gegend war bekannt, dass sie hier auf dem Anwesen lediglich zu dritt wohnten. Es würde sie nicht wundern, wenn sich das irgendjemand zunutze machen wollte.
Justine hielt den Atem an, als sie den schweren Vorhang ein Stück zur Seite schob. Gerade so weit, dass sie durch das geöffnete Fenster auf den Hof spähen konnte.
Es war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Aber der Mond versteckte sich hinter dicken Wolken und es war so dunkel draußen, dass sie nur wenige Umrisse erkennen konnte. Alles schien friedlich vor sich hin zu schlummern. Dann hörte sie erneut etwas. Ein Kratzen. Als ob jemand ein Stück Holz an der Hauswand entlangziehen würde. Das konnte unmöglich ein Tier sein. Oder doch?
Justine zuckte erschrocken zurück. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals. Was sollte sie tun? War Gustav bereits zurück? Sollte sie ihre Tante wecken? Im Haus war alles still. Offenbar hatte außer ihr niemand etwas mitbekommen.
Mit einem Anflug von Panik kauerte sie unter dem Fenster. Es dauerte einen Moment, bis sie sich wieder beruhigt hatte. Sie wusste, dass sie hier nicht untätig sitzenbleiben konnte. Ihre Aufgabe war es jetzt herausfinden, ob Gefahr drohte oder nicht.
Sie holte tief Luft, lugte erneut vorsichtig nach draußen und lauschte. Da war es wieder. Diesmal jedoch kein Kratzen. Jemand atmete schwer. Eindeutig. Es klang, als ob es direkt unter ihr war.
Langsam streckte sie den Kopf ein Stück weiter aus dem Fenster und blickte nach unten. Von hier oben ließ sich jedoch kaum etwas erkennen. Höchstens ein undefinierbarer Schatten an der Hauswand. Er bewegte sich nicht. Das könnte vielleicht doch ein Tier sein, überlegte sie. Ein großes Tier. Das könnte aber auch ein Mensch sein. Jedenfalls gehörte das dort nicht hin.
Fieberhaft dachte sie nach, was zu tun sei. Dann kam ihr eine Idee. Lautlos huschte sie ins Zimmer zurück, tastete nach der Kommode in der Ecke und griff nach dem Puderdöschen aus Metall, das sie schon lange hätte auf ihr Schminktischchen zurückstellen sollen, wo es eigentlich hingehörte. Jetzt war sie froh, dass sie es noch nicht getan hatte. Damit eilte sie zurück ans Fenster.
Sie lehnte sich so weit nach draußen, bis sie den Schatten unter ihr ausmachen konnte, visierte ihr Ziel an und ließ das Döschen fallen.
Einen Moment später gab es ein dumpfes Geräusch, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Scheppern, als das Döschen über den gepflasterten Hof hüpfte. Ein Stück entfernt von dem Schatten blieb es liegen. Der Krach schreckte die Tiere im Stall auf, die nun wild zu gackern und zu wiehern begannen. Jedoch zu ihrer Überraschung fiel der Schatten mit einem dumpfen Schlag einfach um und blieb liegen.
„Oh Gott, ich habe es getötet!“, entfuhr es Justine entsetzt und sie bekreuzigte sich hastig.
Jetzt waren auch im Haus Geräusche zu hören. Tante Babette polterte durch den Gang und stand wenige Sekunden später schnaufend, mit einem Morgenmantel bekleidet und einer Kerze in der Hand, bei ihr im Zimmer.
„Liebes, was ist passiert? Was war das für ein Krach? Was machst du denn da am Fenster?“
„Draußen im Hof ist etwas“, erwiderte sie aufgeregt. „Ich habe mein Puderdöschen danach geworfen. Ich glaube, ich habe es getötet.“
„Du hast etwas mit deinem Puderdöschen getötet?“, fragte Tante Babette ungläubig.
„Ja, ich habe was auch immer damit getroffen. Dann ist es einfach umgefallen.“
„Komm, schnapp dir die Laterne, ich nehme die Muskete und wir sehen nach, was du da getroffen hast.“
Babette machte auf dem Absatz kehrt und eilte aus dem Zimmer. Justine, die lediglich ihr Nachthemd am Leib trug, zog geschwind ihren Morgenrock über und eilte schnurstracks hinterher.
5
Vorsichtig öffneten sie die schwere Holztür und spähten in den Hof. Die Tiere im Stall hatten sich wieder weitgehend beruhigt. Abgesehen von dem ein oder anderen Grunzen war es totenstill.
Mit der geladenen Muskete im Anschlag schlich die Hausherrin vorsichtig nach draußen. Die langen Haare hatte sie nur flüchtig hochgesteckt. Einige Strähnen hingen wild über ihrem Rücken. Dicht hinter ihr folgte Justine, mit der flackernden Laterne in der Hand.
Ein paar Meter weiter an der Hauswand lag tatsächlich etwas Dunkles und bewegte sich nicht. Schritt für Schritt traten sie näher heran und stellten erstaunt fest, dass es sich um einen Mann handelte. Er lag seltsam verdreht da. Seine Augen waren geschlossen. Nicht weit davon entfernt - das Puderdöschen.
Blut tropfte aus einer kleinen Wunde an seinem Kopf und seine Kleidung war zerschlissen und verschmutzt. Schuhe hatte er auch keine an. Aber das Merkwürdigste war, dass der Mann eine Schandgeige aus Holz um Hals und Hände trug. Er war also ein Geächteter oder ein entlaufener Gefangener oder so etwas Ähnliches.
„Wie kommt der denn hierher?“, fragte Babette Dupin erstaunt.
„Ist er tot?“ Justine wusste nicht, ob ihr das in diesem Moment vielleicht sogar lieber gewesen wäre.
„Das werden wir gleich feststellen. Geh bitte ins Haus zurück und hole einen Eimer Wasser. Wenn er noch lebt, wecken wir ihn auf. Gefesselt ist er ja bereits. Da kann er uns nichts tun.“
Hastig eilte sie los, während ihre Tante weiter mit der Muskete auf den am Boden liegenden Körper zielte. Sie wollte kein Risiko eingehen.
Eine Minute später klatschte dem Mann ein Schwall eiskaltes Wasser ins Gesicht.
Prustend rang er nach Luft und öffnete verwirrt die Augen.
„Was…was…wo bin ich?“, stammelte er.
Blinzelnd versuchte er zu erkennen, wer da vor ihm stand.
„Monsieur, gestattet mir die Frage, wer Ihr seid und was Ihr auf meinem Anwesen zu suchen habt. Noch dazu in diesem jämmerlichen Aufzug.“ Babettes Stimme klang bestimmt und ungeduldig.
„Ich…also…was ist passiert?“ Er schien völlig durcheinander.
Nervös sah er sich um. Die beiden Frauen konnten Angst in seinen Augen sehen.
„Ich gebe Euch den guten Rat, meine Fragen schleunigst zu beantworten. Ich habe eine Muskelschwäche in meinem Zeigefinger. Irgendwann ziehe ich automatisch den Abzug.“ Nachdrücklich stupste sie mit dem Lauf der Muskete gegen sein Knie.
„Ein Loch in Eurem Bein dürfte bei Eurer weiteren Flucht sehr hinderlich sein. Ihr seid doch auf der Flucht, nehme ich an?“
„Ja,…bitte…ich…lasst mich bitte aufsetzen, Madame. Dann kann ich Euch alles erklären.“
Mühsam versuchte er sich hochzurappeln, doch durch die Schandgeige, die aus einem dicken Holzbrett bestand, das auseinandergeklappt werden konnte und in das drei Löcher gebohrt war, die dann Hals und Handgelenke fest umschlossen, war das für jemanden in diesem Zustand beinahe ein unmögliches Unterfangen.
Justine fasste sich ein Herz und half ihm, sich hinzusetzen.
„Vielen Dank, Mademoiselle, Ihr seid sehr gütig.“
Erneut stupste Babette den Lauf der Muskete gegen sein Bein.
„Ich werde langsam ungeduldig.“
Der Mann, der Mitte vierzig sein dürfte, im Moment allerdings deutlich älter wirkte, nickte, atmete tief durch und begann zu erzählen.
„Mein Name ist Antoine Ronno. Ich bin ein einfacher und rechtschaffener Bürger aus Charolles. Das ist eine kleine Siedlung, etwa drei Tagesreisen südlich von hier, schätze ich.“ Er machte eine kurze Pause. „Ich wurde ungerechtfertigterweise mit diesem Schmuckstück ausgestattet und durch das Dorf getrieben. Als man mich danach damit im Fluss ertränken wollte, gelang es mir, meinen Peinigern zu entkommen. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich bin unschuldig. Das müsst Ihr mir glauben, edle Dame.“
Babette zog skeptisch eine Augenbraue nach oben.
„Was wirf man Euch vor?“, fragte Justine, während sie auf das hölzerne Folterinstrument und die darin eingeklemmten blutig gescheuerten Handgelenke starrte.
„Man bezichtigt mich des Betrugs. Der Hufschmied hatte eines meiner Pferde neu beschlagen. Zwei Livre habe ich ihm dafür bezahlt. So, wie wir es vereinbart hatten. Doch dann behauptete er plötzlich, ich hätte ihn bedroht und mich geweigert zu bezahlen. Keines von beidem entspricht der Wahrheit.“ Er seufzte und ließ die Schultern hängen. „Kurz darauf standen die Soldaten des Königs vor meiner Tür, haben mich aus dem Haus gezerrt und auf dem Dorfplatz an den Pranger gestellt. Drei Tage musste ich dort ausharren. Wurde mit Unrat beworfen und bin bespuckt worden. Danach haben mir dieselben Soldaten dieses lästige Teil um den Hals gelegt und mich durch das Dorf getrieben. Als es schließlich zum Fluss gehen sollte, schaffte ich es zu entkommen. Dann bin ich gerannt, so gut es eben ging.“
Er sah zu den beiden Frauen auf. „Irgendwie bin ich hier angekommen. Ich weiß nicht, ob man mich verfolgt oder wie weit ich es noch schaffe. Ich wollte mich nur kurz an die Mauer lehnen und einen Moment ausruhen. Dann hat mich etwas am Kopf getroffen. Mehr weiß ich nicht mehr.“ Seine Worte wurden immer unverständlicher und er kippte ohnmächtig zur Seite.
6
Als er wieder zu sich kam, lag er auf einem Bett in einer schlichten, aber geräumigen Kammer. Die Wunde an seinem Kopf war gereinigt und versorgt worden. Es war bereits hell und die Sonne schien durch das kleine Fenster. Justine saß auf einem Stuhl und lächelte ihn an.
„Wie schön, Ihr seid aufgewacht, wie fühlt Ihr Euch?“
„Oh, etwas benommen. Aber verzeiht, schöne Frau, darf ich Euren Namen erfahren und könnt Ihr mir bitte verraten, wo ich hier bin?“
„Ich heiße Justine. Ihr befindet Euch auf dem Anwesen meiner Tante Babette Dupin, der Witwe des Marquis de Pollin. Als Ihr ohnmächtig geworden seid, haben wir Euch ins Haus gebracht.“
„Das ist das Anwesen des Marquis de Pollin?“, fragte er ungläubig. „Ich denke, dann bin ich hier sicher.“ Erleichtert stieß er die Luft aus.
„Wie kommt Ihr darauf?“
„Der Marquis galt zeitlebens als Menschenfreund, als gütig und gerecht. Ein Jammer, dass er nicht mehr unter uns weilt.“
„Ja, das ist es“, bestätigte sie traurig.
„Könntet Ihr mich wohl von diesem Instrument hier befreien? Ich wäre Euch sehr dankbar dafür. Es ist doch mit der Zeit ziemlich hinderlich.“ Ungelenk wackelte er mit der Halsgeige, mit der er immer noch gefesselt war.
„Prinzipiell ja, aber wer sagt denn, dass Ihr der seid, für den Ihr Euch ausgebt? Und wenn ja, wer sagt, dass Eure Geschichte wahr ist?“
„Ja, das ist ein Dilemma. Ich kann das gut verstehen. Mir zu vertrauen, bedeutet für Euch ein Risiko. Ich kann bedauerlicherweise nicht mehr tun, als zu beteuern und bei Gott zu schwören, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Der Rest liegt an Euch.“
Justine stand auf und ging zur Tür.
„Wartet bitte einen Moment, Monsieur Ronno. Ich werde mich mit meiner Tante besprechen.“
„Danke – und nennt mich bitte Antoine.“
„Also gut, Antoine.“ Sie lächelte sanft. „Ich bin gleich zurück.“
7
Ein paar Minuten später erschien Gustav mit einem Hammer und einer Zange in der Kammer.
„Monsieur – auch wenn ich nicht sicher bin, dass dies eine gute Idee ist, werden wir das Experiment wagen und Euch von diesem Monstrum befreien.“
Mit dem Geschick eines erfahrenen Handwerkers entfernte er das Schloss der Schandgeige und nahm sie Antoine ab.
„Vielen Dank. Ihr seid sehr gütig. Das werde ich Euch nicht vergessen.“
„Kommt bitte mit. Madame Dupin wartet oben in der Halle auf Euch. Ich führe Euch zu ihr. Und benehmt Euch, sonst habt Ihr das Ding schneller wieder um den Hals, als Ihr bis drei zählen könnt.“
Kaum waren die beiden aus dem Raum, schlich Justine in die Kammer und betrachtete fasziniert das Folterinstrument, das nun dort in der Ecke stand. Vorsichtig streckte sie den Finger aus und fuhr über die gehobelte Holzkante. Sie fühlte sich hart und robust an. Die Löcher für die Hände waren dunkel mit verkrustetem Blut verschmiert, die Metallbeschläge rostig und verbogen. Trotz seines abgewetzten Zustands strahlte dieses „Ding“ eine unheimliche Macht aus. Was sich Menschen so alles ausdachten, um andere zu demütigen, ging es ihr durch den Kopf.
8
„Antoine, da seid Ihr ja“, empfing ihn Babette freundlich. „Ich darf doch Antoine zu Euch sagen? Ich freue mich, dass Gustav Euch von dieser schrecklichen Last befreien konnte. Ich hoffe, es war kein Fehler.“ Sie deutete auf einen der schweren Ledersessel. „Bitte nehmt Platz. Wir werden sogleich Eure Handgelenke versorgen. Aber trinkt erst einmal einen Schluck zur Stärkung. Ich habe hier einen vorzüglichen Tropfen aus Portugal.“ Sie reichte ihm ein Glas.
„Habt Dank, Madame Dupin. Meinen Handgelenken geht es gut. Aber ich bin Euch zutiefst verbunden für Eure Hilfe und Eure Gastfreundschaft. Ihr werdet es nicht bereuen. Für mich müsst Ihr Euch keine Mühe machen. Ich gedenke, Euer Anwesen unverzüglich wieder zu verlassen.“
Sie sah ihn kritisch an.
„Das dachte ich mir. Und wo genau wollt Ihr hin?“, fragte sie.
„Das weiß ich noch nicht. Aber selbst, wenn ich es wüsste, wäre es zu meinem und Eurem Schutz besser, es Euch nicht zu sagen. Eventuell sucht man nach mir.“ Er machte eine kurze Pause und fragte dann. „Kann ich darauf zählen, dass Ihr mich nicht verraten werdet?“
„Mein lieber Antoine. Glaubt mir, hätte ich das gewollt, säßet Ihr bereits im Kerker.“
„Ich danke Euch, Madame Dupin. Ihr seid sehr gütig und ein wahrer Menschenfreund. Aber gestattet mir eine Bitte. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Für eine kleine Stärkung wäre ich Euch zutiefst zu Dank verpflichtet. Ich bezahle selbstverständlich dafür. Danach werde ich unauffällig verschwinden.“
„Aber bitte – wollt Ihr mich beleidigen? Ihr seid mein Gast. Ihr könnt Euch stärken, wie es Euch beliebt. Ich werde meine Nichte bitten, etwas zuzubereiten und Euch vor allem neu einzukleiden. In diesem Aufzug werdet Ihr nicht von hier fortgehen.“
Er wollte gerade etwas darauf erwidern, als eilige Schritte zu hören waren und einen Moment später Gustav durch die Tür gestürmt kam.
„Madame, bitte verzeiht, aber es kommen Reiter auf das Anwesen. Es sieht so aus, als wären es Soldaten.“
„Danke, Gustav“, erwiderte Babette. „Folgt mir, Antoine. Ihr könnt nicht hierbleiben. Ich werde Euch in ein kleines Versteck führen, bis die Situation geklärt ist.“
9
Babette stand an der geöffneten Tür des Herrenhauses, als sechs schwer bewaffnete Soldaten in der Uniform des königlichen Regiments mit schnaubenden Rössern durch das große Tor in den Hof geritten kamen.
Auf das Zeichen ihres Anführers hin stellten sie sich in einer Reihe nebeneinander auf. Die Musketen geschultert, die Säbel mit güldenen Griffen in der Scheide und die Haltung diszipliniert steif. Vorneweg der Lieutenant, der zum Gruß die Hand hob und mit dem Kopf eine Verbeugung andeutete.
„Madame Dupin?“, fragte er in humorlosem Ton.
„Was verschafft mir die Ehre, Lieutenant?“, antwortete sie zuckersüß.
„Wir sind auf der Suche nach einem flüchtigen Mörder, Verräter und Geächteten. Er wurde etwas weiter südlich von hier gesehen. Ist Euch etwas Verdächtiges aufgefallen oder habt Ihr jemand Fremdes gesehen?“
Babette überlegte, ob sie eher die Empörte oder lieber die Erschrockene spielen sollte, entschied sich jedoch dann für Letztere.
„Ach du lieber Gott!“ Entsetzt schlug sie die Hände vor den Mund. „Wie kann es nur so schlechte Menschen geben? Wie sieht er aus? Sind wir in Gefahr?“
„Das kann ich nicht ausschließen, Madame. Er hat dunkle Haare, ist mittleren Alters und trägt eine Schandgeige. Eventuell konnte er diese jedoch bereits ablegen.“
„Nein, wir haben hier schon länger keine Fremden mehr gesehen. Sollen wir Wachen aufstellen?“
„Dazu würde ich Euch raten.“ Prüfend sah er sich im Hof um. „Ihr habt also niemand dergleichen gesehen?“
„Aber das sagte ich doch bereits, Lieutenant.“
„Dann verzeiht bitte die Störung.“ Er sah kurz zu seinen Männern. „Würdet Ihr uns gestatten, hier eine kurze Rast einzulegen, bevor wir weiterreiten. Die Pferde benötigen eine Pause und etwas Wasser. Wir werden uns so lange ein wenig in der Gegend umsehen. Nur um sicherzugehen, dass sich hier niemand versteckt hat.“
„Natürlich, Lieutenant. Führt die Pferde an die Tränke, sie wurde heute Morgen frisch gefüllt. Kann ich Euch und Euren Männern eine Stärkung anbieten?“
„Das ist sehr gütig, Madame Dupin. Wenn Ihr mir erlaubt zu bemerken, dass ich den Marquis de Pollin stets sehr geschätzt habe.“
„Vielen Dank. Das ehrt ihn und auch mich. Habt Ihr ihn persönlich gekannt?“
„Nur flüchtig. Wir sind uns ein paar Mal bei Hofe begegnet.“
„Dann lasst es mich wissen, wenn es Euch an etwas fehlt.“ Sie lächelte sanft und wandte sich an Gustav. „Gustav, bitte bringt unseren Gästen etwas Wein und Käse und sorgt dafür, dass es ihnen an nichts fehlt, solange sie bei uns rasten.“
Damit machte sie auf dem Absatz kehrt und ging mit erhobenem Haupt und stolzem Schritt zurück ins Haus.
10
Nachdem die Soldaten sich ausgeruht und ein wenig in der Gegend umgesehen hatten, sattelten sie auf und ritten weiter.
Erleichtert eilte Babette in die Bibliothek. Dort gab es, verborgen hinter einem der hohen Bücherregale, einen kleinen fensterlosen Raum, in dem Antoine still und geduldig ausharrte.
Die Kammer war ein Relikt aus vergangenen Zeiten und eigentlich mehr eine Art Zwischenwand. Gerade groß genug, um darin auf einem Hocker zu sitzen und dabei nicht mit den Knien an der Wand anzustoßen.
In früheren Zeiten wurde sie zu Spionagezwecken genutzt. Durch ein kleines Loch ließ sich direkt in den Teesalon spähen. Hatte der Marquis Gäste, war es zuweilen durchaus hilfreich, diese dort etwas warten zu lassen, was der Marquis wiederum von der Kammer aus beobachtete. Auf diese Weise konnte man Dinge erfahren, die einem ansonsten verborgen geblieben wären.
Scherzhaft wurde der kleine Raum von den Eingeweihten daher „Beichtstuhl“ genannt.
„Sie sind weg“, sagte Madame Dupin, als sie die im Bücherregal verborgene Tür öffnete. „Aber sagt, wie steht es bei Euch mit der Wahrheit? In Eurer Darstellung seid Ihr unschuldig, während die Soldaten davon berichten, einen Mörder zu suchen. Es wäre zu gütig, wenn Ihr uns das erklären könntet, Antoine.“ Ihr Unterton signalisierte, dass sie in dieser Sache keine Ausflüchte dulden würde.
„Ich? Ein Mörder?“ Antoine wurde blass. „Bitte, Madame. Das ist in höchstem Maße absurd.“ Er rieb sich die geschundenen Handgelenke. „Ich bin nichts dergleichen. Das schwöre ich Euch bei allem, was mir heilig ist. Ich verstehe nicht, was hier gespielt wird, aber offensichtlich hat jemand großes Interesse daran, mich aus der Welt zu schaffen.“
Babette schob das Bücherregal wieder zu.
„Nun gut, ich bin nicht überzeugt, aber ich will Euch fürs Erste Glauben schenken. Jetzt geht in die Küche. Justine hat etwas zu essen gerichtet. Stärkt Euch in aller Ruhe und dann sehen wir weiter.“
„Madame, ich versichere Euch…“
„Geht jetzt, bitte.“