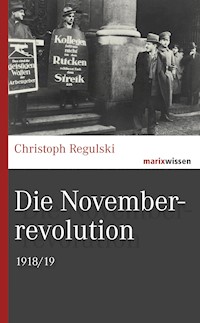
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: marixwissen
- Sprache: Deutsch
Die Novemberrevolution 1918 und die durch sie entstandene Weimarer Republik sind ein Meilenstein der deutschen Geschichte. Christoph Regulski erklärt verständlich die Ursachen, den Verlauf und die Ergebnisse der revolutionären Ereignisse bis in das Jahr 1920. Trotz ihrer Errungenschaften ist noch immer die Rede von einer unvollendeten Revolution 1918/19. Dass die aus ihr hervorgegangene Republik nach einem Jahrzehnt katastrophal scheiterte, verdunkelte stets den Blick auf ihren Ursprung. Waren dort nicht all die Fehler schon gemacht worden, die den Untergang zwangsläufig nach sich zogen? Einerseits wurden eine Demokratie mit einer modernen Verfassung, ein Wahlrecht auch für Frauen und der Bruch mit der Monarchie erreicht. Andererseits geschahen Grausamkeiten gegen politische Gegner und das eigene Volk. Liebknecht und Lu- xemburg wurden ermordet, als sie mit Hunderttausenden die weitergehende soziale Revolution einforderten. Diesen Protest brachen Soldaten, die unbeschreibliche Gemetzel anrichteten. Nun standen sich SPD und KPD verfeindet gegenüber und Zentrum und Liberale trugen den Staat. Angesichts des Nationalsozialismus erwies sich dieser gesellschaftliche Konsens als zu dünn. Nach dem Krieg knüpfte man an die Weimarer Republik an, weil sich zeigte, was man verloren hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Regulski
Die Novemberrevolution
1918/19
INHALT
1.EINLEITUNG
2.BIS ZUR REVOLUTION VON 1918
2.1Die SPD im Kaiserreich
2.2Abspaltung der USPD
2.2.1Russische Revolutionen 1917
2.3Unruhen in der Hochseeflotte 1917
2.4Voraussetzungen des Waffenstillstands 1918
2.5Die Regierung des Prinzen Max von Baden
2.6Abdankung des Kaisers
3.DIE ERSTE REVOLUTIONSPHASE
3.1Revolutionsbeginn in Kiel
3.2Das Rätesystem
3.3Novemberrevolution in Berlin
3.4Der Rat der Volksbeauftragten
3.4.1Die Sozialisierungsfrage
3.4.2Militärische Kontinuität
3.5Das Stinnes-Legien-Abkommen
3.6Der Reichsrätekongress 1918
3.7Weihnachtsunruhen 1918
3.8Gründung der KPD
4.DIE ZWEITE REVOLUTIONSPHASE
4.1Januarkämpfe in Berlin
4.1.1Reichsweite Aufstände gegen die Regierung
4.2Die Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs
4.3Die Bremer Räterepublik
4.4Der Freistaat Bayern unter Kurt Eisner
4.5Freistaat Preußen
4.6Parteien
4.6.1Die Verfassunggebende Nationalversammlung
5.DIE DRITTE REVOLUTIONSPHASE
5.1Märzunruhen 1919
5.1.1Die Münchener Räterepublik
5.2Die Verfassung der Weimarer Republik
5.3Revolutionäres Aufbäumen 1920
6.RÜCKBLICK UND AUSBLICK
6.1Zeitstrahl
7.LITERATUR
7.1Quellen
7.2Literatur
8.BILDNACHWEIS
1.EINLEITUNG
Die Weimarer Republik ist ein Meilenstein und Wendepunkt in der deutschen Geschichte und der Ursprung unserer heutigen Demokratie. Den Boden für diese Entwicklung bereiteten die Revolution und die Ausrufung der Republik am 9. November 1918.
Beide Ereignisse gingen auf den Aufstand der Kieler Matrosen vom 30. Oktober 1918 zurück. Ursache für diese Auflehnung war der von der Seekriegsleitung erlassene Befehl, in eine militärisch sinnlose Schlacht gegen die britische Royal Navy auszulaufen. Zu diesem Zeitpunkt war nach mehr als vier Jahren Krieg die Niederlage des deutschen Kaiserreichs bereits besiegelt, diese Tatsache war den Kieler Matrosen bewusst. Sie verweigerten den Gehorsam, der Aufstand griff immer weiter um sich, wurde nicht niedergeschlagen und führte zur Revolution – gegen das Kaiserreich, die Vormacht des Militärs, gegen Hunger, extreme Arbeitsbedingungen und gegen die Bürokratie als Herrschaftsinstrument.
Zugleich schlossen führende demokratische Politiker zu Beginn der Revolution einen Waffenstillstand mit den Alliierten, der das millionenfache weltweite Blutvergießen des Ersten Weltkrieges beendete. Eine gemäßigte sozialdemokratische Regierung sorgte für geordnete Verhältnisse in der Heimat und schaffte es, ein Heer von acht Millionen Soldaten friedlich zurückzuführen und den allermeisten Kriegsteilnehmern in kurzer Zeit wieder eine zivile berufliche Perspektive zu geben. Die Verwaltung arbeitete weiterhin zuverlässig, der Wirtschaft gelang die Umstellung auf die zivile Produktion. Vor diesem Hintergrund ließ die Regierung eine moderne demokratische Verfassung ausarbeiten, die unserem heutigen Grundgesetz als Vorbild diente. Alle Macht ging nunmehr vom Volke aus, die Monarchie war nach Jahrhunderten mitunter unumschränkter Herrschaft abgeschafft.
Doch trotz dieser richtungsweisenden Beschlüsse und Ereignisse ist nicht allzu viel Positives zu lesen, wenn man einen ersten Blick auf die Literatur zur Deutschen Revolution des Jahres 1918/19 wirft. Oftmals ist die Rede von einer abgebrochenen Revolution, einer unvollendeten Revolution, einer Revolution ohne klar erkennbare Ziele oder gar von einer verratenen Revolution. Dass die aus der Revolution des 9. Novembers 1918 hervorgegangene Weimarer Republik nach etwas mehr als einem Jahrzehnt katastrophal scheiterte, verdunkelte stets den Blick auf ihren Ursprung. Waren dort nicht all die Fehler schon gemacht worden, die den Untergang der Demokratie zwangsläufig nach sich zogen?
Ganz sicher finden sich Entwicklungslinien, die zum Scheitern des Staates führten, und unbestritten sind von allen politisch Handelnden falsche Entscheidungen getroffen worden, die das innenpolitische Klima belasteten.
Und dennoch: Brachte die Revolution nicht auch bis dahin vollkommen ungeahnte Möglichkeiten mit sich, die es auszuloten galt? War ihr Scheitern tatsächlich zwangsläufig, unausweichlich? Mit der Verfassung aus dem Jahr 1919 war nach langem innenpolitischen Kampf jedenfalls eine Grundlage geschaffen, auf der sich die Demokratie festigen konnte.
In diesem Band stehen die Ereignisse der deutschen Revolution 1918/19 im Zentrum der Betrachtung. Sie erhielt schon sehr früh die Bezeichnung »Novemberrevolution«. Auch wenn mit diesem Begriff die Auswirkungen zeitlich eher begrenzt erfasst sind, hat er sich bis heute als feste Größe gehalten und wurde deshalb auch als Titel gewählt. Um zu verstehen, was sich um den 9. November 1918 ereignete, muss der Blick zurück in das Kaiserreich und auf den Ersten Weltkrieg gelenkt werden. Dort kam es zu grundlegenden Entscheidungen, die den Verlauf der Revolution maßgeblich vorherbestimmten. Vor allem lohnt sich die Beschäftigung mit der wichtigsten Partei in der deutschen Revolution, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD): Wie wirkte sich die politische Entwicklung der SPD seit ihrer Gründung im Jahr 1875 von einer ausgegrenzten, oppositionellen Partei zur stärksten politischen Kraft im letzten Reichstag vor dem Ersten Weltkrieg aus? War sie wirklich noch eine revolutionäre Partei, wie es in ihren Programmen stets zu lesen war?
Die Revolution brachte Deutschland den Frieden. Der in den ersten Tagen der neuen Regierung Ebert vereinbarte Waffenstillstand wäre nach geltender Übereinkunft aber eigentlich Aufgabe der unterlegenen militärischen Führung gewesen. Verbarg sich hinter dem positiven Akt des Friedensschlusses aber nicht auch eine mögliche Angriffsfläche gegen den jungen Staat? Nun war es jedenfalls von nationalistischer Seite aus leicht, die Behauptung aufzustellen, Demokraten hätten den Krieg mit einer Niederlage beendet. Ungeachtet der historischen Absurdität dieser Argumentation bleibt zu betrachten, wie sie sich langfristig auf die Innenpolitik auswirkte.
In jeder Revolution werden plötzlich neue politische und gesellschaftliche Kräfte frei, die bis dahin entweder im Verborgenen schlummerten oder bewusst unterdrückt worden waren – so auch in der Revolution von 1918/19. Welche Kräfte waren es, die in den Ereignissen der wichtigen Novembertage auf einmal sichtbar wurden und das Straßenbild, die Betriebe und die Kasernen prägten? Wie war es um deren politische Grundhaltung bestellt? Waren die Träger der Revolution wirklich ausschließlich Radikale, die alles grundlegend verändern wollten? Nutzten sie ihre tatsächliche Macht, ob bewaffnet oder qua Organisation, um dem Revolutionsverlauf ihren Stempel aufzudrücken? Damit ist aufs Engste die Frage verbunden, wie diese Kräfte, die sich in den Arbeiter- und Soldatenräten festigten, zu den sozialdemokratischen Parteien standen. Hier sind wir bereits auf der Ebene der politischen Entscheidungsträger angelangt. Ganz zentral für die Entwicklung Deutschlands waren die sozialdemokratischen Vorstellungen von einem zukünftigen Staat. Inwieweit befürworteten die beiden Parteien – die SPD hatte sich 1917 in zwei Lager gespalten – Veränderungen des staatlichen Systems? Blieben sie auch in der Revolution durch die jahrzehntelange Einbindung in das Kaiserreich zu stark an dessen Strukturen gebunden? Bis zu welchem Grad konnten sie gesellschaftliche Veränderungen gutheißen? Diese Fragen berühren ganz besonders die entscheidenden Themenblöcke Monarchie, Demokratisierung, Bürokratie und Militär. Weiterhin war die Forderung nach einer Sozialisierung oder aber Verstaatlichung der deutschen Wirtschaft ein äußerst wichtiges Anliegen der Revolution. Auf diesen Feldern wollten die radikalen Kräfte schnelle und nachhaltige Veränderungen in Gang setzen, und so ist zu untersuchen, was erreicht wurde, was erreicht werden konnte und was im November 1918 unmöglich erschien.
In den politisch unübersichtlichen Verhältnissen, die jede Revolution erst einmal nach sich zieht, ist auch für die deutsche Revolution 1918/19 zu schauen, wo die Kräfte der Kontinuität walteten. Waren sie nur in den Parteien oder auch bei den Arbeitern und ihren etablierten Vertretungen, den Gewerkschaften, anzutreffen? Standen sich innerhalb von Parteien und Arbeiterschaft gar entgegengesetzte Kräfte gegenüber, die schließlich ihre inhaltlichen Konflikte offen austrugen? Bei der Polarisierung dieser Kräfte zu Beginn des Jahres 1919 ist dann genau zu betrachten, welche Gruppe sich mit welcher Strategie und welchen Mitteln durchzusetzen versuchte. Dabei rückt die Frage nach der Gewaltanwendung in einer bis dahin friedlichen Revolution in den Vordergrund. Durch die im Januar 1919 einsetzenden bewaffneten Auseinandersetzungen entstand eine neue Situation. Gingen die regierenden Sozialdemokraten dabei zur Abwehr radikaler Forderungen eine fatale Bindung mit militärisch-reaktionären Kräften ein, weil sie deren totale Ablehnung des neuen Staates sträflich unterschätzten? Ja, mehr noch – machte die SPD damit einen ihrer Gegner auf lange Sicht erst wieder stark und ermöglichte so die Basis für demokratiefeindliche Bestrebungen?
In dieser komplexen Lage ist es besonders wichtig, eine klare Linie auszumachen. Bestand diese in dem Bemühen um eine Demokratie, die auf einer Verfassung basierte? Und: Wurde dieses Anliegen von einer Mehrheit mitgetragen? Dabei ist zu klären, wie dieses Ziel erreicht werden sollte. Eröffnete eine demokratische Wahl zu einer Verfassunggebenden Nationalversammlung nicht auch restaurativen Kräften die Möglichkeit, Einfluss zu gewinnen? Konnte eine solche Wahl eventuell Verluste für die Sozialdemokraten beider Parteien nach sich ziehen? Stellten demnach die Regierenden die Interessen des Staates über ihre eigenen Partei- und Machtinteressen?
Aus den durchaus unterschiedlichen Entwicklungslinien zwischen Bewahrung, Demokratisierung oder Sozialisierung resultierte eine fast schon greifbare Spannung. Da die Gegensätze aber nicht zu jedem Zeitpunkt gleich stark ausgeprägt waren, kann der Revolutionsverlauf in einzelne Phasen gegliedert werden. So ist es naheliegend, eine erste, friedliche Phase der Revolution bis zu den sogenannten Weihnachtsunruhen des Jahres 1918 zu definieren. In dieser Zeit wurde über die unterschiedlichen Vorstellungen in Gesprächen, Konferenzen und Kabinettssitzungen entschieden. Als sich hier die Entwicklung hin zu einer demokratischen Verfassung abzeichnete, die weitergehende sozialistische Veränderungen nicht in vollem Umfang berücksichtigte, radikalisierten sich in einer zweiten Phase die Kräfte, die genau dafür eintraten.
In dieser zweiten, gewalttätigeren Phase kam es zu offenen Auseinandersetzungen und der Bildung lokaler sozialistischer Regierungen in Deutschland. Hier wird zu schauen sein, ob diese eine Alternative darstellten, von welchen Gruppen sie getragen wurden und welche Gegner sie hatten. Wie sah das Ergebnis dieser Revolutionsphase aus? War es ein endgültiges, oder zumindest ein so weit weichenstellendes, dass sich die Gewichte hin zu einer demokratischen Staatsform verschoben? War dann eine dritte Revolutionsphase überhaupt erforderlich oder bereits vergebliches Bemühen?
In dieser dritten Phase kam es schließlich zu dramatischen Ereignissen, die die Geschichte der jungen Demokratie maßgeblich beeinflussten. Zunächst ging diese Phase von einem militärischen Putsch von rechts aus. Meldete sich damit eine längst überwunden geglaubte Kraft dauerhaft zurück? Wie konnte diese sich so kurz nach der Revolution derart festigen und einen restaurativen Umsturz wagen? Hatte sie überhaupt Aussicht auf Erfolg? Zu den Gegnern des Putsches gehörte vor allem die demokratische Reichsregierung, die einen erfolgreichen Generalstreik ausrief. Wer befolgte diesen mit welchen Zielen? War mit der Gegnerschaft zu einem Militärputsch das Bekenntnis zur Republik verbunden? Diese Fragestellungen lenken den Blick auf die Industrieregionen Deutschlands. Im Zentrum des Geschehens stand das Ruhrgebiet, wo sich eine Rote Ruhrarmee zusammenfand, um gegen den Putsch zu kämpfen. Dabei muss aber auch gefragt werden, ob diese Kampfformation weitergehende Ziele verfolgte als die Verteidigung der Demokratie. War die Konstellation des Frühjahrs 1920 nicht die letzte Möglichkeit, das Pendel nach der linken Seite ausschlagen zu lassen und mit der zentralen Forderung nach einer Verstaatlichung des Bergbaus ernst zu machen?
In dieser von vielen, ganz unterschiedlichen Kräften geprägten Zeit werden die Hauptentwicklungslinien mit ihren jeweiligen Ergebnissen verfolgt. Parallel dazu wird zu schauen sein, welche Alternativen bestanden und welche Optionen sie beinhalteten. Nur so lassen sich Verlauf und Ergebnis der deutschen Revolution der Jahre 1918/19 und ihrer Ausläufer im Jahr 1920 würdigen, die für die Entwicklung der jungen Weimarer Republik entscheidend waren.
2.BIS ZUR REVOLUTION VON 1918
2.1Die SPD im Kaiserreich
Die wichtigste politische Kraft der deutschen Revolution 1918/19 war die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), deren Gründung auf das Jahr 1875 zurückgeht. Damals vereinigten sich in der thüringischen Residenzstadt Gotha der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein von Ferdinand Lassalle und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei unter der Führung August Bebels und Wilhelm Liebknechts zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD), die 1890 in SPD umbenannt wurde und auch heute noch so heißt. Der Ort Gotha wird später, 1917, noch einmal eine bedeutende Rolle in der Parteigeschichte spielen. Die SPD war den Gedanken und Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels verpflichtet, die eine Überwindung des kapitalistischen Systems durch eine Revolution prophezeiten.
Diese Ideologie prägte die Partei besonders in der Zeit ihres Verbots durch das »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« von 1878, besser bekannt als Sozialistengesetz. Dieses Gesetz verbot die SPD und untersagte allen Mitgliedern die politische Betätigung außerhalb eines bereits errungenen Mandats. Die Sozialdemokraten waren massiven Repressalien ausgesetzt, und viele Mitglieder emigrierten. Nach Bismarcks Entlassung als Reichskanzler wurde das Gesetz im Jahr 1890 nicht verlängert, und so konnte die SPD zwölf Jahre später wieder legal in Deutschland arbeiten und zu Wahlen antreten.
In einer sich seit den 1890er-Jahren innenpolitisch stabilisierenden Lage forderte Eduard Bernstein, der 1891 noch zusammen mit Karl Kautsky das revolutionäre Erfurter Programm verfasst hatte, bald eine neue, zukunftsweisende Ausrichtung der Partei und entfernte sich von marxistischen Grundlagen. In seinem Londoner Exil hatte er gründlich die Entwicklung während der vergangenen Jahrzehnte untersucht und bescheinigte der kapitalistischen Wirtschaft eine große Wandlungsfähigkeit. Sie sei in der Lage, durch Zugeständnisse seitens der Arbeitgeber die zuvor sehr hohen Belastungen der Arbeiter zu mindern. Nach Bernstein musste es demnach auch zukünftig möglich sein, auf diesem Weg die Verhältnisse der Beschäftigten spürbar zu verbessern und somit langfristig einen gesellschaftlichen Ausgleich herbeizuführen. Dieses Konzept, 1899 erstmals formuliert, stieß auf heftigen Widerstand innerhalb der Partei und wurde auf dem Dresdner Parteitag 1903 abgelehnt. Durch die damit verbundene Abkehr von revolutionären Prinzipien bekam es die Bezeichnung »Revisionismus«. Besonders um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die einer strengen marxistischen Richtung in der Partei angehörten, fand sich eine Gruppierung, die bis in die Revolution von 1918/19 hinein die traditionelle Position vertrat.
Ein Blick auf die deutsche Innenpolitik um die Wende zum 20. Jahrhundert schien aber der Programmatik Bernsteins in der Praxis Recht zu geben. Stellte sich in einem wirtschaftlich gefestigten, hochindustrialisierten und militärisch starken Staat unter monarchischer Führung tatsächlich noch die Frage einer Revolution, zumal die Arbeiter durch sichere Arbeitsplätze und steigende Löhne ebenfalls profitierten? Gewiss, vieles lag noch im Argen, wenn man nur an die Wohnverhältnisse in den Ballungszentren denkt, an die trotz der Sozialversicherungen immer noch schwierige Lage bei Krankheit oder im Alter – aber ließen sich diese Fragen nicht doch eher durch einen Dialog lösen?
Ein Blick in das Großherzogtum Baden scheint diese Annahme zu bestätigen. In dem durch den liberalen und beliebten Großherzog Friedrich I. regierten Bundesstaat hatte sich die SPD schon vor 1900 auf eine praktische Zusammenarbeit mit den liberalen Parteien und dem katholischen Zentrum verständigt. Obwohl von der Parteizentrale kritisiert, hielten die badischen Sozialdemokraten an ihrem Kurs fest, da aus Berlin keine praktikable Alternative aufgezeigt werden konnte. Aber auch in anderen Staaten – das Kaiserreich bestand aus 22 Bundesstaaten und den drei freien Städten Hamburg, Bremen und Lübeck sowie dem Reichsland Elsaß-Lothringen – spielte sich eine Zusammenarbeit in den jeweiligen Landesparlamenten ein. In dem kleinen Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt bekleidete der Sozialdemokrat Franz Winter von 1912 bis 1920 sogar das Amt des Landtagspräsidenten. Hier schien die in dem Erfurter Programm formulierte Ausrichtung nur noch als theoretische Grundlage zu bestehen. Die politische Praxis hingegen sah ganz anders aus, auch wenn die SPD sich programmatisch noch nicht dazu bekannte.
Lediglich in dem größten deutschen Staat Preußen war die SPD durch ein ungerechtes Dreiklassenwahlrecht weitgehend chancenlos. Das Wahlrecht unterteilte alle Wähler (Frauen besaßen weder das aktive noch das passive Wahlrecht) in drei Klassen, die nach dem Steueraufkommen bestimmt wurden. So konnte es in einigen Kreisen dazu kommen, dass zwei oder drei Wähler in der ersten Klasse so viele Stimmen hatten wie tausende Wähler aus der dritten Klasse. Da die erste Klasse fast ausschließlich aus Fabrikanten und Gutsbesitzern und die zweite Klasse überwiegend aus dem gut verdienenden Bürgertum bestand, fielen die Stimmen aus beiden Gruppen den liberalen oder konservativen Kandidaten zu. Die SPD als Partei der dritten Klasse war somit im preußischen Staat stark unterrepräsentiert. Das Wahlrecht für den Reichstag hingegen war liberaler. Es war ein direktes, gleiches und geheimes Wahlrecht für Männer. Auch hier blieben die Frauen außen vor.
Frauen durften erstmals nach der Novemberrevolution, bei der ersten reichsweiten Wahl zur Verfassunggebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919 wählen. Diese Wahl zu Beginn der Weimarer Republik war auch die erste reichsweite Wahl im Verhältniswahlrecht. Ein großer Nachteil im damaligen Wahlsystem bestand in den durch die Industrialisierung völlig veränderten Wahlkreisen. So waren für den Gewinn eines Mandats aus den Ballungszentren hunderttausende Stimmen erforderlich, während es in entlegenen Provinzen ausreichte, einige zehntausend Stimmen zu erringen. Trotzdem gelang der SPD ein enormer Aufschwung, der zwar durch einzelne Rückschläge gekennzeichnet war, aber auf lange Sicht stetig verlief. So erreichte die Partei bei den letzten Reichstagswahlen vor dem Weltkrieg im Jahr 1912 mehr als ein Drittel der Stimmen und stellte durch 110 direkt gewonnene Mandate die meisten Abgeordneten. Hier bewahrheitete sich in der politisch-parlamentarischen Praxis die Idee Bernsteins. Die SPD war zu einem innenpolitisch äußerst wichtigen Faktor geworden, an dem über kurz oder lang kein Weg vorbeiführte. Allein die Mitgliederzahl, die 1914 erstmals über einer Million lag, war herausragend. Keine andere politische Partei hatte auch nur annähernd vergleichbare Zahlen vorzuweisen.
Das Bild der Partei prägte kurz vor dem Weltkrieg vor allem ein Mann: Friedrich Ebert. Er stieg bis zum Vorsitzenden auf und führte die Partei zusammen mit Hugo Haase. Ebert war durch seine Geburt in Heidelberg Bürger des Großherzogtums Baden. Aus einfachen Verhältnissen als Sattlermeister arbeitete er sich hoch und führte, wie zuvor der berühmte, 1913 verstorbene Vorsitzende August Bebel, einen Handwerksbetrieb. In der Partei ragte Ebert vor dem Krieg in den großen Debatten nicht heraus, da seine Stärke eher auf organisatorischem Gebiet lag. Er führte die Partei in modernen Strukturen weiter und legte großen Wert auf Disziplin. Diese Eigenschaften, verbunden mit einer erheblichen Durchsetzungsfähigkeit und auch Beharrlichkeit, ließen ihn zum unumstrittenen Vorsitzenden der Partei und maßgebenden Politiker der Revolutionszeit werden.
Hugo Haase war von seiner Persönlichkeit her das Gegenteil von Ebert. Er war studierter Jurist, ein kluger Kopf, blieb aber stets der abwägende Charakter; Entschlüsse fielen ihm schwer. In der Partei wurde es für ihn zusehends schwieriger, seine im klassisch sozialdemokratischen Denken verhafteten Prinzipien durchzusetzen. Besonders der 4. August 1914 war für Hugo Haase ein schwarzer Tag. In der Probeabstimmung konnte er sich mit der von ihm befürworteten Ablehnung der Kriegskredite nicht durchsetzen. Dennoch fiel ihm die Aufgabe zu, am nächsten Tag die Zustimmung seiner Partei zu eben diesen Krediten zu verlesen. Die weitere Entfremdung im Rahmen der Burgfriedenspolitik (dem Verzicht auf innenpolitische Auseinandersetzungen während der Kriegszeit) ließ eine Trennung zwischen Ebert und Haase fast schon zwangsläufig werden. Im April 1917 wurde Hugo Haase Vorsitzender der sich abspaltenden USPD. Rund eineinhalb Jahre später aber gab es ein Wiedersehen zwischen Haase und Ebert auf höchster politischer Ebene in der Revolution. Die alte Machtfrage stellte sich erneut.
Ein weiterer Mann darf nicht unerwähnt bleiben: Gustav Noske. Er nahm sowohl in der innerparteilichen Ausrichtung der SPD vor dem Weltkrieg, in entscheidenden Situationen während des Krieges und des Ausbruchs der Revolution als auch – und dadurch ist er durchaus noch im deutschen Bewusstsein gegenwärtig – in der Revolutionszeit selbst zentrale Positionen ein. Geboren 1868 in Brandenburg an der Havel entstammte er kleinen Verhältnissen und lernte als Sohn eines Webers die Nöte der einfachen Menschen kennen. Er selbst arbeitete in Fabriken, bildete sich aber fort. So gelang es ihm, die journalistische Laufbahn einzuschlagen. Gustav Noske trat 1884 in die SPD ein und wurde 1892 Vorsitzender der Partei in seiner Heimatstadt. Seine ersten, viel beachteten politischen Schritte unternahm er als junger Reichstagsabgeordneter im Jahr 1907. Noske trat für die Wehrhaftigkeit des Deutschen Reiches in einem Verteidigungskrieg ein und durchbrach das ungeschriebene Dogma der Partei, das Militär nicht zu unterstützen – nach den berühmten Worten August Bebels: »Diesem System keinen Mann und keinen Groschen.« Der Abgeordnete erwarb über seine Partei hinaus schnell den Ruf eines Militärfachmanns, den er während des Weltkrieges festigte. Den revoltierenden Matrosen der Hochseeflotte stand er im Sommer 1917 durch seine Verteidigung der Wehrkraft aber schon zu weit rechts, als dass sie ihn um seine Unterstützung hätten bitten wollen. Doch als im November 1918 endgültig der revolutionäre Funke zündete, sandte die SPD im Auftrag des Rats der Volksbeauftragten Noske nach Kiel, um die Lage zu beruhigen. Es gelang ihm, in Kiel selbst für Ordnung zu sorgen, aber der sich ausbreitenden Revolution konnte er nicht mehr Einhalt gebieten. In der Regierung Ebert und später Scheidemann war er Experte für Wehrfragen und entschied sich, die aus seiner Sicht große linke Bedrohung der jungen Republik durch massiven Gewalteinsatz zu bekämpfen. Bis heute ist die Bezeichnung »Bluthund der Revolution« mit seinem Namen verbunden.
Bei der Kriegskreditbewilligung durch den Reichstag am 4. August 1914 zeigte sich die Bedeutung der Partei. Nur durch die Zustimmung der SPD konnte eine innere Einigung erzielt werden und das Reich geschlossen in den Krieg ziehen. Dafür erhielt sie höchste Anerkennung vom Monarchen Kaiser Wilhelm II. Der Preis dafür war aber hoch. Die Zusammenarbeit mit der Reichsleitung stieß bei einem nicht unerheblichen Teil der Arbeiter auf scharfe Kritik. Da sie den Worten der Politiker, für Sozialisierung und für Frieden einzustehen, glaubten, war für viele der Umschwung der SPD umso bitterer.
Am Beispiel einer Bremer Arbeiterfamilie lässt sich das gut zeigen. Als Robert Pöhland eingezogen wurde, schrieben sich die Eheleute beinahe täglich und tauschten ihre Erfahrungen an der Front und in der Heimat aus. Der vollständig erhaltene Briefwechsel der Eheleute Pöhland war von der Enttäuschung über die SPD geprägt, und so neigten beide dann auch der sich immer mehr herausbildenden Strömung der linken Sozialdemokratie in Bremen zu. So ging es vielen Arbeitern, die sich angesichts der Not in der Heimat besonders nach 1916 radikalisierten.
Die Versorgungslage in diesem »Steckrübenwinter« war schlimm. Zum einen bauten die Bauern durch falsche Anreize viel zu viele Rüben an, und durch die große Feuchtigkeit des Frühjahrs und Sommers verfaulten die wenigen gepflanzten Kartoffeln schon in der Erde. Die rationierte Zuteilung sank auf etwas mehr als 1000 Kalorien täglich, wahrlich zu wenig zum Leben, aber zu viel zum Sterben. Der einzige Ausweg bestand im illegalen »Hamstern«. Jedes Wochenende fuhren tausende Bürger aufs Land und versuchten, ihre letzten Wertsachen gegen Lebensmittel einzutauschen. Diese Form der Wirtschaft florierte, zumal der Staat durch fehlende Polizeikräfte kaum in der Lage war, dem illegalen Handel Einhalt zu gebieten. Es ist nicht zu hoch gegriffen, den Umfang des Schleichhandels bei 40 % des Gesamthandelsvolumens anzusetzen. Die Folgen waren für die ärmeren Menschen fatal. Ihnen wurden die legal zugeteilten Lebensmittel entzogen, da sie für die Gemeinden einfach nicht mehr verfügbar waren. Zum anderen litten wirklich reiche Menschen keine Not. Während mehr als eine dreiviertel Million Menschen verhungerten, finden sich in den Haushaltsbüchern Wohlhabender Einkäufe wie Butter, Eier, Käse, Schinken, Schweine- und Rindfleisch bis hin zu Schokolade und Orangen. Das machte die Notleidenden wütend und untergrub maßgeblich die staatliche Autorität. Von der sehr engen Zusammenarbeit der SPD mit der Reichsregierung im Rahmen des Burgfriedens profitierte die USPD. Die wenigen Nachwahlen zum Reichstag während des Krieges brachten ihren Kandidaten häufig ein Mandat ein. Noch deutlicher zeigte sich die Kräfteverschiebung bei den großen Januarstreiks 1918. Ausgangspunkt war die schlechte Ernährungslage der Arbeiter. Auch wenn es Zulagen für schwer Arbeitende gab, reichten sie bei Weitem nicht aus.
Während Hunger ein ständiger Begleiter in den Betrieben blieb, kam in diesen Januarstreiks zum ersten Mal eine politische Note hinzu. Die sich schnell gründenden Streikkomitees forderten Frieden und Demokratie. Sie hatten das Vertrauen zur SPD längst verloren und wandten sich an die USPD. Die Streikbewegung griff in fast allen Industriezentren des Reiches um sich und erfasste mehrere hunderttausend Arbeiter. Durch Zugeständnisse in Fragen der Arbeitszeiten und der Vergütung sowie der Versorgung konnte schließlich der Streik beigelegt werden. Die Stellvertretenden Generalkommandos ließen die Arbeiter aber auch wissen, dass sie bei einer Fortführung des Streiks militärisch durchgreifen würden. Durch die Arbeitsniederlegung in der kriegswichtigen Industrie war die Waffen- und Munitionsherstellung für die Front gefährdet.
Politische Zugeständnisse machte die Regierung nicht. So blieben die großen Hindernisse für ein demokratisches Deutschland bestehen. Die Reichsverfassung bestimmte, dass die Regierung durch den Deutschen Kaiser ernannt wurde. Sie war nur ihm und nicht dem Parlament gegenüber verantwortlich. Diese Hürden konnten durch die politische Entwicklung bis 1917 zum Teil überwunden werden, als Sozialdemokraten hohe Regierungsämter erhielten und der Kaiser in seiner Osterbotschaft verkündete, das Wahlrecht in Preußen nach Kriegsende zu ändern. Im Jahr 1918 war die SPD unter Reichskanzler Prinz Max von Baden tatsächlich erstmals in der Regierungsverantwortung und stellte mehrere Staatssekretäre, die die Funktion heutiger Minister wahrnahmen.
Diese Entwicklung trugen nicht alle Sozialdemokraten mit. Nach der Weigerung Karl Liebknechts, der zweiten Kriegskreditvorlage im Dezember 1914 zuzustimmen, formierte sich um ihn der innerparteiliche Widerstand, der über die Abspaltung der Unabhängigen Sozialdemokratie 1917 bis hin zur Gründung der Kommunistischen Partei im Dezember 1918 führte. Diese Positionierung einer Parteiminderheit prägte die Ausrichtung und den Verlauf der deutschen Revolution von 1918/19 ganz entscheidend mit.
2.2Abspaltung der USPD
Bereits zu Kriegsbeginn bestanden in der SPD zwei unterschiedliche politische Lager, die sich immer weiter voneinander entfernten. Die Mehrheit der Partei ging mit der Regierung durch die Burgfriedenspolitik eine Zusammenarbeit ein, wodurch alle bestehenden Konflikte erst einmal ruhten. Eine Minderheit unter dem Parteivorsitzenden Hugo Haase und dem Abgeordneten Karl Liebknecht sah dies skeptisch. Bereits vor der ersten Kriegskreditbewilligung im Reichstag votierten 17 Abgeordnete in einer internen Abstimmung dagegen. Da in dieser Frage Fraktionszwang herrschte, erfolgte das Ja der SPD im Reichstag trotzdem einstimmig. Mit diesem Votum war zwar die innenpolitische Linie der Partei auf Verständigung und Ausgleich ausgerichtet, alle internationalen Bestrebungen der europäischen Sozialisten erwiesen sich aber als Illusion. Die Beschlüsse der Kongresse aus den Jahren 1907, 1910 und 1912, die eine europäische Solidarität beschworen und einen Krieg verhindern sollten, waren mit einem Schlag hinfällig. Doch gerade Liebknecht wollte das so nicht hinnehmen. Er hielt seine Kontakte mit belgischen und niederländischen Sozialisten aufrecht und berichtete den Freunden über die Empörung der deutschen Linken. Am 21. September 1914 kündigte er an, zukünftige Kriegskredite nicht mehr bewilligen zu wollen. Im Herbst 1914 positionierte sich die Linke der SPD des Wahlkreises Niederbarnim noch ganz im Verborgenen. In dieser ländlich geprägten Umgebung konnte sie ungestört vom Berliner Parteibetrieb umfangreiches Referentenmaterial für sozialistische Vertrauensleute erarbeiten und begründete damit praktisch den späteren Spartakusbund, der in der Revolution noch eine ganz besondere Rolle einnehmen wird. Vor diesem Hintergrund verfasste Karl Liebknecht seine Novemberthesen zu einem friedlichen Sozialismus, mit denen er seine Ablehnung weiterer Kriegskredite vorbereitete.
Am 2. Dezember war es dann so weit. Der Abgeordnete Liebknecht stimmte als einziger mit Nein und zeigte öffentlich, dass er kein weiteres Geld für die Fortführung des Krieges genehmigen wollte. Die Reaktion war scharf. Es folgte eine Welle der Empörung; Eduard David, Fraktionsvorstand der SPD und Mitglied des Reichstags, wollte ihn umgehend aus der Fraktion ausschließen. Anfang des Jahres 1915 folgten dann schnell Schritte gegen den Abweichler, sowohl von der eigenen Partei als auch von der Regierung. Die SPD beschloss am 2. Februar ein Votum gegen die Positionen Liebknechts, der Staat reagierte mit einer Einberufung des Abgeordneten ins Heer als Armierungssoldat. In dieser Funktion musste Liebknecht militärische Bauarbeiten verrichten, hatte aber als gewählter Abgeordneter weiterhin das Recht, an den Reichstagssitzungen teilzunehmen.
Zudem traf es auch Rosa Luxemburg, die eine Haftstrafe verbüßte. Sie hatte in einer öffentlichen Rede in Frankfurt-Bockenheim 1913 ausgeschlossen, dass deutsche Arbeiter auf französische schießen könnten. Diese Äußerung zog im Februar 1914 die Verurteilung zu einer Strafe von 14 Monaten Gefängnis nach sich. Die Haftstrafe musste sie im Februar 1915 antreten und war somit als äußerst scharfsichtige und brillante Autorin im politischen Tagesgeschäft auf lange Zeit nicht mehr zu vernehmen, da sie nach dem Schutzhaftgesetz auch weiterhin inhaftiert blieb. Rosa Luxemburg war, anders als Karl Liebknecht, auch vom parlamentarischen Leben ausgeschlossen, da sie als Frau kein Mandat bekleiden durfte.
Doch trotz der durchgreifenden Maßnahmen konnte der Widerstand gegen den Burgfrieden nicht vollkommen unterdrückt werden. Sozialisten trafen sich auch weiterhin ohne Kenntnis der Parteiführung und arbeiteten daran, das eingeführte Vertrauensmännersystem weiter auszubauen. Durch dieses System konnten sie sich gedanklich austauschen und schnell auf Veränderungen reagieren. Als aus diesen Bestrebungen eine Zeitschrift mit dem Titel Internationale hervorging, bezeichnete sich die politische Gruppierung um Liebknecht und Luxemburg nach dieser Veröffentlichung. Für David war damit eine Grenze überschritten. Er rief zum öffentlichen Bruch mit dem Abtrünnigen in seiner Fraktion auf. Doch Liebknecht ließ sich davon wenig beeindrucken. Er stimmte am 20. März erneut gegen die Kriegskredite und war nun nicht mehr allein. Otto Rühle verweigerte ebenfalls die Zustimmung, und auch 30 weitere Sozialdemokraten waren mit der Kriegspolitik nicht mehr einverstanden. Sie verließen vor der Abstimmung den Plenarsaal und entzogen sich einem Votum. Die Kriegskreditgegner waren 1915 überwiegend publizistisch aktiv. So schrieb Liebknecht das Flugblatt Der Feind steht im eigenen Land, und Luxemburg verfasste unter dem Pseudonym »Junius« während ihrer Inhaftierung die Broschüre Die Krise der Sozialdemokratie. Als Ergebnis dieser Arbeit entstand ein Brief an den Parteivorstand der SPD vom 9. Juni 1915, der zu einer Beendigung des Burgfriedens aufforderte und von 1000 Sozialdemokraten unterschrieben wurde. Auf der internationalen sozialistischen Konferenz in Zimmerwald bei Bern, die vom 5. bis zum 8. September 1915 dauerte, fassten die Teilnehmer hingegen einen wichtigen Beschluss im Sinne der deutschen Mehrheitssozialdemokraten. Sie sprachen sich gegen ein revolutionäres Vorgehen aus, um die politische Macht auf »evolutionärem« Weg übernehmen zu können.
Karl Liebknecht
Rosa Luxemburg
Vor dieser zunehmend polarisierenden Entwicklung wuchs allerdings innerhalb der SPD der Widerstand gegen die Kriegskredite. Am 21. Dezember 1915 stimmten bereits 20 Abgeordnete dagegen, 22 verließen wieder vor der Abstimmung das Parlament. Im ersten Vierteljahr 1916 spitzten sich die Ereignisse weiter zu und stellten die Weichen endgültig auf eine Parteispaltung.
Liebknecht wurde am 12. Januar aus der Reichstagsfraktion ausgeschlossen, Otto Rühle erklärte sich solidarisch und verließ die Fraktion. Am 27. Januar 1916 erschien die erste Nummer der Zeitschrift Spartakus. Sie wurde namensgebend für die Gruppe der linken Sozialdemokraten. Als am 24. März 1916 erneut 18 Abgeordnete gegen die Kriegskredite stimmten, handelte der SPD-Vorstand. Alle Abweichler wurden nunmehr aus der Fraktion ausgeschlossen. Diese gründeten daraufhin am 30. März die »Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft« (SAG) unter der Leitung Hugo Haases und des Anfang 1915 aus dem Fraktionsvorstand ausgetretenen Georg Ledebour. Otto Rühle und Karl Liebknecht blieben der SAG fern und besaßen den Status fraktionsloser Abgeordneter. Für Liebknecht hatte zu diesem Zeitpunkt ein schneller Friedensschluss oberste Priorität. Er entschloss sich – der Gefahr durchaus bewusst – an einer verbotenen Feier zum 1. Mai 1916 am Potsdamer Platz in Berlin teilzunehmen und in der Uniform des Armierungssoldaten die Hauptrede zu halten. Sie gipfelte in dem Appell: »Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!« Liebknecht wurde umgehend verhaftet und schnell abgeurteilt. Das Urteil der ersten Instanz von zwei Jahren, sechs Monaten und sechs Tagen Zuchthaus wurde in zweiter Instanz gar auf vier Jahre und einen Monat Zuchthaus verschärft. Die Inhaftierung Liebknechts und die rücksichtslose Fortführung des Krieges trugen maßgeblich zu einer Verbitterung linker Politiker und Arbeiter bei.
Als sich oppositionelle Sozialdemokraten aus ganz Deutschland vom 6. bis zum 8. April 1917 in Gotha, der Stadt des Vereinigungsparteitages von 1875, trafen, kam es zur Gründung einer neuen Partei, die sich »Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands« (USPD) nannte. An der Versammlung nahmen 124 Delegierte aus 91 Wahlkreisorganisationen und 15 Reichstagsabgeordnete teil. Auch die Spartakusgruppe war an der Gründung beteiligt, ohne aber ihr revolutionäres Programm durchsetzen zu können.
Durch die Spaltung der Sozialdemokratie 1917 waren bereits wichtige Weichen für die Revolution des Novembers 1918 gestellt worden. Die SPD unter ihrem Vorsitzenden Friedrich Ebert arbeitete weiterhin eng mit der Regierung zusammen. Sie vertrat bis zum Ende des Ersten Weltkrieges die Burgfriedenspolitik und versuchte 1918/19, die revolutionären Bestrebungen zu lenken. Die Partei verfolgte eine kontinuierliche Entwicklung von einem parlamentarischen Kaiserreich, wie es im Oktober 1918 bestand, hin zu einer Demokratie ohne revolutionäre Brüche. Die Spartakusgruppe musste Ende 1918 erkennen, dass sich auch die USPD und die Mehrheit der Arbeiter- und Soldatenräte in diese Richtung entwickelten, und zog daraus ihre Konsequenzen. Sie gründete am 30. Dezember 1918 die »Kommunistische Partei Deutschlands« und schuf damit die politische Grundlage für einen revolutionären Kampf. Es sollte sich zeigen, dass dieser Schritt zu spät erfolgte, um den Verlauf der Revolution noch nachhaltig beeinflussen zu können.
2.2.1Russische Revolutionen 1917
Zwei russische Revolutionen im Jahr 1917 hatten sowohl auf die Sozialdemokratie als auch auf die bürgerlichen Kräfte in Deutschland starke Auswirkungen. Zum großen Schrecken der kaiserlichen Regierung und des konservativen Bürgertums war nach der ersten Revolution vom Februar 1917 der unumschränkte Herrscher Zar Nikolaus II. von der hungernden Bevölkerung gestürzt worden. Die SPD musste sich in dieser Lage die Frage stellen, ob ihr regierungsfreundlicher Kurs noch zeitgemäß war. Mit dem Ende des Zarismus war der Partei ein wichtiges Argument genommen, das sie seit 1914 stets bemüht hatte. Der allseits respektierte Vorsitzende August Bebel hatte vor dem Ersten Weltkrieg erklärt, er selbst würde die Waffe gegen das zaristische Russland ergreifen.
Noch gravierender waren aber die Auswirkungen der zweiten bolschewistischen Revolution im Oktober 1917. Die neue Regierung unter Lenin beendete den Krieg und setzte den Umbau des Staates nach ihren kommunistischen Vorstellungen um. Auch wenn die staatlichen Verhältnisse in Russland und Deutschland in den Jahren 1917 und 1918 nicht zu vergleichen waren, bestand in bürgerlichen Kreisen bis weit in die SPD hinein die Furcht vor einem revolutionären Staatsumbau. Diese Angst war aber weitgehend unbegründet, da außer wenigen tausend Mitgliedern der späteren KPD kaum Arbeiter das sowjetische Konzept übernehmen wollten.





























