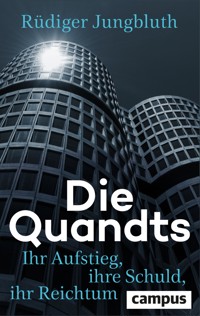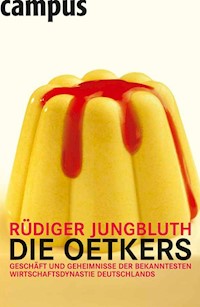
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
98 Prozent der Deutschen kennen den Namen Oetker - er ist bekannter als der des Bundeskanzlers. Doch dass sich dahinter eine Familie verbirgt, die deutlich Spannenderes zu bieten hat als Pudding und Backpulver, wissen die wenigsten. Rüdiger Jungbluth, Autor des Bestsellers Die Quandts, stellt die Familie Oetker vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2004
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
|5|Für Marianne und Johannes Jungbluth zum 19. August 2004
|11|Prolog
Rosely Schweizer erlebt immer wieder dasselbe. »Wenn ich geborene Oetker sage, echot mein Gegenüber in neun von zehn Fällen Backpulver oder Pudding«, berichtet die CDU-Politikerin und Unternehmerin. Sie ist die älteste Tochter des Bielefelder Konzernpatriarchen Rudolf-August Oetker, der im September 2004 seinen 88. Geburtstag feiert.
Die Oetkers sind die bekannteste Industriellenfamilie in Deutschland. 98 Prozent der Deutschen wissen mit dem Namen etwas anzufangen. Die Gründe für diese einmalig hohe Popularität liegen auf der Hand: Ein Großteil der Produkte, die die Familie in ihren Firmen herstellen lässt, wird unter der Marke Dr. Oetker verkauft, und es sind Verbrauchsartikel für die Masse. Überdies hält sich das Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert am Markt. Angehörige aller Generationen kennen also Oetker. Die Schattenseite ihres Reichtums und ihrer Bekanntheit erfuhr die Familie bei der Entführung Richard Oetkers 1976. Das spektakuläre Verbrechen hat ebenfalls dazu beigetragen, den Namen der Familie im öffentlichen Bewusstsein zu verankern.
Die Oetkers waren Pioniere der Markenartikelindustrie in Deutschland und gehören seit Jahrzehnten zu den großen Werbetreibenden. Vermutlich hat keine andere deutsche Familie so viel Geld dafür ausgegeben, ihren Namen im Land bekannt zu machen, wie sie. Die Investitionen haben sich ausgezahlt. Die Oetker-Gruppe ist heute der größte Hersteller von Nahrungsmitteln in Deutschland. Aber nicht nur das.
Die meisten Menschen unterschätzen den Oetker-Konzern gewaltig. Backpulver und Pudding spielen keine große Rolle mehr. Das mit |12|Abstand größte Geschäft macht die Nahrungsmittelfirma heute mit Tiefkühlpizza. In den meisten Ländern Europas ist Oetker Marktführer bei Pizzen. Selbst in Italien steht die Bielefelder Firma auf dem zweiten Platz unter den Anbietern.
Noch höhere Umsätze als mit Nahrungsmitteln erwirtschaftet die Familie mit Bier. Ob Radeberger oder Jever, Dortmunder Union oder Henninger, Clausthaler oder Schöfferhofer Weizen – welches dieser Biere sich am besten verkauft, ist den Bielefeldern gleichgültig, denn all diese Brauereien, und noch einige andere mehr, gehören zum Oetker-Reich. Kein anderer Konzern und schon gar keine Familie braut in Deutschland gegenwärtig so viel Bier wie Oetker.
Beim Sekt halten die Oetkers den zweiten Platz. Unter ihrer Aufsicht werden die Sorten Henkell Trocken, Söhnlein Brillant, Fürst Metternich, Deinhard, Carstens SC und Rüttgers Club gekeltert. Der Wodka Gorbatschow stammt ebenso von Oetker wie der Likör Batida de Coco. Darüber hinaus besitzt die Familie ein halbes Dutzend Luxushotels wie das Brenner’s Park-Hotel in Baden-Baden, sie hat mit der Condor-Gruppe ihre eigene Versicherung und mit dem Bankhaus Lampe ihr eigenes Kreditinstitut. Die Oetkers haben eine Chemiefabrik und sind außerdem erfolgreiche Verleger. Nach der Bibel erreichen ihre Koch- und Backbücher die höchsten Auflagen in Deutschland.
Der Oetker-Konzern ist ein ungewöhnlich breit gefächertes Konglomerat, wie es keine zweite Unternehmerfamilie in Deutschland errichtet hat. Die Firmengruppe besteht gegenwärtig aus nicht weniger als 332 Unternehmen, von denen 130 ihren Sitz im Ausland haben. Die Familie beschäftigt inzwischen mehr als 20000 Menschen, und der Umsatz des Konzerns summierte sich 2003 auf rund 5,5 Milliarden Euro. Damit ist die Oetker-Gruppe dreimal so groß wie die Sport- und Modefirma Puma und immerhin halb so groß wie der Chemiekonzern Henkel.
Das größte Geschäft machen die Oetkers in einem Wirtschaftsbereich, der im Exportland Deutschland merkwürdigerweise kaum beachtet wird: in der Schifffahrt. Sie besitzen seit Jahrzehnten die |13|traditionsreiche Reedereigruppe Hamburg Süd, den zweitgrößten deutschen Schifffahrtskonzern. Hamburg Süd lässt über 100 Containerschiffe in Hochhausgröße zwischen Europa und Südamerika und zwischen Nord- und Südamerika hin- und herfahren. Weil der internationale Containertransport in hohem Tempo wächst – noch schneller als der Welthandel selbst –, wollen die Oetkers ihr Engagement auf diesem Feld weiter ausbauen. Im Frühjahr 2004 hat die Familie sogar ihr Interesse bekundet, Hapag-Lloyd, die größte deutsche Reederei, zu kaufen.
Geld genug für eine solche Übernahme ist da. Und jede Bank wäre froh, den Oetkers einen Kredit geben zu dürfen. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes taxiert das Vermögen der Familie von Rudolf-August Oetker und seinen acht Töchtern und Söhnen auf 7,5 Milliarden Dollar. Auf der Liste der reichsten Deutschen rangieren die Oetkers damit ganz oben. Nur die Brüder Karl und Theo Albrecht (ALDI), Quandt-Erbin Susanne Klatten (BMW, Altana) und die Familie des Versand und Immobilienunternehmers Werner Otto werden als noch vermögender eingestuft. Selbst im internationalen Vergleich ist das Vermögen der Oetkers gewaltig, und es wächst stetig. Auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt ist die Bielefelder Familie in den vergangenen Jahren auf Platz 50 vorgerückt.
Solche Rangfolgen beruhen allerdings auf Schätzungen, nicht auf Kontoauszügen. Da die Firmen der Oetkers zum größten Teil nicht an der Börse notiert sind und ihre Gewinne nicht veröffentlichen, ist es schwer, ihren Wert zu bestimmen. Das manager magazin beispielsweise rechnet konservativer als Forbes und bezifferte den Reichtum des Bielefelder Unternehmerclans im Jahr 2003 mit 3,5 Milliarden Euro.
In beiden Ranglisten ist allerdings Arend Oetker nicht enthalten, ein Neffe des Bielefelder Konzernpatriarchen Rudolf-August Oetker. Dieser Arend Oetker ist ein außergewöhnlich erfolgreicher Unternehmer, dessen Reichtum gemeinhin unterschätzt wird. Er hat ein eigenes Firmenimperium aufgebaut und ist Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Die wertvollsten Stücke in seinem |14|Beteiligungsportfolio sind der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Hero, der im Jahr 2003 rund 1,5 Milliarden Franken umsetzte, und der Marmeladenhersteller Schwartauer Werke. Aber auch mit der Champions League hat Arend Oetker viele Millionen verdient. Er sammelt Ehrenämter ebenso wie Kunst, und ein US-Fachblatt hat den 65-Jährigen jüngst in die Liste der weltweit aktivsten Kunstkäufer aufgenommen.
Die Oetkers gehören zu den wenigen alten Wirtschaftsfamilien in Deutschland, denen es gelungen ist, ihre Stellung und ihr Vermögen über alle politischen Systeme und wirtschaftlichen Umbrüche hinweg bis in die Gegenwart zu bewahren. So steht heute an der Spitze des Konzerns der Urenkel des Firmengründers – geradezu das Musterbeispiel einer Dynastie. Dabei hat die Familie in den Kriegen und Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts einen ungewöhnlich hohen Blutzoll bezahlt.
Umso beachtlicher ist die ökonomische Erfolgsgeschichte, die der Clan geschrieben hat und noch schreibt. Sie reicht weiter zurück als bei den meisten anderen deutschen Unternehmerfamilien. Schon 1900 waren die Oetkers mehr als nur eine Familie mit Industriebesitz, sie waren ein regelrechter Sippenverband erfolgreicher Unternehmer, die sich in verschiedenen Regionen Deutschlands niedergelassen hatten. Und nicht mit Backpulver, wie es die Legende heute will, fing die Oetker-Saga an, sondern mit Marzipan und Seide.
|15|1870 – 1914
Eine wilhelminische Erfolgsgeschichte
|17|1. »In eigenen Räumen und mit eigener Dampfkraft«
Louis C. Oetker und seine Marzipanfabrik
Louis Carl Oetker war 25 Jahre alt, als er sich 1870 selbstständig machte. Der Konditor hatte ein Kapital von 1200 Talern, mit dem er in der Reichenstraße 27 in Altona bei Hamburg sein eigenes Geschäft eröffnete. Der junge Oetker war ein Könner seines Faches und sehr fleißig. Sein Geschäft wurde schnell zu einer der größten Konditoreien in der Hamburger Schwesterstadt. Anfangs stellte der Konditor alle Sorten von Kuchen und Gebäck her. Am beliebtesten aber war Marzipan.
Louis C. Oetker begann schon bald, sich auf die Herstellung dieser Zuckerware aus Mandeln zu spezialisieren. Dafür benutzte er in seiner Konditorei einfache Werkzeuge. Die Mandeln verarbeitete er in kleinen Mengen mit Hilfe eines Reibsteins. Anschließend wurden sie in einem Kessel auf dem Koksfeuer geröstet, während der Konditor den Zucker allmählich zusetzte. Aus der Masse formte Oetker die so genannten Lübecker Marzipantorten. Lübeck und Königsberg waren schon im 19. Jahrhundert die Städte in Deutschland, die für ihr köstliches Marzipan bekannt waren.
Nach einiger Zeit kam Louis C. Oetker auf die Idee, auch andere Artikel aus Marzipan anzufertigen. Er formte Früchte und Gemüse, und mit Hilfe von Anilinfarben stellte er bald auch bunte Marzipanleckereien her. Das war neu und machte großen Eindruck beim Publikum. Die Altonaer Bürger rissen sich förmlich um die originellen und dekorativen Süßigkeiten des Konditors. Oetkers Laden war fast ständig ausverkauft, obwohl nahezu rund um die Uhr gearbeitet wurde. Immer häufiger kamen auch Kunden aus dem benachbarten Hamburg |18|in Oetkers Geschäft. Viele kauften die zunehmend künstlerisch gestalteten Marzipanartikel, um sie an Verwandte zu schicken, die in anderen Städten oder auf dem Lande wohnten. Auch ins Ausland wurden Pakete versandt.
Um der wachsenden Nachfrage gerecht werden zu können, bildete Louis C. Oetker eine Reihe von Gehilfen im Modellieren und Färben des Marzipans aus. Außer Früchten produzierte die Konditorei bald auch Blumen, Tiere und Figuren aus Marzipan. Oetker war ein kreativer Kopf. Mit seinem lockigen Haar und dem dichten Vollbart sah er aus wie ein Künstler. Aber er hatte auch durchaus Sinn für das Geschäftliche. Er zog mit seiner Familie aus der Wohnung über der Konditorei aus, damit er alle Räume für die Marzipanproduktion nutzen konnte. Schon bald eröffnete er mehrere Filialen im benachbarten Hamburg, in denen Angestellte ausschließlich seine Marzipanartikel verkauften. Schon früh präsentierte der Konditor seine Erzeugnisse auch auf Fachausstellungen und heimste dafür mehrere Prämierungen ein.
Zur Herstellung des stetig wachsenden Bedarfs an roher Marzipanmasse schaffte Oetker eine Reibmaschine an, die mit Muskelkraft bedient wurde. Aber es zeigte sich schnell, dass auf diese Weise nicht so viel produziert werden konnte, wie sich in den Verkaufsstellen absetzen ließ. So beschloss Louis C. Oetker, sein Geschäft industriell zu betreiben und eine Fabrik zu bauen. Dem Konditor fehlten allerdings die finanziellen Mittel. Doch auch seine Versuche, Kredite zu bekommen, erwiesen sich als mühevoll. Bei mehreren Banken holte sich Oetker eine Abfuhr, dort hatte man kein Zutrauen in eine solche neuartige Süßwarenfabrik.
Louis C. Oetker blieb nichts anderes übrig, als seine Pläne zurückzuschrauben und sich zunächst eine kleine Halle zu suchen, in der er sein Marzipan industriell fertigen konnte. Bald wurde in Altona »ein Raum mit Dampfkraft gemiethet«, wie es später in einer Firmenschrift hieß. Oetker bekam vom Vermieter neben den Räumen auch eine Dampfmaschine bereitgestellt. Sie sorgte für den Antrieb der Maschinen, die der Konditor nach eigenen Plänen hatte anfertigen lassen.
|19|Das Kalkül ging auf. Als das Marzipan industriell produziert wurde, kam die Nachfrage richtig in Schwung. Oetker nahm einen neuen Anlauf bei den Banken und bekam schließlich den nötigen Kredit zum Aufbau einer Fabrik. Daraufhin verkaufte er die Konditorei und erwarb ein Grundstück an der Flottbeker Chaussee 70 in Ottensen, »auf dem er in eigenen Räumen und mit eigener Dampfkraft die Fabrikation von Marzipan in großem Maßstabe einrichtete«, wie es in einer späteren Jubiläumsschrift stolz hieß.
Das war 1876. Binnen sechs Jahren war aus dem Konditormeister ein Fabrikant geworden. Es war eine politisch außerordentlich ereignisreiche Zeit, in der sich dieser Aufstieg abspielte. Als Oetker seine Konditorei eröffnete, gab es den deutschen Nationalstaat noch nicht. 1871 wurde der König von Preußen zum Deutschen Kaiser gekrönt und Oetker ein Bürger des Deutschen Reichs. Durch den Zusammenschluss der norddeutschen und der süddeutschen Staaten stieg Deutschland zur europäischen Großmacht auf.
Als Louis C. Oetker seine Fabrik baute, war die Vereinigungseuphorie im Lande allerdings schon wieder verflogen. Es flossen längst keine Zahlungen mehr aus dem im Krieg besiegten Frankreich in die deutsche Wirtschaft. 1873 hatte es einen schweren wirtschaftlichen Einbruch gegeben, und nach diesem Gründerkrach hatte eine wirtschaftliche Flaute eingesetzt. Das dürfte mit ein Grund gewesen sein, warum es Oetker so schwer fiel, einen Kredit zu bekommen.
Es fehlte während dieser Depression an großen Neuerungen, die die Wirtschaft hätten voranbringen können. Es fehlten Innovationen, wie es die Dampfmaschine und die Eisenbahn in den Jahren vor der Reichsgründung gewesen waren. Die Stimmung im Lande war gedrückt, gereizt und gespannt. Reichskanzler Bismarck führte einen erbarmungslosen Kampf gegen die Sozialdemokraten, eine neue und durchaus revolutionäre Partei. Nach Bismarcks Willen sollte das Deutsche Reich ein Untertanenstaat bleiben.
Der 32-jährige Fabrikant Louis C. Oetker musste sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld behaupten. Gleichzeitig musste er mit den speziellen Herausforderungen seines eigenen Betriebs fertig |21|werden. Ein Problem lag in der Tatsache, dass Marzipanerzeugnisse Saisonartikel waren. Den größten Teil seiner Waren setzte Oetker vor Weihnachten und Ostern ab. In den Sommermonaten war die Fabrik nicht ausgelastet, für die Arbeiterinnen und Arbeiter gab es nichts zu tun. Um das zu ändern, baute Louis C. Oetker an die Frontseite seiner Fabrik eine Konditorei. Den Garten, aus dem man einen schönen Blick auf die Elbe hatte, gestaltete er als Freiluftcafé. Dieses »Sommeretablissement«, wie man eine solche Gastronomie damals nannte, wurde schnell zu einem durchschlagenden Erfolg. Vor allem an Sonntagen war im Café Oetker Hochbetrieb. Ausflügler aus Hamburg und Altona sorgten zuverlässig für Umsatz.
Louis Carl Oetker begann die Erfolgsgeschichte des Clans mit Figuren aus Marzipan, die er in einer Konditorei in Altona fertigte.
|21|Mit der Gastronomie schuf sich der Unternehmer ein zweites Standbein. Das Hauptgeschäft aber blieb die »Dampf-Marzipanfabrik«, wie Oetker sein Unternehmen mit einigem Stolz genannt hatte. Er selbst sah sich als Fabrikant und nicht mehr als Handwerker. Und mit der Zeit verlegte er sich mehr und mehr darauf, statt fertiger Artikel Marzipanrohmasse für Konditoreien, Bäckereien und Einzelhändler zu produzieren.
Louis C. Oetker hatte Familiensinn. Seine Vorfahren, die einst Ottokar geheißen hatten, stammten aus dem Dorf Wiedensahl bei Stadthagen und waren Bauern. Doch seit mehreren Generationen gab es auch selbstständige Handwerker in der Familie. Oetker selbst war in Obernkirchen in Niedersachsen aufgewachsen, einem Ort bei Bückeburg. Sein Vater Heinrich Christian Oetker besaß eine Mühle in Obernkirchen. Dort lebte auch Louis Oetkers älterer Bruder August Adolph, der Bäckermeister geworden war. Dessen Sohn Albert nahm der Marzipanfabrikant 1881 als Lehrling in der Altonaer Konditorei auf. Der Neffe bewährte sich. Als er mit seiner Lehre fertig war, verließ der junge Albert Oetker den Betrieb des Onkels allerdings, um sich auch in anderen »renommirten Geschäften in Conditorei und Kochkunst vollkommen auszubilden«, wie später ein kurzer Lebenslauf erläuterte.
Die Marzipanfabrik entwickelte sich günstig. Aber Louis C. Oetker konnte den Erfolg seiner Aufbauarbeit nicht lange genießen. Der Unternehmer |22|wurde krank. Anfangs ignorierte der Enddreißiger alle Symptome körperlicher Schwäche und arbeitete in gewohntem Umfang weiter. Auf Anraten eines Arztes trat Oetker schließlich doch eine Kur an und reiste in den Luftkurort Falkenstein im Taunus. Dort verschlechterte sich sein Zustand allerdings weiter. Die Ärzte des Sanatoriums konnten dem Fabrikanten nicht helfen, jegliche Behandlung blieb erfolglos. Am 10. März 1884 starb Louis Carl Oetker im Alter von 39 Jahren.
In einem Nachruf wurde der Fabrikant als der »Begründer der Marzipan-Groß-Industrie« gerühmt und sein Schicksal betrauert: »Es sollte ihm nicht beschieden sein, die Früchte seiner rastlosen Thätigkeit und den Lohn seiner unendlichen Sorgen und Mühe zu ernten.« Oetker sei ein Mensch gewesen, »dessen sich jeder, welcher ihn als Freund, als College, als Principal oder sonst gekannt hat, mit der größten Achtung und Liebe erinnern wird«.
Der Marzipanfabrikant hinterließ bei seinem Tod Frau und Kinder. Für die Erben führte zunächst ein angestellter Geschäftsführer die Fabrik weiter, während die Konditorei und der Cafégarten an einen Gastronomen verpachtet wurden. Unter neuer Führung lief die Fabrik in soliden Bahnen, wenn auch mit dem Tod des Gründers die Zeit stürmischen Wachstums zu Ende gegangen war. Inzwischen war der Wettbewerb härter geworden, da mehrere Konkurrenten ähnliche Fabrikationen aufgezogen hatten.
Das Unternehmen geriet immer mehr in die Abhängigkeit seiner Abnehmer im Konditorhandwerk und Einzelhandel, die darauf drängten, dass ihnen ihr Rohstofflieferant keine Konkurrenz im Geschäft mit den Endverbrauchern machte. Aus diesem Grund stellte die Firma L. C. Oetker 1886 die Produktion fertiger Marzipanartikel vollständig ein und konzentrierte sich ganz auf die Produktion von Rohmasse.
Die Witwe Luise Oetker kam auf die Idee, den jungen Neffen ihres verstorbenen Mannes zu fragen, ob er in das Unternehmen, in dem er seine Lehrzeit verbracht hatte, zurückkehren wollte. Sie stellte dem damals 21-jährigen Albert Oetker sogar eine Beteiligung an der Firma in Aussicht. Der junge Konditor ergriff die Chance, und bald darauf |23|fing er als technischer Leiter in der Firma seines verstorbenen Meisters an. Überdies betätigte sich Albert Oetker aber auch als reisender Vertreter der Marzipanfabrik. Er war dabei so erfolgreich, dass das Geschäft einen spürbaren Aufschwung nahm. Mit 24 Jahren übertrug Luise Oetker ihm die kaufmännische Leitung der Firma und ernannte ihn zum Prokuristen.
Der Umsatz stieg von Jahr zu Jahr in großen Stufen. Marzipan war ein Luxusartikel, aber mit dem Wohlstand im Kaiserreich wuchs auch die Kaufkraft. Als sich Albert Oetker in seiner neuen Position etabliert hatte, sorgte er dafür, dass die Fabrik auf den jüngsten Stand der Technik gebracht und die Kapazität gesteigert wurde. Die Dampfkessel und -maschinen wurden durch doppelt so große ausgewechselt. Oetker stellte weitere Reisende sowie ortsansässige Vertreter ein, die die Rohmarzipanmasse in allen größeren Städten vertrieben. Ihnen richtete die Firma kleine Lagerräume ein, damit die Bestellungen der Kunden schneller als bisher ausgeführt werden konnten.
Das Geschäft boomte dermaßen, dass die Arbeiter in der Fabrik an der Flottbeker Chaussee bald in Tag- und Nachtschicht produzierten. Doch auch das reichte nicht. Mit der Zeit wurde es offensichtlich, dass die von Louis C. Oetker 1876 gebaute Fabrik zu klein war. Eine Erweiterung war an dieser Stelle aber nicht möglich. So kaufte Albert Oetker, der inzwischen Teilhaber der Firma L. C. Oetker geworden war, ein großes Grundstück im Altonaer Stadtteil Bahrenfeld. Dort wurde, 20 Jahre nach der ersten Fabrik, am 1. Oktober 1896 ein neues Fabrikgebäude eingeweiht.
In dem Bau aus roten Backsteinen wurde eine Vielzahl neuartiger Maschinen aufgestellt, die Albert Oetker seinen Erfahrungen entsprechend selbst entworfen hatte. Die Mandeln wurden maschinell gesiebt, gereinigt, gebrüht und von ihren Schalen befreit. Eine zeitgenössische Betriebsbeschreibung vermittelt viel von der damaligen Faszination für Technik: »Gewaltige, mit Dampfkraft betriebene Messer zerschneiden die Mandeln hier in grobe Stücke, dann aber wandert diese grob geschnittene Masse über Transportwerke auf die Quetschmaschine, welche ihr durch Quetschen einen weiteren Grad der |24|Feinheit verleiht, und von dieser endlich auf die großen sechsläufigen Walzwerke, Musterwerke der Technik und der Sauberkeit. Drei große Granitwalzen zerreiben in jeder dieser Maschinen die Mandeln, welche bis dahin noch immer ein wenig den körnigen Charakter zeigten, zu einer gleichförmigen Masse, die aber noch auf die unter den Granitwalzen laufenden drei Porzellanwalzen fällt, welche der Masse den höchsten erreichbaren Grad der Feinheit zu geben vermögen.«
Den Antrieb für die Maschinen lieferten zwei große Dampfkessel und zwei 90 PS starke Dampfmaschinen, die in einem separaten Gebäude untergebracht waren. Betrieben wurden sie mit Kohlen, die in Eisenbahnwaggons direkt auf den Fabrikhof transportiert wurden. Es war eine überaus saubere Fabrik, deren Wände mit Mettlacher Platten gekachelt und deren Fußböden mit italienischem Terrazzo belegt waren. »Nirgends in der Fabrik sind Treibriemen zu sehen«, hieß es in der Beschreibung der unterirdischen Transmissionsanlage. »Die Kraft wird von den Maschinen von unten zugeführt, so dass es den Eindruck macht, als würde das Ganze von geheimnisvollen Mächten bewegt.«
In großen Kupferkesseln wurde die Marzipanmasse gekocht und so lange geröstet, bis sie alle überflüssige Feuchtigkeit verloren hatte. Um eine besonders große Gleichmäßigkeit des Produkts zu gewährleisten, ließ Albert Oetker das Marzipan in einem weiteren Arbeitsgang in Portionen von 400 Kilogramm mischen und kühlen. Die fertige Rohmasse packten Arbeiter in mit Papier ausgelegte Holzkisten, die waggonweise an die Kunden verschickt wurden. Das Altonaer Unternehmen lieferte sein Marzipan auch nach London und Manchester. Für den Export verwendete die Firma als Markenzeichen eine Schiffsschraube und den Satz »Mein Feld ist die ganze Welt«. Im Inland setzte man auf den schlichten Schreibschriftzug »Oetker«, den sich das Unternehmen patentamtlich hatte schützen lassen.
Die Fabrik in Altona-Bahrenfeld war so ausgelegt, dass sie täglich 25000 Kilo Marzipan produzieren konnte. Auf dem Dachboden lagerten große Mengen von Mandeln, Nusskernen und Zucker. Sie waren aber nur ein Teil der Vorräte, über die die Firma verfügte. Ein Großteil von Oetkers Rohwaren lagerte zollfrei im Hamburger Freihafen.
|25|Allmählich verlegte der Fabrikdirektor Albert Oetker sich stärker auf die kaufmännische Leitung des Unternehmens, vor allem auf den Einkauf der Rohware. Er hatte überdies die Konkurrenz stets im Blick. So ließ er zum Beispiel die Produkte seiner Wettbewerber analysieren. Das Ergebnis eines solchen Warentests veröffentlichte er: »Die Firma L. C. Oetker ist im Besitz von Proben, welche als Marzipan trotz der Garantie für ein Drittel Zucker und zwei Drittel Mandeln, bis zu 42 Prozent Zucker aufweisen. Was statt Mandeln in solchen auf Schädigung des Publikums berechneten Fabrikaten sein mag, lässt sich schwer controllieren.«
Nachdem Albert Oetker eine Vielzahl von Erfahrungen und Erkenntnissen bei der Verarbeitung von Mandeln für Marzipan gewonnen hatte, erwog der Industrielle, ob er nicht auch ganze abgezogene Mandeln vertreiben könnte. Dazu musste er einen speziellen Trocknungsapparat konzipieren, denn beim Brühen nahmen die Mandeln viel Feuchtigkeit auf, und wenn sie nun auf herkömmliche Weise getrocknet wurden, wurden sie zu heiß und verloren ihr Aroma und ihre Haltbarkeit.
Noch vor der Jahrhundertwende wurde die Palette der Erzeugnisse um Nougat erweitert. Die Konditoren fertigten die Masse damals nach einem französischen Rezept. Es hatte aber den Nachteil, dass das Nougat schnell ranzig wurde. Der Firma L. C. Oetker gelang es schließlich nach zahlreichen Experimenten, eine Masse zu produzieren, die bei kühler trockener Lagerung gut haltbar war.
Als das Unternehmen im Jahr 1900 sein 30-jähriges Bestehen feierte, ließ Albert Oetker eine prächtige Festschrift für die Freunde und Kunden des Unternehmens drucken. Darin hieß es ohne jede Bescheidenheit: »Die Firma L. C. Oetker ist heute dank der Rührigkeit ihres Leiters in ihrer Branche nicht allein in Deutschland und Europa, sondern in der ganzen Welt die größte. Gleichzeitig ist sie auch die größte Importeurin von Mandeln und Nusskernen in der ganzen Welt, in denen sie neben dem größten Verbrauche zu ihrer Fabrikation auch den größten Handel betreibt.«
|26|2. »Zucht und Ordnung zum Gedeihen der Fabrik«
Albert Ferdinand Oetker und seine Seidenweberei
Albert Ferdinand Oetker war fünf Jahre älter als sein Bruder Louis C., und die Verwandtschaft war den Brüdern schon im Gesicht anzusehen. Wie Louis trug auch Albert Ferdinand einen mächtigen Vollbart. Er war bereits 30 Jahre alt, als er 1869 ins Rheinland zog und als reisender Vertreter bei der Seidenweberei Deuß & Weiß anfing. Was Albert Ferdinand Oetker vorher gemacht hatte, ist nicht überliefert, bekannt ist aber, dass er, als er nach Krefeld kam, noch ledig war.
Die Firma, bei der Oetker angestellt wurde, gehörte zwei ungleichen Männern. Wilhelm Deuß stammte aus Krefeld, hatte aber im Bergischen Land bei einem Seidenfabrikanten den Kaufmannsberuf gelernt. 1855 hatte er in seiner Geburtsstadt ein Unternehmen gegründet. Carl Weiß war Lehrer an der Höheren Töchterschule gewesen, bevor er als Teilhaber in die Deuß’sche Seidenweberei eingestiegen war. Die beiden Inhaber hatten eine klare Arbeitsaufteilung. Während Deuß sich um den Betrieb mit seinen anfangs zwölf Webstühlen kümmerte, hatte Weiß als reisender Vertriebsmann vor allem in Berlin und Umgebung für den Absatz der Stoffe gesorgt. Es war ihm gelungen, das Geschäft mit einem großen Textilhaus in Berlin so auszuweiten, dass dieses schließlich die gesamte Ware des Krefelder Unternehmens abnahm. Weiß hatte deshalb auch seinen Wohnsitz nach Berlin verlegt, wo er die Niederlassung der Firma Deuß & Weiß leitete, als der junge Oetker in Krefeld anfing.
Trotz aller Erfolge befriedigte die Arbeit Carl Weiß nicht. Im Grunde seines Herzens war er immer ein Pädagoge geblieben. Er engagierte |27|sich in einem Berliner Verein für Frauenbildung und hatte eine Reihe von Plänen zur Gründung von Erziehungsanstalten im Kopf. Als Carl Weiß seinem Partner Wilhelm Deuß mitteilte, dass er aus der gemeinsamen Firma aussteigen wollte, um wieder als Lehrer und Erzieher zu arbeiten, bot sich für den tüchtigen Albert Ferdinand Oetker die Chance, die frei gewordene Stelle zu besetzen und zum Fabrikanten aufzusteigen. 1870 ließ sich Weiß ausbezahlen, und Oetker wurde Mitinhaber des Unternehmens, das fortan den Namen Deuß & Oetker führte. Albert Ferdinand Oetker war damit das erste Mitglied der Familie, das den Aufstieg vom Handwerker oder Kaufmann zum Fabrikanten vollzog.
Zu diesem Zeitpunkt arbeitete das Unternehmen noch in traditioneller Weise mit hand- und fußgetriebenen Webstühlen, die überwiegend in den Haushalten einiger Hundert so genannter Heimweber im Bergischen Land standen. In England wurde schon seit Jahrzehnten mit Webmaschinen produziert, am Niederrhein aber setzte sich der mechanische Webstuhl erst in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts durch. Es war ein schwieriger Prozess. Nicht nur die Heimweber waren gegen die Umstellung, auch viele Unternehmer waren skeptisch, ob es sich lohnte, in völlig neue und andersartige Fabriken zu investieren. »Zunächst waren es nur wenige mutige, jüngere Fabrikanten, die einsahen, dass der schnell wachsende Textilbedarf infolge der Bevölkerungszunahme, des steigenden Wohlstands mit seinen höheren Ansprüchen und der Ausdehnung des Welthandels nur durch eine Umstellung auf die mechanische Weberei zu bewältigen war«, schreibt Ludwig Hügen in seiner Chronik der Firma Deuß & Oetker. »Als ein solch weit schauender Unternehmer, wie ihn die nun einsetzende Industrialisierung der Textilindustrie erforderte, erwies sich Albert Oetker.«
Deuß & Oetker baute 1889 eine Fabrik in Schiefbahn, einem Dorf südlich von Krefeld. Der Bürgermeister der Gemeinde hatte sich sehr um die Ansiedlung eines Industrieunternehmens bemüht. Die Gemeinde hatte den beiden Inhabern ein großes Grundstück zum Vorzugspreis verkauft und ihnen Steuerfreiheit während der Anlaufphase |28|garantiert. Die Hausweber am Ort litten damals wegen des Preisverfalls große wirtschaftliche Not. Gemeinsam mit anderen Webern hatten sie sogar eine Petition an den Kaiser gesandt: »Majestät! Tausende von Seidenwebern in den Kreisen Cempen, Crefeld und Umgegend sind augenblicklich ohne Arbeit und damit brotlos, teilweise dem bittersten Mangel preisgegeben, tatsächlich am Hungern.« In dieser Situation war der neue Industriebetrieb eine große Hoffnung für die Menschen in dem Ort.
Die Fabrik entstand auf der grünen Wiese. Als sie fertig war, war der Websaal mit einer Fläche von 16 000 Quadratmetern der größte im Deutschen Reich, wie Firmenchronist Hügen berichtet. 179 Menschen fanden dort eine Arbeit, als im November 1889 die ersten mechanischen Webstühle anliefen. Für die Arbeiter ließ Albert Oetker eine Siedlung in unmittelbarer Nachbarschaft der Fabrik errichten. Das Kalkül des Fabrikanten war, die Arbeiter dauerhaft an das Unternehmen zu binden. Außerdem hatten sie kurze Wege zur Fabrik und konnten somit für einen langen Arbeitstag im Betrieb sein.
Die Siedlung lag außerhalb des Ortskerns von Schiefbahn und erhielt bald den Namen »Kolonie«. Die Doppelhäuser enthielten jeweils zwei Wohnungen mit einer Grundfläche von 62 Quadratmetern. In den Räumen wohnten die Arbeiterfamilien nicht nur, sie nutzten sie auch als Platz zur Heimarbeit. Viele Frauen, Kinder und Alte wurden von Deuß & Oetker zu Hause damit beschäftigt, in Handarbeit Webfehler und Verunreinigungen an Fabrikerzeugnissen zu beseitigen.
Während Deuß und Oetker bei der Rekrutierung ihrer Belegschaft auf die Weber in Schiefbahn und Umgebung zurückgriffen, warben sie die Meister und Vorarbeiter im Bergischen Land an, wo Deuß selbst einst für eine Tuchfabrik gearbeitet hatte. Diese Männer waren evangelisch, die Arbeiter in Schiefbahn dagegen fast ausnahmslos katholisch. Firmenchef Oetker selbst war, wie 80 Prozent der Unternehmer in Deutschland damals, Protestant. Obwohl die Katholiken 36 Prozent der Reichsbevölkerung ausmachten, gab es unter ihnen nur wenige Unternehmer. Wie ihre Kirche taten sich die meisten Katholiken schwer mit der Modernisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft|29|. Sie lebten in einer inneren Distanz zu dem sich entwickelnden System des Kapitalismus und der Marktwirtschaft. Wichtige Bestandteile ihres Lebens waren Wallfahrten, Prozessionen und häufig auch ein ausufernder Marienkult. Während der Nationalstaat in den Augen der Protestanten eine Art Schlusspunkt der Reformation darstellte, sah sich die katholische Kirche in ihrem Machtanspruch über die Menschen durch dieses starke preußisch-evangelisch geprägte Deutsche Reich bedroht. Sie reagierte mit Verhärtung und Abschottung.
Bald kam es auch bei Deuß & Oetker zu heftigen konfessionellen Konflikten. Sie entzündeten sich an der Frage der Arbeitszeit. Albert Oetker war der Ansicht, dass die Katholiken zu viele Feiertage begingen. Weihnachten, Neujahr, Ostern und Pfingsten wurde nicht gearbeitet und auch nicht am Buß- und Bettag, an Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und Allerheiligen. Hinzu kamen noch der Dreikönigsfeiertag, Peter und Paul sowie nicht weniger als drei Feiertage zu Ehren der Muttergottes: Mariä Lichtmess, Mariä Verkündigung und Mariä Empfängnis. Der Fabrikant Albert Ferdinand Oetker war nicht willens, an all diesen Tagen seine Webstühle stillstehen zu lassen.
Die lokale Presse bekam Wind von den Auseinandersetzungen bei Deuß & Oetker. Am 22. Dezember 1890 war in der Niederrheinischen Volkszeitung zu lesen: »Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer scheint in unserer hiesigen Fabrik nicht mehr ein inniges zu sein, was folgender Vorgang veranlasst hat. Kürzlich ließ einer der Herren Fabrikbesitzer die sämtlichen Arbeiter zu sich kommen, bei welcher Gelegenheit sie als faul, dumm und ungebildet geschildert wurden. Sie (die Fabrikbesitzer) hätten sich in ihnen getäuscht und wären besser in Crefeld geblieben.« Außerdem habe Albert Oetker den Arbeitern angekündigt, dass künftig »an allen Mutter-Gottes-Festen gearbeitet werden sollte, weil sonst die Firma nicht bestehen könnte«.
Das Lokalblatt stellte sich in seinem Kommentar ganz auf die Seite der katholischen Arbeiterschaft: »Für jeden vernünftigen Menschen ist es schwer begreiflich, daß der Bestand der Fabrik nur durch Arbeiten an kath. Feiertagen kann erhalten bleiben und auch muß es jedem |30|sehr auffällig erscheinen, von rein kath. Arbeitern die Festtagsarbeit zu fordern.« Für Unmut habe bei Betriebsversammlung ferner gesorgt, dass die Inhaber den Arbeiterinnen und Arbeitern neue Strafbestimmungen für Fehlverhalten in der Fabrik angekündigt hätten.
Das Unternehmen reagierte mit einer Gegendarstellung, die zwei Wochen später erschien. Darin hieß es, »dass das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in unserer Fabrik allezeit das beste war und auch heute noch ist«. Gleichzeitig wurde aber eingeräumt, dass die Ansprache eines Inhabers nach Ablauf des ersten Betriebsjahres »neben Worten der Anerkennung auch solche der Rüge erhielt, letztere an diejenigen Arbeiter gerichtet, deren Leistungen das Durchschnittsmaß nicht erreichten«. Dabei seien auch die Worte »faul«, »dumm« und »ungebildet« gefallen, allerdings in »wohlwollender Absicht«. Von neuen Strafbestimmungen für Fehlverhalten könne keine Rede sein. »Vielmehr wurde nur hervorgehoben, daß, wie zum Gedeihen eines jeden Gemeinwesens, so auch zu dem einer Fabrik es nothwendig sei, daß Zucht und Ordnung herrsche, und daß deshalb die bestehende Fabrikordnung fernerhin zur strikten Durchführung kommen werde.«
Nach Darstellung der Inhaber hatte die Firma Deuß & Oetker damals mit dem Ortsgeistlichen vereinbart, dass die Arbeiter an den weniger hohen Feiertagen nur für die Zeit ihres Kirchenbesuchs freigestellt würden. Der Heimatforscher Hügen fand im Archiv der Pfarrgemeinde allerdings einen Brief des Pastors an den Kölner Erzbischof, in dem dieser die Vorgehensweise der Firmenleitung heftig kritisierte. Am Dreikönigsfest sei der Betrieb bei Deuß & Oetker nicht eingestellt worden, klagte der Priester, man habe den katholischen Arbeitern lediglich freigestellt, ob sie kämen oder nicht. »Zum Lobe der Arbeiter muss es gesagt sein, dass zahlreich von dieser Freiheit im Sinne der Feiertagsheiligung Gebrauch gemacht wurde, obgleich die Fabrikarbeiter wussten, wie unangenehm eine solche Maßnahme für sie werden kann.« Auch an Mariä Lichtmess hätten einige Arbeiter »Mut genug gehabt, ihre katholische Überzeugung nicht zu opfern«, schrieb der Pfarrer dem Bischof.
|31|Im Herbst 1899 einigten sich Firmenleitung und Belegschaft darauf, dass an den Marienfesten in der Fabrik nicht gearbeitet werden würde. Zum Ausgleich mussten sich die Lohnempfänger verpflichten, während der Sommermonate täglich 15 Minuten länger zu arbeiten.
1897 zog sich Firmengründer Wilhelm Deuß im Alter von 70 Jahren aus dem Unternehmen zurück. Der Fabrikant war Junggeselle geblieben, und so konnte sein zwölf Jahre jüngerer Geschäftspartner Albert Ferdinand Oetker Alleininhaber werden. Bevor Ruheständler Deuß zu großen Reisen in die Alpen, nach Florenz und Neapel aufbrach, schenkte er der Stadt Krefeld noch einen Stadtwald. Auf die Idee hatte ihn Oetker gebracht, der bei seinen Geschäftsreisen nach England die dortigen Parks gesehen und bewundert hatte.
Albert Ferdinand Oetker selbst war ein Mann, der sich in vielen Bereichen betätigte. Er beteiligte sich an weiteren Unternehmen wie der Krefelder Baumwollspinnerei und der Krefelder Teppichfabrik. Zehn Jahre lang gehörte er als Mitglied der Liberalen Fraktion dem Stadtverordnetenkollegium in Krefeld an, und er wirkte im Vorstand und später im Aufsichtsrat des Stadttheaters. Im Gemeinderat von Schiefbahn saß er als so genannter Meistbegüteter. Oetker schenkte dem Kaiser-Wilhelm-Museum eine Sammlung niederrheinischer Altertümer und besorgte das Geld für einen Erweiterungsbau.
In Schiefbahn half sein Unternehmen bei der Gründung von Vereinen für Sänger, Turner, Fußballer und Radfahrer. Die Firma richtete überdies eine eigene Rentenkasse ein. Der »Kolonie« seiner Arbeiter stiftete Oetker eine Schule mit zwei Klassen und ein großes Gesellschaftshaus, das einen Saal mit Bühne und ein Wirtshaus fasste. Hier traf sich auch eine Gesellschaft namens »Frohsinn«, die ein Meister des Unternehmens Deuß & Oetker für die Arbeiter gegründet hatte. Ab 1898 wurde das gesamte Dorf von der Firma mit Strom versorgt, während die Menschen in den Nachbargemeinden sich noch mit Petroleumlampen behelfen mussten. Heimatforscher Hügen kommt in seiner Chronik zu dem Schluss, »dass die Firma auf den verschiedensten Gebieten entscheidend dazu beitrug, dass Schiefbahn eine der modernsten und wohlhabendsten Gemeinden am Niederrhein wurde«.
|32|Der Fabrikant lebte selbst nicht schlecht dabei. Oetkers Reichtum dokumentierte sich 1898 weithin sichtbar darin, dass er in der Nähe seiner Fabrik eine hochherrschaftliche Villa errichten ließ, die von einem riesigen Privatpark umgeben war. Ein französischer Gartenbauarchitekt schuf die aufwändige Anlage mit seltenen Bäumen und künstlichen Seen, mit aufgeschütteten Hügeln und Grotten. In dem Park gab es Spazierwege und sogar eine kleine Brücke. Die Arbeiter der Fabrik und andere Bewohner Schiefbahns durften die Anlage nicht betreten, sie konnten höchstens mal einen Blick durch den hohen Zaun werfen. Das Haus selbst war in einer Mischung aus Neoklassizismus und Schweizer Landhausstil gebaut worden. Die Diele prägte ein großes Jugendstilfenster aus buntem Glas. Die Villa, die den Namen »Niederheide« bekam, diente dem Fabrikanten und seiner Familie anfangs nur als Sommersitz, den Winter verbrachten die Oetkers in Krefeld.
Die Familie bestand zu dieser Zeit aus fünf Köpfen. Albert Oetker hatte, bald, nachdem er an den Niederrhein gekommen war, Emilie Peters geheiratet. Mit Milly, wie sie genannt wurde, hatte er innerhalb von fünf Jahren eine Tochter und drei Söhne bekommen. Der Erstgeborene Karl war aber mit 16 Jahren gestorben, so dass die Nachfolge nun auf den 1874 geborenen Rudolf zulief.
Im Mai 1900 wurde Albert Ferdinand Oetker zum Königlichen Kommerzienrat ernannt. Diese staatliche Ehrung, auf die Unternehmer im Kaiserreich großen Wert legten, war ein Ereignis für die gesamte Firma Deuß & Oetker. Arbeiter, Meister und Angestellte bildeten am Abend einen Fackelzug, der mit einer Musikkapelle durch den Park zur Oetkerschen Villa zog. Die Krefelder Zeitung hatte einen Reporter entsandt, der das Fest beschrieb: »Vor der Terrasse der Villa angekommen, beglückwünschte der Direktor der Fabrik Ewald Hülsemann den Kommerzienrat und hob besonders hervor, dass das ganze Etablissement, wie es in Schiefbahn emporblüht, sein Entstehen und Vollenden hauptsächlich der energischen Schaffenskraft und dem unermüdlichen Eifer des Gefeierten verdanke.«
Viele Arbeiter sahen das anders. Sie mussten sich mit Löhnen begnügen, die deutlich unter denen anderer Branchen lagen und auch |33|im Vergleich mit anderen Textilunternehmen am Niederrhein niedrig waren. Der Durchschnittslohn im Unternehmen betrug vor der Jahrhundertwende 2,14 Mark am Tag. Allerdings verdienten 63 von 750 Beschäftigten 1897 weniger als eine Mark. Das war gerade so viel, wie damals ein Pfund Butter oder zwölf Eier kosteten.
Der Christliche Gewerkschaftsverband, dem viele Textilarbeiter angehörten, mochte nicht länger mit ansehen, »dass die schlechten Lohnverhältnisse in Schiefbahn allmählich auf die gesamte Stoffindustrie am Niederrhein zurückwirkten«. Doch die Firmenleitung weigerte sich, die Löhne auf das Niveau anderer Betriebe anzuheben, da die »Verschiedenheit der einzelnen Betriebe« einheitliche Sätze nicht zuließe. Ein durchschnittlicher Arbeiter habe bei Deuß & Oetker immerhin sein Auskommen, hieß es. Man müsse auch berücksichtigen, »dass die mechanische Seidenstoffweberei so wenig Ansprüche an geistige und körperliche Beschäftigung der Arbeiter stellt, wie das kaum in einer anderen Industrie der Fall ist«.
Tatsächlich war die Belastung hoch. Die typische Arbeiterin bei Deuß & Oetker fand sich im Sommer um sechs Uhr morgens in der Fabrik ein und arbeitete mit einer viertelstündigen Frühstückspause bis zwölf Uhr mittags. Nach anderthalb Stunden Mittagspause trat sie wieder zur Arbeit an und blieb bis sieben Uhr abends, so dass sich die reine Arbeitszeit auf elf Stunden pro Tag belief. Samstags und vor Feiertagen dauerte der Arbeitstag bis halb sechs. Jugendliche Arbeiter zwischen 14 und 16 Jahren arbeiteten volle zehn Stunden. Eine Kantine gab es nicht, nur ein Kaffeezimmer.
In der Fabrik herrschte ein strenges Regiment. Die Firmenleitung verhängte regelmäßig Geldstrafen, wenn Arbeiter Fehler machten oder nicht parierten. Geahndet wurden nicht nur unentschuldigtes Fernbleiben und Zuspätkommen. Die »Arbeitsordnung für die Fabrik von Deuß & Oetker, Schiefbahn« aus dem Jahr 1900 legte auch Geldstrafen für Delikte fest wie »Betreten von Räumen, in welchen dem Arbeiter keine Beschäftigung angewiesen ist«, »Verweilen in den Arbeitsräumen nach Schluss der Arbeitszeit« und »Um- und Ankleiden sowie Waschen und Kämmen an nicht dazu bestimmten Stellen«. Auch |34|wer Mängel an Webmaschinen nicht sofort anzeigte, musste mit Lohnabzügen rechnen. Die höchste Geldstrafe lag bei einer Mark für die »Nichtbeachtung der Arbeitsvorschriften der Vorgesetzten«.
Der Christliche Gewerkschaftsverband beklagte, dass »die Behandlung der Arbeiterschaft seitens der Firma bzw. ihrer Angestellten nachgerade unerträglich« geworden sei, und kritisierte besonders das »traurige Straf- und Lohnabzugssystem«. Der von Oetker eingesetzte Fabrikdirektor Ewald Hülsemann übte seine Macht in besonders umstrittener Weise aus. »Der Direktor ›bestrafte‹ einige jugendliche Arbeiterinnen, die außerhalb der Arbeitszeit ein fremdes Grundstück betreten hatten, mit zwei Mark, welche ›für die Armen‹ verwendet werden sollten«, hieß es in einem Bericht der Gewerkschaft. »Ähnliche Strafen waren folgende: Auf’s Gras getreten: 25 Pfg. Strafe, Kartoffeln nicht rein aufgelesen: 50 Pfg. Strafe, Rübstiel ausgerissen: 25 Pfg. Strafe. Mit einer Maus gespielt und dabei gekreischt: 25 Pfg. Strafe.«
Die Arbeiterschaft empfand diese Geldstrafen als demütigend. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass das Unternehmen den auf diese Weise einbehaltenen Lohn in eine besondere Unterstützungskasse leitete, die vor allem den Familienvätern unter den Arbeitern, die in Not geraten waren, zugute kam.
Mit Unterstützung der Gewerkschaft bildete sich bei Deuß & Oetker in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts ein so genannter Arbeiterausschuss. Das Gremium entwarf eine Eingabe an die Firmenleitung, in der bessere Löhne und ein Ende der Strafen gefordert wurden. Aber Albert Oetker lehnte jedes Entgegenkommen ab. Er mochte den Arbeiterausschuss nicht einmal anerkennen. Die Fronten verhärteten sich. So kam es im Mai 1905 bei Deuß & Oetker zu einem Arbeitskampf, der mehr als drei Monate dauern sollte. Nach Darstellung des Firmenchronisten Hügen war es der größte Weberstreik des Rheinlandes. Damals zählte das Unternehmen schon mehr als 1000 Mitarbeiter.
Die Firmenleitung verhandelte zwar mit dem Ausstandskomitee, zeigte sich aber nicht bereit, auf Forderungen einzugehen. Der Krefelder Gewerkschaftsführer Jakob Pesch sprach Ende Juli 1905 vor |36|einer Versammlung von rund 600 Arbeiterinnen und Arbeitern in Schiefbahn. Daraufhin wurde eine Resolution verfasst, die dem Bürgermeister übergeben wurde: »Die Versammelten sind fest davon überzeugt, dass der Friede in einer für beide Seiten befriedigenden Weise herbeigeführt werden kann, wenn die Firma es nur will.« Der Bürgermeister wurde aufgefordert, den Landrat in Gladbach um eine Schlichtung des Konflikts zu bitten. Aber der Landrat mochte sich nicht näher mit der Sache befassen, nachdem ihm Kommerzienrat Oetker erklärt hatte, dass er den Forderungen seiner Arbeiter niemals nachkommen werde. Überdies war man auch im Landratsamt der Ansicht, dass der Gewerkschafter Pesch ein »gefährlicher Hetzer« sei, »der von langer Hand die Schiefbahner Arbeiter zum Streik aufgefordert und aufgewiegelt hat«.
Albert Ferdinand Oetker, hier mit seiner Gemahlin Milly und ihren Kindern, führte ein strenges Regiment und war kein Freund der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter.
|36|Oetker und sein Direktor weigerten sich zwar, mit den Führern des Christlichen Textilarbeiterverbandes zu verhandeln, sie sprachen aber mit dem betriebseigenen Arbeiterausschuss. Sie erklärten sich sogar bereit, diese Vertretung anzuerkennen und künftig alle Vorschläge und Klagen in regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen entgegenzunehmen. Schließlich wurden die Löhne doch angehoben, wenn auch nur in einer Weise, wie sie die Firma laut Bericht des Bürgermeisters »auch schon vor der Bewegung ihrer Arbeiter in Aussicht genommen hatte«. Im August 1905 endete der Streik nach mehr als 14 Wochen. In einem Bericht für den Landrat zog der Schiefbahner Bürgermeister Bilanz: »Der Ausstand hat einen Lohnausfall von wohl mehr als 100000 Mark zur Folge gehabt und dem gewerblichen Leben in der Gemeinde schwere Wunden geschlagen, die sobald nicht verheilt sein werden.«
Albert Oetkers Geschäfte liefen ansonsten aber gut. Die Nachfrage nach seinen Kleider- und Krawattenstoffen wuchs beständig. Eine viel gefragte Spezialität der Weberei war der schwarze Krawattenstoff Turquoise. Nachdem Oetker sich entschlossen hatte, die Kapazitäten zu vergrößern, gelang es ihm 1906, eine Seidenweberei in Gräfrath bei Solingen zu kaufen. Eine weitere Fabrik übernahm er in Walbeck. Und 1908 und 1909 baute er kleinere Werke in Wachtendonk und Herongen.
|37|Mit der Expansion hatte er sich offenbar zu viel zugemutet. Am Morgen des 8. August 1909 starb Albert Oetker im Alter von 69 Jahren nach einem Herzschlag. Bei einer Andacht in dessen Haus rühmte der evangelische Pfarrer den Verstorbenen als fürsorglichen Familien und Firmenvater: »Und wenn ich weiter dessen gedenke, was seine Persönlichkeit für das kommunale Leben in Schiefbahn bedeutet, wie der unverkennbare wirtschaftliche Aufschwung der letzten 15 Jahre auf seine Tüchtigkeit, seine soziale Fürsorge und sein tätiges Interesse an allen gemeinnützigen und edlen Bestrebungen sehr wesentlich zurückzuführen ist, so will die Lücke, die sein Tod gelassen, immer größer und unerfüllbarer erscheinen.«
Albert Oetker wurde in Krefeld beerdigt, aber auch die Gemeinde Schiefbahn bereitete ihm einen großen Abschied. Erst sang der Kirchenchor in der Villa »Niederheide«, dann trugen die Obermeister der Fabrik den Sarg zu einem Wagen. Sämtliche Vereine waren mit Fahnen aufmarschiert, und im Park und auf den Straßen standen die Bürger und Schulkinder Spalier.
Der Verstorbene hinterließ ein Unternehmen, das aus sechs Fabriken bestand, in denen mehr als 2000 Arbeiter beschäftigt waren. Das Schicksal der Firma lag nun in den Händen der Witwe Milly Oetker und ihrer beiden Söhne, des 33-jährigen Rudolf Oetker und seines zwei Jahre jüngeren Bruders Paul.
|38|3. »Benutze jede Gelegenheit, um etwas zu lernen«
August Oetker und der Onkel aus Amerika
Während Louis C. und Albert Ferdinand Oetker es in ihren Unternehmen zu enormem Erfolg und Reichtum gebracht hatten, dauerte es in der Familie ihres ältesten Bruders August Adolph eine Generation länger, bis der Schritt hin zum Fabrikanten gemacht war. Erst dessen Sohn August Oetker sollte sich mit seinen beiden Onkeln in Tatkraft und unternehmerischem Ehrgeiz messen können.
Dieser August Oetker wurde am 6. Januar 1862 als das älteste von zehn Geschwistern in der niedersächsischen Ortschaft Obernkirchen geboren. Sein Vater August Adolph Oetker war ein eher derber, jovialer Mann, der nach oben geheiratet hatte. Die Mutter Bertha war immerhin die Tochter eines Rechtsanwalts in Kassel. August Adolph Oetker selbst war Bäckermeister und buk das Brot für die Arbeiter, die in den Glasmanufakturen, Steinbrüchen und Kohlegruben von Obernkirchen schufteten. Damit hatten es die Oetkers zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht und konnten sogar Dienstboten beschäftigen. Am Rathausplatz bewohnten sie ein ansehnliches Fachwerkhaus. Obschon es ihnen also nicht an Geld fehlte, starben drei der neun Geschwister von August Oetker früh an Krankheiten.
Warum Bertha Oetker drei ihrer zehn Kinder verlor, ist nicht überliefert. Wollte sie die Säuglinge nicht stillen, wie so viele Frauen damals? Das war nach heutiger Erkenntnis der Hauptgrund, warum zu dieser Zeit von 1000 Säuglingen in manchen Landstrichen Deutschlands bis zu 260 schon im ersten Lebensjahr starben. Oft waren es gerade die Frauen in der bäuerlichen Oberschicht, die ihren Kindern nicht die Brust geben mochten und sie stattdessen mit Kuhmilch, Brei |39|und Zuckerwasser abspeisten. Und oft waren es Frauen wie Bertha Oetker mit einem großen Haushalt, zu dem auch Gesinde gehörte, die bei all ihrer Arbeit für die Pflege der Kinder nicht ausreichend Zeit fanden. In der Gegend, wo die Oetkers lebten, haben zeitgenössische Mediziner noch eine andere Besonderheit gefunden. Man gab den Säuglingen oft Pumpernickelbrot, wenn man sie beruhigen wollte – eine von Kleinkindern kaum zu verdauende Nahrung. Es ist denkbar, dass auch die Kinder des Bäckers auf diese Weise ruhig gestellt wurden.
Vielleicht aber wurden die Oetker-Kinder auch durch Infektionen oder Seuchen dahingerafft. Es gab noch keine Medikamente gegen Pocken, Scharlach, Masern und Diphtherie, keine wirksamen Arzneien, die Typhus und Tuberkulose, die damals noch Schwindsucht hieß, bekämpfen konnten. Meist riefen Eltern nicht einmal den Arzt, wenn ihre Kinder krank wurden. In einem 1877 erschienenen Bericht aus Minden rügte ein Mediziner die Gewohnheiten der Einheimischen: »Der westfälische Landmann versäumt es in den allermeisten Fällen, in Krankheitszuständen bei sich selbst oder in der Familie rechtzeitig ärztliche Hilfe nachzusuchen; erst wenn die Krankheit den Angehörigen und Verwandten gefährlich erscheint, bequemt er sich hierzu und begnügt sich häufig damit, ärztlichen Rath auf ›mündlichen Bericht‹ zu fordern. Das gilt aber ganz besonders bei Krankheiten kleiner Kinder, die ja nicht sagen können, was ihnen fehlt. Man vertraut hier lediglich der Heilkraft der Natur, nachdem vorher das Heer der vorgeschlagenen, oft unsinnigen Hausmittel erschöpft ist, oder bedient sich der homöopathischen Mittel.«
Wie die meisten Eltern damals dürften der Bäckermeister Oetker und seine Frau den Verlust der Kinder als einen unabwendbaren Schicksalsschlag hingenommen haben – gottergeben und mit einem gewissen Gleichmut. Das Kindersterben war damals noch Teil der Alltagswirklichkeit. Man litt, man klagte – und lebte weiter. »Der liebe Gott hat mit uns getheilt«, trösteten sich die Eltern.
Wie mag wohl der ältere Bruder auf den Verlust der Geschwister reagiert haben? August Oetker war ein aufgeweckter Junge, der gern forschte und tüftelte. Er war wissbegierig und von einem gesunden |40|Ehrgeiz beflügelt. »Benutze jede Gelegenheit, um etwas zu lernen«, lautete ein Rat, den er damals beherzigte und in seinem späteren Leben häufig anderen Menschen erteilte.
Zunächst hatte August Oetker die Bürgerschule in Obernkirchen besucht und war später auf das Gymnasium in Bückeburg gewechselt, das zum Herzogtum Schaumburg-Lippe gehörte. In Bückeburg war das Schulgeld niedriger. Der Bäckersohn war dort Schüler des angesehenen »Adolfinums«, als sich ihm und seiner Familie die Frage stellte, welche Richtung er in seinem Leben einschlagen sollte. Auf welchem Feld sollte er sich beweisen? August Oetker beschloss, Apotheker zu werden. Er wollte lernen, wie Arzneimittel wirken und wie man sie herstellte. Ein auf dem Gymnasium gewecktes Interesse an der chemischen Wissenschaft mag bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Aber vielleicht hat den Jugendlichen auch der frühe Tod der Geschwister bewogen. Vielleicht hat er sich gefragt, ob ihnen mit der richtigen Medizin hätte geholfen werden können.
Naheliegend wäre für den Sohn des Bäckermeisters damals ein anderer Berufsweg gewesen. August Oetker hätte im Betrieb des Vaters anfangen können, als ältester Sohn war er der geborene Nachfolger. Er hätte auch bei seinem Onkel Louis C. Oetker in die Ausbildung gehen können. Sicher hätte der den Neffen gerne zu sich genommen, so wie er es dann ja mit dessen jüngerem Bruder Albert tat. Auch zu einem anderen Onkel, dem Seidenfabrikanten Albert Ferdinand Oetker in Krefeld, waren die Verbindungen eng.
Aber es gab da noch einen weiteren Verwandten, der eine Rolle im Leben des Schülers August Oetker spielte – Onkel Louis in Amerika. Es spricht viel dafür, dass dieser Mann damals entscheidenden Einfluss auf August Oetker ausübte. Ja, es gibt sogar Indizien dafür, dass auch der spätere Unternehmer August Oetker seine wichtigsten Anregungen von dem Verwandten in der Neuen Welt bezog.
Doch wer war dieser Onkel in Amerika? Genau genommen, war Louis Dohme ein Vetter von August Oetkers Vater. Dessen Mutter und die Mutter Dohmes waren Schwestern gewesen. Auch Louis Dohme stammte aus Obernkirchen, wo er 1837 als das älteste von sieben Kindern |41|geboren worden war. Sein Vater Carl Dohme war dort Steinhauer gewesen. Er hatte einen eigenen Steinbruch besessen, in dem er einen braunen Sandstein abgebaut hatte. Dieses ansehnliche Material war bis in die USA geliefert worden. In Baltimore im US-Bundesstaat Maryland waren damit eine Kirche, ein Zollgebäude und zwei Banken verkleidet und verziert worden.
Als der Steinbruch in Obernkirchen keinen Sandstein mehr hergab, hatte sich Carl Dohme entschlossen, ein neues Leben zu beginnen und mit seiner Familie in die USA auszuwandern. Louis Dohme war 15 Jahre alt gewesen, als er 1852 mit seiner Familie in Bremen ein Passagierschiff bestiegen hatte, um Wochen später in Baltimore von Bord zu gehen.
Die Dohmes waren Teil einer der vielen Wellen deutscher Auswanderer, die damals in Amerika ihr Glück suchten. Deutschland war ja noch ein Land, das seine Bewohner nicht ernähren konnte. Zwischen 1850 und 1870 waren rund zwei Millionen Menschen in die USA ausgewandert: Bauernsöhne ohne eigenen Grund, Handwerker und Kaufleute, alle hatten sich in Übersee eine bessere Zukunft erhofft und sich eine Schiffspassage gekauft. Es war die Zeit, als die Vereinigten Staaten ständig gleichermaßen an Menschen und an Raum wuchsen, als weiße Siedler von Osten nach Westen vordrangen und blutige Schlachten zur Vertreibung der Indianer geschlagen wurden. Von Baltimore ausgehend, war 1827 die erste Eisenbahn in Richtung Westen gebaut worden. Für viele Menschen war die Stadt daher eine Durchgangsstation. Nicht so für die Dohmes. Sie waren nach ihrer Ankunft an der Ostküste sesshaft und Bürger des Staates Maryland geworden.
Der Steinhauer Dohme hatte in Baltimore ein Lebensmittelgeschäft eröffnet. Sein ältester Sohn Louis aber hatte den Apothekerberuf gelernt – so wie es ihm August Oetker 25 Jahre später in Deutschland nachmachen sollte.
Aber Dohme hatte nicht lange als Apotheker gearbeitet. Sein Lehrmeister Alpheus Phineas Sharp hatte schnell erkannt, dass Dohme ein junger Mann von beachtlicher Intelligenz war, und hatte ihn gefördert. So hatte Dohme im Anschluss an seine Gehilfenprüfung die pharmazeutische |42|Hochschule in Baltimore besucht. Als er fertig war, hatte er zunächst eine Stelle bei einem Apotheker in Washington, D. C. angetreten. Dann aber hatte ihm Sharp eine Beteiligung an einem gemeinsamen Unternehmen angeboten, und Louis Dohme war nach Baltimore zurückgekehrt. Im Jahr 1860 hatten die beiden Männer ein Unternehmen zur Herstellung von Arzneimitteln gegründet, die Firma Sharp & Dohme.
Es war im Nachhinein betrachtet ein besonders günstiger Zeitpunkt für die Gründung eines solchen Betriebes, denn just in diesem Jahr war der Anwalt Abraham Lincoln zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Mit ihm zog der Amerikanische Bürgerkrieg herauf, der der neuartigen Arzneimittelindustrie einen kräftigen Anstoß gegeben sollte.
Nachdem zunächst elf Südstaaten aus der Union ausgetreten waren und die Konföderierten Staaten von Amerika gegründet hatten, war es 1861 zum Krieg mit den Nordstaaten gekommen, die die Abspaltung nicht akzeptiert hatten. Für das riesige Heer an Soldaten waren Medikamente aller Art benötigt worden. Erstmalig waren diese Arzneimittel in Fabriken gefertigt worden. Unternehmen wie E. R. Squibb & Sons hatten Pulver und Tabletten in großer Stückzahl produziert und die Armeen der Nordstaaten beliefert. Auch Sharp & Dohme hatte die Unionstruppen mit Medikamenten ausgestattet. So war im Schatten des Kriegs eine neue Industriebranche entstanden.
Doch auch nach dem Bürgerkrieg war die Nachfrage nach Arzneimitteln weiter gewachsen. Viele US-Bürger versorgten sich, wenn sie krank waren, lieber selbst mit Pillen, statt zu einem teuren Arzt zu gehen. Arzneimittel gab es an jeder Ecke. Allerdings verdienten viele Präparate den Namen nicht. Zu einem Großteil bestanden sie aus Wasser, Alkohol und einem Geschmacksmittel, und häufig waren die angebotenen Arzneimittel unrein oder enthielten nicht die Inhaltsstoffe, die auf der Packung standen. Für einen Pharmaunternehmer wie Dohme bedeutete das: Wer sich in diesem Markt als ernsthafter Anbieter durchsetzen wollte, tat gut daran, bei seiner Kundschaft Vertrauen zu wecken. So begannen Pharmaunternehmen wie Upjohn, Eli |43|Lilly und Sharp & Dohme in einem neuen Stil für sich und ihre Produkte zu werben. Sie inserierten in Zeitungen und machten ihre Namen im ganzen Land bekannt. Sie gaben Almanache und Ratgeber heraus und veröffentlichten Erfahrungsberichte ihrer Kunden.
Die Firma entwickelte sich glänzend, und Louis Dohme konnte es sich leisten, von Zeit zu Zeit mit einem Dampfschiff in sein deutsches Heimatland zu fahren. In seinen späten Jahren unternahm er diese große Reise sogar jeden Sommer.
Bei einem dieser Besuche lernte er den Sohn seines Vetters August Adolph Oetker kennen. Als Gymnasiast hatte der junge August Oetker ein Zimmer bei einem Müllermeister in Bückeburg bezogen, der ebenfalls Dohme hieß. Es ist anzunehmen, dass er ein Verwandter des in die USA ausgewanderten Louis Dohme war. Wann August Oetker Dohme das erste Mal traf, ist nicht überliefert. Aber es spricht manches dafür, dass es der erfolgreiche Pharmaunternehmer war, der dem Gymnasiasten riet, den Apothekerberuf zu erlernen.
Louis Dohme hegte große Sympathien für den begabten August Oetker. Der Unternehmer selbst war unverheiratet und kinderlos. Dohme versuchte sogar, den jungen Verwandten zu bewegen, in die USA überzusiedeln. Das war für August Oetker eine faszinierende Aussicht und eine großartige Chance. Aber als er das Vorhaben mit seinen Eltern besprach, spürte er, wie sehr seine Mutter die Vorstellung schmerzte, den Sohn künftig nur noch alle Jahre einmal zu sehen. Vor allem ihr zuliebe gab August Oetker den Plan wieder auf.
Im Anschluss an sein Abitur im Jahr 1878 begann der 16-jährige August Oetker eine Lehre bei einem Apotheker in Stadthagen, der zweiten Stadt im Fürstentum Schaumburg-Lippe. Dreieinhalb Jahre dauerte die Ausbildung in der Ratsapotheke des Dr. Ernst Brackenbusch. Jeden Tag lief August 16 Kilometer zu Fuß, um vom Haus der Eltern, in das er nach Ende seiner Schulzeit wieder zurückgekehrt war, zu der Apotheke und wieder zurückzukommen.
Als August Oetker seinen Beruf erlernte, wurden in den Apotheken des Landes noch in großem Stil Arzneimittel von Hand hergestellt. Oetker lernte, wie in Schneide-, Stoß- und Siebkammern die benötigten |44|Chemikalien zubereitet und die Medikamente im Labor gefertigt wurden. Er lernte Rohdrogen zu zerreiben, Pulver zusammenzustellen und Elixiere zu mischen. Den Apothekern stand es auch damals nicht mehr frei, welche Zutaten sie verrührten, da die Zusammensetzung der Medikamente genau festgelegt war. Die Rezepte waren von einer Kommission aus Ärzten und Apothekern formuliert worden und standen in einem so genannten Arzneibuch. Jeder Apotheker im Deutschen Reich hatte sich daran zu halten.
Zu den Kunden, die der Lehrling Oetker in der Ratsapotheke in Stadthagen bediente, gehörte auch Wilhelm Busch. Der Dichter und Zeichner stammte aus Wiedensahl bei Stadthagen und war nach Jahren an den Akademien von Düsseldorf, Antwerpen und München dorthin zurückgekehrt. In dem Dorf Wiedensahl hatten auch Vorfahren der Oetkers gelebt, ein Kirchendiener namens Hinrich Otteker war bereits 1557 urkundlich erwähnt worden. Ob der Lehrling August Oetker in der Stadthagener Apotheke möglicherweise sogar das Vorbild für den von Wilhelm Busch gezeichneten »Aptekerei-Proviser Mickefett« abgab, ist ungewiss. In dem Gedicht »Die Uhren« lässt Busch allerdings seinen Mickefett eine Taschenuhr ziehen und sagen, »sie ist von einem überseeischen Paten«. Es ist nicht ausgeschlossen, dass August Oetker von Louis Dohme eine solche Uhr bekam, zumal verbürgt ist, dass Dohme seinem Bruder Charles eine besonders kostbare Taschenuhr geschenkt hat.
Im September 1881 legte August Oetker seine Prüfung als Apothekengehilfe ab und bestand sie mit der Note gut. 1882 zog er nach Langen bei Offenbach, wo er einige Zeit in der Apotheke Münch arbeitete. Die weiteren Stationen, die Oetker als Gehilfe durchlief, sind nicht bekannt. Vermutlich im Jahr 1884 kam er zu W. Heraeus nach Hanau. Die Firma produzierte vor allem Apparaturen und Geräte für Apotheken und Labors. Dem Apotheker und Chemiker Wilhelm Carl Heraeus war es 1856 als Erstem gelungen, in der Knallgasflamme Platin zu schmelzen. August Oetker hospitierte im Laboratorium und in der Platinschmelze.
In Hanau hatte der junge Mann ein Zimmer bei der Witwe Julie |45|Jacobi, einer wohlhabenden Frau, die ein Textilgeschäft führte. Sie hatte eine Tochter namens Caroline, die auf Oetker großen Eindruck machte. Die jungen Leute fanden Gefallen aneinander und freundeten sich an. Um in Carolines Nähe bleiben zu können, absolvierte August Oetker sein Einjährigen-Jahr als Soldat in Hanau. Er verließ das Militär als Reserveoffizier, was seine gesellschaftliche Stellung deutlich hob.
Als August Oetker den Beruf des Apothekers erlernte, steckte die Wissenschaft der Pharmazie noch in den Anfängen. Nur an wenigen Universitäten hatten sich Professoren auf dieses Fach spezialisiert. Andererseits gab es aber schon eine Prüfungsordnung für Apotheker, die ein Hochschulstudium von mindestens drei Semestern vorschrieb. August Oetker entschied sich für die Universität Berlin. Er schrieb sich dort für ein Studium der Naturwissenschaften ein.
Nirgendwo anders im Deutschen Reich als in Berlin hätte August Oetker in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts eindrucksvoller erleben können, mit welcher Macht sich die Industrialisierung ihre Bahn gebrochen hatte. Immer mehr Menschen zogen vom Land in die Stadt, und Berlin wurde nun zur Großstadt mit 1,5 Millionen Einwohnern. Um den alten Stadtkern entstanden ausgedehnte Vorstädte mit Mietshäusern, in denen Hunderttausende Arbeiter wohnten, die aus Schlesien und Ostpreußen gekommen waren. Die Industrie wandelte sich zur Großindustrie, die Eisen und Stahl, Chemikalien und Apparate produzierte. Oetker wurde Zeuge, wie ganz neue Fabrikbezirke im Osten der Stadt emporwuchsen. Berlin wurde zum größten Industriezentrum auf dem europäischen Kontinent. Nirgendwo lebten die Menschen gedrängter aufeinander als hier.
Die Gesellschaft veränderte sich. Die Oberschicht schwelgte im Luxus, aber auch die Arbeiter hatten es besser. Die soziale Hierarchie wurde zusehends komplizierter. Neben den Adel traten die neuen Herren der Industrie und des Finanzwesens. In den schnell wachsenden Unternehmen entstand eine Vielzahl neuer Positionen, vom ungelernten Arbeiter über die Vorarbeiter bis zu den Ingenieuren. Die Möglichkeiten der Zeit berauschten die Menschen. Erwerbsgier und Börsenspekulation |46|erfassten breite Teile des gehobenen Bürgertums. Geld und Vermögen prägten zunehmend das Prestige eines Menschen. Aber auch Bildung stand noch immer hoch im Kurs, ein akademischer Abschluss garantierte nach wie vor ein hohes Ansehen.
Nach vier Semestern bestand August Oetker sein Staatsexamen mit der Note »sehr gut«. Nun hätte er die Approbation als Apotheker erhalten können. Aber Oetker hatte Ehrgeiz entwickelt und entschloss sich zu einem weiteren Studium. Er schrieb sich an der Universität in Freiburg ein. Dort begann er, an einer Dissertation zu arbeiten. Dabei wählte er nicht etwa ein Thema der Pharmazie oder der Chemie. Der bildungshungrige Mittzwanziger wandte sich jetzt der Pflanzenkunde zu. Seine Doktorwürde erwarb er schließlich durch eine Arbeit mit der Titelfrage: »Zeigt der Pollen in den Unterabtheilungen der Pflanzenfamilien charakteristische Unterschiede?«
August Oetkers Promotion fiel in das Jahr 1888, das als Dreikaiserjahr in die deutsche Geschichte eingehen sollte. Im März starb Kaiser Wilhelm I. im Alter von fast 91 Jahren. Sein Sohn Friedrich III. hatte lange warten müssen, bis er die Nachfolge antreten konnte. Er war 56 Jahre alt, als er Kaiser wurde. Da er als liberal denkender Mann bekannt war, ruhten auf ihm die Hoffnungen des freisinnigen Bürgertums. Der Kaiser hatte eine ausgesprochen kluge Frau, die britische Prinzessin Viktoria, deren gleichnamige Mutter Königin von Großbritannien und Irland und Kaiserin von Indien war. Die Eheleute hegten schon lange eine Abneigung gegen die preußischen Militärtraditionen und gegen Bismarck. Sie hatten Pläne für eine Liberalisierung des Deutschen Reichs nach dem Vorbild des parlamentarisch regierten England.
Aber der Kaiser war sterbenskrank, als er die Regierungsgeschäfte übernahm. Er litt unter Kehlkopfkrebs und konnte schon nicht mehr sprechen. Im Krankenbett musste er seine Anweisungen niederschreiben. 99 Tage währte seine Regentschaft, am 15. Juni 1888 war der Kaiser tot.
Damit war der Weg frei für seinen Sohn. Dieser Wilhelm II., der nun mit 29 Jahren Kaiser wurde, war von gänzlich anderer Denkungsart |47|als sein Vater. Sein Verhältnis zu den Eltern war denkbar schlecht gewesen. Manche behaupten sogar, Wilhelm II. habe Mutter und Vater, die ihn ihrerseits häufig kritisiert hatten, geradezu gehasst. Seinen gestrengen Großvater hatte der junge Wilhelm dagegen sehr geliebt und er verehrte auch dessen Berater, den Reichskanzler Otto von Bismarck. Der junge Kaiser war zudem ein autoritärer Typ und er liebte den Prunk. Alles Militärische begeisterte ihn. Er war durchaus intelligent, aber er überschätzte sich. Er hielt sich für auserwählt und war entschlossen, die deutschen Staatsgeschäfte nach seinen eigenen Vorstellungen zu führen.
|48|4. »Ich werde versuchen, etwas Besonderes zu leisten«
Ein Apotheker mit Ambitionen
Die Karriere des Unternehmers August Oetker begann mit einer Pleite. Nach seiner Promotion war der gelernte Apotheker von Freiburg zurück nach Berlin gezogen. Die Stadt übte damals eine magische Anziehungskraft auf Provinzler aller Art aus. Oetker beteiligte sich in Berlin an einer Firma, die Einrichtungen für Apotheken und chemische Fabriken vertrieb. Seine ersten Schritte als selbstständiger Unternehmer wagte er gemeinsam mit zwei Partnern.
An seiner Seite lebte inzwischen die junge Caroline, die er als Praktikant in Hanau kennen gelernt hatte. Als das Paar am 20. März 1889 in der Heimatstadt der Braut vor den Traualtar getreten war, war die Braut bereits schwanger gewesen. Im November kam ihr Sohn in Charlottenburg zur Welt. Er wurde auf den Namen Rudolf getauft.
Charlottenburg gehörte damals noch nicht zu Berlin. Die Oetkers wohnten in einer guten Gegend. Im vornehmen Westen der Metropole lebten Offiziere und höhere Beamte, aber auch Künstler und Professoren. Während Oetkers Privatleben in erfreulichen Bahnen lief, kam er geschäftlich nicht voran. Das Unternehmen warf kaum etwas ab – zu wenig jedenfalls, um drei Teilhaber und ihre Familien zu ernähren.
In dieser Situation besann sich August Oetker wieder auf seinen eigentlichen Beruf. Wohl durch eine Zeitungsannonce erfuhr er, dass in Bielefeld eine Apotheke zum Verkauf stand. Er reiste mit der Eisenbahn in die ostwestfälische Stadt und besichtigte die Aschoffsche Apotheke in der Niedernstraße 3 gegenüber der Altstädter-Nicolai-Kirche. Ihre Ausstattung war nicht zeitgemäß und entsprach nicht den Vorstellungen des Naturwissenschaftlers. Aber das ließe sich ja ändern.
Laut Firmenlegende hat Dr. August Oetker sein Backpulver in einem Hinterzimmer der Aschoffschen Apotheke in Bielefeld entwickelt.
|50|