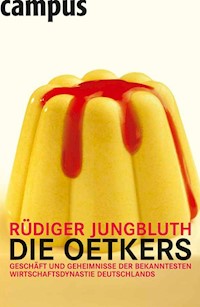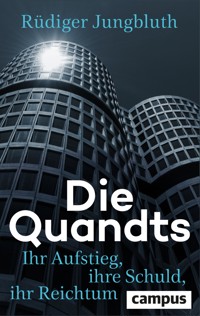
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Quandts sind die reichste Familie Deutschlands. Ihr Firmenreich umspannt heute den Globus, mit Produktionsstätten in Europa, den USA, China und Afrika. Ihnen gehören nicht nur BMW, Mini und Rolls-Royce, sondern viele weitere Konzerne, etwa im Chemie- und Arzneimittelsektor. Und sie betreiben Logistik und Umwelttechnologie, fördern Start-ups und finanzieren Forschung und Wohltätigkeit. Rüdiger Jungbluth durchleuchtet Deutschlands mächtigste Dynastie - von ihren Anfängen in der Kaiserzeit bis heute. Interviews mit Familienmitgliedern und tiefe Recherchen geben Einblick, wie die Quandts ihr Wirtschaftsimperium regieren und es an die nächste Generation weitergeben. Eine Erzählung über unternehmerischen Erfolg, politischen Opportunismus und familiäre Verwicklungen. Pressestimmen zur vorigen Ausgabe: Das Buch liest sich so unterhaltsam wie ein Roman. Wer von einer deutschen Familiengeschichte gefesselt werden möchte, muss nicht auf die Buddenbrooks zurückgreifen. Die Realität kann mindestens so spannend sein.« NZZ am Sonntag »Frau Klatten gibt ungewöhnliche Einblicke in ihr Privatleben.« Die Welt »Die Lektüre des lebendig geschriebenen, gut recherchierten und detailreichen Buches lohnt sich.« Wirtschaftswoche
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rüdiger Jungbluth
Die Quandts
Ihr Aufstieg, ihre Schuld, ihr Reichtum
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Die Quandts sind die reichste Familie Deutschlands. Ihr Firmenreich umspannt heute den Globus, mit Produktionsstätten in Europa, den USA, China und Afrika. Ihnen gehören nicht nur BMW, Mini und Rolls-Royce, sondern viele weitere Konzerne, etwa im Chemie- und Arzneimittelsektor. Und sie betreiben Logistik und Umwelttechnologie, fördern Start-ups und finanzieren Forschung und Wohltätigkeit.Rüdiger Jungbluth durchleuchtet Deutschlands mächtigste Dynastie - von ihren Anfängen in der Kaiserzeit bis heute. Interviews mit Familienmitgliedern und tiefe Recherchen geben Einblick, wie die Quandts ihr Wirtschaftsimperium regieren und es an die nächste Generation weitergeben.Eine Erzählung über unternehmerischen Erfolg, politischen Opportunismus und familiäre Verwicklungen.Pressestimmen zur vorigen Ausgabe:Das Buch liest sich so unterhaltsam wie ein Roman. Wer von einer deutschen Familiengeschichte gefesselt werden möchte, muss nicht auf die Buddenbrooks zurückgreifen. Die Realität kann mindestens so spannend sein.« NZZ am Sonntag»Frau Klatten gibt ungewöhnliche Einblicke in ihr Privatleben.« Die Welt»Die Lektüre des lebendig geschriebenen, gut recherchierten und detailreichen Buches lohnt sich.« Wirtschaftswoche
Vita
Rüdiger Jungbluth studierte Volkswirtschaft und absolvierte die Journalistenschule in Köln. Er arbeitete als Wirtschaftskorrespondent bei stern und Spiegel und viele Jahre als Wirtschaftsredakteur bei der Zeit. Jungbluth hat verschiedene bedeutende Wirtschaftsbiografien veröffentlicht, im Jahr 2002 eine erste aufsehenerregende Biografie über die Quandts, auf deren Recherchen sein neues Buch über die junge Generation aufbaut. Er lebt heute als freier Autor in Köln.
Für Ulrike
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Der Reichtum der Quandts — Ein globales Imperium aus Unternehmen
Kapitel 2
Uniformen für Preußen und das Kaiserreich — Wie die Quandts als Tuchfabrikanten in Brandenburg begannen
Kapitel 3
Feindliche Übernahmen und Machtgewinn in der Inflationszeit — Wie Günther Quandt den Elektrokonzern AFA übernahm und sein Imperium vergrößerte
Kapitel 4
Ein Neuanfang und Schicksalsschläge — Günther Quandts Ehe mit Magda, der späteren Frau Goebbels
Kapitel 5
Des Vaters zweite Wahl — Kindheit, Jugend und Berufseinstieg Herbert Quandts
Kapitel 6
Schmeicheln, kämpfen, profitieren — Günther Quandt und die Nazis
Kapitel 7
Ein Mann ohne Skrupel — Günther Quandt als Rüstungsfabrikant in Hitlers Reich
Kapitel 8
Zweier Väter Sohn — Harald Quandt, Vorzeigekind des Ehepaars Goebbels
Kapitel 9
Ein Mitläufer der besonderen Art — Günther Quandt in Haft, vor Gericht und beim Neuanfang
Kapitel 10
Die ungleichen Brüder — Herbert und Harald Quandt regieren ihr Reich gemeinsam
Kapitel 11
Die Rettung von BMW — Herbert Quandt beginnt ein neues Leben
Kapitel 12
Tod, Trennung, Teilung — Große Brüche im Hause Quandt
Kapitel 13
Eine Pille für den DAX — Susanne Klatten und ihr Glück mit Altana
Kapitel 14
Es begann mit einer Krise — Der Antritt der Quandt-Geschwister bei BMW
Kapitel 15
Lehr- und Herrenjahre eines Industriellen — Wie Stefan Quandt sein Firmenreich verkleinerte und vergrößerte
Kapitel 16
Die anderen Quandts I — Die Erben von Varta
Kapitel 17
Die anderen Quandts II — Haralds Töchter und Enkel
Kapitel 18
Erpresst und befreit — Susanne Klatten wird Opfer eines Verbrechens
Kapitel 19
Ein Wirtschaftswunder der Jetztzeit — Der phänomenale Erfolg von BMW
Kapitel 20
Eine Unternehmerin will sich beweisen — Susanne Klatten und SGL Carbon
Kapitel 21
Maßhalten mit Milliardeneinkünften — Neue Investments und gute Werke
Quellen und Literatur
Archivquellen
Literatur
Bildnachweise
Register
Vorwort
In diesem Buch erzähle ich die Geschichte der Familie Quandt von ihrer Einwanderung nach Brandenburg im 18. Jahrhundert bis in die Jetztzeit.
Mein erstes Buch Die Quandts erschien im Jahr 2002. Es bildete die Grundlage für den 2007 ausgestrahlten NDR-Dokumentarfilm Das Schweigen der Quandts, der sich vor allem mit der Verstrickung der Familie in den Nationalsozialismus und seine Verbrechen beschäftigte. Durch die Ausstrahlung der Dokumentation unter Druck geraten beauftragte die Familie Quandt den Bonner Historiker Joachim Scholtyseck, ihre Geschichte vor und während der NS-Zeit wissenschaftlich aufzuarbeiten. Sie gewährte Scholtyseck einen Zugang zum Archiv der Familie, der mir 2001/2002 noch versagt worden war.
Als ich mein Buch 2015 das erste Mal aktualisierte, berücksichtigte ich in den historischen Teilen neue Erkenntnisse aus Scholtysecks gründlicher Untersuchung, die vier Jahre zuvor erschienen war.
Das vorliegende Buch schreibt die Geschichte der Familie nun bis in die Gegenwart fort. Im Vordergrund steht dabei die vierte Generation dieser mächtigen Unternehmerdynastie, aus der die beiden BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt herausragen.
Erstmals nehme ich nun aber auch die fünfte Generation in den Blick, deren Mitglieder zum Teil bereits Vermögen und Einfluss von ihren Eltern übertragen bekommen haben.
Man kann dieses Buch von vorn bis hinten lesen. Es ist eine Familiensaga, die die deutsche Geschichte widerspiegelt wie keine andere. Man kann aber auch weiter hinten einsteigen und mit den Kapiteln über das Leben und Wirken der Quandt-Erben in der heutigen Zeit beginnen – und deren bewegte Vorgeschichte dann später erkunden.
Rüdiger Jungbluth
Köln, im März 2024
Kapitel 1Der Reichtum der Quandts
Ein globales Imperium aus Unternehmen
Es ist vermutlich die größte regelmäßige Geldüberweisung, die es in Deutschland überhaupt gibt. Jedes Jahr im Frühling transferiert der Automobilkonzern BMW eine Milliarden-Dividende an seine beiden Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt. Das Geld fließt stets im Mai, sobald das Unternehmen sein großes Aktionärstreffen abgehalten hat.
Auf ihrer Hauptversammlung fassen die Aktionäre einen Beschluss über die Höhe der Gewinnausschüttung. Dabei folgt die Mehrheit stets dem Vorschlag, den ihr der Vorstand und der Aufsichtsrat unterbreitet haben. Die Höhe der Dividende richtet sich nach dem im Vorjahr erwirtschafteten Gewinn von BMW. Es wird allerdings nicht der gesamte Ertrag unter den Aktionären verteilt, meist sind es nur rund 30 Prozent. Der größte Teil des Gewinns verbleibt im Unternehmen. Gleichwohl handelt es sich bei der Ausschüttung um einen extrem hohen Betrag. BMW ist ein Weltkonzern und dabei hochprofitabel.
Im Mai des Jahres 2023 hat der Autokonzern die Rekordsumme von 5,43 Milliarden Euro an seine Anteilseigner überwiesen. Die Aktionäre konnten mit dieser Dividende sehr zufrieden sein. Ein Kleinaktionär zum Beispiel, der einhundert BMW-Aktien im Wert von 10 800 Euro besaß, erhielt eine Dividende von 850 Euro auf sein Konto.
Die beiden Großaktionäre aus der Quandt-Dynastie verbuchten Beträge in einer ganz anderen Dimension. Susanne Klatten verfügt über rund 126 Millionen Stammaktien des Automobilkonzerns. Entsprechend hoch fiel ihr Anteil bei der Ausschüttung aus: Es waren sagenhafte 1 071 Millionen Euro, mit anderen Worten: mehr als eine Milliarde für eine einzelne Person.
Diese Zahl übersteigt das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen. Begreiflicher wird sie, wenn man es so ausdrückt: An jedem einzelnen Tag des Jahres 2022 hat Susanne Klatten durch BMW annähernd 3 Millionen Euro verdient. So ein Einkommen ist selbst aus der Perspektive von Topmanagern exorbitant. Der gut bezahlte Vorstandsvorsitzende von BMW, Oliver Zipse, hat mit seinem Einkommen von 7 Millionen Euro 2022 deutlich weniger verdient als Susanne Klatten an drei Tagen.
Klattens jüngerer Bruder Stefan Quandt kassierte eine noch größere Summe. Ihm gehören mehr als 155 Millionen BMW-Stammaktien. Sie brachten ihm eine Dividende in Höhe von 1,318 Milliarden Euro ein. In der deutschen Wirtschaft war das der größte Jackpot – es war allerdings einer, der sehr viel mehr Geld enthielt als der beim Lotto. Vergleicht man Quandts Gewinn mit dem jenes besonders reich beschenkten Lottogewinners, der im April 2023 einen Rekord-Jackpot geknackt hatte, sieht man einen großen Unterschied. Der Lottogewinner kassierte 45 Millionen Euro. Das ist eine geradezu märchenhafte Summe, aber um mit Stefan Quandt gleichzuziehen, hätte der Mann fast 30 solcher Gewinne kassieren müssen.
Die Quandt-Geschwister holen sich den Jackpot jedes Jahr. Im März 2024 gab BMW die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Mit 6,50 Euro pro Stammaktie fiel sie etwas niedriger aus, was die Kleinaktionäre enttäuscht haben dürfte. Die Großaktionäre kassieren aber auch dieses Mal wieder im großen Stil: Susanne Klatten 818 Millionen Euro, Stefan Quandt mehr als 1 Milliarde.
BMW ist nicht die einzige Beteiligung an einem Unternehmen, die den Quandt-Geschwistern regelmäßig Geld in ihre Kassen spült. Susanne Klatten ist auch noch Alleineigentümerin der Altana Aktiengesellschaft. Das ist ein international tätiges Spezialchemie-Unternehmen mit Hauptsitz in Wesel. Es brachte ihr im Frühjahr 2023 eine Dividende von 70 Millionen Euro ein.
Stefan Quandt hält die große Mehrheit (88 Prozent der Aktien) am internationalen Logistikkonzern Logwin, der von Luxemburg aus gesteuert wird. Dieses Unternehmen hat trotz des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 so gut verdient, dass die Dividende gegenüber dem Vorjahr vervierfacht werden konnte. Bei dieser Ausschüttung kassierte Quandt 60 Millionen Euro. Ihm allein gehört zudem der Arzneimittelhersteller Heel. Dieses Unternehmen, das sogenannte Naturmedizin vertreibt, überwies ihm 2023 eine Dividende von 70 Millionen Euro.
Bei diesen Zahlen liegt der Eindruck nahe, dass die Quandt-Geschwister von Jahr zu Jahr reicher werden. Das trifft wohl auch zu. Das Geschäft läuft allerdings nicht überall immer gut. Susanne Klatten ist zu 28,5 Prozent an der SGL Carbon Aktiengesellschaft beteiligt, einem Hersteller von Produkten aus Kohlenstoff, wie sie unter anderem die Luftfahrt- und die Windkraftindustrie brauchen. SGL Carbon entwickelte sich in den vergangenen Jahren schlecht, zeitweilig rutschte der Konzern sogar in die Verlustzone. 2022 machte er zwar Gewinn, aber der fiel so gering aus, dass man beschloss, vorerst nichts davon an die Aktionäre auszuschütten. 2023 waren die Zahlen noch schlechter, weil die Nachfrage der Windindustrie nach Carbonfasern eingebrochen war.
Susanne Klatten und Stefan Quandt im Juli 2022 in der BMW-Zentrale in München.
Die Quandts können solche Ausfälle leicht verkraften. Das Auf und Ab von Unternehmen, der Wechsel von Krise und Erfolg, damit sind Susanne Klatten und Stefan Quandt wohl vertraut. Sie und ihre Vorfahren haben damit mehr Erfahrung als fast jede andere Unternehmerfamilie in Deutschland. Denn Susanne Klatten, Jahrgang 1962, und Stefan Quandt, Jahrgang 1966, gehören zur vierten Generation einer Dynastie, die schon vor rund einhundert Jahren zu einer der bedeutendsten Wirtschaftsfamilien in Deutschland aufgestiegen ist.
Mittlerweile steht die Familie an der Spitze der deutschen Reichtumspyramide. Keine andere deutsche Familie hat über die Jahrzehnte eine solche Erfolgsstory geschrieben. Keine andere hat mit so vielen Unternehmen und in so vielen Branchen einen derart prägenden Einfluss in der deutschen Wirtschaft ausgeübt wie die Quandts.
Gegenwärtig ist das Quandt-Vermögen das größte, das es in Deutschland gibt. Dabei lässt sich dessen exakter Wert naturgemäß schwer bestimmen. Er schwankt mit den Börsenkursen, den Immobilienpreisen und vor allem mit den Geschäftsaussichten der Unternehmen. Die Journalisten des manager magazin bezifferten das Quandt-Kapital im September 2023 mit 40,5 Milliarden Euro. Der Anstieg des BMW-Aktienkurses habe binnen eines Jahres zu einem Zuwachs von 7 Milliarden Euro geführt.
Zur gleichen Zeit taxierte das US-Wirtschaftsmagazin Forbes den Reichtum von Susanne Klatten auf 27 Milliarden US-Dollar und den ihres Bruders auf 25 Milliarden US-Dollar. Auch wenn das Vermögen der Quandt-Geschwister damit bei weitem nicht an das der amerikanischen Tech-Milliardäre wie Elon Musk, Jeff Bezos oder Bill Gates heranreicht, so gehören sie nach der Forbes-Liste immerhin zu den 60 reichsten Menschen der Welt. Jedes der beiden Geschwister ist etwa zehn Mal so vermögend wie der britische König Charles III. (Zu dessen Krönung BMW klassische Automobile aus der konzerneigenen Rolls-Royce-Flotte zur Verfügung stellte.)
Der große Kern des Quandt-Vermögens ist ihre Megabeteiligung an BMW. Susanne Klatten hat 21,7 Prozent der stimmberechtigten Stamm-Aktien, Stefan Quandt 26,8 Prozent, zusammengerechnet 48,5 Prozent. Ihr Anteil, der lange Jahre bei 46,7 Prozent lag, ist gestiegen, ohne dass die beiden Großaktionäre Geld investieren mussten. BMW hat mit Zustimmung der Quandts Aktien von Kleinaktionären aufgekauft und damit die Gesamtzahl der umlaufenden Wertpapiere verringert.
Auch wenn die Quandts nicht die absolute Mehrheit haben, reicht ihre Beteiligung aus, um den Automobilkonzern zu kontrollieren. Gegen den Willen der Quandt-Geschwister läuft bei BMW nichts, sie sind in allen wichtigen Fragen die letzte Instanz. Aus diesem Grund ist auch der schwankende Börsenkurs kein geeigneter Wertmesser für das in BMW steckende Vermögen der Familie. Die Preise, die große internationale Investoren für eine Kontrollmehrheit an einer Weltmarke wie BMW zu zahlen bereit wären, sind ganz andere als jene, die für einzelne Aktien im täglichen Handel gezahlt werden.
Die BMW Group trägt offiziell immer noch den Namen Bayerische Motoren Werke AG. Das klingt beschaulich, traditionell und regional. Tatsächlich handelt es sich aber schon lange um einen wirklichen Weltkonzern mit 31 Produktionsstätten, die rund um den Globus verteilt sind. So produziert die BMW zum Beispiel in seinem Werk Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina mit rund 11 000 Mitarbeitern Fahrzeuge der sogenannten X-Klasse. Und in Shenyang im Nordosten der Volksrepublik China arbeiten sogar 23 000 Menschen für BMW.
Die BMW-Gruppe versteht sich als Premiumanbieter, und sie hat im Jahr 2023 fast 2,6 Millionen hochpreisige Automobile verkaufen können. Das waren fast 800 000 Fahrzeuge mehr, als sie der US-Konzern Tesla im gleichen Zeitraum abgesetzt hat. BMW hat daneben allerdings auch noch mehr als 210 000 Motorräder produziert. Im Automarkt agiert der Konzern mit drei Marken. Neben der Stammmarke BMW gehört seit den neunziger Jahren auch der einstmals britische Mini zum Automobilriesen der Quandts. Sozusagen als Krönung kaufte BMW Ende der neunziger Jahre auch noch die Marke Rolls-Royce. Seither verfügen die Quandts über einen Namen, der der Inbegriff des Luxusautomobils ist. Auf einem Grundstück, das zum Landgut Goodwood in der Grafschaft West Sussex im Süden Englands gehörte, baute der Konzern eine moderne Fabrik zur Fertigung neu entwickelter Rolls-Royce-Modelle.
Unter der Aufsicht der Quandts hat sich BMW in den vergangenen Jahren außerordentlich gut entwickelt. 2023 hat der Konzern mehr als 155 Milliarden Euro eingenommen und dabei einen Reingewinn von 12 Milliarden Euro erzielt. Die Zahl der Mitarbeiter bei BMW ist mittlerweile auf 155 000 angewachsen. Dabei handelt es sich nur um die Menschen, die direkt bei BMW angestellt sind. In Wahrheit sind aber sehr viel mehr Menschen von dem Konzern abhängig, denn er beschäftigt nicht weniger als 1 800 Zulieferer und Lieferanten rund um den Globus.
2023 hat der Konzern in aller Welt für 96 Milliarden Euro bei anderen Unternehmen eingekauft, das reichte von Rohstoffen über Komponenten bis hin zu Dienstleistungen. Das Einkaufsvolumen von BMW übertraf den deutschen Verteidigungsetat desselben Jahres um 29 Milliarden Euro.
Verglichen mit diesem Autogiganten ist das zweitgrößte Quandt-Unternehmen, die Altana AG, ein Zwerg. Aber auch dieses Unternehmen ist weltweit tätig und beschäftigt rund 8 000 Mitarbeiter. Es handelt sich um eine Unternehmensgruppe auf dem Feld der Spezialchemie, die als Zulieferer für die Herstellung von Lacken, die Druckindustrie und die Elektrobranche erfolgreich ist. 2023 nahm Altana 2,7 Milliarden Euro ein. Altana hat nur eine Eigentümerin: Susanne Klatten. Ihr Unternehmen weist in seiner Bilanz ein Eigenkapital von fast 3 Milliarden Euro aus, und es hat kaum Kredite laufen. Die Erträge sind mehr als nur erfreulich. 2023 stand unterm Strich ein Reingewinn von 110 Millionen Euro, den Klatten größtenteils zur weiteren Vermehrung in ihrem Unternehmen beließ.
Susanne Klatten, die im 2022 ihren sechzigsten Geburtstag feierte, regiert gegenwärtig ein kaum noch zu überschauendes Unternehmensreich, das über BMW, Altana und SGL Carbon noch weit hinausreicht. So hält sie zum Beispiel auch eine Vielzahl von Unternehmensbeteiligungen auf dem Feld der Wassertechnologie. Dabei geht es um die Aufbereitung von Wasser und Abwasser. Im Laufe der vergangenen Jahre hat Klatten ihr Kapital in eine Vielzahl von Unternehmen auf diesem Markt investiert. Sie heißen Ovivo, EnviroWater Group, Eliquo Water Group, Paques, Adasa, Enpure, Ecopreneur, inCTRL, Matten, Sentry, Fido, SouthWestSensor und up2e! Manche dieser Firmen gehören Klatten zu 100 Prozent, an anderen hält sie Minderheitsbeteiligungen. Klattens Wassertechnologie-Imperium besteht mittlerweile aus 120 Einzelgesellschaften in 30 Ländern. Susanne Klatten hat diese Beteiligungen unter dem Dach der SKion Water GmbH vereint, deren Umsatz 2022 die Schwelle von 1 Milliarde Euro überstiegen hat.
Die Wassergruppe ist ein Teil einer weitaus größeren Beteiligungsfirma namens SKion GmbH. In diese Gesellschaft hat die Multiunternehmerin alle ihre Firmenanteile geparkt mit Ausnahme der an BMW, für die sie eine separate Aufbewahrung hat. Im Firmennamen SKion sind die Initialen der Alleineigentümerin passenderweise großgeschrieben. Außer den bereits genannten Unternehmen findet sich unter dem SKion-Dach auch Klattens Aktienpaket am Windkraftunternehmen Nordex. Ihr gehört ferner eine große Beteiligung an Avista Oil, einem Altölaufbereiter. Die Multiunternehmerin mischt außerdem seit 2020 bei dem als innovativ geltenden Batteriehersteller BMZ mit. Eingekauft hat Klatten sich ferner bei Landa Digital Printing in Israel, bei Wattron (Heizsysteme für die Kunststoffindustrie) und bei der MultiMaterial-Welding AG, die auf einer Innovation in der Verbindungstechnik gründet.
Ihr Bruder Stefan Quandt regiert neben BMW ebenfalls noch ein Firmenreich, in dem er als unternehmerischer Alleinherrscher walten kann. Es handelt sich dabei zum einen um die Delton-Gruppe, die wiederum aus drei eigenständigen Konzernen besteht. Diese heißen Delton Health, Delton Logistics und Delton Technology. Das sind Firmen, hinter denen sich jeweils Beteiligungen an anderen Unternehmen verbergen, die Stefan Quandt gehören.
So steckt in der Delton Health der Arzneimittelhersteller Heel, dessen offizieller Name Biologische Heilmittel Heel GmbH ist. In dem Unternehmen, das seine Zentrale in Baden-Baden hat, arbeiten mehr als 1 000 Mitarbeiter für Quandt. Der Umsatz belief sich 2022 auf 262 Millionen Euro. In die Delton Logistics hat Quandt sein Engagement beim Logistikkonzern Logwin gepackt. Mittlerweile gehört ihm Logwin zu 88 Prozent. Auch dieses Unternehmen ist auf allen wichtigen Weltmärkten präsent und unterhält nicht weniger als 190 Standorte auf sechs Kontinenten.
Logwin hat 2023 einen Umsatz von 1,3 Milliarde Euro erwirtschaftet. 3 800 Mitarbeiter arbeiten in dem Konzern unter anderem dafür, das Vermögen von Stefan Quandt zu vermehren und ihm weitere Investitionen in anderen Wirtschaftsbereichen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck hat Quandt 2018 die Delton Technology gegründet, sie soll ihm als eine neue strategische Beteiligungsgesellschaft dienen. Er zielt damit auf weitere Mehrheitsbeteiligungen an »gut positionierten Technologieunternehmen«.
Stefan Quandt kontrolliert zudem die Beteiligungsgesellschaft AQton SE. In dieser Gesellschaft verwahrt er einen Teil seiner BMW-Aktien. Außerdem gehört ihm das US-Unternehmen Entrust, das Software und Hardware für Finanzkarten und elektronische Ausweise und die Authentifizierung von Benutzern anbietet. Bei Entrust arbeiten 2 500 Mitarbeiter für Quandt, der Umsatz beläuft sich auf 800 Millionen US-Dollar. Die Quandt-Firma, deren Hauptsitz im US-Bundesstaat Minnesota liegt, beliefert Mastercard, Visa und Microsoft und viele Staaten und Behörden rund um den Globus.
Stefan Quandt hat sich überdies in den neunziger Jahren beim ostdeutschen Photovoltaik-Unternehmen Solarwatt eingekauft. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden sagt von sich, dass jede fünfte Solaranlage auf deutschen Einfamilienhäusern von ihm stamme. Solarwatt erzielte mit seinen 850 Mitarbeitern 2023 einen Umsatz von 330 Millionen Euro. Nach den bisher veröffentlichten Jahresabschlüssen steckt die Firma tief in den roten Zahlen. Wegen der chinesischen Konkurrenz kündigte das Unternehmen, das Stefan Quandt zu fast 100 Prozent gehört, im April 2024 an, die Produktion in Dresden einzustellen.
Angesichts seines riesigen Vermögens kann es sich der Multimilliardär leisten, einen Teil seiner Finanzmittel in Unternehmen zu investieren, die (noch) keinen Gewinn erwirtschaften. So ist er zum Beispiel an der Ratingagentur Scope zu 25 Prozent beteiligt. Die 2012 neu ausgerichtete Ratingfirma setzt mehr als 20 Millionen um, sie hat die Gewinnschwelle aber bislang nicht erreicht. Quandt-Geld steckt ferner in dem deutsch-amerikanischen Start-up Dedrone, das ein System entwickelt hat, mit dem sich Städte, Flughäfen und Unternehmen vor Drohnen warnen lassen können. Auch Dedrone, das seinen Hauptsitz von Kassel nach San Francisco verlegt hat, schreibt bislang rote Zahlen.
In Quandts Unternehmenssammlung befindet sich ferner Heliatek, ein Technologieunternehmen in der Solarbranche. Das Unternehmen, das in Dresden beheimatet ist, hat eine organische Folie entwickelt, mit der besonders grüner Strom produziert werden kann. Die Firma, in der 250 Menschen arbeiten, hat aber bisher keine nennenswerten Umsätze aufzuweisen. Für Stefan Quandt handelt es sich um eine Investition in die Zukunft. Dasselbe gilt für das Start-up Kiwigrid und seine Softwareplattform, mit der eine dezentrale Energieproduktion gemanagt werden kann.
Quandts jüngste Erwerbung ist ein Anteil an einem jungen Schweizer Agrartechnikunternehmen. 2023 kaufte sich der Unternehmer bei Ecorobotix ein. Das Start-up hat ein System entwickelt, Pflanzenschutzmittel präziser und damit sparsamer und umweltschonender als bislang üblich auszubringen.
Die Liste der Unternehmen, bei denen Susanne Klatten und Stefan Quandt heute das Sagen haben oder jedenfalls ein gewichtiges Wort mitreden, ist lang. Beider Vermögen besteht überwiegend aus Unternehmensbeteiligungen, aber daneben gibt es auch manches andere Wertvolle. So hat sich Susanne Klatten zum Beispiel in Frankfurt einen Büroturm namens Winx Tower bauen lassen und dabei schätzungsweise 400 Millionen Euro investiert. Überdies verfügen die Quandt-Geschwister über ein großes Privatvermögen im In- und Ausland, das vor neugierigen Blicken gut geschützt ist.
Der wirtschaftliche und finanzielle Erfolg der Familie Quandt ist wahrhaft atemberaubend, der Zuwachs an Vermögen außerordentlich. Dieser fast unermessliche, hochkonzentrierte Reichtum wirft zahlreiche Fragen auf: Wie kam es dazu? Wo liegen die Quellen dieses Megavermögens? Wie hat es sich im Laufe eines Jahrhunderts bis zur gegenwärtigen Größe entwickelt? Wie kam es zu dieser extremen Konzentration von Kapital in den Händen zweier Menschen?
Es stellt sich auch die Frage, welche unternehmerischen Leistungen dem wirtschaftlichen Megaerfolg eigentlich zugrunde gelegen haben. Welche Rolle spielte die Vererbung, welchen Anteil am Erfolg hatte die individuelle Leistung einzelner Familienmitglieder? Worin genau bestand diese? Schließlich: Gibt es so etwas wie ein Geheimnis des Erfolgs? Was haben die Quandts in ihrer Geschichte besser als andere Unternehmerdynastien gemacht?
Diese Familie hat das Kunststück fertiggebracht, über drei politische Systeme hinweg eine führende Rolle in der deutschen Wirtschaft zu behaupten. Monarchie, Demokratie, Diktatur – die Quandts zeigten sich kompatibel mit allen Herrschaftsordnungen. Sie stiegen auf während des Kaiserreichs, sie spielten schon während der Weimarer Republik in der ersten Industrie-Liga. Sie expandierten weiter in der Zeit des Nationalsozialismus, und sie luden dabei auch in vielerlei Hinsicht Schuld auf sich.
Heute ist vor allem die Frage von Interesse, was diese Industriellenfamilie gegenwärtig antreibt. Welche Ziele verfolgen die Quandts mit ihren Unternehmungen? Welche Werte haben sie neben den materiellen? Wofür setzen sie ihr Geld ein? Auf welche Weise geben sie es aus?
Die Geschichte der Quandts ist eine wirtschaftliche Erfolgsstory. Zugleich ist sie eine große wahre Familiensaga. Sie ist voller Triumphe, aber auch voller Tragödien.
Wie hat sie eigentlich angefangen?
Kapitel 2 Uniformen für Preußen und das Kaiserreich
Wie die Quandts als Tuchfabrikanten in Brandenburg begannen
Die Geschichte der Quandts ist die Geschichte einer erfolgreichen Zuwanderung. Und sie ist eingebettet in den Aufstieg der Mark Brandenburg zur europäischen Großmacht Preußen. Am 18. Januar 1701 setzte sich Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg in Königsberg die Krone auf den Kopf und wurde auf diese Weise zu Friedrich I., König in Preußen. Er herrschte allerdings über ein armes Land, es war dünn besiedelt und rückständig. Um das zu ändern, holte sein Sohn und Nachfolger, König Friedrich Wilhelm I., in großem Stil Einwanderer in sein Land. Er lockte Immigranten aus ganz Europa an. »Menschen achte ich vor den größten Reichtum«, sagte er.
In welchem Jahr die Quandts aus Holland nach Brandenburg einwanderten, lässt sich nicht mehr zurückverfolgen, ebenso wenig, aus welchem Grund sie ihre Heimat verließen. Vielleicht war der erste Quandt schon 1648 mit dabei, als die ersten Holländer als Kanal- und Landschaftsbauer nach Brandenburg kamen.
Womöglich kamen die Quandts aber auch erst, als bereits Friedrich II. regierte, der später der Große genannt wurde. Dieser König wollte »jeden nach Seiner Fasson selich« werden lassen und gewann 300 000 Einwanderer für sein Reich. Vor allem Menschen, die in ihrer Heimat religiös verfolgt wurden, folgten dem Ruf des Königs: Waldenser, Mennoniten, schottische Presbyterianer, böhmische Protestanten und Juden. Sie alle waren willkommen in Preußen, denn ihr neuer Herrscher verfolgte ein machtpolitisches Ziel. Die »Kolonisten« sollten dazu beitragen, die Wirtschaftskraft Preußens zu stärken. Nicht zuletzt sollten die Einwanderer dem König jene Steuern erwirtschaften, die er für den Unterhalt seiner Armee brauchte. Preußen war ein kleiner Staat mit einer großen Streitmacht und zielte auf Expansion.
Die Einwanderer versetzten dem sandigen und von Natur aus armen Land, das im Dreißigjährigen Krieg verwüstetet worden war, einen Modernisierungsschub. Die politischen Bedingungen, unter denen die Menschen lebten, waren günstig. Preußens Könige und ihre Minister machten eine gute Wirtschaftspolitik. Die Bürger mussten zwar hohe Steuern zahlen, aber sie lebten ein Leben, so frei von Willkür, wie das zu dieser Zeit in Europa nirgendwo sonst möglich war.
Die Quandts arbeiteten über Generationen hinweg als einfache Handwerker in Brandenburg. Sie waren Seiler, Schuhmacher und Tuchmacher. Ihr Aufstieg zur bedeutendsten deutschen Wirtschaftsdynastie begann mit Emil Quandt. Er war der erste kapitalistische Unternehmer der Familie. Geboren wurde er am 13. Januar 1849, als erster (und einziger) Sohn von Friedrich und Henriette Quandt. Die Familie lebte in Pritzwalk, einer kleinen Stadt in der Prignitz, im Nordwesten Brandenburgs gelegen.
Mit sechs Jahren verlor Emil Quandt seinen Vater. Die Mutter zog ihn alleine auf. Emil lernte Sparsamkeit als eine Tugend aus Notwendigkeit. Aber er durfte die höhere Schule in Perleberg besuchen. Mit 16 Jahren fing der junge Quandt dann in der Tuchfabrik der Gebrüder Draeger in Pritzwalk an. Das war ein überschaubarer Betrieb. Es gab sechs mechanische Webstühle, die durch im Kreis laufende Pferde angetrieben wurden. Garn wurde noch von Hand gesponnen, die erste Dampfmaschine aufgestellt, als Emil Quandt bereits zwei Jahre im Unternehmen tätig war. Quandt arbeitete sich vom Lehrling zum Handlungsgehilfen hoch und wurde schließlich Prokurist. Die Fabrik wurde zum Mittelpunkt seines Leben, doch dann musste Quandt 1871 miterleben, wie sie bis auf die Grundmauern abbrannte. Die Katastrophe passierte ausgerechnet in einem Jahr des allgemeinen Aufbruchs, dem Jahr der Reichsgründung, dem Jahr, in dem der preußische König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser proklamiert wurde.
Zu ihrem Glück waren die Inhaber, die Gebrüder Draeger, versichert, bei einer Gesellschaft namens Phoenix in London. Sie kam für den Schaden zügig auf, sodass einem Wiederaufbau nichts im Wege stand. Einer der Brüder ließ sich bei der Gelegenheit allerdings lieber auszahlen. Der andere, Ludwig Draeger, sah den Neuanfang als eine Chance. 1873 ließ er ein neues vierstöckiges Gebäude errichten. Für Ludwig Draeger wurde der fleißige und fähige Quandt zum wichtigsten Mitarbeiter. Draegers ältester Sohn war ebenfalls begabt, er konnte sich aber für die Tuchfabrikation nicht begeistern. Da traf es sich gut, dass Draegers Tochter Hedwig und der junge Quandt aneinander Gefallen fanden. Die beiden verlobten sich. Noch vor ihrer Hochzeit am 20. Juli 1880 starb Vater Draeger. Emil Quandt musste die Leitung der Firma übernehmen, er war damals 30 Jahre alt. Das Unternehmen gehörte zunächst der Witwe Draeger und ihren fünf Kindern. 1883 übernahm dann aber Emil Quandt gemeinsam mit einem jüngeren Bruder seiner Frau die Fabrik. Von diesem Tag an war er sein eigener Herr.
Durch die Heirat mit der Fabrikantentochter Hedwig Draeger stieg Emil Quandt 1880 zum Unternehmer auf. Er produzierte Tuche für die Uniformen der Kaiserlichen Marine.
Emil Quandts Aufstieg zum Unternehmer fiel in eine Zeit, in der sich die Wirtschaft dramatisch veränderte. Nach dem Sieg Deutschlands im Krieg gegen Frankreich und der Gründung des Reiches hatte ein hitziger Konjunkturboom das Land erfasst. Doch der Aufschwung endete abrupt. Nach einem Börsenkrach in Wien am 9. Mai 1873 setzte eine scharfe Rezession ein. Auch an der Börse in Berlin fielen die Kurse all der neu gegründeten Eisenbahngesellschaften, Banken und Montanfirmen tief. Im Lande breitete sich Resignation aus.
Inmitten dieser Depression übernahm Emil Quandt die Geschäfte des Textilunternehmens. Er bewältigte die Krise: Unter den elf Tuchfabriken, die es in Pritzwalk gab, sollte sein Unternehmen das einzige sein, das die Flaute überlebte. Von der Konkurrenz unterschied sich das Unternehmen in mehrfacher Hinsicht. An der Spitze stand ein erfolgshungriger Aufsteiger, der darum kämpfte, den gerade erlangten Status nicht wieder zu verlieren. Zudem war die Fabrik technisch auf dem neuesten Stand, seit der Brand einen Neuanfang erzwungen hatte. Neben 26 mechanischen Webstühlen gab es mittlerweile halbautomatische Spinnmaschinen, sogenannte Mule-Jennies aus englischer Fabrikation. Hinzu kamen eine eigene Wäsche, Walke und Appretur, in denen die Tuche fertiggestellt wurden.
Noch wichtiger war, dass die Firma ihre Stoffe fast ausschließlich für einen finanzstarken Großabnehmer produzierte: den Staat. Schon seit 1858, dem Gründungsjahr der Marine des Norddeutschen Bundes, war die Fabrik der Gebrüder Draeger deren Lieferant gewesen. Das setzte sich fort, als 1871 die Kaiserliche Marine gebildet wurde. Diese Militäraufträge machten die Tuchfabrik unempfindlich gegen die Schwankungen der Konjunktur.
Ein Jahr nach ihrer Hochzeit bekamen die Quandts ihr erstes Kind, es war ein Sohn. Der Junge kam am 28. Juli 1881 in Pritzwalk zur Welt. Seine Eltern wählten den Namen Günther, in dem die althochdeutschen Wörter gund für Kampf und heri für Heer enthalten sind. Schon bald zog die junge Familie in Hedwig Quandts Elternhaus am Meyenburger Tor. Diese Villa lag in direkter Nachbarschaft der Fabrik.
Als er heranwuchs, konnte der kleine Günther mitansehen, wie sich der väterliche Betrieb entwickelte. Immer neue Maschinen wurden aufgestellt. Bald war die Fabrik eine der am besten ausgestatteten Anlagen im ganzen Kaiserreich. Der Junge erlebte das Unternehmen mit seiner strengen Hierarchie aus Arbeitern, Vorarbeitern und Meistern. Über allem thronte der Vater, ein großer, früh ergrauter Mann mit mächtigem, nach oben gezwirbeltem Schnauzbart. Die Familie wuchs rasch. Zwei Jungen kamen zur Welt, Werner und Gerhard, und ein Mädchen, Edith.
Vater Quandt war ein konservativer Preuße. Auch in geschäftlichen Dingen war Emil Quandt altmodisch, er lehnte es beispielsweise ab, neue Maschinen auf Kredit zu kaufen. Jede Erweiterung musste aus Gewinnen finanziert werden. Was den Vater bei seiner Arbeit antrieb, das hat der Sohn Günther Quandt in späteren Jahren so beschrieben: »Er dachte wie ein Bauer oder Handwerker alten Stils in Generationen. Was er erarbeitet hatte, sollten seine Söhne, meine Brüder und ich, einmal fortführen.«
Unter den drei männlichen Nachkommen war Günther der Primus. Eine gründliche Ausbildung sollte ihn auf die Nachfolgerrolle vorbereiten. Doch das war zu dieser Zeit und an diesem Ort nicht einfach einzurichten. Wenn Günther all das lernen sollte, was er als Fabrikant in der sich rasch verändernden Textilbranche wohl brauchen würde, dann hätte der Vater in Pritzwalk, einer Stadt mit damals rund 6 000 Einwohnern, mehrere Hauslehrer beschäftigen müssen. Sie hätten den Sohn Englisch und Französisch lehren müssen, die Sprachen der zu dieser Zeit größten Industrie- und Handelsmächte in Europa, dazu die Grundzüge des kaufmännischen Rechnens und mindestens so viel Kenntnis der Naturwissenschaften, dass er die Patentschriften der Textilbranche würde lesen können. Der Vater wählte einen anderen Weg und stellte damit eine entscheidende Weiche im Leben Günther Quandts. Er schickte seinen Sohn mit 15 Jahren nach Berlin.
So kam es, dass der aufgeweckte Junge aus der Provinz, noch bevor er erwachsen wurde, eine Prägung in der aufstrebenden Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches erfuhr. Großstädte sind niemals statisch, doch die Entwicklung, die Berlin um die Jahrhundertwende nahm, war auch im historischen Vergleich atemberaubend. Die Stadt wuchs nicht, sie wucherte. Zu Hunderttausenden kamen Menschen in die Metropole, die bisher auf dem Lande gelebt hatten. Auf der Suche nach einem besseren Leben fanden sie Quartier in den schnell wachsenden Vorstädten Berlins. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg stieg die Zahl der Einwohner Berlins um das Zehnfache auf vier Millionen.
Günther Quandt lebte in Berlin wohlbehütet. Er ging auf die Luisenstädtische Oberrealschule und wohnte im Haus seines Schulleiters, der zugleich sein Englischlehrer war. Er war ein guter Schüler, vor allem in Mathematik, Chemie, Geschichte und Geografie waren seine Leistungen überdurchschnittlich. Im Haus seiner Gasteltern lernte er Menschen kennen, denen er in der Provinz wohl niemals begegnet wäre, es verkehrten dort Persönlichkeiten wie der freisinnige Abgeordnete und langjährige Bismarck-Gegner Eugen Richter.
Der junge Quandt saugte Berlin in sich auf. Fast täglich unternahm er in seiner freien Zeit Streifzüge zur Erkundung der Metropole. Voller Faszination verfolgte er die Fortschritte beim Untergrund- und Hochbahnbau, der in diesen Jahren seinem Abschluss entgegenging. Der Schüler Quandt träumte davon, später einmal Architekt zu sein. Aber er wusste, dass auf ihn eine andere Aufgabe wartete.
Der Ruf kam früher als geplant. Gegen Ende des Jahrhunderts erkrankte Emil Quandt schwer an Galle und Leber. Sein Zustand besserte sich zwar rasch wieder, aber von nun an reiste der Firmenpatriarch in regelmäßigen Abständen zu Kuraufenthalten nach Karlsbad. Aus diesem Grund wollte er den Sohn so bald wie möglich im Unternehmen sehen. Emil Quandt spürte aber wohl auch, dass er selbst als Fabrikant bei dem rasanten Tempo der industriellen Veränderung nicht mehr lange würde mithalten können.
Von frühester Kindheit an wurde der älteste Sohn auf seine Rolle als Unternehmer vorbereitet: Günther (Mitte) mit seinen Brüdern Werner und Gerhard Quandt im Jahre 1890.
Günther Quandt war 17 Jahre alt, als ihn der Vater aus der Unterprima nahm. Damit war seine Jugend schlagartig beendet. Als Erstes durchlief er einen sechsmonatigen Schnellkurs im väterlichen Betrieb. Morgens um sechs Uhr setzte sich Günther an den Webstuhl, wo ihn eine erfahrene Weberin anlernte, anschließend übte er das Spinnen, lernte Walke und Wäsche. Ein Färbermeister führte ihn in die Kunst des Tuchfärbens ein und brachte ihm bei, wie man aus dem Saft der Indigopflanze leuchtende Marine- und Dragonerblaus zauberte. Im technischen Teil der Ausbildung machte sich Quandt mit der Dampfmaschine vertraut. Die Nachmittage waren der kaufmännischen Schulung reserviert. Täglich von zwei bis sieben Uhr saß Günther Quandt an der Seite des Vaters im Kontor und lernte von ihm Korrespondenz, Buchhaltung und Inventur.
Emil Quandt war mittlerweile Alleininhaber der Tuchfabrik Gebrüder Draeger geworden. Sein Schwager hatte sich beim Tennis eine Lungenverletzung zugezogen und zur Ruhe gesetzt. Im Oktober 1899 schickte Quandt seinen Sohn Günther auf die Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie nach Aachen. Für den jungen Mann begann eine harte Zeit. Seine Vorkenntnisse des Tuchmacherhandwerks erwiesen sich trotz der Schulung im elterlichen Betrieb als zu gering, er kam nicht mit. Bis in die Nächte musste Quandt über den Büchern sitzen, bis er aufgeholt hatte, was ihm zum Anschluss an die Mitschüler fehlte. Dieser selbst erarbeitete Erfolg beflügelte ihn. Freude machten ihm nicht nur die eigenen Fortschritte. Besonders gefielen ihm auch die Exkursionen, die ihn und seine Klassenkameraden in Kämmereien, Spinnereien, Maschinenfabriken oder Farbwerke in Köln, Elberfeld und Düren führten. Sein ganzes Leben sollte Günther Quandt kaum etwas so sehr fesseln wie die Besichtigung von Fabriken.
Mit großem Tatendrang übernahm der junge Günther Quandt – hier mit seinem Vater im Jahre 1900 – seine ersten Aufgaben als Unternehmer.
Der unternehmungslustige junger Mann durchwanderte den Aachener Wald und machte mit einem Schulkameraden eine zehntägige Tour mit dem Fahrrad den Rhein entlang. Er besuchte in Aachen die Tanzstunde und schloss sich einer studentischen Vereinigung namens Tessitura an. Die rheinischen Freunde schwärmten ihm von den Vergnügungen des Karnevals vor, und der junge Preuße, der wenig Taschengeld zur Verfügung hatte, bat den Vater brieflich um einen Zuschuss. Die ablehnende Antwort erhielt er nach drei durchfeierten Tagen am Aschermittwoch: »Du musst lernen, Dich nach der Decke zu strecken. Lerne sparen, leiste was, so kannst Du was, hast Du, bist Du was!«
An anderer Stelle zeigte sich der Vater großzügig. Als Quandt im August 1900 nach Hause telegrafierte, dass er sein Examen mit »gut« bestanden hatte, kam die prompte Antwort: »Herzlichen Glückwunsch. Durchfahre mit Mutter Aachen 23. August mitternachts zur Weltausstellung nach Paris. Du bist herzlich eingeladen mitzufahren.«
Die Reise nach Paris erlebte Günther Quandt wie einen wunderbaren Traum, sie hinterließ einen tiefen Eindruck. Sein damaliges Lebensgefühl beschrieb er Jahrzehnte später so: »Ich selbst unbeschwert, gerade 19 Jahre alt, mit einer zarten, stillen Liebe im Herzen, Mitglied eines siegreichen Volkes, das vor dreißig Jahren die Einigkeit errungen hatte, junger Bürger einer aufstrebenden Nation.«
Günther Quandts Ausgangsposition als Unternehmer war viel günstiger als die seines Vaters. 1896 hatte in der Wirtschaft des Kaiserreichs ein stürmischer Aufschwung eingesetzt. Verglichen mit dem Wandel in England und Frankreich erfolgte die Industrialisierung in Deutschland zwar spät, aber schnell und umfassend. Zur Jahrhundertwende war das Kaiserreich zur führenden Industrienation in Europa aufgestiegen.
Zurück im Unternehmen bewies Günther Quandt nicht nur schnell, dass er der übertragenen Aufgabe gewachsen war. Es gelang ihm auch, den vorsichtigen Vater, den der Gründerkrach mit seinen vielen Pleiten geprägt hatte, davon zu überzeugen, dass das Familienunternehmen vergrößert werden sollte. Die Gelegenheit zur Expansion ergab sich in der entfernten Verwandtschaft. In Wittstock stand die Tuchfabrik des Kommerzienrats Paul Georg Wegener zum Verkauf. Sie war sogar noch größer als die der Quandts, allerdings technisch veraltet. Emil Quandt beriet sich mit seinem Ältesten, dann kaufte er das Unternehmen für 1,1 Millionen Mark. Die Leitung der hinzugewonnenen Fabrik übernahm hoch motiviert Günther Quandt. »Was konnte es Schöneres für einen kaum zwanzigjährigen Jüngling geben, als lernend und leitend zugleich tätig zu sein?«, erinnerte er sich später.
Erst nachdem er sich sich als Textilfabrikant bewährt hatte, konnte er eine Familie gründen: Günther Quandt und Antonie Ewald bei ihrer Verlobung im Jahre 1905.
Sechs Jahre lang führte er die Firma, ohne dass ihm der Vater hineinregierte. Er unterzog das Unternehmen, das über sechs Betriebsstätten verfügte, einer durchgreifenden Modernisierung, brachte die Herstellung auf den neuesten Stand der Technik und legte veraltete Produktionsanlagen still. Binnen zwei Jahren baute Günther Quandt eine neue Tuchfabrik.
Als die Fabrik fertig war, gründete der junge Unternehmer eine Familie. Günther Quandt hatte die drei Jahre jüngere Antonie Ewald gewählt, sie war die Tochter eines Maschinenfabrikanten aus Pritzwalk. Die jungen Leute kannten sich schon seit Jahren, sie hatten bereits Briefe getauscht, als Quandt noch die Aachener Webschule besuchte. Diese »Toni« war die »zarte, stille Liebe«, die er in seinem Herzen durch Paris getragen hatte.
Im September 1906 wurde in Pritzwalk Hochzeit gefeiert. Quandt war 25 Jahre alt, seine Frau 22. Es war ein großes Fest, zu dem sich die Gäste gleichzeitig in zwei Lokalen der Stadt einfanden: In dem einen tafelten Verwandte und Freunde, im anderen feierte die Belegschaft der Tuchfabrik. Die anschließende Hochzeitsreise dauerte fünf Wochen und führte das Paar über Südtirol nach Venedig, quer durch Italien und schließlich nach Nizza, Monte Carlo und Cannes. Zurück in Pritzwalk übernahmen die Eheleute die Villa am Meyenburger Tor, in der bis dahin die Eltern gewohnt hatten. Günther Quandt machte sich nun daran, den Familienbetrieb nach eigenen Plänen zu erneuern und die Fertigungskapazitäten dabei erheblich zu vergrößern. Es war ein Umbau in Etappen, der sich über Jahre hinzog.
1908 kam im Hause Quandt der Stammhalter zur Welt, er wurde auf den Namen Hellmut getauft. Von diesem Tag an begann auch Günther Quandt in Generationen zu denken. Wenn der junge Fabrikant, der seinen Arbeitstag in der Regel morgens um sieben Uhr im Kontor begann, gegen zehn Uhr nach Hause zu einem zweiten Frühstück ging, schob er vorher meist noch einen kurzen Spaziergang dazwischen: »Oft wanderte ich dann durch den alten Park, immer vor Augen, dass das gleichmäßig emsige Schaffen jeden Tag und jedes Jahr die Betriebe der Familie um gute Schritte weiterbrachte«, erinnerte er sich später.
Bei aller Arbeit war Günther Quandt begierig, etwas von der Welt zu sehen. Die zweite große Reise seines Lebens unternahm er im Jahre 1910 alleine, seine Frau war zu dieser Zeit das zweite Mal schwanger. Quandt fuhr nach Montreux, Genf und Lyon, nach Marseille, dann weiter nach Tunis, anschließend nach Palermo, Messina, Catania und Syrakus. Er sah Amalfi und Sorrent, besuchte Pompeji, Neapel und Rom, bevor er schließlich über Prag nach Berlin zurückkehrte.
Rechtzeitig zur Geburt seines zweiten Sohnes war Quandt wieder in Pritzwalk. Am 22. Juni 1910 gebar Antonie Quandt morgens um halb acht einen Sohn, der den Namen Herbert erhielt. Zur Begrüßung des Kindes wurde auf dem Turm der Fabrik die Fahne gehisst.
Die Familie lebte in einem beträchtlichen Wohlstand. Das Haus bekam einen Anbau, elektrisches Licht und eine Zentralheizung. Günther Quandt ruhte sich aber auf den Erfolgen nicht aus. Nachdem er die Produktionsanlagen in Pritzwalk erweitert hatte, nahm er jede Mühe auf sich, um die neuen Maschinen auszulasten. Jedes Jahr ging er für vier Monate auf eine lange Vertreterreise, die ihn kreuz und quer durch das Kaiserreich führte. Zwei große Koffer schleppte er mit sich herum. In dem einen waren die persönlichen Dinge, in dem anderen die Muster aller möglichen Sorten von Uniformtuchen für Heer, Marine, für Post und Eisenbahn, für Polizei, Schützen, Chauffeure und Pförtner. Von Königsberg bis Köln, von Frankfurt bis Hamburg klapperte Quandt mit der Eisenbahn die größeren Städte ab, um Aufträge zu akquirieren. Durch diese Reisen wurde dem Unternehmer ganz Deutschland zur Heimat, sie öffneten ihm den Blick für andere Regionen, Mentalitäten und Branchen.
Günther Quandts Einfluss in der Tuchbranche wuchs in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg kontinuierlich, nicht zuletzt dadurch, dass sich die Familie vergrößerte. Seine Schwester Edith verlobte sich um 1910 mit dem einzigen Sohn des Wittstocker Textilfabrikbesitzers Rudolf Paul. Bald darauf kontrollierte der Quandt-Clan drei bedeutende Unternehmungen in diesem Geschäftsfeld.
Wie selbstverständlich fiel Günther Quandt die Aufgabe zu, aus diesen Firmen eine Einheit zu formen. Zu diesem Zweck schlossen die Inhaber der Fabriken – die drei Brüder Quandt und ihr Schwager Fritz Paul – einen Gesellschaftsvertrag, in dem sie vereinbarten, die Unternehmen von nun an gemeinsam zu bewirtschaften. Sie legten den Material- und Rohstoffeinkauf sowie den Vertrieb zusammen und koordinierten die Produktion. Das Sagen hatte Günther Quandt. Es war sein erster Konzern.
Das Arrangement entsprach dem Zeitgeist. Überall im Land suchten die Unternehmen in diesen Jahren nach Möglichkeiten, ihr Geschäft einträglicher zu gestalten. Eine beliebte Methode war dabei, den Wettbewerb aufzuheben und Kartelle oder Konzerne zu bilden. Quandt schrieb dazu später: »Konkurrenz auf enger werdendem Raum kann sich volkswirtschaftlich höchst ungünstig auswirken, dann nämlich, wenn zu große Mittel und Energien aufgewendet werden, um den Gegner niederzukämpfen. So entsprach es durchaus dem ökonomischen Prinzip, dass man sich über den Markt verständigte, statt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen.«
Es war die große Zeit der Trusts und Syndikate, in der Günther Quandt seine ersten Schritte als Unternehmer machte. Der Kapitalismus im kaiserlichen Deutschland entwickelte sich in zweierlei Hinsicht genauso, wie Karl Marx es vorhergesagt hatte: Die Unternehmen expandierten, und sie konzentrierten sich gleichzeitig. Quer durch die Branchen verleibten sich große Firmen kleinere ein, zwangen mächtige Unternehmer die Rohstofflieferanten, Zulieferer und Herstellerbetriebe unter das Dach ihrer Konzerne. Der Staat zeigte damals noch kein Interesse, die Konsumenten vor überhöhten Preisen zu schützen, die in aller Regel eine Folge der Firmenzusammenballungen waren.
Die deutschen Tuchfabrikanten schlossen sich 1912 in einer Interessengemeinschaft zusammen. Sie wollten gegenüber ihren Lieferanten und ihren Abnehmern stärker als bisher auftreten. Ihre Zulieferungen wie die Wolle wollten sie von nun an gemeinsam über eine Material-Beschaffungs-GmbH einkaufen. An der Spitze dieser Organisation stand der Textilindustrielle Fritz Rechberg, an seine Seite rückte bald Günther Quandt. Er war es, der wenig später die Verträge für eine gemeinschaftliche Tuchverkaufsstelle aller 45 deutschen Firmen, die damals die Post belieferten, ausarbeitete und aushandelte – in einer Nachtsitzung, die die meisten anderen Fabrikanten nicht durchstanden. Gegen 4.30 Uhr weckte Quandt die Herren und ließ sie unterschreiben, was er vorbereitet hatte.
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs markierte eine Wende im Leben Günther Quandts. Er war 32 Jahre alt, als die europäische Katastrophe 1914 ihren Lauf nahm. An einem sommerlichen Sonntag im Juni saß Quandt im Zug von Wittstock nach Berlin, als er bemerkte, wie die Ausflügler in großer Aufregung den Bahnhöfen zuströmten. Zeitungshändler riefen Extrablätter aus, und am Bahnhof Frohnau bekam Quandt eines in die Hand: »Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich und seine Gattin in Sarajevo von einem Serben ermordet.« Quandt hörte, wie das Wort »Krieg« von Mund zu Mund ging.
Anfang Juli 1914 gewann der Unternehmer dann allerdings den Eindruck, dass sich die Kriegswahrscheinlichkeit vermindert hätte. Und so brach er zu einer lang geplanten Schiffsreise nach Norwegen auf. Auch dieses Mal war er alleine unterwegs, denn Toni Quandt musste sich 1914 einer Operation unterziehen, eine Folge der schwierigen Geburt ihres Sohnes Herbert.
Günther Quandts Fahrt führte ihn in die Fjorde Norwegens. In Trondheim eröffnete der Kapitän den Passagieren beim Fünf-Uhr-Tee, dass in Deutschland die Mobilmachung unmittelbar bevorstehe. Er ließ die Passagiere abstimmen, ob die Gesellschaftsreise unter diesen Umständen fortgesetzt werden solle. Eine knappe Mehrheit der Reisenden wollte nach Hause. In Eilfahrt ging es die Nacht hindurch zunächst bis nach Bergen, wo das Schiff am Morgen ankerte. Man wartete auf Nachrichten, und die Reisenden erhielten die Möglichkeit, sich bis zum späten Nachmittag in der Stadt zu vergnügen. Günther Quandt und seine Reisebekanntschaften, ein junger Mann und, wie er sich erinnerte, »zwei bildschöne junge Damen«, waren durch die Aussicht des Krieges nicht bedrückt. Im Gegenteil, wie so viele Menschen in Deutschland fühlten sie sich befeuert: Sie ließen einen Wagen mit Girlanden aus dunkelroten Rosen verzieren und unternahmen eine Ausflugsfahrt durch die Stadt und ihre malerische Umgebung.
Am 3. August lief das Schiff in Bremerhaven ein. Quandt nahm den Nachtzug über Hamburg und traf am Morgen des 4. August 1914 in Pritzwalk ein. Am Bahnhof konnte er sich noch kurz von seinem Schwager Fritz Paul verabschieden, der als Soldat in feldmarschmäßiger Ausrüstung auf dem Weg in den Westen des Reiches war.
Für einen Uniformtuchfabrikanten war der Ausbruch eines Krieges gleichbedeutend mit einer gewaltigen Auftragswelle. Günther Quandt übernahm sofort das Ruder in den Betrieben. Während Bruder Werner in Pritzwalk blieb, kümmerte er sich um die Fabriken in Wittstock. Dort war der Vater von Fritz Paul aus Sorge um seinen Sohn nervlich zusammengebrochen, sodass Quandt auch in dieser Firma die Zügel in die Hand nehmen musste. Für alle drei Fabriken lagen schon seit Jahren Pläne für den Fall der Mobilmachung bereit. Wurden bisher etwa 400 Uniformen in der Woche gefertigt, stieg deren Zahl nun in kurzer Zeit auf das Vierfache. Die Werke waren bald voll ausgelastet.
In den meisten Teilen der deutschen Wirtschaft hinkte die Vorbereitung auf den Krieg der militärischen Mobilmachung deutlich hinterher. Die Generäle begannen den Krieg in einer großen Siegesgewissheit. Bei Kriegsbeginn gab es nicht einmal Getreidevorräte. Erst auf den Vorschlag des Industriellen Walter Rathenau hin, der damals an der Spitze der AEG stand und später deutscher Außenminister werden sollte, wurden einige Rohstoffe und die Produktion wichtiger Güter unter die Regie des preußischen Kriegsministers gebracht. Männer der Wirtschaft übernahmen nun im Auftrag des Ministeriums das Kommando.
Einer davon war Günther Quandt. Der junge Fabrikant, der als »vorerst untauglich« gemustert worden war, sollte in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Manager der deutschen Kriegswirtschaft werden. Zunächst zog er in den Aufsichtsrat einer sogenannten Kriegswollbedarf AG ein. Bald darauf leitete er als Vorstand selbst deren Geschäfte. Auch auf dem neuen Posten erwies er sich als ein befähigter Organisator.
Der Erste Weltkrieg war ein historisch neuartiger Krieg. Je länger er dauerte, umso mehr wurde er zu einem Wirtschaftskrieg, einer Schlacht, die in den Betrieben der Kriegsparteien geschlagen wurde. Niemals zuvor in der Geschichte waren größere Menschenmassen kämpfend aufeinander getroffen, aber niemals zuvor hatte die Kopfzahl für den Ausgang der Schlachten eine so geringe Bedeutung. Entscheidend war die Ausstattung der Kämpfenden mit Vernichtungsmitteln, mit Panzern, mit Flugzeugen, mit Maschinengewehren und Giftgas. Das tödliche Material in Massen herzustellen, das war eine Aufgabe der Wirtschaft.
Mit großem Einsatz nahm Günther Quandt an dem teil, was Rathenau den »Feldzug der Materie« nannte. Die Aufgabe, vor der er stand, war schwierig. Die meisten Industriellen wehrten sich gegen den Staatseingriff. Quandt musste lernen, wie man Widerstände aus dem Weg räumt und seinen Willen auch außerhalb des eigenen Unternehmens durchsetzt.
Der Unternehmer war ein kaisertreuer Patriot, aber sein Geschäftssinn war noch stärker ausgeprägt als die Vaterlandsliebe. Seine Einsatzfreude bei der Organisation der Kriegswirtschaft speiste sich nicht aus einem Hurrapatriotismus, wie ihn große Teile des Volkes pflegten, eher schon aus einem Pflichtgefühl. Vor allem aber witterte der Unternehmer aus der Provinz eine gute Gelegenheit, um sich in Berlin Verbindungen zu mächtigen Männern aufzubauen, die ihm dabei helfen könnten, seinen Einfluss über die Textilbranche hinaus auszudehnen. Mit der Herstellung von Tuchen hatte es Quandt zwar bereits zu beträchtlichem Wohlstand gebracht, er wusste aber, dass diese Branche nicht zu den Wachstumsfeldern der Wirtschaft gehörte. Sie lastete ihn auch nicht aus. Die Betriebe in der Prignitz leitete er von Berlin aus mit brieflichen Anweisungen, während er die Kriegswollbedarf AG zu einer Firma mit 2 100 Mitarbeitern ausbaute.
Von Golo Mann stammt der Satz: »Es ist eine alte Erfahrung, dass der Krieg die Starken stärker und die Schwachen, schon im Niedergang Befindlichen, noch schwächer macht.« Für Günther Quandt traf das zu. Er gehörte von Anfang an zu den Gewinnern des Krieges. Wie andere deutsche Fabrikanten auch arbeitete Quandt mit exorbitanten Gewinnspannen. Die Behörden waren außerstande, die Preise der Rüstungsfabrikanten und Heereslieferanten zu kontrollieren. Im Grunde waren sie nicht einmal willens dazu. Die Militärs wollten mit der Hilfe der Industrie einen Krieg gewinnen, es ging ihnen nicht darum, Steuergelder zu sparen. Schließlich war ohnehin vorgesehen, am Ende den besiegten Feinden die Rechnung aufzubürden.
Vom Blutbad und Massensterben in den Schützengräben bekam Quandt in Pritzwalk und Berlin nichts mit. Für alle Deutschen, die damals nicht an den Fronten waren, war dieser Krieg ein fernes Ereignis, das sie vornehmlich in der Lektüre von Heeresberichten erlebten. Es gab noch keine Fliegerangriffe auf deutsche Städte wie im Zweiten Weltkrieg.
Im August 1918, als die Schlacht bei Amiens verloren ging, wurde Günther Quandt klar, dass der Krieg verloren war. Am 5. Oktober saß der Fabrikant als Zuschauer im Reichstag und wurde Zeuge, wie der neue, noch vom Kaiser berufene Reichskanzler Max von Baden ein Waffenstillstandsangebot verlas. Am 9. November 1918 dankte Wilhelm II. ab.
Die alte Elite war diskreditiert. Nun übernahmen Sozialdemokraten die Führung im Reich. Ihr Ziel war eine Reform von Staat und Gesellschaft, aber sie wollten zugleich eine Revolution nach russischem Vorbild verhindern. Friedrich Ebert sah es als seine patriotische Pflicht an, die Deutschen vor »Bürgerkrieg und Hungersnot« zu bewahren. Deshalb beließ der SPD-Politiker, der 1919 Reichspräsident wurde, die kaiserlichen Beamten auf ihren Posten, und deshalb ließ er die Aufstände im Land vom alten Heer niederschlagen. Das allerdings war eine schwere Hypothek für die entstehende Republik.
Anders als den Krieg empfand Quandt die revolutionären Geschehnisse, die den militärischen Zusammenbruch begleiteten, als bedrohlich. Auf einmal wurde auch in Berlin geschossen und gekämpft. Demonstrationen und Straßenschlachten, Streiks und Putschversuche – für den Ordnungsmenschen Quandt waren das erschütternde Erlebnisse. »Unser Vaterland stand vor dem Chaos«, schrieb er später. Mit gemischten Gefühlen sah er, dass es Sozialdemokraten waren, die wieder »etwas Ordnung in das Staatswesen« brachten.
Schon vor Kriegsende hatte sich Günther Quandt in Berlin nach einem Haus für sich und seine Familie umgeschaut. Fündig war er in Neubabelsberg geworden. Die Villa lag in der Kaiserstraße 34, direkt am Griebnitzsee. Die dortige Villenkolonie hatte sich zu einem Rückzugsgebiet reicher Berliner Bankiers, Fabrikanten, Offiziere und Professoren entwickelt. Es war eine malerische Gegend, die Straßen waren von Platanen, Linden oder Ahorn gesäumt. Quandts Haus war das letzte des Ortes, sein Grundstück grenzte unmittelbar an den Schlosspark Babelsberg.
Im Oktober 1918 besuchten Antonie Quandt und ihre halbwüchsigen Söhne Hellmut und Herbert den Vater während der Schulferien in der Reichshauptstadt. Die Familie logierte im Fürstenhof. Stolz führte Quandt den Seinen das Haus in Neubabelsberg und den 7 000 Quadratmeter großen Park mit altem Baumbestand vor. Hier sollten sie bald alle gemeinsam wohnen.
Doch es kam anders. Als Antonie Quandt mit ihren Söhnen am nächsten Tag nach Pritzwalk zurückkehrte, musste sie sich gleich ins Bett legen, so schlecht ging es ihr. Am Tag darauf erhielt Günther Quandt in Berlin einen Anruf seines Prokuristen, der ihm mitteilte, dass sich seine Frau wohl eine Lungenentzündung zugezogen habe. Quandt versuchte, einen Berliner Medizinprofessor dazu zu bewegen, mit ihm gemeinsam nach Pritzwalk zu fahren, aber der Arzt lehnte ab. Er hatte ein Dutzend ähnlicher Fälle schwer kranker Grippepatienten, die er behandeln musste.
Am Tag darauf starb Antonie »Toni« Quandt. Sie war eines von insgesamt 20 Millionen Opfern, die die Spanische Grippe 1918 weltweit forderte.
Kapitel 3Feindliche Übernahmen und Machtgewinn in der Inflationszeit
Wie Günther Quandt den Elektrokonzern AFA übernahm und sein Imperium vergrößerte
Der Tod seiner Frau war der erste schwere Schicksalsschlag in dem bis dahin an Glück und Erfolg überreichen Leben des Günther Quandt. Mit 37 Jahren war er zum Witwer geworden. Aber er ließ sich davon nicht niederschlagen.
Die beiden Söhne, acht und zehn Jahre alt, wohnten vorübergehend bei den Großeltern in Wittstock. Im März 1919 holte er sie nach Berlin und brachte sie im Schülerheim Dahlem unter, wo sie unter der Obhut eines Ehepaars lebten. Hellmut und Herbert Quandt besuchten das Arndt-Gymnasium. Ihren Vater sahen sie nur am Wochenende.
Günther Quandt arbeitete an seinem weiteren Aufstieg. Die Basis war gut. Wenige Menschen in Deutschland hatten vom Ersten Weltkrieg in dem Maße profitiert wie der Uniformfabrikant. Schon vor dem Krieg hatte Emil Quandt einen Großteil seines Vermögens auf seine Nachkommen übertragen. Als Armeeausstatter hatten die Söhne ihr Erbe vervielfachen können. Aus dem wohlhabenden Provinzfabrikanten Günther Quandt war ein reicher Mann geworden, und er verfügte nun über Verbindungen in andere Bereiche der Industrie und in den Beamtenapparat hinein. Ehrenamtlich leitete der Unternehmer das Referat Kunstwolle im Reichswirtschaftsministerium und stand an der Spitze einer Reichsstelle für Textilwirtschaft.
Zur selben Zeit begann Günther Quandt eine weitere Karriere auf einem anderen Feld der Wirtschaft: in der Kaliindustrie. In dieser Branche ging es sehr viel ungestümer zu als in der Textilwirtschaft, wo die Konjunkturwellen ausgesprochen sanft verliefen. Seit Justus von Liebig nachgewiesen hatte, dass sich Salze mit dem Element Kalium als Düngemittel verwenden ließen, war der Kalibergbau in Deutschland zu einem Betätigungsfeld für Gründer und Spekulanten geworden. So viele Bergwerke waren eröffnet worden, dass das Angebot an Kali stark gewachsen war, wodurch die Preise verfielen. Große Vermögen lösten sich dadurch in kurzer Zeit in Luft auf. Um die Krise zu überwinden, hatten die Kalifirmen schon vor dem Krieg angefangen, sich in größeren wirtschaftlichen Einheiten zu organisieren. Die entscheidende Konzentrationsphase begann mit den zwanziger Jahren.
Einer der Strategen in diesem großen Monopoly war Günther Quandt. 1918 trat er, vermittelt durch den Textilunternehmer Fritz Rechberg, in den Vorstand von Wintershall ein. Dort traf Quandt auf den elf Jahre älteren August Rosterg, den Generaldirektor von Wintershall, der zugleich ein großer Anteilseigner des Unternehmens war. Rosterg machte sich daran, die Branche aufzurollen, und dafür konnte er Quandt gut gebrauchen.
Die beiden Männer hatten auf den ersten Blick wenig gemein. Der eine war ein Fabrikantensohn, dem der Vater reichlich Starthilfe gegeben hatte, der andere das Kind einer zwölfköpfigen Bergmannsfamilie, der sich vom Bohrmeister zum Generaldirektor hochgearbeitet hatte. Aber beide verband der Drang, sich Firmenreiche aufbauen zu wollen. Rosterg wollte aus Wintershall den beherrschenden Konzern der deutschen Kaliindustrie machen.
Vor dem Ersten Weltkrieg hatte Deutschland auf dem Weltmarkt für Kali ein Monopol errichten können, das nach der Niederlage zerfiel. Wintershall hatte zwei Werke im Elsass verloren, aber dafür wurde die Firma vom Reich entschädigt. Diese Kriegsentschädigung bildete die Kriegskasse für Firmenübernahmen. Rosterg und Quandt setzten die Mittel dazu ein, ihrer Gruppe zahlreiche Konkurrenzunternehmen einzuverleiben. 1920 unterhielt Wintershall 27 Kaliwerke. Mit Quandts Hilfe hatte Rosterg in kurzer Zeit einen riesigen Konzern geschaffen, für dessen Leitung er in Kassel eine Zentrale einrichtete.
Rosterg war ein Mann, der das Wohlgefühl der Macht genoss, den es aber nicht danach verlangte, sich im Glanze dieser Macht zu sonnen. Dieses Vorbild bestärkte Günther Quandt in seiner eigenen Vorliebe, hinter den Kulissen zu agieren. Dass eine diskrete Vorgehensweise in der Wirtschaft von Vorteil war, für diese Erkenntnis fand Quandt bei den Übernahmeschlachten in der Kalibranche vielfach Bestätigung. Man konnte, wenn man still und heimlich seine Pläne verfolgte, die Konkurrenten überraschen und überrumpeln.
Rosterg und Quandt hatten die industrielle Logik auf ihrer Seite, und ihr Übernahmefeldzug war ein Gebot der Wirtschaftlichkeit. Der Konzentrationsprozess in der Kaliindustrie war aber zugleich auch ein Beutezug, bei dem nicht immer mit sauberen Mitteln gekämpft wurde. Für Günther Quandt war es eine weitere wichtige Lehrzeit. Denn bei diesen Unternehmenskäufen machte sich der Fabrikant mit allen Finessen des Aktienhandels und der Spekulation vertraut. Seine Kenntnisse und Erfahrungen in Finanzdingen sollten ihm dann außerordentlich nützlich sein, als das Geldwesen des Deutschen Reiches in Turbulenzen geriet und schließlich zusammenbrach.
Für die große Geldentwertung, die sich Anfang der zwanziger Jahre ereignete, machten viele Deutsche die Revolution und die junge Republik verantwortlich. Tatsächlich war sie eine Folge des Krieges und seiner gewaltigen Kosten. Der Krieg hatte nach dem Plan der kaiserlichen Regierung genauso finanziert werden sollen wie der von 1870/71: durch spätere Zahlungen des besiegten Feindes. Die Steuern waren nicht erhöht und die Kriegskosten durch Anleihen abgedeckt worden, durch Geld also, das sich die Regierung bei den Bürgern lieh. Während des Krieges hatte das Reich außerdem Großkredite aufgenommen, um die wuchernden Ausgaben zu decken, sodass die Geldmenge über die Maßen wuchs. Die Folge war Inflation. Zwischen 1914 und 1918 verdreifachten sich die Preise in Deutschland.
Nach der Kapitulation sah sich die neue Regierung vor die Wahl gestellt, entweder Engpässe in der Nahrungsmittelversorgung hinzunehmen, gar einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zu riskieren, oder weiterhin auf Pump zu regieren. Die neuen Herren entschieden sich für neue Schulden – und damit für noch mehr Inflation. Die Reparationen verschärften die Lage dann noch. Im Versailler Vertrag von Mai 1919 bürdeten die Siegermächte Deutschland sämtliche Rechnungen auf, die nach dem großen Krieg offen geblieben waren.
Der Verfall der deutschen Währung nahm seinen Lauf. 1921 setzten die Siegermächte den von den Deutschen zu zahlenden Schadenersatz auf 132 Milliarden Goldmark fest, zu zahlen in Dollar, aufgeteilt in Jahresraten über mehrere Jahrzehnte. Schon die erste Rate brachte die deutsche Regierung nur dadurch auf, dass sie Geld drucken ließ und es anschließend an den Devisenmärkten gegen Dollar verkaufte. Sofort sackte der Wechselkurs der Mark zu Dollar und Sterling ab, die Preise schossen in die Höhe.
Im Juni 1922 erschossen zwei Männer aus einem Auto heraus den Reichsaußenminister Walter Rathenau. Diese Bluttat zerstörte den Rest des Vertrauens in die Mark. Anleger im In- und Ausland trennten sich von Guthaben, die sie in deutscher Währung hielten. 1922 lag die Inflationsrate in Deutschland bei 1 300 Prozent. Im Herbst des Jahres 1923 erreichte die Währungskrise ihren Höhepunkt. Der Bargeldumlauf explodierte, im Oktober gab es Scheine mit dem Betrag von 2 500 Billiarden Mark, im November waren es 400 Trillionen. Auf dem Devisenmarkt war die Mark nichts mehr wert, Mitte November bekam man für einen Dollar 1,26 Billionen Mark. Dann kam der große Schnitt – die Währungsreform mit der Rentenmark, einer Übergangswährung, die durch Grundschulden gedeckt war.
Die völlige Entwertung des alten Geldes traf nicht alle Deutschen in gleicher Weise. Manchen kam die Inflation gerade recht. Wer Schulden hatte, wurde sie los. Wer dagegen Ersparnisse in Kriegsanleihen oder auf einem Sparbuch angelegt hatte, war mit einem Mal wieder arm. Die Hauptopfer waren die Sparer und Zeichner der Kriegsanleihen, ein Großteil der Mittelschicht war durch die Hyperinflation ruiniert worden. In vielen Akademikerfamilien, die das Studium ihrer Kinder traditionell durch Ersparnisse finanzierten, war diesen Plänen die Grundlage entzogen. Einer ganzen Generation sei damals ein seelisches Organ entfernt worden, hat Sebastian Haffner später geschrieben, ein Organ, das den Menschen Standfestigkeit und Gleichgewicht gebe und das sich als Vernunft oder Moral äußere.
Günther Quandt hingegen verfügte über die Talente, die man in einer solchen Situation brauchte. Er war klug, schnell und entschlossen. Dank dieser Gaben schaffte er es, zu einem der Nutznießer der Währungstragödie zu werden, die die Mehrheit der Deutschen in tiefe soziale Not stürzte.
Früher als die meisten seiner Landsleute hatte Quandt begriffen, dass es bei einer Inflation darauf ankommt, liquides Vermögen in Sachwerte umzuschichten. Das war allerdings nicht einfach zu bewerkstelligen. Unklar war zum Beispiel, ob Aktien als Sachwerte gelten konnten. Die meisten Kleinaktionäre sahen das damals nicht so. 1919 und 1920 fielen die Kurse, es herrschte Panikstimmung unter den Besitzern.
Andere kauften an der Börse kräftig ein, weil sie genauer verstanden, wohin die Wirtschaft schlingerte. Das Währungsdrama bot risikofreudigen Spekulanten fantastische Möglichkeiten. Börsenhaie wie Peter Klöckner, Otto Wolff und Friedrich Flick rafften in wenigen Jahren Hunderte von Firmen zusammen. Der König der Konzernbauer war ohne Zweifel Hugo Stinnes. Er schaffte sich ein Reich von Kohle- und Stahlunternehmen, kaufte Werften und Kraftwerke und sammelte Luxushotels wie das Atlantic in Hamburg und das Esplanade in Berlin. Auf dem Höhepunkt seiner Macht besaß Stinnes Anteile an nicht weniger als 4 554 Gesellschaften.
Risikolos waren Spekulationen in der Inflationszeit nicht. Eine Gefahr lag darin, dass der Prozess der Geldentwertung nicht stetig verlief. Mal beschleunigte er sich, dann aber gelang es der Reichsbank, die Inflation durch Intervention zu bremsen. Und noch ein Umstand machte jede größere Aktienspekulation zu einer gefährlichen Sache: Schon damals glich die Börse einem Haifischbecken, in dem zahlreiche große Fische herumschwammen. Wer nicht nur mit einzelnen Aktien handelte, sondern mit Paketen, der lief Gefahr, bei seinen Geschäften einem Größeren, einem Mächtigeren in die Quere zu kommen.
Ein solches Erlebnis machte Günther Quandt im Frühjahr 1921. In der Tageszeitung las er die Tagesordnung für die anstehende Aktionärsversammlung der Deutschen Wollwaren-Manufaktur, einer AG, von deren Aktien er viele gekauft hatte, sodass ihm nun 10 Prozent gehörten. Nun wollte diese Firma ihr Kapital erhöhen und dazu neue Aktien ausgeben, ohne sie jedoch als Erstes den Altaktionären anzubieten, wie es üblich war. Überdies sollte es sich bei den neuen Aktien um Papiere mit zehnfachem Stimmrecht handeln. Quandt war alarmiert, als er davon erfuhr: »Kein Zweifel, das war ein Angriff auf mich«, erinnerte er sich später. »Gelang er, so war mein Besitz entwertet.«