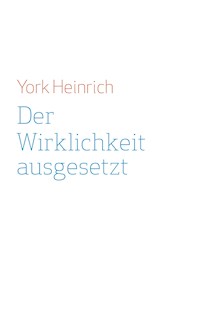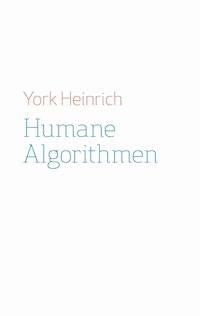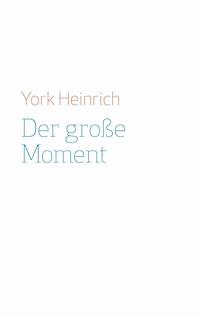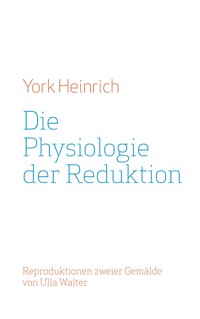
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ist Philosophie eher allgemeine Kritik an Sprache und Denken, oder lässt sie sich auch im Praktischen durchführen, mit Stift und Pinsel? Zum Beispiel in einer persönlichen Malerei mit individuellen Fragen an die Wirklichkeit? Zwei Bilder, im Abstand von mehr als dreißig Jahren von derselben Künstlerin gemalt, begleiten in diesem Buch eine philosophische Reduktion - kein Hinwegtun, sondern eine Transformation in das Wesentliche. Dabei präsentiert sich diese Philosophie als peridisziplinäre Methode, bei der sich um alles Disziplinierte, das die Menschen benötigen, um sich im Chaos der Wirklichkeit zurechtzufinden, kreatives Gepäck ansammelt, für jeden persönlich und immer mitzunehmen. Philosophie und Malerei schaffen so gemeinsam einen Brückenschlag in einen sonst unzugänglichen Bereich: Das wenige Persönliche eines Menschen, sein Wesentliches, sonst verborgen im Amalgam aus Durchdachtem und Emotionalem, wird in Wort und Bild beispielhaft decodiert. Begriffe wie Bild und Bildung, Wahrheit und Wirklichkeit, Wesen und Wesentliches werden aus einem persönlichen Blickwinkel begreifbar. Das Buch setzt dabei auf das Wesen des Menschen, sich selbst hinterfragen zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
In-sich-Sein
Merkmalsträger
Erzählung
Fragen
Wesen
Klima
An-Anderem-Sein
Vertrauensperson
Intoxikation
Kreativität
Diszipliniert
Homöostase
Umfeld
Transformation
Funktion
Vertrauen
Informationen
Zukunft
Physiologie
Sprache
Absicht
In-sich-an-Anderem-Sein
Individuum
Roman
Musik
Buch
Zyklus
Liebe
Bildung
Ordnung
Reduktion
Modell
Vernunftwesen
Verstand
Man muss erst eine Brücke geschaffen haben.
Friedrich Nietzsche, Digitale Kritische Gesamtausgabe, BVN-1888, 1220
Abb. 1 Ulla Walter • Tanz über der Stadt, 1986 • Öl auf Malplatte, 186 x 227 cm • Foto © Michael Lüder
VORWORT
Das Bild war noch völlig unbegreiflich. In einem wissenschaftlichen Theater wurde den Besuchenden ein Wunderkind präsentiert, das bereits alles wissen konnte. In dessen Umgebung steckte so viel technisches Meisterwerk, das aus jedem seiner angelegten Werkzeuge ein wohlklingendes Instrument zaubern konnte.
Das sorgfältig platzierte Auditorium bekam allerhand Erläuterungen zu diesem menschlichen Wunderwerk. Trotzdem herrschte eine seltsame Stimmung im Saal, da die derzeitigen Katastrophen einander ablösten und jeweils eine das ganze Geschehen bestimmte. Die drohende Klimakatastrophe war gerade aufgrund der reduzierten Auffassungsfähigkeit des Menschen ausgeblendet.
Ein Zuhörer fragte das Wunderkind in einer Fremdsprache, wie das Wetter werden würde, und mit minimaler Verzögerung war aus einem kleinen, in einer Innentasche der sehr zeitgemäßen Kleidung angebrachten Lautsprecher mit kindlicher Stimme zu hören: Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sonnig. Die Antwortmöglichkeiten waren auf alle Regionen der Erde in allen möglichen Sprachen eingerichtet. Ein riesiger Applaus zeugte vom verwunderten Staunen der Zuhörenden, denn das kleine Kind hatte zuvor bereits die verschiedensten Fragen adäquat, das hieß im Sinne des allgemein Berechenbaren, beantwortet.
Mit transhumaner Technikverliebtheit waren, schnurlos verbunden mit einer riesigen Datenbank, in schnellstmöglicher Zeit die Wahrscheinlichkeiten für das kommende Wetter errechnet worden. Anhand einer Ausdruckserkennung des impulsgebenden Gesichtes wurde die ehrliche Absicht der Frage mit einer vorhergesagten Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und der Reaktion im kindlichen Gehirn abgeglichen. Hätte das Kind Angst bekommen, wäre die Antwort anders ausgefallen. Die künstliche Intelligenz war sein allwissendes Umfeld. Sie kannte zudem alle gängigen Dimensionen einer Atmosphäre. Welche Eindrücke hatten ein Gesicht geformt; eher ein Staunen oder mehr Gram, ein Lächeln oder Grinsen, vielleicht nur eingefrorene Züge oder Fratzen? Die winzige Kamera in der Kleidung des Kindes nahm alle möglichen Gesichtszüge wahr, und eine Verknüpfung mit gespeicherten Daten ordnete sie bekannten Verhaltensweisen zu.
Ein Computer errechnete aus den wenigen Begriffen, die in den Fragen vorkamen, die zutreffendsten Antworten. Der Mensch liebte die Technik und hatte sich für die meisten Fertigkeiten ein besseres Modell geschaffen. Mit autonom fahrenden Verkehrsmitteln waren Distanzen noch schneller zu überbrücken, und intelligente mobile Geräte befriedigten prompt nahezu alle menschlichen Bedürfnisse. Hierbei war der Mensch aber von den Techniken noch körperlich getrennt. Implantierte Elektroden würden in Zukunft diese Insuffizienz beheben. Aber was der Mensch mit der gewonnenen Zeit anfing, war nur eine von vielen Fragen, bei der die Datensammlung der Welt noch auf absurde Seiten verwies.
Dennoch wuchs eine große Sehnsucht im Auditorium. Alles wissen zu können stellte eine Verführung dar, der die Menschheit bisher erlegen war. War es die Hoffnung, dass sich die ständig wiederholenden menschlichen Probleme durch die künstliche Intelligenz endlich verhindern ließen? Die Menschheit war auf dem Weg zur Selbstoptimierung und verließ dabei die klassische Bildung, das hieß die Entwicklung über Bilder, die der einzelne Mensch noch selbst, ohne zwischengeschaltete Bildbearbeitungsprogramme, wahrgenommen hatte. Eine natürliche Software für Bilder war das Gehirn. Es nahm nicht nur die benennbaren Gegenstände wahr, sondern rundherum noch viele nicht bewusste Dinge. Gleich den Rändern seines Gesichtsfeldes, das zudem noch weitere Sinnqualitäten integrierte, oder in der Wahrnehmung von Musik mit ihren starken Emotionen. Wenn sich der Mensch auf etwas konzentrierte, nahm er anderes aus dem Blickfeld, aber nicht aus der Wahrnehmung.
Wie verhält es sich zum Beispiel mit der künstlerischen Wahrnehmung und dem Begriff der Reduktion in der Kunst? Letzteres ist kein fest definierter Terminus und lässt vielfältige Assoziationen zu. Das bringt ihn in Verbindung mit der beginnenden Moderne des frühen 20. Jahrhunderts und der Abkehr von der akademischen Tradition. In zunehmend radikalerer Ausprägung findet sich der Begriff der Reduktion in verschiedenen Kunstrichtungen der Nachkriegsmoderne. Über den künstlerischen Minimalismus hinaus ist »Reduktion auf das Wesentliche« aber eine für verschiedene Entwicklungszeiten zutreffende Beschreibung und lässt sich auch auf vielfältige Strömungen der zeitgenössischen Kunst beziehen.
Wie wäre zu der vorliegenden philosophischen Reduktion auf das Wesentliche ein begleitendes künstlerisches Experiment, bei dem es gilt, das Thema eines bestehenden Bildes nach über dreißig Jahren neu zu bearbeiten (s. Abb. 1 und 2))? Würde das Wesentliche des Bildes überdauern, bliebe die Wahrheit bestehen? Was ist die unmittelbare Essenz, die den Bildgedanken trägt, und wie setzt eine Künstlerin ihre eigenen Wahrnehmungen und Entwicklungen in dreißig Schaffensjahren beim selben Bildthema erneut um? Worauf ließe sich nicht verzichten, um Wesentliches zu erhalten?
In dem beschriebenen Theater des Positivismus sollte der fokussierte Blick auf das zu dieser Zeit höchst entwickelte Menschenbild mit seinen ständigen Wissensmodifikationen den Blick schärfen. Die Menschen richteten sich nach diesem scheinbaren Optimum aus. In der ständigen Selbstoptimierung, dem Milieu eines disziplinierten In-sich-Seins und eines interdisziplinären An-Anderem-Seins, wäre keine dauerhafte Veränderung gesellschaftlicher Bedingungen denkbar. Alles bliebe beim Alten, also einem ständigen Stoffwechsel und dem unausweichlichen Ende freien menschlichen Lebens unterworfen.
Die Menschen würden wahrscheinlich den Lauf der Dinge nicht ändern können, aber sie könnten ihn anders würdigen, ihm eine andere Perspektive einräumen. Neben eine allgemeine Stoffwechselphysiologie, einen Überschreibmodus, ließe sich eine Physiologie der Reduktion stellen, eine Entscheidung zu persönlichen, differenzierten Blickwinkeln mit eigenen Fragen, Bildern und Erzählungen, die durch andere ergänzt werden könnten, aber zu einer Kultur der schwer überschreibbaren Wahrheiten, zum Wesentlichen, führte.
Das Wunderkind schien Spaß am Applaus zu haben, aber wenn sein Wissen ständig überschrieben wurde, was war dann das Wesentliche seines Daseins?
IN-SICH-SEIN
Ein konkretes Leben entsprang zwei Sätzen aus den allgemeinen Erbinformationen, die verschieden miteinander verbunden worden waren und je nach aufgesuchter Umwelt persönlich ausgesprochen wurden. Je nach Dominanz der Sätze in einer bestimmten Fragestellung entwickelte sich nun der Träger einer Anlage oder eines Merkmals. Aber wie gestaltete sich eine Merkmalsausprägung: monogen oder eher multifaktoriell, also durch viele Gene und Umweltfaktoren geprägt?
MERKMALSTRÄGER
Ein genetischer Abdruck des Bisherigen, einer nicht fassbaren Wirklichkeit, transformiert durch die Eltern, gab einem Kind seine Form. Bestimmte Anlagen oder Merkmale des Genoms, also des Genbestandes der Menschen, wurden in einem persönlichen Genotyp herausgeschrieben und ließen im Verlauf des Seins ein äußeres Erscheinungsbild, den Phänotyp, entstehen. Hierbei existierten auch Merkmale, die nicht sichtbar vererbt wurden, vielleicht weil die Codierung bei der Vererbung durch die Eltern nicht dominant war.
Es existierten viele Bilder der Weitergabe von Informationen, die entweder aus dem geschenkten Satz der Gene aus sich heraus gelesen werden konnten oder erst durch Übersetzung anderer gelernt werden mussten.
Wenn ein Bild ungebildet angeschaut wurde, konnte es leichter einen tiefen Eindruck hinterlassen. Je mehr Bilder sich mit der Zeit der Wahrnehmungen darüberlagerten, desto vielfältiger war dabei die Symbolik, die von der jeweiligen Umwelt geprägt wurde. Wer das Merkmal der Schönheit trug, der, so hieß es, habe es im Leben einfacher. Aber die Anlagen anderer Gene beteiligten sich an den Erscheinungen in einem Menschenbild. Ob ein Menschenkind nur die Anlage für bestimmte Merkmale besaß oder gar ein Merkmalsträger war, hing von vielen Faktoren ab, die von einem Individuum nur schwer beeinflussbar waren. Wenn die Anlage zu einer natürlichen Bildung nicht vererbbar war, musste sie durch Umwelteinflüsse oder, wie bei dem beschriebenen Wunderkind, durch künstliche Intelligenz ergänzt werden.
ERZÄHLUNG
So ließ es sich auch bei den meisten Hauptpersonen beobachten, die es in jeder Erzählung gab. Solch eine Person fand in einer sogenannten vordisziplinären Phase einen festen Platz in einem bereits bestehenden Umfeld, zum Beispiel in einer Familie.
Besonders eindrucksvoll war ein Bild Leonardos auf Holz, das ein Kind auf dem Schoß der Mutter zeigte und von drei Personen mit Geschenken, also Ergänzungen, bedacht wurde. Viele Menschen hatten sich darum eingefunden, aber nur die Hauptpersonen waren im Blickfeld.
Mit einem geschulten Wissen wurde die Szene zu einer Geschichte ergänzt, die das Baby als Jesuskind beschrieb, das von den Heiligen Drei Königen angebetet wurde. Bevor dieses Kind seine Bestimmung selbst gefunden, seine Disziplin gefestigt hatte, wurde ihm eine Form gegeben, und wo es nicht widersprach, gaben ihm seine Mitmenschen verschiedenste Wege vor, als Arzt, Heiliger, Gerechter, guter Hirte, Meister oder gar König. Manche beschrieben das Kind als Tür, als Wahrheit, als Licht der Welt oder nannten es das A und O. Die Menschen erzählten sich viele Geschichten, erfanden Details dazu oder ließen welche weg und sammelten die eigenen Eindrücke im Gehirn. Es begann eine Seelenbildung an den verschiedensten Orten des Daseins auf der Erde.
Die Seele ist die Anthologie von bewussten und unwillkürlichen, also zeitweise nicht begreifbaren Geschichten, die dem Menschen zur Verfügung stehen.
Andere Bilder und andere Geschichten bildeten andere Seelen. Denn das, was gewesen ist, was in die gegebene Form hineingefüllt und entschieden wurde, die häufigsten Tätigkeiten und Gedanken, bestimmte das Wesentliche eines Menschen. Es war nicht die körperliche Form oder die Summe der sichtbaren Merkmale. Die Anlage bestimmter Eigenschaften war häufig gar nicht zu sehen, sondern latentes Potenzial.