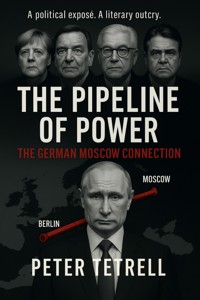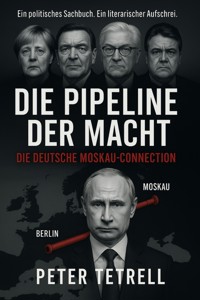
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was dieses Buch ist – und was es nicht ist Dieses Buch ist keine Anklageschrift. Es ist ein Protokoll. Ein sezierender Blick zurück auf Entscheidungen, Reden, Verträge, Protokolle, Reaktionen. Alles belegt. Alles nachlesbar. Es ist auch keine Polemik. Wo die Fakten sprechen, schweigt das Pathos. Aber es ist auch kein neutraler Bericht. Denn Neutralität, wo Menschenwürde verhandelt wird, ist keine Tugend – sondern ein Verrat an der Aufklärung. Die Architektur der Täuschung Man kann die deutsche Russland-Politik der letzten 25 Jahre als eine Pipeline beschreiben – nicht nur aus Stahl, sondern aus Entscheidungen: •2001: Putins Bundestagsrede – der Anfang einer Illusion •2004: Schröder nennt ihn einen "lupenreinen Demokraten" •2007: Putin droht in München – Deutschland bleibt still •2008: Krieg in Georgien – und Nord Stream wird dennoch gebaut •2014: Annexion der Krim – und Nord Stream 2 beschlossen •2022: Angriffskrieg gegen die Ukraine – und einige schweigen noch immer Jede Station dokumentiert, jede Entscheidung analysierbar. Wem gehört die Verantwortung? Sie gehört nicht einem Einzelnen. Sie gehört einem System, das aus Feigheit Loyalität machte, aus wirtschaftlichem Opportunismus moralisches Argument. Ein System, das von demokratisch gewählten Akteuren getragen wurde – mit offenen Augen, aber verschlossenen Akten. Die Frage an uns alle Warum konnte diese Politik so lange Bestand haben? Warum wurde so lange weggesehen – von Medien, Parlament, Öffentlichkeit? War es nur ökonomisches Kalkül? Oder steckt dahinter ein tieferes Versagen – jenes der politischen Urteilskraft, der historischen Sensibilität, der Verantwortung vor künftigen Generationen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Die Täuschung wie alles begann
Wie Schröder, als Kanzler, die Nähe zu Putin suchte. Der Anfang der Freundschaft – und das Versprechen des billigen Gases.
2. Jahre der Annäherung
Frank-Walter Steinmeiers Rolle als außenpolitischer Architekt der Ostöffnung, seine Nähe zu Lawrow und die ideologische Grundierung.
3. Putins Vision von Macht
Merkels ambivalente Rolle: Kalte Miene, warme Pipeline. Nord Stream 2 als geopolitische Kapitulation – und ihr Schweigen nach dem Krieg.
4. Anatomie eines Projekts
Wie zwei Röhren durch die Ostsee zu einem Symbol für Europas Abhängigkeit wurden. Verträge, Konstruktionen, Milliarden. Kanzler Schröder der verlängerte Arm von Putin.
5. Die Zeitenwende im Bundestag
Der Abstieg Schröders vom Volksvertreter zum Gazprom-Mann. Wer mit ihm ging – und wer ihn ließ.
6. Ein Kontinent unter Strom
Ex-Minister, Staatssekretäre, Wirtschaftsbosse. Eine kartographische Aufarbeitung des Netzwerks.
7. Die Sabotage
„Eine Explosion in der Tiefe – und an der Oberfläche zerbricht ein Jahrzehnt deutsch-russischer Energiepolitik.“
8. Deutschland der taumelnde Hegemon Europas
Wie Kiew seit 2006 warnte – und wie Berlin hörte, aber nichts sagte.
9. Die Medien und das Märchen vom Wandel durch Handel
Wie Narrative gesetzt wurden. Wer sie schrieb. Und wer sie nie infrage stellte. Putin mordet munter weiter.
10. Die SPD – Eine Partei im Schatten Moskaus?
Verbindungen, Parteistiftungen, Städtepartnerschaften. Warum die SPD besonders tief verstrickt war.
Eine Chronologie des Wegsehens. Der letzte Versuch, Verantwortung zu erkennen – bevor die Archive sich schließen.
Vorwort: Das Schweigen der Jahre
Man wird später sagen, man habe es nicht gewusst.
Man wird sich herausreden, man habe doch nur gehandelt, wie es alle taten. Dass man gute Gründe hatte – wirtschaftliche, diplomatische, parteipolitische. Man wird sich auf Akten berufen, auf Gespräche, auf Alternativlosigkeit. Und man wird hoffen, dass niemand nachfragt, was man wirklich wusste – und wann.
Dieses Buch ist eine Antwort auf das Schweigen. Eine Chronik der Unterlassungen. Eine Aufarbeitung der Naivität, des Wegsehens und der bewussten Komplizenschaft – über 25 Jahre deutscher Russland-Politik.
Es geht nicht nur um Putin. Es geht um uns.
Um eine politische Klasse, die billige Energie gegen moralische Integrität eintauschte. Um Minister, Kanzler, Lobbyisten, die wussten, mit wem sie sich einließen – und es dennoch taten. Um Netzwerke, die aus Geschäftsbeziehungen Gewohnheiten machten, aus Freundschaft Abhängigkeit, aus Interessen Hörigkeit.
Es geht um die SPD – aber auch um die CDU. Um Linke, die sich der Kreml-Narrative bedienten. Um Rechte, die Putin als Bollwerk gegen den Westen stilisierten. Und um ein Deutschland, das nicht hören wollte, als Journalisten, Dissidenten, Geheimdienste und ukrainische Präsidenten längst Alarm schlugen.
Dies ist kein neutrales Buch. Es erhebt Anspruch: auf Wahrheit, auf Benennung, auf Transparenz. Es nimmt kein Blatt vor den Mund, und es versteckt sich nicht hinter wohlformulierten Rückblicken.
Denn die Geschichte der deutschen Russlandpolitik ist keine Geschichte der Diplomatie. Sondern eine der Verdrängung, der Dummheit, der Angst – und des Vorteilsdenkens.
Wer heute fragt, wie es so weit kommen konnte, sollte bei sich selbst beginnen. Und bei denen, die gewählt wurden, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden – und stattdessen für warme Büros, stabile Wahlergebnisse und Karrieregarantien ihre Eide gebrochen haben.
Dies ist kein Buch für die Archive. Es ist ein Buch für Untersuchungsausschüsse.
Und für all jene, die sich fragen, wieviel ein Land vergessen darf – bevor es sich selbst verliert.
Prolog
Der Mann mit den Blumen
„Es ist der stille Teil der Geschichte, der am lautesten schreit.“
Berlin, ein verhangener Novembermorgen im Jahr 2022.
Ein Mann tritt aus der gepanzerten Limousine. Schwarz gekleidet, Mantel bis zum Knöchel, ein Blumenstrauß in der Hand – weiße Rosen, frisch gebunden, keine Schleife. Er schreitet langsam über das feuchte Kopfsteinpflaster, vorbei an den Grabreihen russischer Kriegsgefangener, vorbei an Gedenksteinen, auf denen Jahreszahlen eingraviert sind, die für andere Generationen Krieg bedeuteten – 1917, 1941, 1945.
Der Mann ist alt geworden. Sein Gang ist gebeugt, das Gesicht grau, aber er trägt den Stolz eines Mannes, der sich nie erklärt hat. Kein Pressetross begleitet ihn, keine Mikrofone, keine offiziellen Protokollführer. Nur ein einzelner Personenschützer bleibt auf Distanz.
Er bleibt stehen.
Vor dem Grab von Alexej Nikolajewitsch – gefallen bei Stalingrad. Daneben eine Gedenkplatte für einen gewissen W. Putin, gestiftet von einer russischen Veteranenorganisation. Die Kamera einer zufälligen Passantin fängt den Moment ein, doch sie erkennt ihn nicht. Die Szene geht verloren im digitalen Rauschen des Tages.
Der Mann ist Gerhard Schröder.Altkanzler.Gazprom-Lobbyist.Verlorener Sohn der Sozialdemokratie.Und Symbol einer politischen Epoche, deren Erbe bis heute nachwirkt.
Ein Vierteljahrhundert Täuschung
Die Geschichte, die dieses Buch erzählt, ist keine einfache Geschichte über Erdgas, Pipelines und Ost-West-Dialoge. Es ist die Geschichte eines Irrtums – eines historischen Irrtums, der nicht aus Unwissenheit geschah, sondern aus Überheblichkeit, Eitelkeit, Feigheit.
Ein Irrtum, der Deutschland über 25 Jahre geprägt hat.Ein Irrtum, der begann mit Beifall im Bundestag – und endete mit Sirenen in Kiew.
Ein Irrtum, der nicht von Diktatoren allein getragen wurde, sondern von Demokraten, die es besser hätten wissen müssen.
Es geht nicht nur um Schröder.
Es geht um Frank-Walter Steinmeier, der über Jahre hinweg die Ostpolitik der SPD mitprägte und nie zur Rechenschaft gezogen wurde.
Es geht um Angela Merkel, die Nord Stream 2 politisch deckte und heute ein Buch über „Freiheit“ schreibt, als hätte sie mit dieser Geschichte nichts zu tun.
Es geht um Manuela Schwesig, Sigmar Gabriel, um Kanzleien, Lobbyisten, Wirtschaftslenker.
Um Banken, Aufsichtsräte, Stiftungen.
Und es geht um ein Land, das sehen konnte – und nicht sehen wollte.
Gas gegen Schweigen
Über zwei Jahrzehnte baute Deutschland eine politische Energiearchitektur auf, die nicht auf Vernunft, sondern auf Wunschdenken beruhte:– Dass Wandel durch Handel funktioniere.– Dass man mit Autokraten auf Augenhöhe verhandeln könne.– Dass Russland zwar brutal im Inneren, aber nützlich nach außen sei.
Diese Annahmen durchzogen Ministerien, Parteitage, Wirtschaftsgipfel.Sie bestimmten Rüstungsentscheidungen, Sanktionen – oder deren Unterlassung.Und sie kosteten am Ende nicht nur politische Glaubwürdigkeit, sondern Menschenleben.
Was dieses Buch ist – und was es nicht ist
Dieses Buch ist keine Anklageschrift.Es ist ein Protokoll. Ein sezierender Blick zurück auf Entscheidungen, Reden, Verträge, Protokolle, Reaktionen. Alles belegt. Alles nachlesbar.
Es ist auch keine Polemik.
Wo die Fakten sprechen, schweigt das Pathos.
Aber es ist auch kein neutraler Bericht. Denn Neutralität, wo Menschenwürde verhandelt wird, ist keine Tugend – sondern ein Verrat an der Aufklärung.
Die Architektur der Täuschung
Man kann die deutsche Russland-Politik der letzten 25 Jahre als eine Pipeline beschreiben – nicht nur aus Stahl, sondern aus Entscheidungen:
2001
: Putins Bundestagsrede – der Anfang einer Illusion
2004
: Schröder nennt ihn einen „lupenreinen Demokraten“
2007
: Putin droht in München – Deutschland bleibt still
2008
: Krieg in Georgien – und Nord Stream wird dennoch gebaut
2014
: Annexion der Krim – und Nord Stream 2 beschlossen
2022
: Angriffskrieg gegen die Ukraine – und einige schweigen noch immer
Jede Station dokumentiert, jede Entscheidung analysierbar.
Wem gehört die Verantwortung?
Sie gehört nicht einem Einzelnen.Sie gehört einem System, das aus Feigheit Loyalität machte, aus wirtschaftlichem Opportunismus moralisches Argument.Ein System, das von demokratisch gewählten Akteuren getragen wurde – mit offenen Augen, aber verschlossenen Akten.
Die Frage an uns alle
Warum konnte diese Politik so lange Bestand haben?Warum wurde so lange weggesehen – von Medien, Parlament, Öffentlichkeit?
War es nur ökonomisches Kalkül?Oder steckt dahinter ein tieferes Versagen – jenes der politischen Urteilskraft, der historischen Sensibilität, der Verantwortung vor künftigen Generationen?
Ein letzter Blick
Der Mann mit den Blumen hat den Ort längst verlassen.Zurück bleibt ein Grab.Und eine Geschichte, die nie zu Ende erzählt wurde.
Dieses Buch beginnt dort, wo die offizielle Erinnerungspolitik endet.Es rekonstruiert, was gesagt, entschieden und unterlassen wurde.Nicht aus Rache – sondern weil Erinnerung auch Gerechtigkeit verlangt.
Kapitel 1: Die Pipeline der Macht
Die Täuschung – Wie alles begann
„Wer Europa spalten will, bietet Frieden an und liefert Gas.“
Berlin, 25. September 2001 – Plenarsaal des Deutschen Bundestages
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) begrüßt den russischen Präsidenten:
„Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! ... Diese Ehre ... bestätigt das Interesse Russlands und Deutschlands am gegenseitigen Dialog.“
Anwesend in der ersten Reihe saßen:
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD)
Vizepräsidentin Anke Fuchs (SPD)
CDU-Fraktionschef Friedrich Merz
CSU-Vize Rudolf Seiters
Außenminister Joschka Fischer (Grüne)
FDP-Vize Hermann-Otto Solms
PDS-Vizepräsidentin Petra Bläss
Diese Besetzung repräsentierte das Präsidium des 14. Bundestags – also die prompte politische Spitze Deutschlands
Putins Rede – Deutsch, charmant, folgenlos
Zwei Wochen nach dem 11. September tritt Putin erstmals als Redner im Bundestag auf. Die Rede beginnt auf Russisch, dann fährt er in nahezu fehlerfreiem Deutsch fort. Er beschwört ein „Großes Europa“ von Lissabon bis Wladiwostok, betont gemeinsame Kultur, Demokratie und Zusammenarbeit gegen Terror. Immer wieder wird applaudiert – am Ende sogar stehender Beifall.
Doch seine Rhetorik enthält Warnungen: Er kritisiert die NATO-Osterweiterung als potentielle Gefahr, beklagt ein unvollständiges Europa und verweist auf die Notwendigkeit einer eigenen Sicherheitsarchitektur ohne US-Dominanz (Deutscher Bundestag).
Erste Zweifel – wer geht, wer bleibt
Der Grünen-Abgeordnete Werner Schulz verlässt anschließend demonstrativ den Saal, was in Deutschland heute als frühes Signalein des Misstrauens gedeutet wird (FAZ.NET). Doch die Mehrheit bleibt sitzen – beeindruckt, unkritisch, euphorisch.
Der Kontext um 2001
Putins innenpolitische Entwicklung
war bereits offenkundig: Zensur, Machtkonsolidierung, Verhaftung von Oligarch
Michail Chodorkowski
(2003). Der Westen wehrte sich kaum.
Auf der anderen Seite steht Deutschlands Politik:
Schröder nennt Putin nach Tschetschenien-Krieg (2004) einen „lupenreinen Demokraten“.
Steinmeier (Außenminister) setzt auf Dialog – auch nach Münchner Sicherheitskonferenz 2007.
Merkel ist noch neu im Amt, hält sich jedoch diplomatisch zurück.
Der erste Splitter in der Fassade
In seiner Rede verdeutlicht Putin, dass Europa sich neu definieren muss – ohne Zwänge und Stereotype. Die Zuhörer applaudieren, doch gleichzeitig verpasst Deutschland einen ersten historischen Moment der Klarheit.
Eine veröffentlichtes Bundestagsprotokoll und zahlreiche Medienberichte (FAZ: „Putin im Bundestag: Wie er 2001 alle um den Finger wickelte“) attestieren dem Saal eine Mischung aus Faszination und gefährlicher Naivität (FAZ.NET).
Erster Schlusspunkt: Das Schweigen der Macht
Deutschland applaudiert, Putins Rede endet als Symbol verhängnisvoller Verkennung. Die politische Elite – Schröder, Merz, Fischer, Steinmeier, Solms, Seiters – lässt das historische Signal unkommentiert: Die Pipeline der Macht beginnt nicht mit Betonröhren, sondern mit Worten, die falsch verstanden wurden.
Zusammenfassung – was vorgefallen ist
Ereignis
Datum
Wichtigkeit
Putins Rede im Bundestag
25. Sept. 2001
Erste deutsche Bühne für Putin; supportive Atmosphäre trotz Warnungen
Präsenz deutscher Politiker
SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP, PDS; Regierungs- und Oppositionsspitze
Symbol politischer Einigkeit ohne kritische Distanz
Werner Schulz verlässt Saal
unmittelbar nach Rede
Einzelner Protest vs. Mehrheit des Applauses
Erste Anzeichen autoritärer Entwicklung
2001–2003
Keine politische Reaktion auf Machtkonsolidierung in Russland
Putins Auftritt und der deutsche Applaus markieren einen frühen Wendepunkt: Deutschland unterschätzte bewusst die strategische Dimension dieses Mannes. Der politische Wille zur kritischen Distanz war nicht vorhanden – trotz aller Warnsignale. Dieses Versäumnis wird später teure Folgen haben.
Kapitel 2: Die Pipeline der Macht
Sektion 2.1. 2001–2007: Jahre der Annäherung – Wie Deutschland Putins System salonfähig machte
Sept–Dez 2001: Euphorie nach der Rede – und die ersten Verflechtungen
Die Bundestagsrede vom 25. September 2001 hallte in Berlin nach – nicht nur in den Feuilletons, sondern in Ministerien, Parteistiftungen und Vorstandsetagen.
Joschka Fischer, als Außenminister, sagte im Oktober 2001 gegenüber dem Tagesspiegel:
„Wir haben eine historische Chance, mit Russland eine neue Sicherheitsarchitektur zu bauen.“([Quelle: Tagesspiegel-Archiv, Okt. 2001])
Wolfgang Clement (damals Wirtschaftsminister, SPD) trifft sich im November mit einer russischen Delegation aus dem Energieministerium – Thema: „Langfristige Energieversorgung Europas“ – ein Euphemismus für Gazprom-Anbindung.
Im Bundeskanzleramt unter der Leitung von Frank-Walter Steinmeier werden die ersten strategischen Papiere zur „Energiepartnerschaft mit Russland“ formuliert. Interne Vermerke des Auswärtigen Amtes, die 2016 durch investigative Recherchen von Correctiv bekannt wurden, zeigen: Schon Ende 2001 gab es Überlegungen, sich russischem Gas langfristig zuzuwenden – mit politischer Rückendeckung.
Kapitel 2 – Sektion 2.2
2002: Schröder, Putin – und die unsichtbare Handschrift Gazproms
„Persönliche Nähe ist ein schlechter Ratgeber in der Außenpolitik. Es sei denn, sie ersetzt den Kompass.“
März 2002 – Schröder nach Moskau
Im Frühjahr 2002 reist Bundeskanzler Gerhard Schröder zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch nach Moskau. Auf dem offiziellen Programm: Gespräche über Energie, Terrorbekämpfung und den „Aufbau wirtschaftlicher Brücken“. Was sich harmlos anhört, ist in Wahrheit ein Treffen von strategischer Tragweite – rückblickend betrachtet sogar der Beginn einer tiefen wirtschaftspolitischen Verflechtung mit Russland, deren Folgen sich erst Jahre später offenbaren sollten.
Wladimir Putin empfängt Schröder nicht in Sotschi oder bei einem EU-Gipfel – sondern im engsten Kreis im Kreml. Die Bilder, die später durch die ARD-Abendschau gehen, zeigen zwei Männer, die einander nicht nur verstehen, sondern fast freundschaftlich verbunden wirken: Schulterklopfen, Lachen, ein fast intimer Tonfall, den man sonst nur aus dem eigenen Wohnzimmer kennt.
Noch am selben Abend versendet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) ein Zitat Schröders, das für Furore sorgt – nicht in Deutschland, aber in Polen und im Baltikum:
„Wir können Russland vertrauen, weil wir wissen, dass es ein verlässlicher Partner ist.“(dpa, 12. März 2002)
Die Botschaft ist klar: Putin ist nicht mehr Sicherheitsrisiko – sondern Wirtschaftsoption.
April 2002 – Gazprom auf leisen Sohlen
Parallel zu Schröders Besuch beginnen in Berlin vertrauliche Gespräche zwischen der Gazprom-Tochter Gazexport, der BASF, dem Bundeswirtschaftsministerium und ausgewählten juristischen Beratern. Inhalt: langfristige Gasbezugsverträge mit bis zu 30 Jahren Laufzeit. Es ist die erste technische Skizze für das, was später zur „strategischen Partnerschaft“ ausgebaut werden soll.
Wolfgang Clement, damals als Superminister für Wirtschaft und Arbeit im Kabinett Schröder tätig, vermerkt in einer Gesprächsnotiz mit Aleksei Miller (damals neuer Gazprom-Chef), dass „eine technische Anbindung deutscher Märkte an russische Quellen unter ökonomischen Aspekten hoch attraktiv sei“.
Was hier auf ministerieller Ebene mit „Anbindung“ beschrieben wird, ist in Wirklichkeit: Energieabhängigkeit im Aufbau.
Juni 2002 – G8-Gipfel in Kanada
In Kananaskis (Kanada) findet der G8-Gipfel statt. Schröder setzt sich im Vorfeld für eine stärkere Integration Russlands in wirtschaftliche Foren ein. Obwohl Moskau offiziell nur Gaststatus hat, bemüht sich Berlin hinter den Kulissen aktiv um eine dauerhafte Aufnahme Russlands in G8-Formate – gegen den Widerstand der USA und Großbritanniens.
Joschka Fischer, der damals das Auswärtige Amt führt, bleibt skeptisch, aber trägt den Kurs mit. Intern vermerkt ein Beamter im Protokoll des AA:
„Die Bundesregierung verfolgt einen langfristigen Kurs der politischen Normalisierung Russlands über wirtschaftliche Integration.“(Interne AA-Notiz, zitiert in: FAZ-Rekonstruktion vom 2018)
Im Gipfel-Kommuniqué wird Russland dann erstmals als gleichberechtigter Wirtschaftspartner bezeichnet – ein symbolischer Akt, aber mit enormer politischer Signalwirkung.
Juli–September 2002 – Austausch der Eliten
In den Sommermonaten 2002 rollt die deutsch-russische Austauschmaschinerie an:
Das
Deutsch-Russische Rohstoffforum
wird unter Mithilfe des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft gegründet.
Zahlreiche SPD-nahe Stiftungen (Friedrich-Ebert-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung) beginnen, mit russischen Thinktanks Kooperationsformate zu entwickeln.
Auch in den Bundesländern (vor allem
Mecklenburg-Vorpommern
,
Brandenburg
und
Niedersachsen
) beginnen erste Gespräche über mögliche Industrie- und Energieansiedlungen mit russischer Beteiligung.
Schröder, Steinmeier, Gabriel – sie alle werden regelmäßig zitiert als „Brückenbauer“, „Stimmen der Vernunft“, „Mittler zwischen Ost und West“. In Wahrheit entsteht ein Netzwerk, das die Nähe zu Moskau zum politischen Projekt erhebt.
Oktober 2002 – Gerhard Schröder in Petersburg
Am Rande eines EU-Russland-Gipfels in Sankt Petersburg trifft Schröder erneut Putin. In vertraulicher Runde spricht man – wie später aus diplomatischen Depeschen bekannt wird – über die Möglichkeit direkter Gaslieferungen unter Umgehung „instabiler Transitländer“. Gemeint sind die Ukraine und Polen.
Diese Gespräche sind die konzeptionelle Urzelle von Nord Stream 1 – und sie finden nicht auf EU-Ebene, sondern im bilateralen Alleingang statt.
Politische Reaktionen in Deutschland: keine
Weder im Bundestag noch in der Opposition wird 2002 eine substanzielle Debatte über Deutschlands neue Russlandstrategie geführt. Es gibt keine Anhörung, keine kritische Bewertung der Energiegespräche, keine systematische Risikoanalyse.
Stattdessen werden die deutsch-russischen Beziehungen unter dem Label „Normalisierung“ geführt – ein Begriff, der vieles verhüllt und kaum etwas erklärt.
Das Jahr 2002 ist ein Wendepunkt. Nicht, weil etwas explodiert – sondern weil sich alles still verfestigt: die Rhetorik, die Nähe, das Netz.
Putin wird von Schröder hofiert, nicht überprüft.
Gazprom tritt nicht als politischer Player auf – sondern als vermeintlicher Marktakteur.
Die Opposition schweigt, weil der Dialog mit Moskau als außenpolitisches Allgemeingut gilt.
Deutschland baut – politisch wie wirtschaftlich – Brücken in ein autoritäres System. Und es tut das mit ruhiger Stimme, guter Miene und weit offenen Augen.
Kapitel 2 – Sektion 2.3
2003: Der Fall Chodorkowski – Wie Russland seine Oligarchen disziplinierte und Deutschland schwieg
„In Russland kann man reich sein – aber nicht unabhängig.“— Michail Chodorkowski, Februar 2003
I. Wer war Chodorkowski?
Michail Borisowitsch Chodorkowski – geboren 1963 in Moskau, Sohn einer Ingenieursfamilie, Mitglied der KPdSU bis 1991, Chemiker, Softwareentwickler, später Finanzmanager. Einer von vielen jungen Männern, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die wirtschaftlichen Trümmer in Geld verwandelten – und zwar in sehr viel Geld.
Doch anders als viele andere Oligarchen jener Zeit – darunter Abramowitsch, Beresowski oder Deripaska – hatte Chodorkowski einen Unterschied: Er glaubte an westliche Prinzipien.
Er war nicht bloß reich – er war gebildet, ambitioniert, westlich orientiert. Und: Er wollte Einfluss.
II. Yukos – Das Imperium
In den 1990er-Jahren übernahm Chodorkowski das marode sowjetische Ölunternehmen Yukos im Rahmen eines der berüchtigten „Kredite gegen Aktien“-Deals, organisiert unter Jelzin. Für einen Bruchteil des Wertes erwarb er die Mehrheit – und machte Yukos zu einem der modernsten, transparentesten Energieunternehmen Russlands.
Einführung westlicher Buchhaltung
Zusammenarbeit mit McKinsey & Co
Börsennotierung und internationale Joint Ventures
Offenlegung von Eigentümerstrukturen
Gleichzeitig begann Chodorkowski, in den USA und Europa gezielt Kontakte zu knüpfen – mit dem Ziel, Yukos mit einem amerikanischen oder britischen Ölkonzern zu fusionieren. Verhandlungen mit ChevronTexaco und ExxonMobil liefen bereits 2002 auf Hochtouren.
Wladimir Putin war das ein Dorn im Auge.
III. Februar 2003 – Die berühmte Szene im Kreml
Bei einem Treffen im Kreml – übertragen im russischen Fernsehen – geschieht der Moment, der als Wendepunkt gilt.
Chodorkowski konfrontiert Putin öffentlich mit einem Dossier über Korruption im staatlichen Ölkonzern Rosneft. Er spricht offen über Bestechung, Schwarzgeld, über Funktionäre mit Offshore-Konten. Putin, sichtlich versteinert, antwortet:
„Ich würde Ihnen raten, sich um Ihr eigenes Unternehmen zu kümmern.“
Was in einer westlichen Demokratie ein legitimer Diskurs wäre, war im Russland Putins ein Todesurteil – politisch, wirtschaftlich, später auch juristisch.
IV. Oktober 2003 – Der Zugriff
Am Morgen des 25. Oktober 2003 landet Chodorkowskis Privatjet auf dem Flughafen von Nowosibirsk. Er ist auf dem Weg zu einem Geschäftstermin in der sibirischen Ölregion. Noch auf dem Rollfeld stürmen maskierte Männer des FSB (Nachfolger des KGB) das Flugzeug, legen ihn in Handschellen und bringen ihn direkt nach Moskau – ohne richterliche Anordnung, ohne formelle Anklage.
Der Vorwurf: Steuerhinterziehung – später ergänzt durch Betrug, Geldwäsche, Unterschlagung.
In Wahrheit aber war es ein politischer Zugriff – ein Signal: Wer sich Putins vertikaler Macht widersetzt, wird nicht verwarnt, sondern entfernt.
V. Das Verfahren – ein Schauprozess
Der erste Prozess beginnt 2004 in Moskau. Die Richter sind jung, eingeschüchtert, die Staatsanwaltschaft agiert mit dünner Aktenlage – aber klarer Mission.
Chodorkowski wird in einem gläsernen Käfig vorgeführt, das Bild geht um die Welt: Der modernste Oligarch Russlands – wie ein Krimineller in Käfighaltung.
Am Ende: neun Jahre Lagerhaft, Verbannung nach Sibirien.Sein Unternehmen Yukos wird zerschlagen – die Filetstücke übernimmt der Kreml-nahe Staatskonzern Rosneft, unter Führung von Igor Setschin, Putins intimem Machtvollstrecker.
VI. Deutsche Reaktionen: verhalten bis gar nicht
Im Bundeskanzleramt unter Frank-Walter Steinmeier wird der Fall intern als „russische Justizangelegenheit“ eingestuft. Schröder sagt öffentlich nichts – inoffiziell heißt es, man wolle die Beziehungen zu Putin nicht belasten.
J
oschka Fischer äußert sich zwar kritisch zur „Art der öffentlichen Vorführung“, doch es bleibt bei Floskeln. Eine offizielle Verurteilung? Keine.
Deutsche Wirtschaftsführer – darunter BASF, Wintershall, Siemens – distanzieren sich nicht, sondern signalisieren: „Die Geschäftskontinuität ist nicht betroffen.“
VII. Die Rolle der EU – ein Schatten
Auch Brüssel reagiert zögerlich. Zwar äußert das EU-Parlament „Sorge“ über die Verfahren, doch Sanktionen oder politische Schritte bleiben aus.
Warum?
Weil Yukos nicht europäisch war
Weil Russland als Energielieferant gebraucht wurde
Und weil Chodorkowski als Oligarch nie das Mitgefühl bekam, das Dissidenten wie später
Nawalny
erhielten
VIII. Was wirklich geschah
Die Verhaftung Chodorkowskis war nicht nur ein persönliches Schicksal – sie war ein Systemsignal:
Der russische Staat duldet keinen wirtschaftlichen Machtpol außerhalb des Kremls
Unternehmen mit Transparenzanspruch und westlicher Orientierung sind ein Risiko
Kritiker, selbst wenn sie loyal zum System aufgewachsen sind, werden ausgeschaltet
Es war die Geburtsstunde des Putinismus 2.0 – die Vermischung von Staat, Macht, Sicherheitsapparat und Rohstoffwirtschaft unter absoluter Kontrolle.
IX. Und Deutschland?
Deutschland hätte diesen Moment zum Wendepunkt machen können – politisch, wirtschaftlich, moralisch.
Doch stattdessen folgte das Gegenteil:
2004
: Schröder nennt Putin einen „lupenreinen Demokraten“
2005
: Die Idee von Nord Stream wird konkret
2006
: Deutsche Unternehmen vertiefen ihre Investitionen in Russland
Die Lektion Putins: Man kann einen Oligarchen verhaften, ein Milliardenunternehmen zerschlagen, den Rechtsstaat aushöhlen – und der Westen tut nichts.
Fazit: Sektion 2.3
Der Fall Chodorkowski war kein interner Machtkampf, sondern ein globales Signal. Russland unter Putin hatte sich entschieden: für Autokratie, für Abschottung, für Machtkonzentration.
Deutschland, Europa, der Westen – hätten es erkennen müssen.Sie hätten antworten müssen.
Aber sie antworteten mit Schweigen.
Kapitel 2 – Sektion 2.4
2004: Die Schule der Gewalt – Tschetschenien, Beslan und Schröders „lupenreiner Demokrat“
„Er ist ein lupenreiner Demokrat.“— Gerhard Schröder über Wladimir Putin, 2004
I. Russland im Kriegsmodus – Der Schatten Tschetscheniens
Im Frühjahr 2004 tobt im Nordkaukasus der Zweite Tschetschenienkrieg. Offiziell war er 2000 für beendet erklärt worden – de facto führte der russische Staat unter Putin einen erbarmungslosen Besatzungskrieg gegen jede Form von Widerstand in der Region.
Satellitenbilder aus Grosny zeigen eine Stadt, die mehr Trümmer ist als Siedlung. Menschenrechtsorganisationen wie Memorial, Human Rights Watch und der Europarat sprechen von:
systematischer Folter in „Filtrationslagern“
Verschwindenlassen von Oppositionellen
Einsatz schwerer Artillerie gegen Wohnviertel
extralegale Exekutionen durch russische Spezialeinheiten
Die russische Zentralmacht nennt das „Antiterrormaßnahmen“.Wladimir Putin spricht von „Stabilisierung durch Stärke“.
II. Das Massaker von Beslan
Am 1. September 2004 besetzen 32 bewaffnete Männer – mutmaßlich tschetschenische Separatisten – die Grundschule Nr. 1 in Beslan (Nordossetien). Sie nehmen über 1.100 Geiseln, darunter fast 800 Kinder.
Der russische Staat entscheidet sich für die militärische Lösung.
Am dritten Tag, ohne vorherige Verhandlungen, stürmen russische Spezialeinheiten das Schulgebäude mit Panzerfäusten und Maschinengewehren. Es kommt zur Katastrophe:
334 Tote
, davon
186 Kinder
chaotische Einsatzführung
bis heute nicht vollständig aufgeklärte Feuergefechte
blockierte Hilfskorridore, keine Transparenz über Todesursachen
Putin spricht anschließend von einem „Sieg gegen den Terror“.Die Mütter der toten Kinder von Beslan gründen eine Bürgerinitiative – bis heute werden sie in Russland überwacht, teils bedroht.
III. Die deutsche Reaktion: ein Zitat, das bleibt
Kurz nach dem Massaker gibt Gerhard Schröder dem Hamburger Abendblatt ein Interview. Die Frage: Wie er die Entwicklung Russlands einschätze, auch angesichts Tschetschenien und Beslan.
Seine Antwort:
„Putin ist ein lupenreiner Demokrat.“— (Hamburger Abendblatt, 23. November 2004)
Es ist ein Satz, der sich tief einbrennt – in das Gedächtnis der Republik, aber auch in die Bilanz der deutschen Russlandpolitik.
Ob Schröder ihn bewusst provokant setzte oder aus strategischer Loyalität sagte, bleibt unklar. Klar ist nur: Er hat ihn nie zurückgenommen.
IV. Frank-Walter Steinmeier – Architekt des Schweigens
Als Chef des Bundeskanzleramts ist Frank-Walter Steinmeier in dieser Phase der zentrale außenpolitische Koordinator der Bundesregierung. Alle Russlandfragen laufen über seinen Tisch. Protokolle aus dem Auswärtigen Amt, später durch Wikileaks veröffentlicht, zeigen: Es gab interne Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien.
Ein Memo des damaligen Referats Russland (AA, Referat 206), datiert auf Oktober 2004, warnt:
„Die Gewalt in Tschetschenien hat systemische Züge angenommen. Die Sicherheitskräfte agieren außerhalb rechtsstaatlicher Rahmenbedingungen.“– (AA, interner Vermerk, zitiert in Süddeutsche Zeitung, 2013)
Die Reaktion des Kanzleramts: keine.
Die Vermerke wurden zur Kenntnis genommen, nicht zur Politik gemacht.
V. SPD und Außenwirtschaft: Kein Kurswechsel
Trotz der Ereignisse in Beslan und Tschetschenien gibt es keinen Bruch in den wirtschaftlichen Beziehungen:
Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft hält an seiner Russlandagenda fest
BASF und Wintershall intensivieren ihre Kontakte mit Gazprom
Siemens und MAN liefern Infrastrukturkomponenten
Sigmar Gabriel, zu diesem Zeitpunkt SPD-Generalsekretär, spricht öffentlich von „verantwortungsvoller Außenpolitik mit Russland auf Augenhöhe“.
Auch in den Bundesländern beginnen SPD-geführte Landesregierungen – u. a. in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen – Kooperationen mit russischen Energiepartnern aufzubauen.
VI. Merkel schweigt – aber beobachtet
Angela Merkel ist zu dieser Zeit Oppositionsführerin im Bundestag. Sie äußert sich im September 2004 zurückhaltend zum Massaker von Beslan, nennt Putins Umgang „besorgniserregend“, aber vermeidet jede direkte Kritik.
Ihr außenpolitischer Sprecher, Friedbert Pflüger, formuliert:
„Wir dürfen Russland nicht isolieren, aber wir dürfen auch nicht alles akzeptieren.“
Es bleibt beim „Aber“.
VII. Die Medien – Debatte ohne Wirkung
In den Feuilletons ist Beslan ein Aufschrei.
Die
Frankfurter Allgemeine
spricht von einem „Staatsverbrechen ohne Schuldeingeständnis“
Die Zeit
titelt:
„Russlands Kinderkrieg“
Die
taz
nennt Putins Russland „eine gelenkte Demokratie mit Gewaltlizenz“
Aber auf politischer Ebene verpufft die Wirkung.Die Debatte bleibt feuilletonistisch – kein Sanktionsverfahren, keine offizielle Resolution im Bundestag, kein Abbruch von Gesprächen mit Moskau.
VIII. Wladimir Putin – gestärkt durch das Schweigen
In einer Pressekonferenz nach Beslan stellt sich Putin hin und sagt:
„Die westliche Welt hat keine Moral, uns gegenüber mit erhobenem Zeigefinger aufzutreten.“
Diese Haltung bleibt bis heute Putins Standardformel:Die Gewalt gehört zur Ordnung – wer sie kritisiert, kennt Russland nicht.
Und Deutschland?
Es passt sich an. Man sucht weiter nach Verständigung, nach Verträgen, nach einem Umgang mit Putin – nicht auf Basis von Werten, sondern von Interessen.
2004 war ein Jahr, in dem Russland seine autoritäre Linie unübersehbar machte:
Krieg in Tschetschenien
Massaker in Beslan
systemische Gewalt unter Putins Kommando
Und Deutschland?
Gerhard Schröder nennt den Mann an der Spitze einen
„lupenreinen Demokraten“.
Frank-Walter Steinmeier ordnet das ein – und ändert nichts.
Die Wirtschaft kooperiert. Die Medien kritisieren. Die Politik bleibt still.
Es ist das Jahr, in dem man hätte erkennen können, dass Putins Russland kein Partner ist – sondern ein System, das Widerspruch nicht duldet.
Man hätte es erkennen können.Wenn man gewollt hätte.
Kapitel 2 – Sektion 2.5
2004: Die Orange Revolution – und Deutschlands Lavieren zwischen Kiew und Moskau
„Wer in Moskau mit Ruhe belohnt werden will, muss in Kiew schweigen.“— (interner Kommentar aus dem Auswärtigen Amt, anonymisiert, 2005)
I. Ein Land zwischen zwei Welten
Die Ukraine steht im Herbst 2004 an einem Scheideweg.Am 31. Oktober und 21. November finden Präsidentschaftswahlen statt – doch was eigentlich ein demokratischer Machtwechsel sein sollte, entwickelt sich zu einer politischen Zerreißprobe. Auf der einen Seite: der prorussische Kandidat Wiktor Janukowytsch, unterstützt vom Kreml, offen von Putin protegiert. Auf der anderen: Wiktor Juschtschenko, westlich orientiert, proeuropäisch, mit Unterstützung zivilgesellschaftlicher Bewegungen, Studentengruppen, Bauern und Gewerkschaften.
In den Wochen vor der Stichwahl überschlagen sich die Ereignisse:
Juschtschenko wird am 5. September mit Dioxin vergiftet.
Sein Gesicht entstellt sich; ein Attentat steht im Raum.
Russische Medien diffamieren ihn als CIA-Marionette.
Der Kreml entsendet „Wahlbeobachter“, die sich als politische Einflussagenten herausstellen.
Am 22. November wird Janukowytsch durch Wahlfälschung zum Sieger erklärt.
II. Der Aufstand beginnt
Binnen Stunden versammeln sich auf dem zentralen Maidan-Platz in Kiew Hunderttausende Menschen. Es ist der Beginn der „Orangenen Revolution“ – eine Massenbewegung, getragen von Studierenden, Rentnerinnen, Intellektuellen und Veteranen. Sie fordern:
Neuauszählung der Stimmen
Rücktritt der Zentrale Wahlkommission
Beobachter aus der EU
freie und faire Neuwahlen
Die Bilder gehen um die Welt: Zelttausende auf dem Maidan, improvisierte Bühnen, Reden bei Schneefall, Lichterketten, Volkslieder. Die ukrainische Flagge weht neben orangefarbenen Tüchern – ein Symbol für Hoffnung und Widerstand.
III. Moskaus Reaktion – und Putins Einmischung
Wladimir Putin gratuliert Janukowytsch noch in der Nacht der umstrittenen Stichwahl zum Sieg – bevor die internationale Wahlbeobachtermission ihre Einschätzung abgibt.
Putins Botschaft:„Die Ukraine gehört zum Einflussbereich Moskaus.“
In Moskau kursieren bereits Pläne für eine engere Zollunion, Energieabhängigkeit, wirtschaftliche Integration. Die Ukraine soll – aus Sicht des Kreml – kein Brückenkopf des Westens werden.
IV. Deutschland reagiert: zurückhaltend, zögerlich, diplomatisch
Im Auswärtigen Amt ist zu diesem Zeitpunkt Joschka Fischer noch Minister, doch die Linie wird zunehmend vom Kanzleramt unter Frank-Walter Steinmeier geprägt. Offiziell fordert die Bundesregierung „Zurückhaltung aller Seiten“ und „Respekt vor demokratischen Verfahren“.
Gerhard Schröder äußert sich nicht direkt zu den Fälschungsvorwürfen.Stattdessen betont er in einem Interview mit der FAZ (28.11.2004):
„Die Stabilität der Region darf nicht durch vorschnelle politische Eingriffe gefährdet werden.“
Zwischen den Zeilen: Man will den Kreml nicht verärgern.
V. Frank Walter Steinmeier – Der Manager der Balance
organisiert – auf Wunsch Schröders – die sogenannte „Troika-Lösung“: Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und der EU. Es ist ein diplomatischer Drahtseilakt, der auf den ersten Blick klug erscheint – in Wahrheit aber eine Strategie des Herauszögerns ist.
Ein interner Vermerk aus dem AA, später durch Wikileaks bekannt:
„Die Positionierung der Bundesregierung orientiert sich an der Prämisse, dass strategische Verlässlichkeit gegenüber Moskau Vorrang vor öffentlicher Parteinahme für Kiew hat.“— AA-Russland-Referat, vertraulich, Dez. 2004
Die USA dagegen positionieren sich früh auf Seiten Juschtschenkos.Condoleezza Rice und Colin Powell sprechen von einem „Testfall für europäische Demokratie“.
Deutschland aber – schweigt. Und wirkt.
VI. Der Westen schaut zu – Berlin laviert
Während hunderttausende Ukrainer im Schneetreiben ausharren, versendet das Bundeswirtschaftsministerium Einladungen zu einer Russland-Investorenkonferenz in Frankfurt. BASF und Siemens sind dabei, Wintershall ebenso. Niemand will riskieren, dass politische Solidarität mit Kiew wirtschaftliche Reaktionen aus Moskau provoziert.
Joschka Fischer reist schließlich – spät – nach Kiew.
Er trifft Juschtschenko, Janukowytsch, Vertreter der Opposition. Doch seine Worte bleiben vage. Keine offenen Schuldzuweisungen. Keine mediale Solidarität. Nur der Satz:
„Die Europäische Union verfolgt die Lage mit größter Aufmerksamkeit.“
Ein Satz, wie gemacht für diplomatische Flucht.
VII. Das Verfassungsgericht entscheidet – der Protest siegt
Am 3. Dezember 2004 erklärt das ukrainische Verfassungsgericht die Stichwahl für ungültig. Die Wahl wird am 26. Dezember wiederholt.Wiktor Juschtschenko gewinnt – unter internationaler Beobachtung.
Die „Orange Revolution“ siegt – nicht wegen Europas Unterstützung, sondern trotz europäischer Zögerlichkeit.
Das Attentat – Wie Juschtschenkos Gesicht zur politischen Botschaft wurde
„Man wollte mich nicht stoppen. Man wollte mich entstellen – um zu zeigen, was passiert, wenn man sich auflehnt.“— Wiktor Juschtschenko, BBC-Interview 2005
I. Der Vorabend des Terrors
5. September 2004, Kiew.Wiktor Juschtschenko ist zu einem Abendessen eingeladen – informell, angeblich vertraulich, angeblich harmlos. Gastgeber: Ihor Smeschko, damaliger Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU, ein Mann mit engen Kontakten nach Moskau.
Mit dabei: Wolodymyr Satsjuk, Vizechef des SBU, eine Figur, die später im Zentrum internationaler Ermittlungen stehen wird.
Noch am Tisch verspürt Juschtschenko erste Anzeichen: Kopfschmerzen, Übelkeit, Sehstörungen. Stunden später kollabiert er.
II. Die Diagnose: Dioxin
Innerhalb weniger Tage verschlechtert sich Juschtschenkos Zustand dramatisch:
sein Gesicht schwillt grotesk an
die Haut vernarbt, das linke Auge sackt ab
Leber und Bauchspeicheldrüse versagen beinahe vollständig
In Wien, in der Rudolfinerhaus-Klinik, wird der Fall untersucht. Nach monatelangen Tests steht die Diagnose fest:
Dioxinvergiftung – 1.000-fach über dem zulässigen Grenzwert
Ein solcher Wert ist nicht zufällig – er ist geplant.Und er ist eine Signatur. Kein Mord, sondern eine lebenslange Warnung.
III. Was Dioxin bedeutet
Dioxin tötet selten sofort – es ist kein Agent für Attentäter in Eile. Es ist ein politisches Gift. Seine Wirkung ist langsam, schmerzhaft, sichtbar. Es entstellt das Gesicht – und soll genau das: ein Mahnmal erzeugen.
Der Feind lebt – aber er ist gezeichnet.Er trägt die Strafe mit sich, im Spiegel, in den Medien, auf jedem Wahlplakat.Es ist psychologische Kriegsführung mit chemischen Mitteln.
IV. Putins Linie der Kontrolle
Russland bestreitet jede Verantwortung.Doch westliche Geheimdienste und Untersuchungsjournalisten – darunter Der Spiegel, BBC und Radio Free Europe – legen nahe:
Die verwendete Substanz war
hochgereinigtes TCDD
– nur in Speziallaboren herstellbar
Zugang zu dieser Substanz bestand nur in
staatlichen oder militärischen Einrichtungen
Wolodymyr Satsjuk
, der Gastgeber des Abendessens,
taucht kurz nach dem Attentat in Moskau unter
Russland lehnt jede Auslieferung Satsjuks bis heute ab
Der Verdacht: Das Attentat war kein spontaner Versuch der ukrainischen Regierung, sondern Teil einer koordinierten Geheimdienstaktion mit Duldung – wenn nicht Lenkung – aus Moskau.
V. Die internationale Reaktion: Schock – und Schweigen
Der Anschlag sorgt weltweit für Entsetzen.
Tony Blair spricht von einem „moralischen Tiefpunkt im postsowjetischen Raum“.
George W. Bush nennt den Angriff „einen Affront gegen alle, die Demokratie wollen“.
Und Deutschland?
Gerhard Schröder äußert sich nicht.
Frank-Walter Steinmeier spricht intern von „einer bedauerlichen Eskalation“.
Joschka Fischer vermeidet direkte Schuldzuweisungen und betont „die Komplexität der Lage“.
Es bleibt bei Zurückhaltung, während ein Mann öffentlich vergiftet wurde – auf Befehl oder stillschweigende Zustimmung von Kräften, mit denen Berlin weiter Verträge aushandelt.
VI. Was das Attentat wirklich zeigte
Das Attentat war nicht nur ein Angriff auf Juschtschenko.Es war eine Demonstration strategischer Grausamkeit. Eine Botschaft an die Ukraine, an Osteuropa, an den Westen:
Wer sich dem Kreml widersetzt, wird nicht einfach politisch bekämpft – er wird deformiert.
Es war Putins Handschrift, bevor die Welt bereit war, sie zu erkennen.
VIII. Rückblickend: eine verpasste Chance
Deutschland hätte mit klaren Worten, mit aktiver diplomatischer Offensive und mit wirtschaftlichem Druck auf Moskau den Ton setzen können – nicht gegen Russland, sondern für Demokratie.
Doch es blieb beim Lavieren.
Weil die Gasgespräche mit Gazprom liefen
Weil Schröder und Putin sich nicht entfremden wollten
Weil Steinmeier auf Stabilität setzte
Und weil die Ukraine nicht als geopolitisches Schlüsselland betrachtet wurde – sondern als Störfaktor in der Beziehung zu Moskau
Die Orange Revolution war ein Wendepunkt – für die Ukraine, für Europa, für Russland.
Doch Deutschland stand nicht auf dem Maidan, sondern beim Kremltelefon.
Während Tausende für Freiheit kämpften, hielt Berlin am Prinzip der Nicht-Einmischung fest – ein Prinzip, das in Wahrheit Einmischung Moskaus legitimierte.
E
s war das Jahr, in dem sich zeigte:Wer zwischen Demokratie und Gasleitung wählen muss, wählt in Berlin oft die Leitung.
Kapitel 2 – Sektion 2.6
2005: Schröders Abgang – und der stille Übergang nach Moskau
„Ich habe meine Entscheidung getroffen. Und ich weiß, warum.“— Gerhard Schröder zur Kritik an seiner Gazprom-Tätigkeit (2006)
I. Das Ende einer Kanzlerschaft
Die Vertrauensfrage – Schröders kalkulierter Abgang
„Ich stelle die Vertrauensfrage, weil ich den Rückhalt in der Mehrheit nicht mehr sehe.“— Gerhard Schröder, 1. Juli 2005
I. Der politische Hintergrund
Frühjahr 2005: Die rot-grüne Bundesregierung steht unter Druck. Die SPD verliert eine Landtagswahl nach der anderen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 5 Millionen. Die Reformpolitik der Agenda 2010 spaltet die eigene Wählerschaft. In Nordrhein-Westfalen, einst SPD-Hochburg, verliert die Partei im Mai 2005 die Landtagswahl – ein Symbol für den bundesweiten Vertrauensverlust.
Gerhard Schröder erkennt: Der politische Rückhalt im Land ist aufgebraucht.
Doch statt zurückzutreten oder sich im Amt durchzuwursteln, plant er einen Befreiungsschlag – unter kontrollierten Bedingungen.
II. Die Idee: Herbeigeführte Neuwahlen
Das Grundgesetz sieht Neuwahlen nur dann vor, wenn der Bundestag dem Kanzler das Vertrauen entzieht – oder wenn der Kanzler selbst die Vertrauensfrage stellt und verliert. Genau darauf zielt Schröder.
Am 1. Juli 2005 stellt er im Bundestag die Vertrauensfrage. Er verknüpft sie nicht mit einer konkreten Sachentscheidung, sondern mit einem politischen Befund:
„Ich bin überzeugt, dass diese Koalition politisch erschöpft ist.“
Ein bemerkenswerter Vorgang: Der Kanzler fordert sein eigenes Parlament auf, ihn nicht zu bestätigen – um über diesen Weg Neuwahlen erzwingen zu können.
III. Der kontrollierte Kontrollverlust
Im Vorfeld der Abstimmung stimmt die SPD-Fraktion taktisch ab:
Einige Abgeordnete bleiben der Abstimmung fern
Andere stimmen bewusst mit „Nein“
Die Grünen machen mit
Das Ergebnis: Der Kanzler verliert mit 151:296 Stimmen.
Die Bühne für Neuwahlen ist bereitet.
Ein klares politisches Signal – aber auch ein juristisch fragwürdiges Manöver, denn das Grundgesetz verlangt echte Vertrauensverluste, keine taktischen Inszenierungen.
IV. Das Bundesverfassungsgericht – und sein Urteil
Zwei Bundestagsabgeordnete klagen gegen die Auflösung des Parlaments: der ehemalige CDU-Abgeordnete Werner Schulz und der Jurist Johann Lang.
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am 25. August 2005. Am 25. August um 10 Uhr erfolgt das Urteil:
„Der Bundespräsident hat bei der Prüfung des Vertrauensverlustes einen Beurteilungsspielraum.“— BVerfG, 2 BvE 4/05
Mit anderen Worten: Schröders Manöver ist zulässig – politisch wie juristisch.
V. Warum diese Phase entscheidend ist
Zwischen Juli und September 2005 öffnet sich ein Machtvakuum auf Zeit: Schröder ist Kanzler, aber nicht mehr unangefochten. In dieser Übergangszeit:
führt er
keine strategischen Gesetzesinitiativen
mehr
bereist
mehrmals Moskau und Sotschi
– u. a. für einen informellen Austausch mit Putin
ist er
politisch freier als je zuvor
, aber
unterhalb medialer Wahrnehmung
Diese Wochen sind der Ursprung der geheimen Vorbereitung für Nord Stream – in genau dieser Phase wird der politische Einfluss Schröders monetarisiert.
VI. Die moralische Frage
Das Problem war nicht die rechtliche Legitimität der Vertrauensfrage.Das Problem war: Was Schröder mit dieser politischen Lücke tat.
Er nutzte die Phase zwischen Vertrauenserklärung und Wahlniederlage, um wirtschaftlich-strategische Weichen zu stellen, die seinem späteren Arbeitgeber dienten.
Er reiste – nachweislich – im Sommer 2005 nach Moskau, traf dort Gazprom-Chef Alexei Miller und Putin, noch als Kanzler.
Die Vertrauensfrage war keine Verzweiflungstat – sie war ein kalkulierter Machtakt, mit dem Schröder sich den Weg aus der Politik ebnete, ohne Verantwortung zu übernehmen.
Er verlor – aber zu seinen Bedingungen.Er trat ab – aber blieb am Tisch.
Und während das Land glaubte, ein Kapitel sei abgeschlossen, bereitete er in Moskau bereits das nächste vor.
Am 18. September 2005 verliert Gerhard Schröder die Bundestagswahl gegen Angela Merkel. Es ist ein denkbar knapper Wahlausgang: CDU/CSU erreichen 35,2 %, die SPD 34,2 %. Wochenlang verhandeln die Parteien über mögliche Koalitionen, Schröder selbst beansprucht zunächst weiter das Amt – ein letztes Aufbäumen. Doch schließlich muss er aufgeben.
Am 22. November 2005 übergibt Schröder das Kanzleramt an Merkel.Frank-Walter Steinmeier wird Außenminister, Peer Steinbrück Finanzminister.
Die Ära Schröder – offiziell – ist vorbei.
Was zu diesem Zeitpunkt jedoch kaum jemand weiß: Im Hintergrund laufen längst Vorbereitungen für eine der umstrittensten Nach-Kanzler-Karrieren der deutschen Geschichte.
VII. Der Brief aus Moskau
Nur wenige Wochen nach der Wahl trifft im Bundeskanzleramt ein vertrauliches Schreiben ein:
Die Gazprom-Tochter North European Gas Pipeline Company (NEGP) teilt mit, man beabsichtige, für das im Bau befindliche Projekt Nord Stream einen prominenten europäischen Aufsichtsratsvorsitzenden zu benennen – am liebsten: Gerhard Schröder.
Offiziell handelt es sich um einen „Vorschlag“.
In Wahrheit ist es eine politische Verabredung zwischen Wladimir Putin und Schröder, die auf den Sommer 2005 zurückgeht – noch während Schröder im Amt war.
Der Brief geht nicht an die Öffentlichkeit.
Stattdessen beginnen erste Gespräche zwischen Gazprom, Schröders Anwälten und dem Bundeskanzleramt – nun unter Leitung von Merkel.
Der Brief – Schröders Aufruf aus dem Kreml
„Das Angebot kam nicht überraschend – sondern war vorbereitet.“
I. Der Brief – und seine wahre Geschichte
Der Brief aus Moskau, der im November 2005 im Kanzleramt eintraf, war nicht bloß eine Einladung, sondern ein Akt politischer Markierung. Absender: Gazprom über die NEGP Company (North European Gas Pipeline), mit Sitz in Zug (Schweiz). Inhalt: Die Bitte um Zustimmung für die Berufung Gerhard Schröders zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Pipeline-Gesellschaft.
Doch dieser Brief war nicht der Anfang, sondern das Ende eines Prozesses – und dieser beginnt nicht nach Schröders Abgang, sondern mitten in seiner Kanzlerschaft, vermutlich zwischen Frühjahr und Sommer 2005.
Was heute bekannt ist – u. a. durch Recherchen von Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Correctiv und durch Aussagen von Beteiligten – zeigt folgendes Bild:
Schröder und Putin