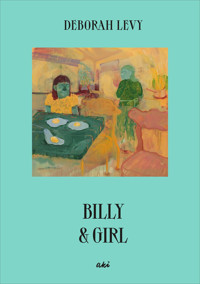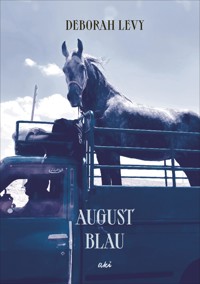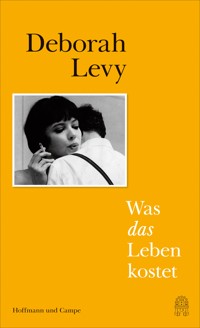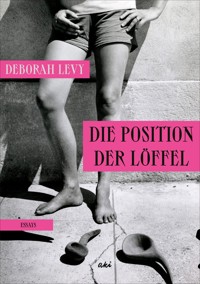
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: AKI Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Essaysammlung Die Position der Löffel leiht uns Deborah Levy ihren Blick. Sie betrachtet ihre Lesebiographie, die Autor*innen, die sie prägten;Colette, Marguerite Duras, Elizabeth Hardwick, Simone de Beauvoir. Mal setzt sie Sigmund Freuds Brille auf und durchschaut die Neurosen der Gäste eines Wiener Kaffeehauses;Hysterie, ödipale Mutterliebe, Schwindel, Sachertorte. Sie betrachtet Künstler*innen und Kunstwerke;Meret Oppenheim, Lee Miller, Francesca Woodman. Sie schreibt ein Alphabet für die innere Stimme und eins für den Todestrieb, pflückt böse Blumen in Baudelaires' Garten und folgt dem weißen Kaninchen durch einen Tunnel von Woolwich nach Anderswo. »Ist Anderswo zwischen deinen Ohren?« Poetisch, klug, manchmal surreal und immer mit einem untrüglichen, liebevollen Blick fürs Detail. Was, wenn es eine Rolle spielt, ob der Löffel zum gekochten Ei zeigt oder davon weg? Was verraten Socken und Schuhe über ihre Träger*innen? Was, wenn es wichtig ist, wem und was wir unsere Aufmerksamkeit schenken? Die Position der Löffel ist gleichzeitig Kurzgeschichtensammlung, kritische Theorie, Poetik und persönliche Bibliotheksführung. Levy-Lesende werden überall Bekanntes aufblitzen sehen, für Noch-nicht-Levy-Lesende gibt es einen neuen Kosmos zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Deborah Levy
Die Position der Löffel
Essays
Aus dem Englischen von Marion Hertle
AKI
Colette
Colette mit ihrer Katze, 1929 © Tuul and Bruno Morandi / Alamy Stock Photo
Ich habe mich in sie verliebt, noch bevor ich auch nur eines ihrer Bücher gelesen hatte.
In meinen von schwarzem Kajal umrandeten Teenageraugen (was nihilistisch und kaputt aussehen sollte, schließlich war es die Zeit von Punk, und wir alle waren in Trauer um unsere Zukunft), besaß Colette eine selbstbeherrschte Schönheit, die sie dem Fotografen nur leihweise überließ, wie es mir schien.
Ich lebte in einer Vorstadt von London, wo alle gleich aussahen und sogar ihren Hunden dieselben Namen gaben (allein in meiner Straße wohnten drei Hunde namens Spot), deshalb war es in meinen Augen sogar noch besser, dass Colette eine Schriftstellerin war, die wie ein Filmstar aussah.
Ich sah kein bisschen aus wie sie. Ihr Hund hieß Toby-Chien.
Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Foto gestoßen bin. Aber ich weiß, es war in einem kalten Dezember 1973, und in dem Haus, in dem unsere Familie wohnte, war die Zentralheizung kaputt.
Es klingelte an der Tür, und meine Mutter rief mir zu, ich solle den Mann einlassen, der gekommen war, um die Heizung zu reparieren. Er stocherte in dem Schrank mit dem Boiler herum und sagte: »Ich erkläre diesen Boiler offiziell für unbrauchbar. Laut Gesetz müssen Sie einen neuen kaufen.« Dann zwinkerte er mir zu und schaltete ihn ein. Die Leitungen im Haus begannen zu surren und zu scheppern wie ein alter Traktor. Als ich schließlich in mein Zimmer zurückkehrte, musste ich mir den Weg durch den schwarzen Rauch bahnen, der aus meinem Heizkörper drang.
Auch wenn es ein gestelltes Bild war, sprach mich die Art, wie Colette es arrangiert hatte, direkt an. Sie war eine Schriftstellerin mit einem Ziel im Leben. Ich sah auf den ersten Blick, dass sie es genoss, sich in Szene zu setzen, um dieses Ziel darzustellen. Das war in dieser Phase meines Lebens besonders interessant für mich.
Ich bin in Südafrika geboren und in Großbritannien aufgewachsen. Als ich dieses Foto mit dreizehn Jahren sah, lebte ich seit vier Jahren in Großbritannien, also noch nicht lang genug, um mich wie eine Engländerin zu fühlen. Colette präsentierte sich auf eine Art, die meiner Teenagervorstellung von einer europäischen Schriftstellerin sehr entgegenkam. Glamourös, ernst, intellektuell, verspielt – mit einer fiesen, seidig glänzenden Katze auf ihrem Schreibtisch hinter den Blumen, alles gerahmt von einem strahlenden Bogen französischen Lichts.
Als ich begann ihre Bücher zu lesen, wehte alles Grenzüberschreitende und Sinnliche ihrer Texte wie ein Wind aus dem Burgund, aus Paris und Südfrankreich in die feuchtkalten Vorstadtgärten Londons. Dank ihrer Affären mit Frauen und ihrer drei Ehen (die erste mit einem perversen und korrupten Bonvivant, der ihre frühen Romane unter seinem Namen veröffentlichte) stand sie mit einem Fuß im bürgerlichen Leben ihrer Zeit und mit dem anderen draußen. Im mittleren Alter bekam sie Arthritis und trug häufig offene Männersandalen zu ihren eleganten Kleidern, sehr zum Leidwesen ihres kreuzbraven zweiten Mannes. Von all dem wusste ich nichts, als ich dieses Foto zum ersten Mal sah, dennoch ahnte ich, dass sie ein experimentelles Leben geführt hat.
Wozu sollte man irgendeine andere Art von Leben führen, fragte ich mich. Draußen hörte ich einen der Hunde namens Spot eine Katze namens Snowy anbellen. Zwanzig Jahre später, als ich La Vagabonde las, hatte ich guten Grund, ihrer leichten und dennoch tiefgründigen Erklärung zuzustimmen: »Kurzum, ich will nichts von der Liebe, außer Liebe.«
Ja, was sonst sollten wir von der Liebe wollen außer Liebe?
Viel zu viel, tatsächlich.
Marguerite Duras
Für Marguerite Duras besteht der Zweck von Sprache darin, eine Katastrophe auf der Seite festzunageln.
Sie denkt so tiefgreifend wie irgend möglich, ohne vor Schmerz zu sterben. Für Duras geht es um alles oder nichts. Sie legt alles in die Sprache. Je mehr sie hineinlegt, umso weniger Wörter braucht sie. Wörter können nichts sein. Nichts. Nichts. Nichts.
Nur das, was wir nicht mit der Sprache machen, verleiht ihr Wert, macht sie notwendig. Langweilige und verdummende Sprache hat Erfolg. Jeder Schriftsteller und jede Schriftstellerin weiß das und trifft eine Entscheidung, was mit diesem Wissen anzufangen ist.
Es ist schwer, manchmal sogar absurd, Dinge zu wissen, sogar schwerer, Dinge zu fühlen – das ist es, was Duras uns immer vermittelt. Ihre Filme sind romanhaft, eine Off-Stimme, innerer Monolog, ihre Romane sind filmisch – sie versteht, dass ein Bild nicht ein »Setting« ist, es muss alles enthalten, was die Lesenden wissen müssen. Duras bettelt nie mit Worten, sondern arbeitet sehr schwer und ruhig für uns. Ihr Trick besteht darin, alles mühelos wirken zu lassen.
Ins Englische übersetzte europäische Literatur war unglaublich schwer zu bekommen in Großbritannien. 1984 war ich neunundzwanzig, als ich Marguerite Duras’ Meisterwerk Der Liebhaberzum ersten Mal las, aus dem Französischen übersetzt von Barbara Bray. Offenbarung und Konfrontation gleichermaßen, als wäre ich aus einem eichengetäfelten Herrenclub des 19. Jahrhunderts ausgebrochen, hinein in etwas Belebendes, Erotisches, Melancholisches, Wahres, Modernes und Weibliches.
Wenn es ihre kühle, sparsame Prosa und ihr makelloser narrativer Aufbau waren, die repräsentativ für den Nouveau Roman waren, der vor allem mit Alain Robbe-Grillet in Verbindung gebracht wird, so war mir doch klar, dass der größte Unterschied darin bestand, dass Duras Emotionen nicht beargwöhnte. Beim Schreiben von Der Liebhaber griff sie auf ihre frühe Jugend in Saigon zurück, wo sie mit ihrer verarmten Mutter und ihren streitlustigen Brüdern gelebt hatte. Wie in einer Art Memoir erzählt sie von einem jungen Mädchen, das mit seiner vornehmen, aber bettelarmen Familie ein ziemlich koloniales Leben in Französisch-Indochina in den dreißiger Jahren führt.
Sie beschließt, etwas zu unternehmen und beginnt einen Männerhut mit flacher Krempe und Schuhe aus Goldlamé zu tragen. Indem sie das tut, sieht sie sich plötzlich »wie eine andere«. Es ist ein Zaubertrick, um sich von ihrer sterbenden Mutter zu lösen, und es funktioniert.
Ein eleganter, reicher, zwölf Jahre älterer Chinese beobachtet sie auf der Fähre über den Mekong. Als er es riskiert, ihr eine Zigarette anzubieten, bemerkt sie, dass seine Hand leicht zittert. »Es gibt diesen Rassenunterschied, er ist kein Weißer, er muss sich überwinden, darum zittert er.«
Sie will, dass er weniger Angst hat, damit er mit ihr machen kann, »was er üblicherweise mit Frauen tut«, und vielleicht kann er dann im Gegenzug ihren Brüdern und ihrer Mutter manchmal eine Mahlzeit kaufen? In einer der verheerendsten und brutal ehrlichsten Verführungsszenen, die je geschrieben wurde, fährt sie der chinesische Finanzier, dem, wie sie herausfindet, alle Arbeiterunterkünfte der Kolonie gehören, in seiner schwarzen Limousine in seine Wohnung im Süden der Stadt.
Sie entkleidet ihn, merkt, dass sie ihn begehrt, wird panisch, sagt ihm, dass sie es vorziehen würde, wenn er sie nicht liebt. Dann weint sie – über die Armut ihrer Mutter und weil sie oft Hass für sie empfindet. Der Liebhaber schildert nicht nur eine verbotene sexuelle Begegnung von atemberaubender Leidenschaft und Intensität; es ist auch ein Essay über Erinnerung, Tod, Verlangen und wie der Kolonialismus alle zugrunde richtet.
Ich bin mir nicht sicher, ob ein so heiß glühendes Buch wie Der Liebhaber, eher existentialistisch als feministisch, heutzutage verlegt werden würde. Jedenfalls nicht in Großbritannien. Man würde Fragen stellen. Sind die Figuren sympathisch (nicht unbedingt), ist es experimentell oder Mainstream (weder noch), ist es ein Roman oder eine Novelle? Ein Glück für Duras, dass es ihren Leserinnen und Lesern egal war. Es hat sich eine Million Mal in dreiundvierzig Sprachen verkauft, den Prix Goncourt gewonnen und wurde fürs Kino verfilmt.
Marguerite Duras war eine gewagte Denkerin, eine Egomanin, auch ein wenig lächerlich, ehrlich gesagt. Ich schätze, sie musste so sein. Wenn sie ihre mutige, aber »schmächtige« weibliche Hauptfigur in ihren Goldlamé-Schuhen in die Arme ihres chinesischen Millionärs schickt, entschuldigt sich Duras nie insgeheim für die Art von Moral oder Psychologie, mit der sie der Welt gegenübertritt.
Meine wunderschönen Brothel Creepers
Als ich mir mit siebzehn mein erstes Paar Brothel Creepers, Lederschuhe mit besonders dicker, weicher Sohle bei Shellys kaufte, dem hippsten Schuhladen in London, sah ich mir ihre sechs Zentimeter dicke schwarze Kreppsohle an und wusste, dass ich sie nie mit Socken tragen würde. Mir war immer klar, dass Männer und Frauen, die Schuhe ohne Socken tragen, dazu bestimmt sind, meine Freunde und Geliebten zu werden. Diese sockenlosen Menschen haben eine Art körperliche Unbekümmertheit. Sie gehen mit Schwung. Gleichzeitig gelingt es ihnen, nonchalant und leicht reizbar zu wirken. Keine Socken zu tragen, bedeutet wach zu sein, aber nicht herzlich. Keine Socken zu tragen, bedeutet nicht so zu tun, als wäre die Liebe für immer.
Falls es ein Trost ist: Menschen, die Socken tragen, sind vermutlich besser angepasst als ihre sockenlosen Brüder und Schwestern. Sie sehen den Dingen ins Auge und haben bei Regen immer einen Schirm dabei.
Die Sockenlosen sind gottlos. Genau wie Brothel Creepers, auch bekannt als »Teddy Boy Shoes«. Mit meinem allerersten Paar die Straße entlangzugehen, gab mir das Gefühl, als trüge ich ein Tattoo, das mich für ein bedeutungsvolles Leben auserkor. Seither habe ich viele verschiedene Varianten davon gekauft, aber zwanzig Jahre später steht mein erstes Paar immer noch unversehrt im obersten Fach meines Schuhregals. Wie Jazzmusiker sind sie mit dem Alter besser geworden. Es sind keine Pikes, aber ihre Leofellzunge (V-förmig) ist immer noch verführerisch, knurrt sprungbereit. Meine nackten Füße in diese Schuhe zu stecken, war wortwörtlich wie auf Luft zu gehen. Meine Brothel Creepers waren Schönheit und Wahrheit, personifizierte Genialität, ganz egal, ob Rock und Bop, darum ging es nicht, sie waren die Metropolis, ein Ticket raus aus der Vorstadt.
Meine Brothel Creepers gaben mir das Gefühl, sexy zu sein, seriös, frivol, voller Selbstvertrauen. Ich trug sie zu eng anliegenden schwarzen Kleidern, und ich trug sie zu Jeans. Ich trug sie zu Bleistiftröcken und nadelgestreiften Hosen, und ich trug sie, um den Müll rauszubringen.
Etwas am Design der Brothel Creepers schien die Welt in Perspektive zu setzen. Ihre spitzen schwarzen Zehen wippten zum Beat der Rebellion; Schuhe, die meine Mutter niemals getragen hätte, Schuhe, die mein Vater niemals getragen hätte, Schuhe, die tatsächlich nicht sehr viele Mädchen trugen, aber die, die es taten, waren großartig. Mein Narzissmus wurde bestätigt, als ich eines Nachmittags schon ganz schwach vor Hunger am Gleis eines Bahnhofs irgendeiner verschlafenen Vorstadt wartete. Als ich hörte, dass der Zug elf Minuten Verspätung hatte, rannte ich (mit meinen wunderschönen Brothel Creepers) über die Brücke, um mir im Supermarkt etwas zu essen zu holen.
Alle dort waren alt, und wenn sie nicht alt waren, sahen sie zumindest so aus. Außer dem Mädchen an der Kasse in ihrem karierten Overall, die verträumt zu den weißen Neonröhren an der Decke starrte. Drei Minuten vor Abfahrt und ihre Kassenzettelrolle ist leer. Als sie aufsteht, um eine neue zu holen, sehe ich, dass auch sie Brothel Creepers trägt. Nur dass ihre aus stahlblauem Wildleder sind und noch mehr Attitüde haben als meine eigenen. Während ich zu meinem Zug renne, weiß ich, dass sie es weg schaffen wird aus diesem Kaff. Ihre Schuhe verraten, dass sie Pläne macht für ein Leben anderswo.
Aus dem Rahmen treten
Francesca Woodman: Space2, Providence, Rhode Island
Sie ist Kunststudentin und hat sich für einige Stunden ein Atelier gemietet. Sie wird sich den Boden, die Wände und die Ecken der Wände angesehen haben, und wo die Fenster sind und wie sie das Licht einsetzen kann. Sie hat ein paar Ideen (Verschlusszeit, Langzeitbelichtung), aber sie will zunächst nur herumspielen. Sie ist ihr eigenes Sujet, steht aber für viele andere Sujets, und eines davon ist Repräsentation. Repräsentation der weiblichen Form. Dieses Bild ist kein Selbstporträt von Francesca Woodman. Sie benutzt ihren Körper, um etwas herauszufinden.
Sehen Sie sie sich an. Da ist sie. Sie ist ganz da. Sie ist da, aber sie will sich immer verschwinden lassen – verdunsten, ein Gespenst, ein Fleck, eine Trübung, ein Sujet, das ausradiert, aber trotzdem erkennbar ist. Sie weiß, dass wir wissen, dass sie da ist, weiß aber auch, dass sie sich, indem sie Methoden ausarbeitet, um sich selbst verschwinden zu lassen, größer macht. Sie macht sich größer, weil wir nach ihr suchen. Die Künstlerin Francesca Woodman lässt uns etwas herausfinden. Es ist ein Tanz, eine Theorie, vielleicht von Lacan (la femme n’existe pas), eine Fiktion, eine Provokation, ein Experiment, ein Scherz, eine ernsthafte Frage. Francesca Woodman will, wie alle Mädchen, aus dem Rahmen treten.
Sie weiß, wenn wir dieses Bild ansehen, werden wir »sie« finden wollen, aber diese »sie«, die wir finden, ist die Kunst – die ganze kinetische Komposition. Ich weiß, sie gestaltet alles, findet heraus, wie der Trick funktioniert. Sie ist aufmerksam, geschmeidig, geordnet, im Gleichgewicht. Sie hat dieses Bild in gewisser Weise schon gesehen, bevor sie es geschaffen hat, oder sie hat es vor sich gesehen, während sie es erschuf, und wahrscheinlich hat sie dieses Bild schon immer gespürt. Sie muss nur noch eine Methode finden, um es zu verwirklichen. Will sie sich selbst präsentieren, indem sie sich absentiert, wäre es einfacher, diese Gleichung mit Mathematik oder Physik zu lösen, aber sie tut es mithilfe von Kunst.
Die Stiefel erden dieses ätherische Bild. Es ist so wichtig, Halt zu haben, wenn wir aus dem Rahmen der Weiblichkeit in etwas Vages, etwas Verschwommenes treten. Francesca Woodman, die Künstlerin, kann sich in diesen Stiefeln frei bewegen, aber sie ziehen sie auch nach unten. Das Bild wäre schwächer ohne sie. Tatsächlich trage ich, während ich das schreibe, ziemlich ähnliche Stiefel. In etwa fünf Minuten werde ich meinen Computer ausschalten, die Tür meines Schreibschuppens verschließen und zur U-Bahn gehen.
Lee Miller
Glauben Sie es
Lee Miller ist in Poughkeepsie, New York, geboren, sieben Jahre nachdem Freud Die Traumdeutung veröffentlicht hat. Fotografien aus ihren jungen Jahren haben immer etwas Traumartiges und Unergründliches. Sie versteckt sich vor der Kamera und gibt sich ihr gleichzeitig hin. Ich will Lee Miller immer weiter ansehen, weil ich mir nicht sicher bin, was ich ansehe – ihre Schönheit, ihre Haltung, ihren Hut, ihren melancholischen Blick.
Was sollte sie mit dieser ganzen Schönheit und ihrem Talent anfangen? Sie wurde in New York Modell für die angesehenen Fotografen ihrer Zeit und ging dann nach Europa, um Kunst zu studieren. In Paris arbeitete sie mit Man Ray, wurde seine Schülerin, Geliebte und Modell, Teil von vielen außergewöhnlichen Bildern, bei denen sie vermutlich nicht genannt wird. In der Öffentlichkeit war sie sehr bescheiden, was ihre eigene Arbeit anging, aber vielleicht sah es in ihrem Inneren anders aus.
Nachdem sie Man Ray verlassen hatte, baute sie sich ihr eigenes Atelier auf und vertrieb sich dort die Zeit mit den Freundinnen der Surrealisten ihrer Generation. Es sind Lees Fotografien von Nusch Éluard und Ady Fidelin, die sie aus ihren Rollen als Musen und Mannequins erretten. Ich freue mich immer, wenn ich beim Durchstöbern der Archive über die Surrealisten auf sie stoße. Und dann ist da noch der Schock über einige Dinge aus Lee Millers eigener Biographie. Ich möchte es nicht glauben. Es gibt ein Foto von Lee als Kind in Latzhosen, sie ist sieben oder acht, nicht lange, nachdem sie von einem »Freund der Familie« vergewaltigt worden war. Sie starrt in die Kamera, wirkt zerbrechlich und wie betäubt.
1944 wurde sie Kriegsberichterstatterin innerhalb der US Army und folgte der amerikanischen Infanterie durch ein traumatisiertes Europa. Sie war Zeugin. Sie richtete ihre Kamera auf schreckliche Dinge, auf die Geschichte der Menschheit der Gegenwart.
Als eine der wenigen weiblichen Kriegsberichterstatter dieser Zeit war es Lee Miller, die die Befreiung von Dachau und Buchenwald fotografierte. Sie stieg auf einen LKW und stand zwischen den Leichen, um die abgemagerten, toten Häftlinge zu fotografieren.
Die Bilder wurden in der amerikanischen Vogue veröffentlicht, unter der Überschrift »Believe it – Glauben Sie es.«
Werte und Normen
Irgendwann begann ich mich zu fragen, warum die Augen einer bestimmten Frau mittleren Alters aus meinem Bekanntenkreis wirkten, als wollten sie in ihrem Kopf verschwinden. Wenn ihre winzigen Guckerchen versuchten, sich meinem Blick zu entwinden, konnte ich ihnen ihr Versteckspiel nicht verdenken, aber es fühlte sich seltsam an, sich mit jemandem mit schrumpfenden Augen zu unterhalten.
Ich merkte, dass sie unter irgendeiner Art von Druck stand. Ich kannte sie nicht besonders gut, aber wir trafen uns manchmal an der Schulpforte, wenn wir unsere Kinder abholten. Sie gehörte zum besten Bürgertum, großes Haus, Bücher im Regal, Kunst an der Wand. Es war, als hätte sie sich gesagt, sie ertrage keine Dummköpfe (wie mich) um sich, und dass sie für gewisse Werte und Normen stehe. Sie war nicht wirklich sympathisch. Ich dachte darüber nach, wie sie ihre Augen abgewandt hatte, im Namen dessen, wofür sie stehen wollte.
Möglich war auch, dass sie nicht so genau hinsehen wollte, wenn es um die Dinge in ihrem Leben ging, die ihr nicht gefielen. Ich hatte beobachtet, wie ihr Mann sich nicht das Vergnügen verkneifen konnte, sie zu verunsichern und zu demütigen. Es war, als hätte er sich gesagt, er ertrage keine Dummköpfe (wie sie) um sich, und dass er für gewisse Werte und Normen stehe. Falls sie eine komplizierte psychische Operation durchgeführt hatte, bei der sie sich ihre eigenen Augen entfernt hatte, und sich und die Welt nun durch seine sah, fragte ich mich, ob sie sich manchmal ihre eigenen wieder einsetzte?
Ich begann über meine Augen nachzudenken. Es hatte Zeiten gegeben, in denen sie eindeutig kleiner geworden waren. Wenn meine Augen zu Guckerchen wurden, dann lag es für gewöhnlich daran, dass andere Dinge größer geworden waren. Vielleicht sogar überwältigend. Es gibt die Wendung »die Augen zu einem Schlitz zusammenkneifen«. Damit ist für gewöhnlich gemeint, etwas oder jemanden abzuwägen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind – Zweifel auszudrücken, Verachtung – vielleicht sogar eine Lüge zu entlarven. Bedeutet das, dass wir unsere Augen schmal machen, um klarer zu sehen? In dem Fall würde es bei Rotkäppchen heißen:
Was hast du für große Augen?
Um dich besser nicht zu sehen.
Was sagt uns das über Realisten mit weit aufgerissenen Augen? Sind die Augen so groß, weil sie sich heimlich danach sehnen nicht mehr, sondern weniger zu sehen, obwohl sie doch so viel in die Wahrheit ihres Weitblicks investiert haben?
Ist es möglich, dass die Frau aus meinem Bekanntenkreis, die für gewisse Werte und Normen stand, gar nicht wissen wollte, dass die Werte und Normen, in die sie investiert hatte, sie womöglich niedermetzeln würden? Ihre Augen, die sie sich ausgestochen hatte wie Ödipus, starrten sie trotzdem an.
Das Reich kommt
»Der Konsumismus regiert, aber die Menschen langweilen sich. Sie stehen am Rand des Abgrunds und warten auf etwas Großes, etwas Seltsames … Sie wollen sich fürchten. Sie wollen die Angst kennenlernen. Und vielleicht wollen sie ein bisschen durchdrehen.«
J.G. Ballard, Das Reich kommt
J.G. Ballard, der größte literarische Futurist Englands, hat die Koordinaten der Realität in der britischen Literatur verschoben und seine treue Leserschaft mit auf einen wilden, intellektuellen Ritt genommen. Nie stellt er nach den Geschehnissen in seinen Romanen die moralische Ordnung wieder her, weil er nicht glaubte, dass wir das wirklich wollen. Egal, was sich Ballard als Nächstes für uns ausdachte, egal wie fremdartig, wir wussten uns immer in sicheren Händen, weil er »die Notwendigkeit« erkannt hat, »einen dramaturgisch schlüssigen narrativen Raum« zu schaffen.
Als junge Schriftstellerin in den Achtzigern las ich zum ersten Mal seine erleuchtende, erotische Geschichtensammlung Der ewige Tag. Es war formal so innovativ, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass es bereits 1967