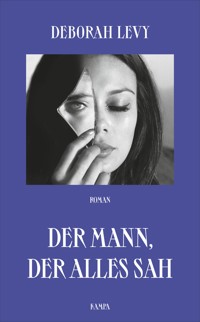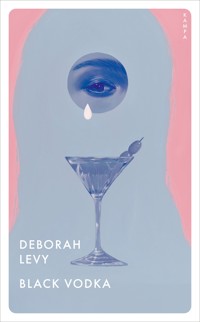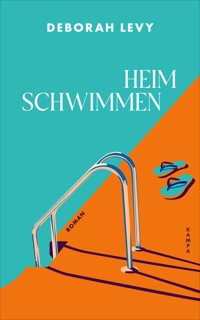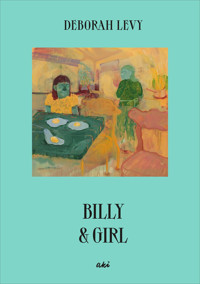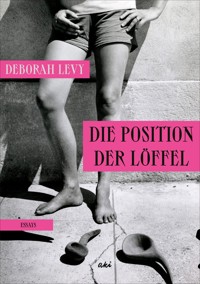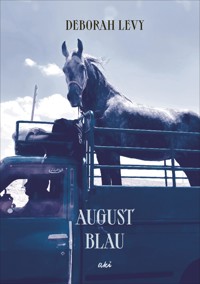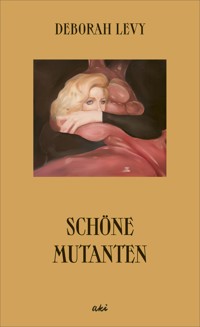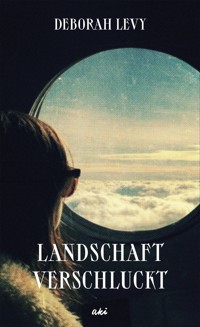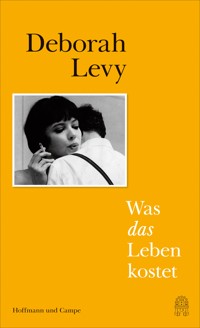
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Prix Femina étranger 2020 Wenn sich das Leben ändert, tut es dies meist radikal. Deborah Levy und ihr Mann gehen getrennte Wege, ihre Mutter wird bald sterben. Doch die entstehende Lücke bedeutet auch Raum für Neues. In präziser und suggestiver Prosa erschreibt Levy sich aus den Bruchstücken ihres alten Selbst ein neues und fragt: Was heißt es, frei zu sein - als Künstlerin, als Frau, als Mutter oder Tochter? Und was ist der Preis dieser Freiheit? »Jeder Satz ein kleines Meisterwerk«, schreibt The Telegraph, und so wird aus einer individuellen Geschichte ein lebenskluges und fesselndes Zeugnis einer zutiefst menschlichen Erfahrung. »Das Leben bricht auseinander. Wir versuchen es in die Hand zu nehmen, versuchen es zusammenzuhalten. Bis uns irgendwann klar wird, dass wir es gar nicht zusammenhalten wollen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Deborah Levy
Was das Leben kostet
Aus dem Englischen von Barbara Schaden
Hoffmann und Campe
Man ist immer irrealer als die andern.
Marguerite Duras, Das tägliche Leben
1Big Silver
Ein Happy End hängt ganz davon ab, wo wir die Geschichte enden lassen, meinte Orson Welles. An einem Abend im Januar saß ich in einer Bar an der Karibik-Küste Kolumbiens, aß Kokosreis mit Fisch, und am Tisch neben mir war ein braungebrannter tätowierter Amerikaner. Er war Ende vierzig, hatte mächtige Muskelarme und sein Silberhaar zu einem Knötchen am Hinterkopf zusammengezwirbelt. Er unterhielt sich mit einer jungen Engländerin, die neunzehn sein mochte. Sie hatte erst für sich gesessen und gelesen, war aber, nach anfänglicher Unschlüssigkeit, der Einladung an seinen Tisch gefolgt. Zuerst bestritt er das Gespräch allein. Nach einer Weile unterbrach sie ihn.
Was sie sagte, war interessant, eindrücklich und merkwürdig. Sie erzählte, dass sie in Mexiko tauchen gewesen war, und als sie nach zwanzig Minuten wieder an die Oberfläche kam, tobte über dem Wasser ein Unwetter. Das Meer war in brodelndem Aufruhr, und sie hatte Angst, sie könnte es nicht mehr bis zum Boot schaffen. Hauptsächlich handelte ihre Geschichte von einem radikalen Wetterumschwung zwischen Anfang und Ende eines Tauchgangs, daneben aber ging es um eine unausgesprochene Kränkung. Die junge Frau beließ es bei ein paar Andeutungen (es war jemand an Bord, von dem sie sich eigentlich Hilfe erwartet hätte) und warf ihm dann einen prüfenden Blick zu, wie um sich zu vergewissern, ob er begriffen hatte, dass das Unwetter eine Metapher war. So groß war sein Interesse allerdings nicht; stattdessen versetzte er mit einem Manöver des Knies dem Tisch einen Stoß, der ihr Buch abstürzen ließ.
Er sagte: »Du redest gern, oder?«
Sie schwieg nachdenklich, kämmte währenddessen mit den Fingern ihre Haarspitzen und beobachtete zwei Jugendliche, die auf dem kopfsteingepflasterten Platz den Touristen Zigarren und Fußballshirts verkauften. Es war anscheinend nicht so einfach, diesem sehr viel älteren Mann klarzumachen, dass die Welt auch ihre Welt war. Er war ein Risiko eingegangen, als er sie an seinen Tisch eingeladen hatte. Immerhin brachte sie ein ganzes eigenes Leben, eine eigene Libido mit. Er war gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie sich nicht für die Nebenfigur und ihn für die Hauptfigur halten könnte. Insofern hatte sie eine Grenze in Frage gestellt, eine soziale Hierarchie zum Einsturz gebracht, gegen die üblichen Rituale verstoßen.
Sie wollte wissen, was das sei, was er da mit Tortillachips aus seiner Schale fischte. Ceviche, sagte er, in Limettensaft marinierter roher Fisch; auf der Speisekarte als sexvice angepriesen – »Wird mit Kondom serviert«, sagte er. Ihr Lächeln zeigte mir, dass sie entschlossen war, sich unerschrockener zu präsentieren, als sie sich fühlte; eine Frau darzustellen, die ohne weiteres auf eigene Faust reisen und abends allein in einer Bar sitzen, lesen und Bier trinken konnte; eine, die ein unmöglich kompliziertes Gespräch mit einem Fremden wagen konnte. Sein Angebot, das Ceviche zu kosten, nahm sie an; dem Angebot, mit ihm an einem einsamen Strand nicht weit von hier – »abseits der Felsen«, versicherte er – bei Dunkelheit schwimmen zu gehen, entzog sie sich.
Nach einer Weile sagte er: »Ich mag Tauchen nicht. Nur für Gold ginge ich tief unters Wasser.«
»Oh«, sagte sie. »Witzig, dass du das sagst. Gerade dachte ich, mein Name für dich wäre The Big Silver.«
»Wieso Big Silver?
»So hieß das Tauchboot.«
Er schüttelte den Kopf, verblüfft, und verlagerte seinen Blick von ihren Brüsten zu der Leuchtanzeige an der Tür, auf der »EXIT« stand. Wieder lächelte sie, aber es war kein echtes Lächeln. Wahrscheinlich war ihr klar, dass der Aufruhr, den sie von Mexiko nach Kolumbien mitgebracht hatte, nach Beschwichtigung verlangte. Sie entschied sich, ihre Aussage zurückzunehmen.
»Nein, Big Silver wegen deinen Haaren und dem Brauenpiercing.«
»Ich bin einfach ein Vagabund«, sagte er. »Ich lass mich treiben.«
Sie zahlte und bat ihn, das Buch aufzuheben, das er auf den Boden befördert hatte. Dafür musste er sich unter den Tisch bücken und mit dem Fuß danach angeln. Es dauerte eine Weile, und als er mit dem Buch in der Hand wieder auftauchte, war sie weder dankbar noch unhöflich. Sie sagte lediglich »Danke«.
Während die Kellnerin Teller mit Krebsscheren und Fischgräten abräumte, musste ich an ein Oscar-Wilde-Zitat denken: »Sei du selbst; alle anderen sind bereits vergeben.« Auf sie traf das nicht ganz zu. Sie musste Freiheiten für sich in Anspruch nehmen, die einem Big Silver selbstverständlich waren – ihm fiel es schließlich nicht schwer, so zu sein, wie er war.
Du redest gern, oder?
Über unser Leben zu reden, wie wir es empfinden, ist eine Freiheit, die wir uns meistens verbieten, aber ich hatte den Eindruck, dass die Worte, die sie sagen wollte, in ihr brodelten und ihr selber so rätselhaft waren wie allen anderen.
Später, als ich schreibend auf meinem Hotelbalkon saß, dachte ich darüber nach, wie sie den sich treiben lassenden Big Silver aufgefordert hatte, zwischen den Zeilen ihrer unausgesprochenen Kränkung zu lesen. Sie hätte die Geschichte mit der Beschreibung des wundersamen Unterwasserlebens in der stillen Tiefe vor dem Unwetter enden lassen können; es wäre ein Happy End gewesen. Aber sie beließ es nicht dabei. Sie stellte ihm (und sich) eine Frage: Glaubst du, dass mich die Person auf dem Boot im Stich gelassen hat? Für ihre Geschichte war The Big Silver der falsche Leser, aber alles in allem, dachte ich, wäre sie vielleicht die richtige Leserin für meine.
2Der Sturm
Windstille. Sonnenschein. Ich schwamm unter Wasser. Und als ich zwanzig Jahre später wieder auftauchte, stellte ich fest, dass ein Unwetter ausgebrochen war, ein brodelnder Aufruhr, und ein wütender Sturm peitschte Wellen über mir auf. Zuerst war ich nicht sicher, ob ich es noch zum Boot schaffen würde, dann wurde mir klar, dass ich es nicht zum Boot schaffen wollte. Chaos sei das, was wir am meisten fürchten, heißt es oft, aber ich glaube heute, insgeheim ist das Chaos unsere größte Sehnsucht. Wenn wir nicht mehr überzeugt sind von der Zukunft, die wir planen, nicht von dem Haus, für das wir uns verschuldet haben, nicht von dem Menschen, der neben uns schläft, dann kann es schon sein, dass uns ein Unwetter (das sich seit langem am Himmel zusammenbraut) der Person näher bringt, die wir in der Welt gern wären.
Das Leben bricht auseinander. Wir versuchen es in die Hand zu nehmen, versuchen es zusammenzuhalten. Bis uns irgendwann klar wird, dass wir es gar nicht zusammenhalten wollen.
Als ich um die fünfzig war und mein Leben eigentlich einen Gang hätte zurückschalten, stabiler und vorhersehbarer werden sollen, wurde alles schneller, instabiler, unvorhersehbarer. Mein Boot war meine Ehe, und ich war sicher, dass Zurückschwimmen Ertrinken bedeuten würde. Meine Ehe ist auch das Gespenst, das für immer durch mein Leben spuken wird. Meine Sehnsucht nach dauerhafter Liebe, die ihre Protagonisten nicht kleiner macht, als sie sind, wird mich mein Leben lang begleiten. Bestimmt war ich nicht oft Zeugin einer Liebe, die das alles zustande gebracht hätte – also ist mein Ideal womöglich ohnehin nur ein Phantom. Welche Fragen stellt mir das Phantom? Es sind jedenfalls politische Fragen, aber Politiker ist das Phantom nicht.
Auf einer Reise durch Brasilien sah ich einmal eine Raupe, die so dick wie mein Daumen war und sehr farbenfroh: Sie trug ein symmetrisches Muster aus blauen, roten und gelben Quadraten und sah aus wie ein Werk von Mondrian. Ich traute meinen Augen nicht. Noch seltsamer war, dass sie zwei Köpfe zu haben schien, einen vorn und einen hinten, beide knallrot. Ich musste sie immer wieder ansehen, um mich zu vergewissern, dass mein Eindruck wirklich stimmte. Vielleicht war mit meinem Kopf nicht alles in Ordnung, vielleicht hatte ich einen Sonnenstich, oder der rauchschwarze Tee, den ich morgens schlückchenweise trank, wenn ich den fußballspielenden Kindern auf dem Platz zusah, wirkte halluzinogen. Später erfuhr ich, dass der zweite, falsche Kopf der Raupe vermutlich zur Irreführung ihrer Fressfeinde diente. Ich selber konnte mich zu dieser Zeit nie entscheiden, wie herum ich schlafen wollte. Lag etwa das Kopfkissen so, dass ich nach Süden blickte, schlief ich erst in dieser Position, drehte später aber alles um und schlief mit dem Kopf nach Norden. Irgendwann legte ich mir zwei Kissen ins Bett, eines ans Kopfende, eines ans Fußende. Kann sein, dass dies die äußere Erscheinungsform von Zwiespalt, unklarem Denken, innerer Zerrissenheit war.
Wenn die Liebe Sprünge bekommt, dringt die Nacht ein. Und die dauert endlos. Sie ist voller zorniger Gedanken und Vorwürfe, und die quälenden Selbstgespräche verstummen auch nicht, wenn es hell wird. Das war für mich eigentlich das Schlimmste: dass meine Gedanken quasi beschlagnahmt waren und nur noch um IHN kreisten. Das war nichts weniger als eine Besitzergreifung. Mein privates Unglück wurde mir zum ständigen Begleiter – wie Beckett meinte, als er schrieb, Leid wachse sich zu etwas aus, »das man lebenslang erweitern kann … wie eine Briefmarken- oder Eiersammlung«.
Als ich nach London zurückkehrte, schenkte mir mein türkischer Zeitungshändler einen Schlüsselring mit einem Fellbommel. Ich wusste nichts damit anzufangen und hängte ihn an meine Handtasche. So ein Bommel hat etwas sehr Erhebendes. Einmal, als ich mit einem Kollegen im Hyde Park spazieren ging, hüpfte der Bommel leichtherzig auf und nieder, während wir durchs abgefallene Herbstlaub pflügten. Er war ein Freigeist, stürmisch vergnügt, halb Tier und halb etwas anderes. So viel fröhlicher als ich! Mein Kollege trug einen schmalen Ring, einen rautengemusterten Goldreif, in den ein winziger schläfriger Diamant eingebettet war. »Den Ehering hat meine Frau für mich ausgesucht«, sagte er. »Er ist viktorianisch, eigentlich nicht mein Stil, aber er erinnert mich immer an sie.« Und dann sagte er: »Meine Frau hat wieder einen Unfall gebaut.« Aha, dachte ich, während wir unter den goldenen Bäumen dahingingen, sie hat keinen Namen. Sie ist eine Gattin. Ich fragte mich, warum mein Kollege so oft die Namen der Frauen vergaß, die er auf Veranstaltungen traf. Eine Frau war für ihn immer jemandes Frau oder Freundin, als sei dies das Einzige, was ich wissen müsste.
Wer sind wir, wenn wir keinen Namen haben?
Ich weinte wie eine Frau, als klar war, dass meine Ehe am Ende war. Ich habe schon einen Mann wie eine Frau weinen sehen, aber habe ich je eine Frau wie einen Mann weinen sehen? Den Mann, der wie eine Frau weinte, sah ich auf einer Beerdigung, und es war kein Weinen im eigentlichen Sinn, sondern ein Wehklagen, Heulen, Schluchzen; er weinte sehr dicke Tränen. Seine Schultern zuckten, sein Gesicht war fleckig, er verbrauchte ein Papiertaschentuch nach dem anderen, um sich die Augen zu trocknen, und jedes löste sich alsbald auf. Von seinem Zwerchfell kamen seltsame Töne und Geräusche. Es war eine sehr ausdrucksvolle Trauer.
Ich hatte das Gefühl, dass er in dem Moment für uns alle mitweinte. Die anderen weinten mit mehr Zartgefühl für ihre Umgebung. Als ich mich später beim Leichenschmaus mit ihm unterhielt, sagte er, dieser Tod habe ihn erkennen lassen, dass sich in seinem eigenen Leben »die Liebe ins Gästebuch eingetragen hat, aber nie eingezogen ist«.
Was habe ihn nur daran gehindert, mutiger zu sein, fragte er. Währenddessen nippten wir an exzellentem irischem Whiskey, einer Lieblingsmarke des außergewöhnlichen Mannes, den wir begraben hatten. Ob er und der Verstorbene ein Liebespaar gewesen seien, wollte ich wissen. Ja, sagte er, phasenweise, über viele Jahre hinweg, aber das Risiko, sich rückhaltlos aufeinander einzulassen, seien sie nie eingegangen. Nie hätten sie sich zu ihrer Liebe bekannt. Weil er so aufrichtig war, konnte ich selber freier sprechen, als er mich fragte, weshalb meine Ehe Schiffbruch erlitten habe. Nachdem ich eine Weile geredet hatte, sagte er: »Ich glaube, du bist besser dran, wenn du ein anderes Leben anfängst.«
Ich stellte mir das Gespräch vor, das ich mit dem Vater meiner Kinder nie geführt hatte, wenn eines Tages die bei der Havarie des Boots über Bord geschleuderte und auf den Meeresgrund gesunkene Black Box gefunden würde, die es aufgezeichnet hatte. An einem verregneten Dienstag in ferner Zukunft würde die Black Box von künstlichen Lebewesen entdeckt, die sich ringsum zusammendrängten, um den traurigen, starken Stimmen schmerzerfüllter Menschen zu lauschen.
Das Beste, was ich je tat, war, nicht zurückzuschwimmen. Aber wo sollte ich hin?
3Netze
Wir verkauften das Haus. Ein langes gemeinsames Leben abzuwickeln und einzupacken war eine Aktion, die die Zeit fast unheimlich verzerrte; es riss mich zurück zum Abschied von Südafrika, dem Land meiner Geburt, aus dem wir fortgingen, als ich neun war, und es riss mich nach vorn in ein unbekanntes Leben, das mich jetzt, mit fünfzig, erwartete. Ich löste das Zuhause auf, für dessen Schaffung ich einen großen Teil meiner Lebensenergie aufgewendet hatte.
Wenn vom Märchen des schönen Heims, in dem Glück und Behagen von Mann und Kind immer vorgehen, die Tapeten abgerissen werden, kommt dahinter eine unbedankte, ungeliebte, vernachlässigte, erschöpfte Frau zum Vorschein. Um ein Heim zu schaffen, das allen wohltut und gut funktioniert, braucht es Geschick, Zeit, Hingabe und Einfühlungsvermögen. Vor allem zeugt es von kolossaler Selbstlosigkeit, Architektin des Wohls aller anderen zu sein. Diese Aufgabe gilt noch heute vorwiegend als Frauenarbeit, weshalb alle möglichen Wörter benutzt werden, um den Kraftakt kleinzureden. Wurde die Ehefrau und Mutter von der Gesellschaft geschwängert, spielt sie Ehefrau-und-Mutter für alle. Sie hat die Geschichte gebaut, die das alte Patriarchat für die heterosexuelle Kernfamilie entworfen hat, und dabei natürlich auch ein paar zeitgemäße eigene Dekostücke untergebracht. Wenn die Frau sich im schönen Heim nicht mehr daheim fühlt, beginnt die größere Geschichte von Gesellschaft und weiblicher Unzufriedenheit. Solange die Frau von der Gesellschaftsgeschichte, die sie mit Hoffnung, Stolz, Glück, Ambivalenz und Zorn inszeniert hat, nicht zu tief in die Knie gezwungen ist, wird sie die Geschichte verändern.
Das Heim einer Familie aufzulösen ist, als zerlegte man eine Uhr. So viel Zeit haben die verschiedenen Dimensionen dieses Zuhauses durchlaufen! Angeblich kann ein Fuchs aus vierzig Metern Entfernung das Ticken einer Uhr hören. In unserem Zuhause hing in der Küche eine Wanduhr, die keine vierzig Meter vom Garten entfernt war – ihr Ticken müssen die Füchse mehr als zehn Jahre lang gehört haben. Jetzt war sie eingepackt, mit dem Gesicht nach unten in einer Kiste.
Als die Türen des Umzugswagens zugeschlagen wurden und der Fahrer den Motor anließ, sah mich meine freundliche Nachbarin im Garten stehen und fragte, ob ich mich bei ihr ein bisschen ausruhen wolle. Eine Stunde lag ich auf ihrem Sofa, und als ich gehen wollte, fragte sie: »Was ist das eigentlich?« Sie zeigte auf die zwei Kescher aus den Kindheitstagen meiner Töchter. Ich hatte sie nicht eingepackt; der eine war gelb, der andere blau, beide noch sandverkrustet. Mit diesen Netzen hatten sie, wenn wir am Meer Ferien machten, kleine Fischchen geangelt, waren kniehoch ins Wasser gewatet und hatten auf Ungeheuerliches gewartet, das ihres Weges käme. Jetzt lehnten die Kescher, an anderthalb Meter langen Stangen hängend, verträumt am viktorianischen Erkerfenster meiner Nachbarin.
Ihr Vater und ich waren uns einig, dass wir getrennt leben, aber am Leben unserer Kinder immer gemeinsam teilhaben würden. Es gibt nur liebevolle und lieblose Elternhäuser. Zu Bruch ging die patriarchale Geschichte. Dennoch werden die meisten Kinder, die in ihr aufgewachsen sind, ihrerseits unbedingt eine Neuauflage der Geschichte schreiben wollen, wie alle.
4Leben in Gelb
Ich reiste umher und identifizierte mich Abend für Abend mit dem reizvollen Gedanken einer allgemeinen Destrukturation und, zugleich, eines Neuaufbaus.
Elena Ferrante, Die Geschichte des verlorenen Kindes (2018)
Im November jenes Jahres zog ich mit meinen Töchtern in eine Wohnung im sechsten Stock eines riesigen heruntergekommenen Wohnblocks auf einem Hügel in Nordlondon. Angeblich war hier eine umfassende Instandsetzung vorgesehen, doch wann sie beginnen sollte, stand in den Sternen. Noch drei Jahre nach unserem Einzug waren die Böden der Gemeinschaftsflure graues Industrieplastik. Die Unmöglichkeit, ein riesiges altes Gebäude zu sanieren und zu renovieren, schien mir auf trübsinnige Weise passend für diese Zeit der Auflösung und des Zerfalls. Der Prozess der Instandsetzung, die Wiederherstellung und Reparatur von etwas, in diesem Fall eines an allen Ecken und Enden bröckelnden Art-déco-Gebäudes, war die falsche Metapher für diese Phase meines Lebens.
Ich wollte die Vergangenheit nicht wiederherstellen. Was ich brauchte, war ein vollständiger Neuaufbau.
Es war ein bitterer Winter. Die zentrale Heizanlage war zusammengebrochen. Es gab im ganzen Haus keine Heizung, kein warmes Wasser, manchmal auch kein kaltes. Ich hatte drei Halogenstrahler in Betrieb und unter dem Spülbecken einen Notvorrat von zwölf großen Flaschen Mineralwasser. Wenn das Wasser versiegte, gab es auch keine Toilettenspülung. Ein namenloser Hausbewohner hatte einen Zettel an die Aufzugtür geklebt. HILFE. Bitte! In den Wohnungen ist es unerträglich kalt, könnte bitte jemand etwasTUN?