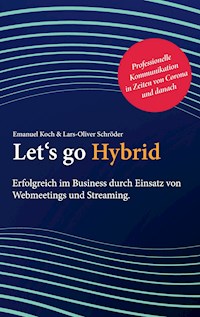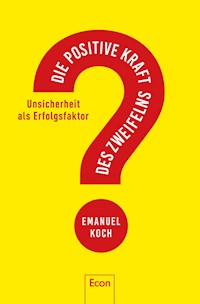
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die positive Kraft des Zweifelns wird unterschätzt. In der richtigen Dosis und an der richtigen Stelle eingesetzt kann sie uns Fehlentscheidungen ersparen und Möglichkeiten eröffnen, die wir zuvor nicht gesehen haben – in der Lebensplanung, in der Karriere, in unseren Beziehungen. Wer nicht zweifelt, hat nicht nachgedacht, nicht geprüft und nicht abgewogen. Wenn wir dem Zweifel keinen Raum geben, überlassen wir den Überheblichen und Leichtgläubigen das Feld. Erfolg mit Zweifeln ist nachhaltig, weil Risiken und Stolperfallen von vornherein mitbedacht worden sind. Zweifel stören also nicht, sondern helfen uns den richtigen Weg zu finden und nachhaltig erfolgreich zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die positive Kraft des Zweifelns
Der Autor
EMANUEL KOCH (*1970) ist studierter Informatiker und weiß: Computer zweifeln nicht – Menschen schon. Der Business-Speaker, Musiker und Unternehmensberater hilft Menschen und Organisationen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Die Wechselwirkung zwischen Emotion und Logik ist sein Schwerpunktthema. Seine wichtigste Lektion in diesem Spannungsfeld hat er auf die harte Tour gelernt: Man kann auch zu wenig zweifeln.
Das Buch
Die positive Kraft des Zweifelns wird massiv unterschätzt. Dabei stecken hinter den größten Erfolgen häufig mehr Zweifel als geniale Geistesblitze: Viele herausragende Persönlichkeiten unserer Zeit zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie immer wieder alles in Frage stellen und sich hartnäckig bis zum Durchbruch zweifeln. Das „Team Zweifel“ ist also alles andere als erfolglos. Ihren schlechten Ruf verdanken Zweifel der Tatsache, dass auch die erfolgreichsten Zweifler kaum über sie sprechen. Denn Zweifler werden schnell als Nörgler und Neinsager abgestempelt. Selbst gesunde Selbstzweifel gelten im digitalen Zeitalter als Loser-DNA: Zwischen 0 und 1 ist kein Raum für Unsicherheit und Zweifel. Von wegen, sagt der „bekennende Zweifler“ und Informatiker Emanuel Koch: Die Fähigkeit zu zweifeln ist unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Computern. Das macht das Zweifeln zu einer wichtigen Zukunftskompetenz, denn es bringt Kreativität und Innovation erst auf die Straße. Der konstruktive Umgang mit Unsicherheit birgt ein enormes Potenzial: In der richtigen Dosis und an der richtigen Stelle eingesetzt, kann das Zweifeln uns Fehlentscheidungen ersparen und neue Möglichkeiten eröffnen – in der Lebensplanung, im Job, in unseren Beziehungen. In diesem Buch zeigt Emanuel Koch, warum wir lernen sollten, Unsicherheit auszuhalten, und wie wir nachhaltig erfolgreich werden: mit den Zweifeln.
Emanuel Koch
Die positive Kraft des Zweifelns
Unsicherheit als Erfolgsfaktor
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
ISBN 978-3-8437-2030-4
Econ ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbH© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Umschlaggestaltung: total italic, Thierry WijnbergAutorenfoto: © Christian HesselmannE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Inhalt
Vorwort
1. Keiner will es, jeder tut es
2. Risikofaktor Überzeugung
3.Der gefährliche Wunsch nach Sicherheit
4.Tabaluga und seine Väter
5.Die Unsicherheit umarmen
6. Spiegel oder Zerrspiegel?
7. Zweifelsfreie Räume
8. Die Kunst, nicht gesehen zu werden
9. Sicherheit geben, Unsicherheit zulassen
10. Kick-off
Danksagung
Anhang
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Inhalt
Vorwort 9
Das Problem mit der Welt
1. Keiner will es, jeder tut es 13
Die unsichtbare Kraft
2. Risikofaktor Überzeugung 37
Warum wir die falschen Dinge anzweifeln
3. Der gefährliche Wunsch nach Sicherheit 67
Die emotionale Seite des Zweifelns
4. Tabaluga und seine Väter 88
Wie Zweifel kleine grüne Drachen erschaffen
5. Die Unsicherheit umarmen 112
Mit Zweifeln zu mehr Veränderungs-Kompetenz
6. Spiegel oder Zerrspiegel? 137
Die ambivalente Kraft der Selbstzweifel
7. Zweifelsfreie Räume 161
Woran wir heute noch glauben können
8. Die Kunst, nicht gesehen zu werden 184
Zweifeln im Team
9. Sicherheit geben, Unsicherheit zulassen 207
Zweifeln für Entscheider
10. Kick-off 224
Erfolgreich zweifeln
Danksagung 249
Quellen und Videos, die in diesem Buch verwendet werden, sowie weiteren Content zum Thema Zweifeln finden Sie auf der Webseite zum Buch:
www.erfolgreich-zweifeln.de
Vorwort
Das Problem mit der Welt
»Das Problem mit der Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel und die Dummen so voller Selbstvertrauen sind.«
Charles Bukowski
Die Ledersitzfläche des Klavierhockers ist von den unzähligen Klavierschülerhintern längst glattgesessen. Schließlich bin ich nicht das einzige Kind, das hier Woche für Woche sitzt, um das Klavierspielen zu lernen. Mittwochnachmittags bin ich dran, seit dreieinhalb Jahren. Inzwischen bin ich 13, neben Frau F. gefühlt aber immer noch höchstens zehn.
Mit freundlichem, aber reserviertem Gesichtsausdruck sitzt sie links neben mir und beobachtet. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie ihre Augen zwischen den Notenblättern und meinem Gesicht hin- und herwandern. Stur starre ich auf die aufgeschlagene Seite und spiele das Stück, das ich in der zurückliegenden Woche üben sollte. Eine recht einfache Klaviersonate von Mozart. Ich habe sie mir selbst ausgesucht, nachdem ich sie in der Schallplattensammlung meines Großvaters gefunden und immer wieder angehört hatte.
Meine Finger laufen leichthändig über die Tasten. Heute läuft es, denke ich bei mir. Der kleine Schweißausbruch, den ich eigentlich jeden Mittwoch bekomme, bevor ich zu spielen beginne, beruhigt sich. Zaghaft breitet sich ein wohliges Gefühl in meiner Brust aus – kann das womöglich Stolz sein? Ich spiele das Stück fast fehlerfrei durch. Als ich fertig bin, drehe ich mich erwartungsvoll nach links.
Der enttäuschte Blick von Frau F. trifft mich wie ein Faustschlag. »Emanuel, du hast vergessen, die Seite umzublättern. Und was heißt das? Das heißt, du hast frei gespielt, aus dem Gedächtnis. Du sollst aber vom Blatt spielen.«
Ich spüre, wie mein Gesicht zu glühen beginnt, und fühle mich wie der lausige Betrüger, den Frau F. jetzt wahrscheinlich in mir sieht.
»Jetzt gehen wir alles nochmal von vorn durch, und dieses Mal spielst du richtig, also nach Noten. Okay?«
Ich nicke und starre auf die Seiten vor mir, während ich im zweiten Durchgang – vom Blatt gespielt – einen falschen Ton nach dem anderen produziere. Sekunden später ist mein T‑Shirt dann doch nass. Ich stelle mir vor, wie ich aus dem Musikzimmer der Frau F. stürme und die Noten auf meiner Flucht in den stinkenden Müllcontainer neben ihrem Haus quetsche.
Wenn ich damals gewusst hätte, dass meine Fähigkeit, ein Musikstück nach ein paarmal Hören ohne Noten zu spielen, eine besondere Gabe ist, um die mich später viele beneiden würden, wäre meine Entwicklung als Musiker anders verlaufen. Ich hätte schon zwanzig Jahre früher einen stabilen Musikerselbstwert entfalten und voller Stolz bereits damals meine selbstkomponierten Songs und Arrangements vorzeigen können. Ich hätte mir eine Menge destruktiver Selbstzweifel erspart.
Stattdessen hätte ich produktiv zweifeln können. An Dingen, an denen zu zweifeln sich lohnt, anstatt an mir selbst.
So hätte ich etwa die Notwendigkeit anzweifeln können, dass das Erlernen des Klavierspiels zwangsläufig mit der Kompetenz verknüpft sein muss, Noten lesen zu können. Ich hätte das musikdidaktische Vorgehen meiner Lehrerin anzweifeln können. Ich hätte daran zweifeln können, mein Weg in die Welt der Musik müsse überhaupt über diese wöchentlichen Stunden führen.
Doch für diese Zweifel war kein Raum in meiner musikalischen Früherziehung. Mein Großvater war Berufsmusiker und blätterte als Bratscher im Osnabrücker Symphonieorchester jeden Abend die Seiten auf dem Notenständer um. Seine Schüler unterrichtete er ebenfalls klassisch, und das bedeutete eben: Es wird nach Noten gespielt.
Zweifel? Nicht vorgesehen.
Ich musste in der Musik und darüber hinaus noch viele weitere Erfahrungen mit vermeintlich alternativlosen Wahrheiten machen, bevor die Ahnung in mir wuchs: Statt sich das Zweifeln verbieten zu lassen, könnte man auch mal anfangen, an denen zu zweifeln, die das Zweifeln verbieten wollen.
Aus heutiger Sicht bin ich dankbar für das, was ich aus der jahrelangen Quälerei von damals gelernt habe: Ich weiß heute um das riesige Potenzial des Zweifelns. Es lohnt sich, gerade die Dinge anzuzweifeln, die selbstverständlich erscheinen. Gerade die scheinbar zweifelsfreien Räume sind oft die mit dem größten Innovationspotenzial.
Der Status quo des »Musiklernen nach Noten« steht für all die »Das machen wir schon immer so«-Abläufe in unserem Alltag, in unserer persönlichen Entwicklung und in der Wirtschaft. Und meine Quälerei als Musikschüler steht für das Unbehagen all der intelligenten Menschen, die ihre Zweifel für sich behalten, weil sie keinen Raum finden, um diese zu artikulieren.
Zu oft scheitern wir nicht an, sondern mit unseren berechtigten Zweifeln, weil die Beharrungskräfte der Bestandswahrer in unserem Umfeld zu stark sind. Zweifel haben in unserer Gesellschaft keine Lobby. Und das möchte ich ändern. Denn solange wir Zweifel ignorieren, kleinreden und abbügeln, lassen wir ein riesiges Potenzial einfach am Wegesrand liegen: Die positive Kraft des Zweifelns.
Dieses Buch öffnet den Raum für produktives Zweifeln, damit überall in unserer Gesellschaft intelligente Menschen mit ihren Zweifeln gehört werden, um deren ungeheures Potenzial auszuschöpfen. Damit nicht nur Kinder wie meine eigenen drei Sprösslinge ihre Begabungen anders als ich früher ungehindert verfolgen und zu den Innovatoren von morgen werden können.
Lassen Sie uns den Gedanken von Bukowski weiterspinnen: Die Zweifler von heute sind diejenigen, die die Probleme der Welt morgen lösen werden. Also nehmen Sie Ihre Zweifel ernst. Ergründen Sie sie. Halten Sie die Unsicherheit aus, die damit einhergeht. Und entdecken Sie im Raum der Unsicherheit eine ganz neue Stufe der Innovationen.
Emanuel Koch, Oktober 2018
1. Keiner will es, jeder tut es
Die unsichtbare Kraft
Zweifel: Der ungebetene Gast
Dieses Buch hätte es fast nie gegeben. Warum? Weil Zweifel im Spiel waren. Aber Sie halten das Buch ja in Ihren Händen. Warum? Weil Zweifel im Spiel waren.
Fast alle Menschen kennen Zweifel. Und für gewöhnlich sind sie extrem unbeliebt. Die Zweifel, wohlgemerkt – nicht die zweifelnden Menschen. Zweifel sind unbequem, sie verstören, sie bringen den festen Plan und die klaren Ziele durcheinander. Denn häufig führen sie zu massiven Gefühlsverwirrungen oder dazu, dass Vorhaben nicht umgesetzt werden.
Da ist zum Beispiel die junge, dynamische, motivierte und super ausgebildete Marketing-Expertin aus meinem Bekanntenkreis. Sie hat vor jeder Präsentation vor den Kollegen in ihrem Unternehmen einen Heidenrespekt, weil sie denkt: »Meine Ideen sind nicht gut genug. Bestimmt habe ich irgendetwas nicht bedacht.« Sie ist notorisch davon überzeugt, dass ihre Ideen keinen Pfifferling wert sind. Dass die anderen immer besser und sowieso fähiger sind, und dass jeder bessere Marketing-Ideen hat als sie, die Marketing-Fachfrau. Eine Art zu zweifeln.
Oder nehmen wir den Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit seinen fast 100 Angestellten, den ich im Rahmen eines Projekts gut kennengelernt habe – mitsamt seinen Zweifeln. Soll er die zwei Millionen Euro in die Entwicklung des neuen Produkts investieren? Ist das die wichtige Weichenstellung für die Zukunft oder doch ein zu unsicheres Wagnis? Eine andere Art zu zweifeln.
Und nebenan ist dieses verliebte Paar. Seit drei Jahren wohnen sie jetzt zusammen. Er thematisiert immer wieder seinen großen Kinderwunsch. Sie fühlt sich noch so gar nicht richtig wohl damit. Diese große Verantwortung. Wieder eine andere Art zu zweifeln.
Wir urteilen auch gern über Menschen, die von außen betrachtet irgendwie blockiert wirken: »Weißte, der Thomas, das ist so’n Zweifler. Der müsste endlich mal Gas geben und machen. Gute Ideen hat er ja, aber er steht sich selbst im Weg!«
Thomas, der alte Zweifler. Soll sich endlich mal zusammenreißen, kriegen alle anderen doch auch hin!
Kriegen sie? Kriegen sie wirklich?
In Wahrheit ist Thomas in bester Gesellschaft – und damit meine ich nicht die Gesellschaft der Gescheiterten. Das Team Zweifel ist alles andere als erfolglos. Viele erfolgreiche Menschen haben in Interviews öffentlich immer wieder bestätigt, dass sie zweifeln. Und manche haben bestätigt, dass die Zweifel eine Menge mit ihrem Erfolg zu tun haben.
Als stolzer Besitzer der großen Loriot-DVD-Collection stolperte ich kürzlich über ein Interview im Bonus-Material. Loriot war einer der ganz großen Komiker in Deutschland. Das Multitalent hat als Autor, Illustrator, Regisseur und Schauspieler deutsche Geschichte geschrieben und die Unterhaltungskultur entscheidend mitgeprägt. Bereitwillig gibt der legendäre Vicco von Bülow zu: »Ich habe mein Leben lang gezweifelt – aber das gehört wohl dazu.« Er reiht sich damit ein in eine lange Liste von Prominenten, Künstlern, Politikern, Führungspersönlichkeiten. Auch Menschen, von denen man vielleicht nicht auf den ersten Blick erwarten würde, dass sie zweifeln.
Papst Franziskus hat Zweifel als Teil des Lebens und des Glaubens zum Standard erklärt: »Wer von uns hätte nicht Unsicherheit, Verlust und Zweifel auf seinem Glaubensweg erfahren? Jeder! Wir alle haben dies erfahren, ich auch. Sie sind Teil unserer Reise im Glauben, Teil unseres Lebens. Zweifel sollten uns nicht überraschen, weil wir menschliche Wesen sind, zerbrechlich und begrenzt. Wir alle sind schwach, wir alle haben Grenzen: Keine Angst! Wir alle haben Zweifel.«
Der König der Zweifler
Ich selbst empfinde mich des Öfteren als den »König der Zweifler«. So etwa, wenn ich Musik komponiere, wenn ich arbeite, als Vater im Umgang mit meinen Kindern oder wenn ich ein Buch schreibe. Also nicht immer und auch nicht immer öfter, aber immer wieder.
Deshalb kenne ich diesen Wunsch aller Zweifler, den Sie insgeheim vielleicht auch schon mal verspürt haben: Wie einfach wäre die Welt, wenn ich nicht zweifeln würde! Wenn ich einfach immer drauflos marschieren und alles durchziehen würde. Aber so bin ich nun mal nicht.
»Ich zweifle, denn so bin ich«: Ich musste erst lernen, das mit völliger Überzeugung aussprechen zu können. Denn noch vor einigen Jahren habe auch ich Zweifler manchmal als schwach empfunden und häufig als nervig. Das sind Leute, die nicht in die Umsetzung kommen, dachte ich. Die alles und jeden anzweifeln, Bedenken haben, keine Veränderungen vertragen – Neinsager eben. Die Festhalter und Bewahrer, die Ewiggestrigen, die Heulbojen. Zu meiner Schande möchte ich hiermit gestehen: In einigen Fällen habe ich Kollegen sogar damit aufzogen, dass sie »mal wieder nicht aus dem Quark kommen«.
Dabei übersah ich, dass ich selbst im tiefsten Inneren ein Zweifler war. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Man will nicht dazugehören, zum Club der Zweifler. Denn Zweifel haben in unserer leistungsorientierten Gesellschaft keine gute Lobby.
Weil ich selbst mal ein anonymer Zweifler war, kann ich heute rückblickend sagen: Mag sein, dass manches in meinem Leben damals einfacher war, als ich die Zweifel noch nicht zuließ. Besser war es nicht.
Die Abwertung von Zweifeln kam biografisch betrachtet natürlich nicht von ungefähr. Schon als Kind habe ich meine eigenen Zweifel fürchten gelernt. Es gab nämlich einen Bereich meines Lebens, in dem ich voller Zweifel und allein damit war: die Musik.
Biografie eines Zweiflers
Ich habe im Vorwort bereits die Geschichte von meinem Klavierunterricht erzählt. Ich habe im Alter von zehn Jahren damit begonnen und war ein recht schlechter Schüler. Meine Klavierlehrerin lehrte, wie bereits erwähnt, die klassische Schule, bei der nach Noten gespielt wird. Ich hatte dazu überhaupt keinen Zugang und musste mir aufgetragene Stücke sehr mühevoll erschließen. Note für Note. Es war eine Quälerei für mich – bis ich ein Gefühl für das Stück bekam und es komplett auswendig spielen konnte.
Das war meine Lösungsstrategie. Sie funktionierte, für mich, und für jeden neutralen Zuhörer natürlich ebenso. Nur für die Vertreterin der klassischen Schule eben nicht. Ich schämte mich, weil ich selbst einfachste Melodien nicht vom Blatt abspielen konnte. Das kann ich übrigens bis heute nicht. Aber seinerzeit habe ich zutiefst an mir als Pianist gezweifelt. Bis wir dann den Unterricht in beidseitigem Einverständnis beendeten.
Noch am gleichen Tag fing ich an, wie ein Wilder zu üben und auf meine Weise Klavier zu spielen: nach Gehör, auf Basis von Akkorden und mit reichlich Improvisation. Mit Freude fing ich an, gemeinsam mit anderen zu musizieren, die es ebenso hielten und auch ihre Zweifel am Sinn und Unsinn der klassischen Methode hatten.
Dennoch waren die Wunden tief. Schon als Jugendlicher habe ich Songs geschrieben, jedoch nie veröffentlicht. Ich hatte tiefsitzende Zweifel, dass sie nicht gut genug seien und traute mich nicht, sie zu präsentieren. Ich habe wirklich viele Jahre gebraucht, einen guten Umgang mit mir selbst als Komponist und Musiker zu finden und meine Prägungen aus der Kindheit zu überwinden. Den Durchbruch brachte die Erkenntnis, dass meine Fähigkeit, nach Gehör zu spielen, einen Wert hat – auch wenn die klassische Schule es anders macht.
Als Heranwachsender fand ich den zweifelnden Teil meines Egos dann zutiefst verabscheuenswert und schwach. Als Teenager, zumal männlicher, will man schließlich zu den coolen Jungs gehören – den verwegenen Draufgängern. Natürlich spürte ich den Zweifel – aber ich wollte das um keinen Preis wahrhaben. Wer will das schon? Die Welt, das beginnen wir in diesem Alter zu verstehen, gehört doch den Machern, den Willensstarken, den Umsetzern, oder etwa nicht? Wer braucht da Zweifler?
So dachte ich – noch weit, sehr weit ins Erwachsenenleben hinein. Gefühlt bis vorgestern. Was ich bei anderen belächelte, waren im Prinzip meine eigenen, ungeliebten Seiten.
Meine Sicht auf Zweifel als Heranwachsender und unreifer Erwachsener scheint eine recht repräsentative Sicht auf das Zweifeln im Business und in vielen anderen Lebensbereichen zu sein. Sie begegnet mir nämlich ständig – Achtung, Floskel-Alarm:
»Wer zweifelt, ist hier fehl am Platz!«
»Unternehmer kommt von unternehmen, nicht von unterlassen!«
»Im Zweifel nicht zweifeln, sondern machen!«
Die negative Art und Weise, wie Menschen das Wort Zweifel benutzen, lässt den Verdacht aufkommen, dass Zweifel unsere großen Gegenspieler sind. Vor allem sind sie mit allerlei Emotionen verbunden, mit denen wir uns unwohl fühlen. Sie sind wie unliebsame Besucher im eigenen Haus. Oft kennen wir sie gar nicht richtig und haben uns noch gar nicht mit ihnen beschäftigt. Eines scheint erst einmal klar: Diese Art von Gästen schränkt unseren persönlichen Raum ein. Wir kennen sie gut, würden sie aber am liebsten schnell wieder loswerden. Zweifel rausschmeißen, dann lebt es sich in Ruhe weiter.
Eine schöne Vorstellung. Aber so funktioniert weder die moderne Welt noch das Leben.
Wenn wir diese Gäste mit Namen »Zweifel« etwas besser kennenlernen würden: Könnten wir dann vielleicht auch ihre positiven Seiten sehen?
Mit dieser Überlegung begann meine Reise durch das Land der Zweifel. Es ist ein weites Land – denn Zweifel sind überall.
Alle erfolgreichen Redner sind rot
Ich stehe in netter Gesellschaft im Café Moskau in der Karl-Marx-Allee in Berlin. Ein langer Veranstaltungstag zu Beginn meiner Redner-Karriere neigt sich dem Ende zu. Im Kreis von mehreren Rednerkolleginnen und Kollegen, die an diesem Tag Vorträge und Workshops gehalten haben, plaudern wir über unsere Eindrücke. Und obwohl das nun schon Jahre her ist, erinnere ich mich noch sehr gut an die Szene, die daraus wurde.
Ein mir unbekannter junger Mann kommt auf unsere Gruppe zu. Offensichtlich kennt er einige meiner Kolleginnen. Ungefragt und offen gesagt eher unpassend beginnt er praktisch ansatzlos einen Monolog im Welterklärer-Modus und legt uns allen dar, wie man als Redner erfolgreich wird. Was, sagen wir mal, gewagt ist in einer Gruppe professioneller Redner, die man noch nicht mal kennt. Ich klinke mich dankbar aus seinem Spontanvortrag aus, da ich zum einen Feierabend habe, zum anderen ein toller Kollege mir eine nette Anekdote zu seinem letzten Jonglier-Auftritt erzählt. Erst ein Sprachfetzen, den ich trotz meiner Bemühungen nicht ignorieren kann, lässt mich wieder hinhören: »Schaut euch das doch mal an. Alle erfolgreichen Redner sind rot!«
Ich bin etwas irritiert und überlege, was er wohl meinen könnte. Vielleicht meint er es politisch – aber dann stimmt seine Schlussfolgerung garantiert nicht. Vielleicht meint er es im Sinne von Bluthochdruck – schon weniger abwegig. Vor allem wenn ich mir anschaue, wie energisch dieser junge Mann gerade vor seinen Redner-Kollegen referiert.
Dann dämmert es mir. Er meint das DISG-Modell, bei dem man versucht, Menschen in bestimmte Typisierungen einzusortieren, um sich besser auf sie einzustellen. Diesen Typen (Dominanz, Initiative, Stetigkeit und Gewissenhaftigkeit) weist man bei DISG entsprechende Farben zu – blau, gelb, grün oder eben rot. Als die Diskussion stattfindet, ist das Modell gerade der letzte Schrei, oder mindestens der vorletzte. Ich höre weiter zu.
»Das ist Fakt!«, freut der selbsternannte Referent sich gerade. »Ein roter Händedruck ist kurz, bestimmt und fest. Ausladende Körpersprache, souveräne Selbstinszenierung, erkennbare Markenkleidung …« Und dann stützt er seine Erkenntnisse mit Beispielen von Redner-Kollegen, die zugegeben sowohl in dieses Raster passen, als auch sehr erfolgreich in ihrem Job sind. Ich merke, wie seine Stimme in meinem Kopf wieder schwindet, im Hintergrund aber weiterläuft und ich ins Kopfkino abgleite.
Alle erfolgreichen Redner sind also rot. Ich komme aus dieser roten Business-Welt. Vor meiner Zeit als Redner habe ich mich dort viele Jahre lang zielsicher bewegt. Aber der Abschied aus der Corporate-Welt war ein bewusster, nicht zuletzt genau deshalb. Heute, als Redner, fokussiere ich mich stärker auf die weichen Themen – eben weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Erfolg ausbleibt, wenn man nur auf die harte Logik schaut und den menschlichen Faktor außen vor lässt.
Ich ertappe mich bei den folgenden zwei Gedanken:
Erstens: Ich muss mich unbedingt mal mit diesem DISG-Modell beschäftigen.
Zweitens: Mist, ich bin als Redner doch auf einem falschen Weg.
Zum zweiten Gedanken muss ich ergänzen, dass ich sehr lange mit mir gehadert habe, mich auf die sogenannten »weichen Themen« zu spezialisieren und trotz meiner negativen Prägungen aus meiner Jugend sogar Klavier auf der Bühne zu spielen und meine Vorträge mit emotionalen Songs zu ergänzen. In einem Business-Vortrag! Ich habe sehr lange gezweifelt, ob das funktionieren kann. Und genau in der Aufbauphase meiner Redner-Karriere bekomme ich nun die Bestätigung, dass das doch nicht der richtige Weg ist – denn als Redner müsse man rot sein. Na toll!
Ich sehe mich um. Einige Kollegen stehen mit großen Augen vor dem Welterklärer, manche lassen sogar die Schultern hängen: Offensichtlich bin ich nicht der einzige, der sich gerade unwohl fühlt.
Die Szene nimmt jedoch eine jähe Wendung, als sich meine Lieblings-Kollegin zu Wort meldet: »Aber das stimmt doch gar nicht. So pauschal ist das nicht richtig, was du sagst.« Sie zitiert ein paar andere Redner, die definitiv in einem anderen Farbspektrum unterwegs sind als dem roten – aber ebenfalls erfolgreich. »Sogar Frauen dabei«, ergänzt sie mit einem Lächeln.
Das ist der Moment, als mein Kopf wieder anspringt. Ich fange ebenfalls an zu reflektieren und den zugegebenermaßen eloquenten Sprecher nicht mehr unreflektiert als Meinungsinstanz zu akzeptieren, also: zu zweifeln.
Zweifel? Du doch nicht!
Heute weiß ich nicht nur, dass die Farbgebung des DISG-Modells nicht immer einheitlich benutzt wird und unterschiedliche Definitionen existieren. Ich weiß inzwischen auch, dass DISG auf der einen Seite hilfreich ist und als gute Leitlinie für manche Persönlichkeitsfragen dient, auf der anderen Seite aber auch eine Menge Kritiker hat. Ich weiß ebenso, dass viele Menschen nicht klar einer Farbe zuzuordnen sind, sondern eine Mischform von Persönlichkeitsmerkmalen haben.
Vor allem aber weiß ich ein paar Jahre nach diesem Erlebnis, dass ich mit meinem Ansatz, mit meinen Themen als Redner und mit meiner Art, die Dinge zu tun, einen Markt habe und damit erfolgreich bin. Vielleicht sogar, weil ich eben nicht »rot« bin. Die Erfahrung hat in diesem Fall also nicht der steilen These recht gegeben, sondern den Zweifeln.
Interessant ist es nun, diese Situation in Berlin kurz zu reflektieren. Aus welchen Gründen auch immer habe ich die Behauptungen des Kollegen erst einmal für bare Münze genommen. Rational gab es genug anzuzweifeln, aber ich bin kurzzeitig meinen Selbstzweifeln verfallen: »Ist das so richtig, wie ich das mache? Kann ich damit unter diesen Umständen überhaupt erfolgreich sein?«
Bis ich angefangen habe, das Gesagte, die Instanz anzuzweifeln. Dieses Anzweifeln hat mir geholfen, zu differenzieren und mich damit abzugrenzen. Ich habe die These mit dem »Redner sind rot« noch einmal analytisch geprüft. Schließlich bin ich, wie die Kollegin, zu dem Schluss gekommen: Sie stimmt nicht.
Abgesehen vom Endergebnis war dieses Erlebnis aber auch der Ausgangspunkt für viele weitere Überlegungen. Denn es hat dazu geführt, dass ich meine Positionierung und mein Geschäftsmodell noch einmal gründlich durchleuchtete und schärfte. Ich habe meine Pianovorträge ausgiebig und an unterschiedlichem Publikum getestet und gezielt daran gezweifelt, dass die Songs bereits »fertig« waren. Dadurch habe ich weiter an ihnen gearbeitet. Ich habe Feedbacks von Zuhörern, Mentoren und Kollegen bekommen und dazu genutzt, an meinem Programm zu feilen und meine Vorträge kontinuierlich zu verbessern. Sogar meine Verkaufspräsentation und meine Marketing-Texte konnte ich durch diese Zweifel-Schleife noch einmal deutlich schärfen.
Und wenn ich genau darüber nachdenke, dann war diese Situation in Berlin der Anstoß für vieles, was letztendlich sehr wichtig für meine Rednerkarriere war. Aus einem Moment des Zweifelns heraus habe ich mein Vorgehen noch einmal gründlich hinterfragt – und definitiv davon profitiert. Seit ich in Berlin einen Abend lang rot sah, führen Zweifel nicht mehr dazu, dass ich schwarzsehe – sondern klarer.
Ich für meinen Teil musste also erst einmal entdecken: Zweifel können recht nützlich sein. Während der Recherchen für dieses Buch habe ich mit vielen Menschen über das Zweifeln gesprochen. Meine Auftaktfrage war dabei stets: »Du sag mal, zweifelst du?« Hier ein Auszug der meistgenannten Antworten:
»Ich habe das Zweifeln erfunden.«
»Ich zweifle immer.«
»Zweifeln ist mein zweiter Vorname.«
»Nur wenn es sein muss.«
»An allem, außer an mir selbst.«
»Was bleibt mir denn anderes übrig?«
»Zweifel? Steht auf meinem Papierkorb.«
Die Meinungen über das Zweifeln gehen also durchaus auseinander. Und ob die Menschen zu ihren Zweifeln stehen, ist wieder eine andere Frage. Eines wurde mir sehr schnell klar: Die Menschen, die am meisten zweifeln, tun sich oft am schwersten damit, es zuzugeben – ganz besonders, wenn es sich um Männer handelt.
Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Eine Antwort war verblüffend anders.
Die Fahrt mit Stöbi
Ich habe einen guten Freund, mit dem ich viel Musik mache. Wir spielen in verschiedenen Bands zusammen, und ich schätze ihn sehr als Musiker. Er ist ein toller Sänger und spielt souverän Akustikgitarre. Neben der persönlichen Ebene haben wir somit auch einen guten musikalischen Draht zueinander. Bei Konzerten produziert er mit seiner rauchigen Stimme »Gänsehaut am Fließband«. Nach jedem Konzert steckt er in einem Pulk von Verehrerinnen fest, die in seine Stimme und damit vermeintlich in ihn verliebt sind.
So weit, so gut. Bis wir uns danach im Backstage-Bereich treffen.
Besonders direkt nach Auftritten wird Stöbi nämlich fast aggressiv, wenn man nach einem Auftritt zufrieden ist – mit ihm oder mit der Leistung im Großen und Ganzen. Schnell bekommt man eine umfangreiche Analyse, was alles besser laufen müsste – und das mitten in die Euphorie nach einem Auftritt hinein.
Zugegeben, ich bin auch kritisch. Vor allem mit mir selbst. Nach Konzerten verschreibe ich mir allerdings einen Zweifel-Stopp. Dann bin ich voll Adrenalin, möchte mich einfach freuen und kann Kritiker und Nörgler nicht ertragen. Meine Standard-Antwort ist dann: »Gute Anmerkungen – gern ab morgen wieder.«
Stöbi hingegen beißt sich wie ein Dackel in den Waden fest und macht allen anderen klar, dass sich im Prinzip nur Idioten jetzt freuen können, denn es gibt noch so viel zu tun, bis es mal wirklich gut wird!
Bei Stöbi ist diese aggressive Selbstkritik nicht auf die Musik beschränkt. Beim Tennis oder Golf mit ihm ist es genauso: Wenn Stöbi zweifelt, dann wird es anstrengend für die anderen.
All das wusste ich schon lange. Doch bei einer Autofahrt mit Stöbi gelang es ihm nicht nur, mir seinen Hang zum Zweifeln zu erklären, sondern auch meine eigene Perspektive auf das Zweifeln zu verändern.
Bei dieser Fahrt erzählte ich ihm beiläufig von meinem Buchprojekt. Er schaute mich an und sagte:
»Coole Idee! Alles, was ich jemals erreicht habe, verdanke ich meinen Zweifeln – so in der Art? Das Buch könnte ich auch schreiben.«
Ich hielt die Luft an. Was hatte er da gerade gesagt? Ich hatte mich mit Stöbi über das Thema unterhalten wollen, weil er einer der extremsten Zweifler ist, die ich kenne. Ich hatte erwartet, dass er das selbst anstrengend und negativ empfinden würde. Und nun sagte er mir, dass er alles seinen Zweifeln verdankt? Mir schossen alle möglichen Fragen durch den Kopf: Hadert er denn gar nicht mit seiner ewigen Zweifelei? Weiß er denn gar nicht, wie sinnlos dieses Zweifeln ist?
Ich blickte nachdenklich aus dem Autofenster – auch um mir meine Irritation nicht anmerken zu lassen. Sollte da etwas dran sein? War Stöbi als Musiker, als Golfer und in vielem anderen wirklich so gut geworden, gerade weil er so viel gezweifelt hatte? Kultivierte er den Zweifel sogar gezielt, um noch besser zu werden?
In der Gesellschaft scheint ein Konsens darüber zu herrschen, dass man zu viel zweifeln kann – und zwar sehr schnell. Durch das Gespräch mit Stöbi wurde mir klar: Man kann auch zu wenig zweifeln.
Mir kam mein Erlebnis mit den »roten Rednern«, von dem ich zuvor erzählt habe, wieder in den Sinn: Da hatten die Zweifel dazu geführt, dass ich mich überprüfte und besser aufstellte. Ebenso haben die Zweifel bei Stöbi dazu geführt, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben. Dranzubleiben. Seine sportlichen und musikalischen Grenzen anzuzweifeln, mehr zu üben, besser zu werden. Der Satz ging mir nicht aus dem Kopf: »Alles, was ich jemals erreicht habe, verdanke ich meinen Zweifeln.«
Mit dieser extremen Haltung nimmt mein Freund Stöbi sicher eine Sonderstellung unter den bekennenden Zweiflern ein. Doch auch ich habe seither erkannt, dass Zweifel auch in meinem Leben immer wieder einen positiven Einfluss hatten – sei es als Unternehmer, als Autor, als Musiker, als Redner oder als Vater: Oft war das Ergebnis am besten, wenn irgendwann vorher Zweifel im Spiel gewesen waren.
Die Bremskraft der Zweifel kann also auch eine positive Kraft sein. Vor allem dann, wenn sie einen davor schützt, mal wieder unreflektiert mit dem Kopf durch die Wand laufen zu wollen.
Das Ende vom hohlen Tschakka
»Denk nicht so viel nach, mach einfach!« Wie oft haben Sie diesen Ratschlag schon bekommen? Und ja, man kann ein Vorhaben förmlich zerdenken. Sich viel zu viel darum sorgen, was alles beachtet werden könnte, sollte, müsste.
Man kann aber auch zu wenig nachdenken – oder zu spät. Am hilfreichsten ist Nachdenken zur richtigen Zeit.
So sagte Dieter Bohlen in einem Interview nach der Veröffentlichung seines zweiten Buches: »Man hätte das Ding tausendmal lesen und es dann nicht veröffentlichen sollen.« Das ist doch mal ein starkes Plädoyer für den Zweifel – von jemandem, der so wirkt, als ob er keine Zweifel kennt. In diesem Fall kamen sie allerdings zu spät. Im Buch plaudert Bohlen über zahlreiche intime Details und denunziert andere Menschen in übelster Form. Nach Bucherscheinen hagelte es einstweilige Verfügungen und heftige Gegenreaktionen zahlreicher Weggefährten. Im Fall von Modern-Talking-Partner Thomas Anders sagte Bohlen im RTL-Interview: »Ich bereue das […] Ich hätte mit Thomas alleine in einem Zimmer sprechen sollen und nicht per Buch mit ihm abrechnen sollen.« Tatsächlich.
Nicht immer ist der Mangel an Zweifeln allerdings so offensichtlich wie in diesem Fall.
»Erfolg ist planbar. Jeder kann es schaffen. Du musst nur …« Haben Sie schon Sätze wie diese gehört? Ich kann die Situationen kaum noch zählen. Immer wieder hört man Ratschläge und solche Motivations-Weisheiten bei Begegnungen, in Vorträgen oder in Erfolgsratgebern und Seminaren. Ich war eine Zeit lang nicht nur ein dankbarer Konsument dieser Motivationsphrasen, ich habe sie unreflektiert auch selbst immer mal wieder verteilt: an meine Kinder, meine Studenten, meine Mitarbeiter und andere. Weil man das eben so macht. Weil Motivation eben die Standardantwort auf Herausforderungen ist. Aber ist es die richtige?
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.