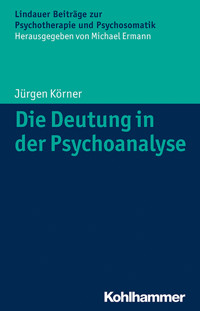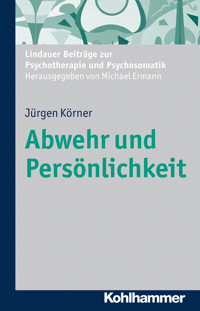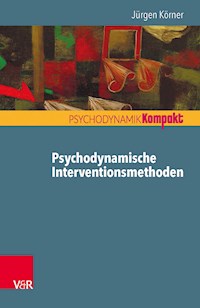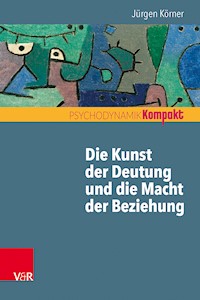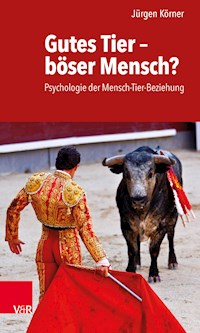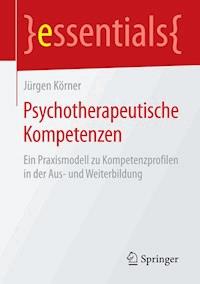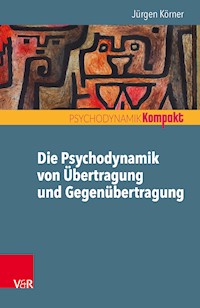
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Psychodynamik kompakt
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der psychodynamischen Methoden könnte auch als Geschichte ihrer Konzepte von der Übertragung und Gegenübertragung erzählt werden. Was hat sich gewandelt? Die Übertragung ist nicht mehr nur der Irrtum, mit dem der Patient frühe Beziehungserfahrungen wiederholt, sondern auch ein Versuch, den Therapeuten in die Lösung innerer Konflikte einzubeziehen und zu verwenden. Und die Gegenübertragung ist nicht mehr eine unvermeidliche Störung, sondern Ausdruck der Mitwirkung der Therapeutin in der psychotherapeutischen Beziehung. Auch Beziehungen des Alltags sind von Übertragungsphantasien geformt, diese aber halten wir unbewusst, damit wir nicht "aus dem Rahmen fallen". In der psychoanalytischen Situation hingegen können sich die Patienten frei machen von den im Alltag geforderten Einschränkungen des Erlebens und Wünschens. Der Patient kann die Chance ergreifen, seine im therapeutischen Prozess lebendig gewordenen Beziehungsphantasien in ein neues, erweitertes Selbst- und Beziehungskonzept zu integrieren. Das wäre ein Schritt ins Freie, vielleicht nach einer Phase der inneren Abhängigkeit vom psychodynamisch arbeitenden Psychotherapeuten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben vonFranz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Jürgen Körner
Die Psychodynamik von Übertragung und Gegenübertragung
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99887-9
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Umschlagabbildung: Paul Klee, Waldhexen, 1938/akg‐images
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen /
Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.
www.v-r.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Vorwort zum Band
1Vorbemerkungen
2Geschichte der Übertragungs- und Gegenübertragungskonzepte
3Die psychoanalytische Situation und die »Entfesselung« der Übertragung
4Erscheinungsformen der Übertragungsanalyse
4.1Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
4.2Widerstände
4.3Die Übertragungsliebe
5Methoden der Übertragungsanalyse
5.1Arbeit an der Übertragung, Arbeit in der Übertragung
5.2Was wirkt?
5.3Die Vorleistungen des Analytikers
5.4Krisen und ihre Bewältigung
6Was bleibt?
Literatur
Vorwort zur Reihe
Zielsetzung von PSYCHODYNAMIK KOMPAKT ist es, alle psychotherapeutisch Interessierten, die in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten, zu aktuellen und wichtigen Fragestellungen anzusprechen. Die Reihe soll Diskussionsgrundlagen liefern, den Forschungsstand aufarbeiten, Therapieerfahrungen vermitteln und neue Konzepte vorstellen: theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich.
Die Psychoanalyse hat nicht nur historisch beeindruckende Modellvorstellungen für das Verständnis und die psychotherapeutische Behandlung von Patienten hervorgebracht. In den letzten Jahren sind neue Entwicklungen hinzugekommen, die klassische Konzepte erweitern, ergänzen und für den therapeutischen Alltag fruchtbar machen. Psychodynamisch denken und handeln ist mehr und mehr in verschiedensten Berufsfeldern gefordert, nicht nur in den klassischen psychotherapeutischen Angeboten. Mit einer schlanken Handreichung von 70 bis 80 Seiten je Band kann sich der Leser schnell und kompetent zu den unterschiedlichen Themen auf den Stand bringen.
Themenschwerpunkte sind unter anderem:
–Kernbegriffe und Konzepte wie zum Beispiel therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Widerstand und Abwehr, Interventionsformen, Arbeitsbündnis, Übertragung und Gegenübertragung, Trauma, Mitgefühl und Achtsamkeit, Autonomie und Selbstbestimmung, Bindung.
–Neuere und integrative Konzepte und Behandlungsansätze wie zum Beispiel Übertragungsfokussierte Psychotherapie, Schematherapie, Mentalisierungsbasierte Therapie, Traumatherapie, internetbasierte Therapie, Psychotherapie und Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie und psychodynamische Ansätze.
–Störungsbezogene Behandlungsansätze wie zum Beispiel Dissoziation und Traumatisierung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen bei Männern, autistische Störungen, ADHS bei Frauen.
–Lösungen für Problemsituationen in Behandlungen wie zum Beispiel bei Beginn und Ende der Therapie, suizidalen Gefährdungen, Schweigen, Verweigern, Agieren, Therapieabbrüchen; Kunst als therapeutisches Medium, Symbolisierung und Kreativität, Umgang mit Grenzen.
–Arbeitsfelder jenseits klassischer Settings wie zum Beispiel Supervision, psychodynamische Beratung, Arbeit mit Geflüchteten und Migranten, Psychotherapie im Alter, die Arbeit mit Angehörigen, Eltern, Familien, Gruppen, Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie.
–Berufsbild, Effektivität, Evaluation wie zum Beispiel zentrale Wirkprinzipien psychodynamischer Therapie, psychotherapeutische Identität, Psychotherapieforschung.
Alle Themen werden von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bearbeitet. Die Bände enthalten Fallbeispiele und konkrete Umsetzungen für psychodynamisches Arbeiten. Ziel ist es, auch jenseits des therapeutischen Schulendenkens psychodynamische Konzepte verstehbar zu machen, deren Wirkprinzipien und Praxisfelder aufzuzeigen und damit für alle Therapeutinnen und Therapeuten eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, die den Dialog befördern kann.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Vorwort zum Band
Die Geschichte der Psychoanalyse ist eng mit den Phänomenen der Übertragung und Gegenübertragung verknüpft. Als psychodynamische Methoden haben sie sich erst mit den Jahren herauskristallisiert und wurden in ihrer Vielfalt und unterschiedlichen Ausdrucksgestalt immer wieder in neue Formulierungen gegossen. Sahen sich die Psychoanalytiker der ersten Generation noch überrascht den intensiven Beziehungsphantasien ihrer Patienten ausgesetzt – fiel auch das frühe Übertragungskonzept defensiv aus und Übertragung wurde als »Fehlwahrnehmung« apostrophiert. Heute geht man davon aus, dass die Übertragung sich nicht grundsätzlich von Beziehungsentwürfen des Alltags unterscheidet. Aber der Rahmen der psychoanalytischen Situation erlaubt es, die echten Gefühle und ernsthaften Beziehungsphantasien in den therapeutischen Dialog einzubringen, ohne »aus dem Rahmen zu fallen«. So kommt es, dass man in allen Varianten von psychodynamischen Therapien »in« der Übertragung arbeitet.
Jürgen Körner führt uns in seinem Buch nicht nur durch die Geschichte der Übertragungs- und Gegenübertragungskonzepte, er leistet auch intensive Beiträge zu den Erscheinungsformen der Übertragungsanalyse, wenn wir als Therapeutinnen und Therapeuten versuchen, in der hermeneutischen Methode des Suchens nach latenten Bedeutungen den Dialog mit den Patienten in seiner Vieldeutigkeit fassbar zu machen, und auszuhalten lernen, von diesen Patienten auch im Therapiekontext »verwendet« zu werden. Das unterscheidet die Therapiesituation wesentlich vom Alltag, in dem wir ja danach streben, die Kommunikation möglichst einhellig zu gestalten. Der Autor spricht von der Übertragung als einer »entfesselten Alltagsbeziehung«. Eine Abgrenzung von Übertragung und Übertragungsneurose wird dabei kaum gelingen, und die Neurose erscheint dann als eine besonders intensive Übertragung.
Die Arbeit »an« der Übertragung braucht stabile Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Diese Voraussetzungen müssen beide Dialogpartner mitbringen. Übertragungswiderstände werden deutlich gemacht, erläutert und in ihren Varianten ausführlich dargestellt. Auch Gegenübertragungswiderstände sind zu erkennen und zu benennen. Ein eigenes Kapitel wird der Übertragungsliebe gewidmet.
Die Erörterung der Methoden der Übertragungsanalyse greift auch die Frage auf, was denn in der Therapie wirken könnte. Vorleistungen des Analytikers, der Analytikerin werden an schlüssigen Fallbeispielen deutlich gemacht. Die Krisen und ihre Bewältigung werden im Kontext neuerer Literatur diskutiert. Die Schlussfolgerungen des Autors führen aus der Illusion heraus, die Übertragung müsse sich am Ende einer Therapie aufgelöst haben. Vielmehr integriert der Patient, die Patientin die im therapeutischen Prozess lebendig gewordenen Beziehungsphantasien in ein neues, erweitertes Selbst- und Beziehungskonzept.
Ein erfrischendes, gut geschriebenes Buch, das wichtige Beiträge zur Diskussion über Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene leistet und für Therapeutinnen und Therapeuten im Alltag sehr wertvolle Hilfen anbietet. Der Autor ist sehr präsent, und man spürt, dass hier eine jahrelange konzeptuelle Beschäftigung vorausgegangen ist. Auch das feinsinnige Gespür und die Reflexion, mit der Situationen im Alltag und in der Therapie beleuchtet werden, ist sehr beeindruckend und wird bei vielen Leserinnen und Lesern auf Resonanz stoßen.
Inge Seiffge-Krenke und Franz Resch
1Vorbemerkungen
Die Geschichte der psychodynamischen Methoden könnte auch als Geschichte ihrer Konzepte von der Übertragung und Gegenübertragung erzählt werden. Die Analytiker der ersten Generation um Sigmund Freud waren zunächst noch überrascht und auch etwas geängstigt angesichts der intensiven Beziehungsphantasien und -wünsche ihrer (überwiegend weiblichen) Patientinnen. Dementsprechend defensiv fiel das frühe Übertragungskonzept aus: Die Übertragung galt als »Fehlwahrnehmung«, die die Patientin, der Patient im Laufe der Therapie korrigieren sollte. Erleichtert konnte sich der Therapeut dann mit der Behauptung heraushalten, dass er ja mit der Übertragung, die so ungerufen gekommen war, nicht gemeint sei.
Er war aber gemeint. Und zwar nicht nur als Projektionsfläche für vielleicht infantile Phantasien des Patienten, sondern er wurde von seinem Patienten als aktiver Mitspieler zur Lösung innerer Konflikte einbezogen und verwendet. Mit dieser Vorstellung von der Übertragung als einer Verwendung wandelte sich auch das Konzept von der Gegenübertragung: von der »Spiegelplatte« der frühen Zeit zum »Messinstrument« Mitte des vorigen Jahrhunderts bis hin zur Auffassung von dem aktiven Beitrag des Analytikers in der Gestaltung der unvermeidlich konflikthaften therapeutischen Beziehung heute. Insbesondere in den modernen Konzepten einer relationalen oder intersubjektiven Psychoanalyse ist das Verständnis für die Mitwirkung des psychodynamischen Psychotherapeuten und seine zuweilen notwendige Vorleistung fortentwickelt worden. Damit trat die alte Vorstellung von der Übertragung als einem »Irrtum in der Zeit« ganz in den Hintergrund der Konzeptgeschichte.
Heute verstehen wir, dass sich die Übertragung nicht grundsätzlich von unseren Beziehungsentwürfen des Alltags unterscheidet. Denn auch diese sind von Phantasien geprägt, die allerdings zumeist unbewusst bleiben müssen, damit wir »nicht aus dem Rahmen fallen«. Hingegen ermutigt der Rahmen der psychoanalytischen Situation mit ihren besonderen Merkmalen der Abstinenz des Therapeuten und seiner neutralen und »triebfreundlichen« Haltung die Patientinnen und Patienten, sich frei zu machen von den im Alltag notwendigen und sinnvollen Einschränkungen des Erlebens. Insofern könnte man die Übertragung in der psychoanalytischen Situation als eine »entfesselte« Alltagsbeziehung verstehen – jedenfalls sind es echte Gefühle und ernsthafte Beziehungsphantasien, über die wir miteinander sprechen. Es ist kein Spiel, und wir tun auch nicht so, »als ob«.
In allen Varianten psychodynamischer Psychotherapie arbeiten wir »in« der Übertragung. Methodische Unterschiede zeigen sich darin, dass wir in kurz dauernden, niederfrequenten Verfahren dem Patienten helfen zu erkennen, wie er uns verwendet, etwa um früh erlebte Defizite zu bewältigen, während wir ihm in einer höherfrequenten, länger dauernden Therapie anbieten, innere Konflikte gemeinsam mit uns durchzuarbeiten und neue Beziehungsversuche zu erproben.
In jedem Fall aber endet eine gelungene psychodynamische Psychotherapie nicht damit, dass sich die Übertragung »auflöst«, sondern dass wirklich Neues entsteht: Zum Mindesten identifiziert sich der Patient mit der analytischen Funktion seines Psychotherapeuten, um sich auch ohne ihn in den Konflikten des Alltags zurechtzufinden. Intensivere Übertragungs- und Gegenübertragungsbeziehungen aber sollten es dem Patienten ermöglichen, sehr frühe Beziehungsphantasien und -wünsche wieder zu beleben und darin vom Analytiker, von der Analytikerin anerkannt zu werden. Dann kann, wie Michael Balint es formulierte, »das Lieben wahrlich neu beginnen«.
2Geschichte der Übertragungs- und Gegenübertragungskonzepte
Den Psychoanalytikern der ersten Generation um Freud erschien die Übertragung ganz ungerufen. Sie hatten mit den intensiven Beziehungsphantasien und drängenden Wünschen der ersten Patientinnen (es waren überwiegend Frauen) nicht gerechnet. Dabei kann aus heutiger Sicht das Auftreten heftiger Übertragungen eigentlich nicht überraschen. Denn Freud hatte seine ersten Patientinnen noch in einer brisanten methodischen Mischung behandelt: abwechselnd »Ausforschen« in der Hypnose, Massage »am ganzen Körper« und außerdem mit den ersten Versuchen einer freien Assoziation. Dieses Setting musste wohl regressive Bewegungen anstoßen und heftige Beziehungswünsche »mit teilweise grob sexuellen Manifestationen« (Balint, 1968, S. 183) hervorlocken.
Einige Analytiker der ersten Generation um Freud gerieten in Angst. Breuer zum Beispiel verstrickte sich in die Übertragungsbeziehung zu seiner Patientin »Anna O.« (Körner, 1989a, S. 210). Diese hatte während der Analyse bei ihm eine Scheinschwangerschaft entwickelt und »in einer wahnhaften Geburtsszene phantasiert, das Kind von Herrn Doktor komme nun« (Kerr, 2011, S. 309). Selbst dann hatte Breuer die Behandlung unbeirrt fortgesetzt. Er gab die täglichen Sitzungen mit seiner Patientin erst auf, als seine Frau aus Verzweiflung darüber, dass er der jungen Frau so viel Zeit widmete, einen Suizidversuch unternahm.
Andere, wie etwa C. G. Jung, gingen auf die Beziehungswünsche ihrer Patientinnen ein und wurden von Freud nachsichtig begleitet. Freud tröstete Jung, der sich wohl gern als Opfer seiner Patientin Sabina Spielrein gesehen hätte, mit dem Zitat aus Goethes »Faust«: »Bist mit dem Teufel du und du und willst dich vor der Flamme scheuen«? (Freud u. Jung, 1974, S. 233).
Die Liste derjenigen Psychoanalytiker/-innen, die sexuelle Verhältnisse mit ihren Patientinnen oder Patienten bzw. deren Angehörigen eingingen, ist lang: nicht nur Ferenczi und C. G. Jung, auch Groddeck, Stekel, Tausk, Reich, Bernfeld, Fenichel, Aichhorn, Rank, Radó, Jones, Masud Khan, Fromm-Reichmann, Horney und Schultz-Hencke (Krutzenbichler, 2008; Krutzenbichler u. Essers, 1991, 2010).
Freud schrieb in einem Brief an Binswanger (Binswanger, 1956), dass er es selbst wohl nur seinem fortgeschrittenen Alter verdanke, dass er »nicht hereingefallen« sei und dass er einige Male nur ein »narrow excape« (Freud u. Jung, 1974, S. 255) gefunden habe. »Ich glaube, nur die grimmigen Notwendigkeiten, unter denen mein Arbeiten stand, und das Dezennium Verspätung gegen Sie, mit dem ich zur Psychoanalyse kam, haben mich vor den nämlichen Erlebnissen bewahrt. Es schadet aber nichts. Es wächst einem so die nötige harte Haut, man wird der ›Gegenübertragung‹ Herr, in die man doch jedesmal versetzt wird, und lernt seine eigenen Affekte verschieben und zweckmäßig plazieren« (S. 254 f.).
Es ist seinen frühen Schilderungen anzumerken, wie erleichtert Freud war, dass er das Unheimliche der sehr intensiven Beziehungsphantasien begrifflich eingefangen, also buchstäblich »festgestellt« hatte: »nun ich das einmal erfahren habe, kann ich von jeder ähnlichen Inanspruchnahme meiner Person voraussetzen, es sei wieder eine Übertragung und falsche Verknüpfung vorgefallen« (Freud, 1895, S. 309).
Allerdings war Freud »anfangs über diese Vermehrung meiner psychischen Arbeit recht ungehalten« (1895, S. 310), und er betrachtete diese »Übertragungen« als »Zwang und Täuschung, die mit Beendigung der Analyse zerfließe« (S. 310). Er verstand aber auch schon sehr früh, dass sich diese Übertragungsphantasien zwar auf ihn richteten, andererseits aber einer Person aus der Geschichte der Patienten galten. Er nannte sie daher auch »falsche Verknüpfungen«, einen »Irrtum in der Zeit« – aber es war ein Irrtum, den aufzuklären sehr aufschlussreich sein könnte.