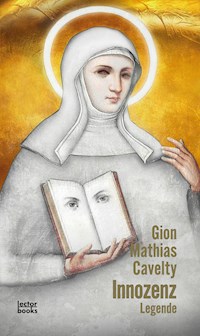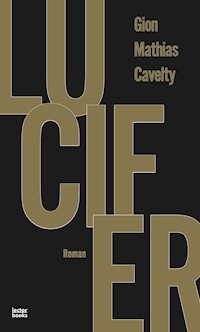Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Salis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
"Quifezit oder Eine Reise im Geigenkoffer" heißt der schelmische Selbstschöpfungsmythos voll Witz und komischem Wahnsinn, der 1997 den damals dreiundzwanzigjährigen Schweizer Autor Gion Mathias Cavelty als fabulierfreudigen Fantasten rasch bekannt machte: "Cavelty fecit! Ecce poeta!", begrüßte ihn die Neue Zürcher Zeitung. In der Fortsetzung "ad absurdum" schickt Cavelty seine Leser auf der Suche nach dem "Buch der Bücher" ins außerkosmische Buchlabyrinth. Alle Freunde der Fabulierkunst seien eingeladen, mit dem kettenrauchenden Pudel Dante an Bord der Vittoria zu kommen! In "tabula rasa", dem abschließenden dritten Teil, gelangt der Leser respektive Nichtleser ins Reich des Irrsinns. Er erlebt die Revolution der Buchstaben, den Umsturz aller Gesetze und wird Zeuge der Schöpfung des perfekten Menschen und einer neuen Welt. Mit der "Quifezit-Trilogie" erscheinen Gion Mathias Caveltys erste drei Romane nun neu als E-Book. Lange vergriffen und längst Kult, abenteuerlich, abgefahren und voll schrägem Personal und noch schrägerem Humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gion Mathias Cavelty
Die Quifezit-Trilogie
Quifezit – ad absurdum – tabula rasa
Quifezit
(Teil 1)
1. Introitus
Seit meinem einundzwanzigsten Lebensjahr wohnte ich in einem alten Turm, der fünf Wohnungen umfasste und seit Menschengedenken nicht renoviert worden war.
Einmal im Monat brachte die Post den Einzahlungsschein für die Miete. Der Einzige im Turm, der sie regelmäßig bezahlte, war ein Priester, der im Stockwerk über mir wohnte. »Es gehört sich nämlich so und nicht anders«, lautete seine Begründung.
Anderer Ansicht war ein klein gewachsener und äußerst hässlicher Physiklehrer, dessen Wohnung sich unter der meinen befand. »Ich habe meine Miete in den letzten sieben Jahren kein einziges Mal bezahlt, und nie hat einer reklamiert, was beweist, dass der Eigentümer des Turmes entweder gestorben ist oder überhaupt nie existiert hat.«
In diesem Punkt hatte er recht: Niemand hatte den Vermieter je zu Gesicht bekommen. Nur der Priester behauptete, er habe einmal einen weißhaarigen Mann im Treppenhaus Rumba tanzen sehen, der ohne weiteres der ominöse Eigentümer hätte sein können.
Ebenfalls nicht an die Existenz des Besitzers glaubte der vierte Mieter, ein fetter schwarzer Pudel, der auf dem Dachboden des Turmes wohnte. Seine Zeit verbrachte er mit dem Fressen von Quarkauflauf und dem Wälzen philosophischer Bücher. Denn die einzigen zwei Vorschriften der Hausordnung lauteten: ›Du sollst keinen Quarkauflauf essen und keine blöden Fragen stellen‹, und unbändig war das Verlangen des Pudels, gegen alle Gebote zu verstoßen.
Über die fünfte Mieterin, eine im vierten Stock lebende Pianistin, wusste niemand etwas, außer dass sie mit penetranter Boshaftigkeit von Punkt halb sieben bis halb acht Uhr abends ihrem Piano Töne entlockte, die künftige Höllenmartern erahnen ließen.
Ich persönlich hielt es mit der Miete so, dass ich sie jeden dritten Monat zu einem Viertel bezahlte.
Eines Abends stand der Priester vor der Tür meiner Wohnung.
»So darf das nicht weitergehen.«
»Wie bitte?«, fragte ich desinteressiert.
»Sie wissen, was ich meine«, antwortete der Priester ernst. »Sie bezahlen Ihre Miete nicht korrekt. Wenn Sie Ihre Miete nicht in richtiger Art und Weise entrichten, werden Sie in der Hölle landen. Ich spaße nicht. Ich habe das Gleiche schon dem Pudel und dem Physiklehrer prophezeit und die beiden haben über meine Worte gelacht. Der Herr wird sie dafür strafen.«
»Danke für den Hinweis. Auf Wiedersehen.«
»Das mit der Miete ist nicht alles. Ich weiß noch anderes über Sie. So zum Beispiel, dass Sie vor drei Wochen Quarkauflauf zum Abendessen hatten. Sie wissen, dass das verboten ist.«
»Sagen Sie das dem Vermieter, wenn Sie ihn mal treffen. Guten Abend.«
»Sie werden’s bereuen, Sie werden’s bitter bereuen, dass Sie nicht auf mich gehört haben«, rief der Priester wütend und ging.
Ich schloss die Tür und hatte den Vorfall schon vergessen.
Des Nachts aber, als ich im Bett lag und nicht einschlafen konnte, kamen mir die Worte des Priesters jäh in den Sinn.
›Die Hölle? Sicher kein sehr angenehmer Ort. Da wird es einem wahrscheinlich rasch langweilig. Und heiß soll’s sein! Nein, ich habe wirklich keine Lust, dort zu landen. Ich muss sofort mit dem Priester reden!‹
Ich sprang aus dem Bett, rannte die Treppe hinauf zur Wohnung des Priesters und klopfte stürmisch. Es dauerte einige Zeit, bis sich die Tür öffnete.
»Hören Sie mich an«, flehte ich. »Ich will nicht ins Inferno!«
Der Priester nickte wieder ernst. »Kommen Sie rein.«
2. Die Lektion des Priesters
Wir betraten einen kleinen Raum, der vollgestopft war mit Heiligenstatuen und anderen religiösen Gegenständen.
»Setzen Sie sich«, forderte mich der Priester auf. »Sie haben also eingesehen, dass Sie ein gottloses Leben geführt haben, und wollen dies grundlegend ändern. Gut so. Ich werde Ihnen dabei helfen. Hören Sie nachfolgende Gebote, und wenn Sie sich daran halten, wird Gott Ihnen verzeihen.«
Er räusperte sich und begann:
»Du sollst nicht stehlen, heucheln, lügen,Begehren deines Nachbarn Gut!Nicht ehebrechen und betrügen,Vergießen keinen Tropfen Blut!«
An dieser Stelle unterbrach der Priester seine Rezitation. »Diese Gebote dürften Ihnen bekannt sein, sie stehen in jeder Bibel. Kommen wir nun zu denjenigen Geboten, die nicht in der Heiligen Schrift zu finden, die für das Seelenheil der Menschen aber trotzdem von ungeheurer Wichtigkeit sind und gar nicht genug betont werden können:
Du sollst nicht Rechenschaften fordernVon Papst und Gott und Vaterland!Gehorsam leiste allen OrdernDer Männer aus dem Klerusstand!
Du sollst nicht müssen, sollst nicht sollen,Vergnügen soll dir sein dein Los!Du sollst nicht murren und nicht grollenUnd essen keine Apfelsoß!
Du sollst nicht blöde Fragen stell’n,Gehorchen sei dir erste Pflicht!Nicht sollst du wie die Hunde bell’n,Denn bellen ist dein Metier nicht!
Du sollst Ihn preisen, sollst Ihn loben,Denn alles Gute kommt von oben!Lass ab von Quarkauflauf mit Wein!Komm her, mein Sohn, sag ja, schlag ein!«
Das Ganze hatte mich entsetzlich kalt gelassen. ›Doch wenn das der Weg sein soll, der in den Himmel führt, will ich ihn gehen.‹
»Ihre Worte«, säuselte ich, »haben mir tiefen Eindruck gemacht und mich erschüttert. Nie wieder will ich Quarkauflauf mit Wein essen.«
»Auch keinen Quarkauflauf mit Bier!«
»Nein.«
»Überhaupt keinen Quarkauflauf mehr! Und nichts, was mit Q anfängt oder mit Q aufhört!«
»Niemals wieder.«
»Gut so. Fünfhundertfünfundfünfzig Franken macht’s, und der Herr wird Ihnen vergeben.«
»Fünfhundertfünfundfünfzig Franken? Das ist arg viel.«
»Du sollst keine blöden Fragen stellen, heißt eins der Gebote. So, rüber mit dem Geld. Danke. Und nun wünsche ich Ihnen eine gute Nacht.«
Ich ging in meine Wohnung hinunter und legte das Geld für die Miete bereit. Dann schlief ich erleichtert ein.
3. Die Lektion des Physiklehrers
Eines Morgens, als ich gerade meine Wohnung verlassen hatte, sah ich den Physiklehrer unter großen Anstrengungen einen Müllsack die Stufen des Treppenhauses hinunterschleifen.
»Guten Morgen«, grüßte ich.
»Morgen«, antwortete der Physiklehrer mit apathischer Stimme.
»Soll ich Ihnen helfen? Sie werden ja fast erdrückt.«
Der Physiklehrer, der, wie erwähnt, ausgesprochen klein von Wuchs war, was konkret bedeutete, dass er einen Gartenzwerg knapp überragte, schnitt eine fürchterliche Grimasse und kam drohend auf mich zu.
»Sie können sich von mir aus ruhig über meine Größe lustig machen. Denken Sie aber bloß nicht, dass Sie mir auch geistig gewachsen, geschweige denn überlegen sind! Ich mag vielleicht klein sein, aber blöd bin ich deswegen noch lange nicht!«
Er fletschte seine Zähne und zerrte mich in seine Wohnung. Der Raum, in den er mich führte, war schwach beleuchtet und mit sibirischer Kälte erfüllt. Auf einem großen Schreibtisch lag die Leiche eines weiß gekleideten Engels, dessen goldene Flügel abgesägt worden waren, an der Decke baumelten sieben kleine Gnome mit langen Bärten, in einem eisernen Käfig lag regungslos ein Wesen mit drei Köpfen und sieben Schwänzen.
»So«, sagte der Physiklehrer und rieb sich seine Hände. »Nun hören Sie genau zu. Sie und der debile Priester denken, Sie seien mir überlegen. Doch da haben Sie sich geschnitten!
Schreibmaschinen, HerbstzeitlosenSchinkenbrot und SiegLanghaardackel, VanillesaucenWagners Büste, Krieg
Besenkammern, SubtraktionenTod und Teufel, SchneeLiebe, Skrupel, blaue BohnenAschenbrödels Fee
Leben vor und Leben währendLeben auf und nach dem TodOmas Katze, lang schon gärendHimmelblau und rot –«
»Was soll das Ganze eigentlich?«, fragte ich an dieser Stelle gereizt.
»Passen Sie gefälligst auf!«, schnarrte der Physiklehrer und fuhr fort:
»Wenn du denkst, du fliegst,Wenn ein Hexenschuss dich quält,Wenn du glaubst, du liebst,Wenn dich wer für Lenin hält,
Was auch nur erdenken kannstDu mit deiner Fantasie,Ist pure, herrliche,Fantastisch wunderbare CHEMIE!
CHEMIE ist, was du hustest,CHEMIE ist, was du schreist,CHEMIE ist, wenn der böse WolfDem Schaf den Kopf abbeißt!
CHEMIE ist hier, CHEMIE ist dort,CHEMIE ist alles, kein Widerwort!CHEMIE bist du, CHEMIE bin ich,CHEMIE ist gut, damit hat’s sich.
Was sagen Sie nun?«
»Nicht gerade ein Meisterstück der Metrik«, wagte ich zu behaupten.
»Mit den ersten paar Strophen bin ich zufrieden, am Rest muss ich noch feilen.«
»Tun Sie das.«
»Und wenn Sie es noch einmal wagen, mich lächerlich zu machen, dann gnade Ihnen Gott!«
»Den gibt’s ja offenbar nicht.«
»Aus meinen Augen!«
Ich lächelte und ging.
4. Die Lektion der Pianistin
Es war an einem schwülen Abend um kurz vor halb sieben, ich hatte eben mein Abendessen eingenommen und stellte mich auf die nun drohende Musikstunde der Pianistin ein, als ich aus dem Treppenhaus plötzlich wundersame Geigenmusik vernahm. Dort stand ein dicker rotlockiger Jüngling, bekleidet mit einem schwarzen Smoking.
»Hallo«, sagte er, als er mich erblickte. »Ich heiße Russell, ich übe hier nur ein bisschen. Sie müssen entschuldigen, ich bin leider völlig unmusikalisch.«
»Aber Ihr Geigenspiel ist doch ausgezeichnet«, erwiderte ich beeindruckt.
In diesem Moment kam die Pianistin die Treppe hinunter und winkte Russell zu sich in die Wohnung. Nach ein paar Minuten ertönte die wunderschönste Musik, die ich je gehört hatte. Mit offenem Mund lauschte ich, die absolute Harmonie ließ mich erschaudern.
›Alle‹, dachte ich, ›alle spielen ein Instrument, nur ich nicht.‹
Diese Tatsache konnte ich nicht auf sich beruhen lassen. Ich verließ die Wohnung mit dem Ziel, eine Geige zu kaufen.
In der Stadt gab es nur einen Geigenbauerladen, der gehörte einem alten Kriegskrüppel namens Kalaschnikoff. Auf der Schwelle zu seinem Geschäft krabbelten dutzende von unansehnlichen schwarzen Grillen herum, die mich sehr ekelten, doch mit einem lässigen Schritt setzte ich mich über das Hindernis hinweg und stand im düstern Ladeninnern. Ich sah mich um; in diesem Moment humpelte auch schon Kalaschnikoff herbei und machte eine tiefe Verbeugung.
»Was darf’s denn sein, der Herr?«, fragte er mit einer etwas zu freundlichen Stimme.
»Eine Geige bitte«, sagte ich, »aus schönem rotem Holz.«
»Eine Geige? Wieso ausgerechnet eine Geige? Hören Sie: Ich kann Ihnen ein fantastisches transportables Harmonium anbieten, es ist nur dreißig Zentimeter hoch, passt in jeden Rucksack …«
»Ich will aber eine Geige«, sagte ich bestimmt, »und zwar die, die auf dem Stuhl dort liegt.«
»Ich verkaufe Ihnen diese Geige nicht!«, schrie Kalaschnikoff.
»Dann«, schrie ich zurück, »nehme ich sie mir!«
Ich sprang auf den Stuhl zu, packte die Geige und den danebenliegenden Bogen und rannte auf den Ausgang zu. Doch die Grillen hatten inzwischen die Größe von Hunden angenommen und machten keine Anstalten, mich hinauszulassen. Da packte mich eine ungeheure Wut: Ich schlug wie wild mit der Geige auf die Insekten ein, dass ihre Panzer nur so krachten, und erkämpfte mir den Weg ins Freie.
»Warten Sie nur!«, schrie mir Kalaschnikoff hinterher. »Das wird Folgen haben!«
In meiner Wohnung streichelte ich liebevoll die Geige. Ich fühlte mich wie neu geboren. Leider musste ich schon bald feststellen, dass ich mir, wie ich naiv angenommen hatte, das Geigenspielen niemals selbst beibringen konnte. Der einzige Ausweg, der sich anbot, war die Pianistin. Sie würde mich in die Geheimnisse der Musik einweihen. So klingelte ich an ihrer Wohnungstür und wartete.
Nach langer Zeit ging die Tür auf und die Pianistin stand mir gegenüber.
»Guten Abend, ich hätte eine Bitte«, begann ich, doch weiter kam ich nicht: Ich war von der vorher nie bemerkten Schönheit meines Gegenübers dermaßen geblendet, dass ich kein Wort mehr herausbrachte.
»Sie wollen sicher Lektionen bei mir nehmen, nun gut«, sagte die Pianistin und zog mich in ihre Wohnung, »ich verlange tausend Franken pro Sekunde, wir legen gleich los, Ihre Geige haben Sie ja mitgebracht.«
Die nächsten paar Stunden widmeten wir dem fachgerechten Halten des Bogens. Mein rechter Arm begann im Laufe der Zeit höllisch zu schmerzen, doch weder das noch die Tatsache, bereits mit mehr als zwölf Millionen Franken in der Kreide zu stehen, machten mir etwas aus: Die ungeheure Gnade, mich in der Nähe meiner göttlichen Lehrerin aufhalten zu dürfen, war mir das wert.
Gegen Mitternacht erklärte die Pianistin, sie habe nun genug und wolle sich hinlegen.
Als ich auf der Schwelle stand, überkam es mich.
»Ich, äh … würden Sie gerne …«, stammelte ich, »hätten Sie Lust, bei mir einen Kaffee zu trinken …«
»Wie soll ich diese Frage auffassen?«, fragte die Pianistin kühl. »Hauen Sie ab und lassen Sie sich nie wieder hier blicken!«
In meinem Schlafzimmer warf ich mich aufs Bett und dachte angestrengt nach. Was hatte ich bloß falsch gemacht? Nachdem ich die Geige zu Kleinholz gehackt hatte, schlief ich ein.
5. Die Lektion des schwarzen Pudels
Eines schönen Tages geschah es, dass mir das Salatöl ausging. Da der Priester nicht zu Hause war, der Physiklehrer mir nie im Leben auch nur einen Tropfen davon geliehen hätte und ich mich bei der Pianistin nicht mehr blicken lassen konnte, musste ich zum schwarzen Pudel auf den Dachboden steigen. Ich klopfte, kurze Zeit später wurde geöffnet.
»Guten Tag«, sagte ich. »Ich hoffe, ich störe nicht. Ich bräuchte unbedingt etwas Salatöl, eine kleine Tasse voll, wenn’s beliebt.«
»Was ist besser: eine Kartoffel im Kopf oder ein Hirn in der Tasche zu haben?«, fragte der Pudel.
»Das Erstere«, antwortete ich nach einer Weile vorsichtig. »Denn ein Hirn in der Tasche ist zu überhaupt nichts nütze. Man kann es nicht essen.«
»Sie beurteilen das Ganze also nach kulinarischen Kriterien«, folgerte der Pudel.
»Nach welchen Kriterien denn sonst? Eine Kartoffel ist wohl zum Essen da, oder nicht?«
»Ein Hirn aber zum Denken.«
»Jetzt langt’s mit dem Unsinn«, sagte ich ärgerlich.
»Meine Frage«, rechtfertigte sich der Pudel, »war von Anfang an als Scherz gedacht. Ein intelligentes Wesen hätte darauf geantwortet: Am besten ist es natürlich, ein Hirn im Kopf und eine Kartoffel in der Tasche zu haben.«
»Salatöl bräucht’ ich.«
»Kommen Sie einen Moment rein.«
Ich folgte dem Pudel in einen kleinen Raum, der mit Büchern und Zeitungen vollgestapelt war.
»Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?«, fragte der Pudel, setzte sich auf einen Stuhl und steckte sich eine Zigarette an.
»Salatöl.«
»Beantworten Sie zuerst meine Frage.«
»Sie lesen viel in philosophischen Schriften, habe ich gehört«, lenkte ich vom Thema ab.
»Ach was«, meinte der Pudel. »Ich habe noch nie was Hochstehendes gelesen. Texte sollten so diffus, mehrdeutig und unsinnig wie möglich sein. Denn das ganze Leben ist absurd, absurd, absurd.«
»So?«, fragte ich.
»Ja. Sie müssen meine Ansichten nicht teilen, denn ich gelte allgemein als verrückt. Der Physiklehrer hasst mich bis aufs Blut und will mich umbringen, weil, seien wir ehrlich, ein sprechender Pudel nicht gerade eine Alltäglichkeit ist.«
»Das kann man wohl sagen.«
»Eben. Sie hätten meinen Stolz verletzt, wenn Sie etwas anderes gesagt hätten.« Der Pudel zog zufrieden an seiner Zigarette.
»Salatöl.«
»Sie haben sich mit dem Priester im dritten Stock angefreundet, sagt man. Er soll Sie so weit gebracht haben, dass Sie Ihre Miete zahlen und keinen Quarkauflauf mehr anrühren.«
»Sonst komme ich in die Hölle, wissen Sie.«
»Lächerlich, absolut lächerlich. Es gibt genauso wenig eine Hölle, wie es einen Himmel oder Salatöl gibt.«
»Aber es gibt Salatöl.«
»Hier nicht. Wollen Sie mein neuestes Gedicht hören?«
»Nein.«
»Es trägt den Titel ›Harzt‹ und ist tiefsinniger, als man auf den ersten Blick meinen könnte:
Harzt
Der Arzt heißt Hans.Sein Vater hieß schon Hans.Sein Großvater hieß schon Hans, undSein Großmutter hieß schon Hans.
Hans ist Arzt.Sein Vater war schon Arzt.Sein Großvater war schon Arzt, undSein Großmutter war schon Arzt.
Na?«
»Was soll daran tiefsinnig sein?«
»Können Sie sich auf das Gedicht keinen Reim machen?«
Langsam hatte ich genug.
»Salatöl haben Sie offenbar nicht. Auf Wiedersehen.«
»Noch ein Wort, bevor Sie gehen«, sagte der Pudel und drückte die Zigarette auf dem Buch ›Metaphysik zwischen Spessart und Karwendel‹ aus. »Ich bin der Meinung, dass der verwünschte Priester rausmüsste aus dem Turm. Er ist ein großes Hindernis, finden Sie nicht? Dauernd trachtet er danach, allen ein schlechtes Gewissen einzureden, Jüngstes Gericht und Höllenqualen, da graust’s den vernünftigen Hund. Raus mit dem Priester, sage ich.«
»Auf Wiedersehen!«, sagte ich und verließ eiligst die Wohnung des Pudels.
6. Das Restarant
Die Worte des Pudels gingen an mir, wider Erwarten, nicht spurlos vorüber. Vielmehr begann ich, an den Geboten des Priesters vermehrt zu zweifeln, bis ich an dem Punkt angelangt war, an dem ich meine Miete überhaupt nicht mehr zahlte und Quarkauflauf jeden Abend in meinem Teller dampfte, obwohl ich Quarkauflauf eigentlich nicht ausstehen konnte.
Fast täglich besuchten der Pudel und ich ein Wirtshaus im düstersten Quartier der Stadt und diskutierten über alles Mögliche. Es war eine dunkle, rote Spelunke. Überall standen kleine Blumentöpfe mit unansehnlichen Farnbüscheln, die dem Loch wohl eine originelle Atmosphäre verleihen sollten. Der Pudel erwies sich als genialer Schwadroneur und profunder Kenner der Szene.
»Dieses Wirtshaus hier«, erzählte er mir, »ist gar kein Wirtshaus; wenn Sie gut aufgepasst haben, werden Sie bemerkt haben, dass auf dem Schild draußen ›Restarant‹ steht.«
»Was nicht erklärt, warum sich der dicke Mensch hinter dem Tresen immer noch nicht hierherbequemt hat, um die Bestellung aufzunehmen, obwohl ich schon seit zwei Stunden nach Kaffee rufe.«
»Merken Sie sich«, belehrte mich der Pudel, »zwei Dinge. Erstens: Finden Sie sich damit ab, dass Sie hier nie zu Ihrem Kaffee kommen werden, auch wenn Sie tausend Stunden rufen. Zweitens: Der dicke Mensch hinter dem Tresen ist taub.«
»Dann sollte er kein Wirtshaus unterhalten!«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, das ist kein Wirtshaus, sondern ein Restarant.«
»Jetzt reicht’s mir.«
»Nun machen Sie mal halblang«, besänftigte mich der Pudel. »Sehen Sie sich um. Wir befinden uns hier im Sammelbecken der gestrandeten Existenzen der Stadt, wie ich es nenne. Jeder hier hat seine eigene Geschichte. Der Mann dort am runden Tisch heißt Todor und hält sich für Gott. Er hat ein Buch geschrieben, vierunddreißig Seiten dick, auf jeder Seite steht ein Buchstabe und diese ergeben einen Satz, der lautet: ›Hallo zusammen! Der Wind, die Sonne und ich.‹ Ich habe mich oft gefragt, ob es sich lohnen könnte, Todor nachzufolgen.«
»Wer ist der pummelige Mann mit der wasserstoffblonden Lockenperücke und den hautengen Lederleggins, der die Leute auf der Straße beobachtet?«
»Oh, das ist Günther. Günther ist der oberste Chef der Unterwelt, alle Geldfälscher, Dirnen, Zuhälter und Killer dieser Stadt stehen unter seinem Kommando. Allen Passanten wirft er vielsagende Blicke zu und macht ihnen linkisch einladende Zeichen. Doch nie will sich einer zu ihm setzen. Herrscher werden nicht geliebt, sondern gefürchtet. Ich hoffe, Günther wird darüber nicht eines Tages in Rage geraten und die Stadt in Schutt und Asche legen.«
»Der Dünne dort?«
»Er heiratete vor kurzem eine Buchverkäuferin. Als er eines Abends müde von der Arbeit heimkam, musste er feststellen, dass sie alle seine Bücher verkauft hatte. Nun, sie ist Buchverkäuferin, jedes Buch, das sie sieht, muss sie verkaufen, das ist ihr Schicksal. Gestern verkaufte sie alle seine Möbel und Bilder. Das macht ihn fertig. Schließlich ist sie keine Möbelverkäuferin.«
»Aha.«
»Der Mann mit der beneidenswerten Frisur da vorne ist ein Professor. So eine Frisur wünsche ich mir schon lange. Morgen hält er einen Vortrag über Utopien, ich werde selbstverständlich hingehen und neunzig Minuten lang seine famose Frisur anstarren. Ich heiße übrigens Dante«, sagte der Pudel an dieser Stelle, zündete sich eine Zigarette an und rauchte genüsslich.
»Momentan schreibe ich an einem Theaterstück«, teilte mir Dante nach einer Weile mit gewichtiger Stimme mit. »Es spielt in einem unendlichen Garten, der einem gewissen Wotan Scharfaug gehört. In der ersten Szene adoptiert Scharfaug einen Knaben namens Roswald. Roswald soll die bestmögliche Erziehung erhalten, deshalb engagiert Scharfaug eine Gouvernante namens Leonardo – kein Mensch weiß, warum sie Leonardo heißt – und einen Privatdozenten für Philosophie, Dr. Banfikowski mit Namen. Während Roswald faul unter einem Apfelbaum liegt und so viele Äpfel verdrückt, wie nur reingehen, versucht Banfikowski, ihn in das Sein einzuführen. ›Das seiende Sein, dem es in solchem Sein um dieses als das Seiende geht‹, doziert er, ›ist nicht zu verwechseln mit dem unseienden Unsein, dem es in solchem Unsein um dieses als das Unseiende …‹ Das Ganze scheint Sie nicht gerade brennend zu interessieren«, sagte Dante an dieser Stelle vorwurfsvoll.
»Ich bin zugegebenermaßen recht müde«, gestand ich.
»Auch recht. Ich muss sowieso gehen. Treffpunkt morgen um drei Uhr. Adieu.«
7. Die Exekution des Pudels
Eines Abends, als ich nach einem Restarantbesuch gerade meine Wohnung betreten wollte, packte mich jemand an der Schulter. Es war der Priester.
»Sie waren beim Pudel, stimmt’s?« Seine Augen blitzten. »Hören Sie. Der Pudel ist ein Werkzeug des Satans; jeder, der ihm Gehör schenkt, wird von Gott ins tiefste, schwärzeste, stinkendste Loch der Hölle geworfen werden, wo er bis in alle Ewigkeit schmoren und ein Spielball des Teufels und seiner Dämonen sein wird!«
»Oh«, stammelte ich und warf mich auf die Knie.
»Der Pudel muss vernichtet werden. Kommen Sie!«
Ich folgte dem Priester in einen kleinen Raum seiner Wohnung, in dessen Mitte ein gigantisches Maul schwebte.
»Das ist das göttliche Maul«, erklärte der Priester. »Es ist dazu bestimmt, das Böse in der Welt aufzufressen. Hier hinein müssen wir den Pudel stoßen. Gehen Sie und holen Sie ihn!«
Kopflos torkelte ich hinauf auf den Dachboden. Dante schlief auf einer Matte. Ich packte ihn an der Gurgel und rannte mit ihm zurück.
»Sehr gut!«, jubelte der Priester. »Los! Ins Maul mit ihm! Worauf warten Sie noch?«
Mit einem kräftigen Wurf schleuderte ich den Pudel ins göttliche Maul. Es schmatzte geräuschvoll.
»Süperb«, kommentierte es mit vollem Mund.
»Es ist vollbracht!«, schrie der Priester und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
8. Der Pfeifenstopfer des Papstes
Unter Führung des Priesters begann ich ein neues Leben. An Quarkauflauf dachte ich nicht einmal mehr, meine Miete bezahlte ich wieder regelmäßig und vollständig. Der Priester war äußerst zufrieden mit mir, und als ich eines Morgens in den Spiegel schaute, entdeckte ich über meinem Haupt einen silbrigen Heiligenschein.
»Das ist fantastisch«, rief der Priester und bekreuzigte sich. »Das müssen wir dem Papst persönlich zeigen. Kommen Sie! Ich weiß, wo er wohnt.«
Wir fuhren zum päpstlichen Schloss und bekamen sofort eine Audienz.
»Das ist außergewöhnlich, ganz außergewöhnlich«, meinte der Papst beeindruckt und musterte meinen Heiligenschein während einer Viertelstunde von vorn und hinten. »Mit Ihnen hat Gott Besonderes vor«, sagte er schließlich und musste schnell auf die Toilette.
»Es lohnt sich eben doch, wenn man keinen Quarkauflauf isst!«, flüsterte der Priester und boxte mich freundschaftlich in die Seite.
Nach ein paar Minuten kehrte der Papst zurück und verkündete: »Ich habe mich entschlossen, Sie mit einer wichtigen kirchlichen Aufgabe zu betrauen. Sie sind ab sofort päpstlicher Pfeifenstopfer.«
Ich zog aus meiner alten Wohnung aus, erhielt ein Zimmer auf dem Dachboden des päpstlichen Schlosses zugeteilt und wurde päpstlicher Pfeifenstopfer.
»Stopf mir meine Pfeife!«, befahl mir der Papst jeden Abend nach den Nachrichten. »Und geiz nicht mit dem Tabak.«
Ich stopfte und der Papst war so zufrieden mit mir, dass er mich nach einem halben Jahr zum päpstlichen Korkenzieher ernannte. Zum päpstlichen Zahnstocher hatte es noch nicht ganz gereicht.
9. Das blonde Polarschnabeltier
Ich ging meiner Arbeit treulich nach und alles ging gut, bis ich eines Tages im päpstlichen Garten die Bekanntschaft eines blonden Polarschnabeltiers machte. Es saß auf einer Bank und las in einem Schundroman.
»Schönes Wetter heute«, meinte ich. »Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Was arbeiten Sie?«
»Ich bin professioneller Zitherspieler von Beruf«, antwortete das Schnabeltier nicht ohne Stolz in der Stimme.
»Höchst interessant! Ich wollte schon immer mal einen Zitherspieler treffen.«
»Kommen Sie mich mal besuchen. Wir veranstalten eine Quarkauflaufparty und ich kann Ihnen was vorzithern.«
›Quarkauflauf?‹, fuhr es mir durch den Kopf. »Bei Gott! Das ist doch verboten! Sie werden in der Hölle landen, wenn Sie es wagen, Quarkauflauf auch nur zu berühren!«
»Der Papst selbst schlägt sich den Bauch damit voll, wussten Sie das nicht?«
Diese Worte brachten mich außerordentlich durcheinander.
»Ich liebe Sie«, stotterte ich nach einer Weile.
»Ich liebe Sie auch«, antwortete das Polarschnabeltier.
Dieser Satz ließ mir das Herz erbeben und glückselig sprang ich auf die Beine. Ich rannte auf schnellstem Weg in mein Zimmer, wo ich sofort einschlief.
Nach drei Stunden wurde ich durch ein lautes Gebrüll unsanft geweckt.
»Wo zum Teufel bleibt mein Korkenzieher? Verdammt noch mal, wo steckt der Kerl?«
Erschrocken lief ich ins päpstliche Refektorium, wo der Papst hinter dem Esstisch saß und mir böse Blicke zuwarf.
»Was fällt Ihnen ein, Sie fauler Lump?«
»Entschuldigung, Ihre Heiligkeit.«
»Wo waren Sie?«
»Ich habe im Park ein Polarschnabeltier getroffen und mich mit ihm unterhalten. Ich möchte es gerne heiraten.«
Der Papst machte ein böses Gesicht.
»Eine solche Liebe kann ich nicht dulden. Nein, nein und dreimal nein.«
»Aber …«
»Sie kommen in die Hölle, wenn Sie es wagen, sich nochmals mit dem Schnabeltier zu treffen.«
Diese Worte trafen mich wie Messerstiche.
»Öffne deinen Wein in Zukunft selber!«, schrie ich dem Papst ins Gesicht und ging.
10. Die Zeit mit dem Polarschnabeltier
Wen wundert’s, dass mein Heiligenschein nach diesem Vorfall verschwunden war. Ich zog aus dem päpstlichen Schloss aus und quartierte mich im kleinen Bungalow des Polarschnabeltiers ein.
Unser Einkommen verdienten wir uns durch Zithern. Es war ein hartes Leben, doch wenn wir abends am Kaminfeuer saßen, vergaßen wir die Sorgen des Alltags.
»Du hast so ein weiches Fell«, pflegte ich manchmal zu sagen. Das Schnabeltier erwiderte dann: »Pfoten weg von meinem Fell!«, und wir lachten und lachten.
Das ging einige Zeit gut so, bis ich mich zu langweilen begann. »Ich habe das Gefühl, du hast nur deine Zither im Kopf!«, sagte ich einmal zum Schnabeltier, das die Gewohnheit hatte, seine Zither sogar mit ins Bett zu nehmen. »Wir könnten doch mal was Lustiges unternehmen … Kino oder Theater oder so.«
»Du weißt genau, dass ich heute noch drei Stunden Zithern üben muss.«
»Schon gut, schon gut«, seufzte ich und ging schlafen.
Eines Tages beobachtete ich das Polarschnabeltier, als es heimlich ins Haus des fetten Pelzhändlers schlich, der neben uns wohnte.
Als es nach drei Stunden zurückkehrte, stellte ich es mit den Worten: »Du triffst dich also mit anderen.«
»Wie bitte?«
»Ich habe dich beobachtet. Du hast behauptet, du gingest einkaufen, stattdessen warst du im Haus des Pelzhändlers.«
Das Schnabeltier blieb stumm. Ich fiel auf die Knie und begann zu schluchzen. »Warum nur, warum? Was habe ich falsch gemacht?«
Fortan war das Schnabeltier fast jeden Abend beim Pelzhändler zu Gast. Es war für mich eine Zeit größter Verzweiflung und ich begann, Apfelsaft zu trinken.
»Hast du wieder getrunken?«, fragte das Schnabeltier jedes Mal spöttisch, wenn es spät in der Nacht von seinen Seitensprüngen heimkehrte. »Schau mal, was für einen schönen Nerzmantel ich geschenkt bekommen habe!«
Eines Abends kam das Schnabeltier nicht mehr zurück. Ich wartete bis Mitternacht und ging dann zu Bett. Am nächsten Morgen suchte ich den Pelzhändler auf.
»War das Schnabeltier nicht bei Ihnen letzte Nacht?«
»Letzte Nascht?«, fragte der Pelzhändler, der sich Mühe gab, mit einem französischen Akzent zu sprechen, obwohl er aus Litauen stammte und seiner Lebtage nie in Frankreich gewesen war. »Non, pas du tout.«
»Was haben Sie mit ihm gemacht?«
»Maschen? Was sollen isch maschen mit Schnabeltier?«
»Was ist das für ein Pelz, den Sie da um Ihren Hals tragen?«
»Pelz? Wo Pelz? Isch sehen nischts, Monsieur.«
»Da ist ja noch der Schnabel dran! Sie Bestie! Sie Scheusal!«
»Isch kann alles erklären!«, stammelte der Pelzhändler. »Votre Schnabeltier, voyez, il …«
Doch ich konnte kein Wort mehr hören. Traurig machte ich mich auf den Weg zum alten Turm.
11. Des Pudels Wiederkehr
Ich stieg zur Wohnung des Priesters hinauf und klopfte. Sofort sprang die Tür auf.
»Ich will Sie um Verzeihung bitten und Ihnen meine Fehltritte beichten.«
»Verschwinden Sie! Ihre Schandtaten sind mir bekannt. Ihnen kann nicht vergeben werden«, sagte der Priester.
»Aber …«
»Nein.« Der Priester schlug die Tür zu.
Traurig verließ ich den Turm und streunte stundenlang durch die grauen Straßen der Stadt. In einem verlassenen Hinterhof entdeckte ich gegen Abend ein Haus, an dessen Tür ›Antiqariat‹ angeschrieben stand.
»Kommen Sie rein, kommen Sie rein«, hörte ich eine sonore Stimme sagen. Ein alter Mann lachte mich hinter einer Theke aus einem zahnlosen Mund an. »Ich habe etwas für Sie. Dieser Geigenkoffer hier«, und bei diesen Worten holte er einen grünen Koffer unter der Theke hervor, »ist etwas sehr Spezielles. Ich habe ihn von einem alten indischen Sekundarschullehrer übernommen, der kurz darauf seinen Geist aushauchte.«
»Was soll an diesem Geigenkoffer speziell sein?«, fragte ich. »Außer der zugegebenermaßen recht ansprechenden grünen Farbe?«
»Das Außergewöhnliche«, antwortete der Alte, »ist, dass Sie darin so viele Dinge unterbringen können, wie Sie nur wollen, und seien diese auch noch so groß.«
»Das kaufe ich Ihnen nicht ab. In einen Geigenkoffer von schätzungsweise 50 x 30 x 15 cm …«
»50 x 35 x 20 cm, mein Herr.«
»Sei’s, wie es will. In diesen Koffer passen nur Gegenstände, die ein kleineres Volumen haben als er selbst.«
»Dann schauen Sie mal zu. Ich steige jetzt in den Koffer – Sie werden zugeben müssen, dass mein Volumen dasjenige des Koffers übertrifft –, ich bin drin, mache den Deckel zu, fertig.«