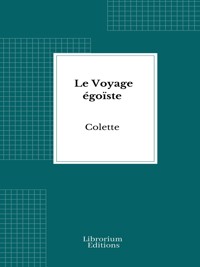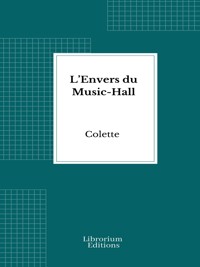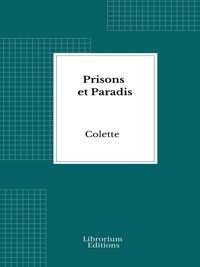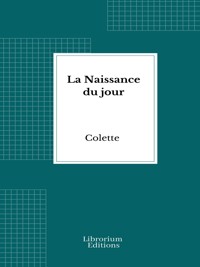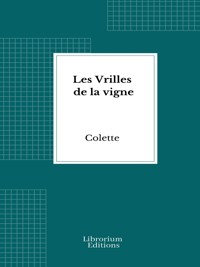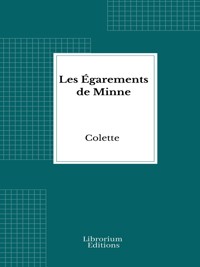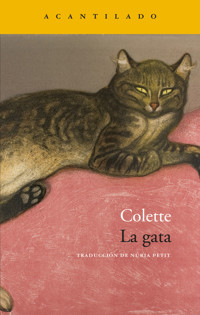1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
In "Die Reinen und Unreinen Freuden" entwirft Colette ein feinfühliges literarisches Porträt menschlicher Lust, Begehren und Identität. In poetischer Sprache und mit einer präzisen Beobachtungsgabe erforscht sie die vielschichtigen Facetten erotischer Beziehungen, von Zärtlichkeit bis zu Grenzerfahrungen, und verankert ihre Reflexionen im gesellschaftlichen Kontext der französischen Moderne. Das Werk hebt sich durch seinen introspektiven Stil und seine komplexen Figuren heraus, die zwischen Konvention und Leidenschaft oszillieren. Im Zentrum steht die Ich-Erzählerin, die als aufmerksame Beobachterin und Gesprächspartnerin fungiert. Sie trifft auf Männer und Frauen, deren Liebeserfahrungen und Sehnsüchte abseits gesellschaftlicher Konventionen liegen. Colette porträtiert etwa die leidenschaftlichen Affären von Frauen mit Frauen, die Sehnsucht nach Erfüllung, die Macht von Eifersucht und das Streben nach wahrer Intimität. Dabei zeigt sie ein tiefes Verständnis für menschliche Komplexität und Ambivalenz. Das Buch war für seine Zeit revolutionär, weil es offen über Sexualität, gleichgeschlechtliche Liebe und Tabubrüche spricht – Themen, die Anfang des 20. Jahrhunderts kaum öffentlich behandelt wurden. Colette entlarvt moralische Dogmen und feiert individuelle Freiheit und Authentizität. Auch heute bleibt das Werk relevant, da es zeitlose Fragen zu Identität, Lust und gesellschaftlichen Normen stellt. Colettes literarisches Erbe prägt die Diskussion über Liebe und Selbstbestimmung bis heute. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Reinen und Unreinen Freuden
Inhaltsverzeichnis
Oben in einem neuen Haus öffnete man mir ein Atelier, das so groß wie eine Halle war, mit einer breiten Galerie auf halber Höhe, die mit chinesischen Stickereien behängt war, wie sie China für den Westen herstellt, mit großen, etwas schlampig gearbeiteten Motiven, die aber recht schön waren. Der Rest bestand nur aus einem Flügel, trockenen kleinen Matratzen aus Japan, einem Grammophon und Azaleen in Töpfen. Wie zu erwarten, schüttelte ich einem Kollegen, Journalisten und Romancier, die Hand und nickte den fremden Gastgebern zu, die mir, Gott sei Dank, ebenso unnahbar erschienen wie ich selbst. Gut auf die Langeweile vorbereitet, nahm ich auf meiner kleinen Einzelmatratze Platz und bedauerte, dass der Opiumrauch schwer bis zu den Glasdächern aufstieg. Er entschloss sich nur widerwillig, sich dort niederzulassen, und sein schwarzer, appetitanregender Duft nach frischen Trüffeln und verbranntem Kakao gab mir Geduld, einen vagen Hunger und Optimismus. Ich fand die gedämpfte rote Farbe der verschleierten Lichter schön, die mandelförmige weiße Flamme der Opiumlampen, eine ganz in meiner Nähe, die beiden anderen verloren wie Kobolde in der Ferne in einer Art Alkoven unter der Balustrade. Ein junger Kopf beugte sich über diese Balustrade, wurde vom roten Schein der hängenden Laternen beleuchtet, ein weißer Ärmel flatterte und verschwand, bevor ich erkennen konnte, ob der Kopf mit den goldenen, wie ertrunkenen Haaren und der mit weißer Seide bekleidete Arm einer Frau oder einem Mann gehörten.
„Kommst du aus Neugierde?“, fragte mich mein Kollege.
Er lag auf seiner kleinen Matratze; ich bemerkte, dass er seinen Smoking gegen einen bestickten Kimono getauscht hatte und die Gelassenheit eines Betrunkenen ausstrahlte; ich wollte mich nur von ihm entfernen, wie ich es mit den Franzosen mache, die ich jenseits der Grenze immer als unpassend empfinde.
„Nein“, antwortete ich. „Aus beruflicher Pflicht.“
Er lächelte.
„Das habe ich mir schon gedacht... Ein Roman?“
Und ich hasste ihn noch mehr dafür, dass er mich für unfähig hielt – was ich tatsächlich war –, diesen Luxus zu genießen: ein ruhiges, etwas vulgäres Vergnügen, das nur von einer gewissen Form von Snobismus, von Prahlerei und einer eher affektierten als echten Neugierde inspiriert war... Ich hatte nur einen gut versteckten Kummer mitgebracht, der mir keine Ruhe ließ, und eine schreckliche Sinnesruhe.
Einer der unbekannten Gäste erhob sich von seinem Lager, um mir Opium zum Rauchen, Kokain zum Schnupfen und einen Cocktail anzubieten. Bei jeder Ablehnung hob er leicht die Hand, um seine Enttäuschung auszudrücken. Schließlich reichte er mir eine Schachtel Zigaretten, lächelte mit englischem Mund und fragte:
„Kann ich Ihnen wirklich nicht helfen?“
Ich bedankte mich, und er drängte nicht weiter.
Ich erinnere mich noch nach über fünfzehn Jahren daran, dass er gut aussah und gesund wirkte, nur dass er seine Augen zwischen starren Lidern zu weit offen hielt, wie man es bei Menschen sieht, die unter langjähriger, hartnäckiger Schlaflosigkeit leiden.
Eine junge Frau, so betrunken, wie ich es beurteilen konnte, bemerkte meine Anwesenheit und verkündete aus der Ferne, dass sie mir „unter die Nase schauen“ wolle. Sie wiederholte mehrmals: „Aber natürlich, unter die Nase, ich werde sie mir anschauen.“ Ich kann mich an keinen weiteren lustigen Vorfall erinnern. Ernsthafte Raucher, die im rötlichen Schatten verschwammen, brachten sie zum Schweigen. Ich glaube, einer von ihnen gab ihr Opiumknödel zum Kauen. Sie tat dies gewissenhaft mit einem kleinen Geräusch, wie ein säugendes Tier.
Mir war nicht langweilig, denn das Opium, das ich nicht rauche, erfüllte diesen banalen Ort mit einem angenehmen Duft. Zwei junge Leute, die sich um den Hals fassten, erregten die Aufmerksamkeit meines Kollegen, des Journalisten, aber sie begnügten sich damit, leise und schnell zu reden. Einer von ihnen schnüffelte ständig und wischte sich die Augen mit dem Ärmel ab. Das dunkle Rot, das uns umgab, hätte selbst den besten Willen betäuben können. Ich befand mich in einer Opiumhöhle und nicht in einer dieser Versammlungen, in denen der Zuschauer in der Regel eine ziemlich anhaltende Abneigung gegen das, was er sieht, und gegen seine eigene Selbstgefälligkeit empfindet. Ich freute mich darüber und begann zu hoffen, dass keine nackten Tänzerinnen oder Tänzer die Abendgesellschaft stören würden, dass keine Gefahr durch alkoholisierte Amerikaner drohte und dass sogar die Columbia schweigen würde... Im selben Moment begann eine weibliche Stimme, watteweich, rau und sanft wie harte Pfirsiche mit dicker Schale, zu singen, und sie gefiel uns allen so gut, dass wir uns hüteten, auch nur zu flüstern.
„Bist du das, Charlotte?“, fragte nach einer Weile einer meiner Nachbarn, der ausgestreckt dalag und sich nicht bewegte.
„Natürlich bin ich das.
– Sing noch ein bisschen, Charlotte ...
„Nein“, schrie eine männliche Stimme wütend. „Dafür ist sie nicht hier.“
Ich hörte das heisere, dumpfe Lachen von „Charlotte“, dann flüsterte derselbe verärgerte Junge in der rötlichen Ferne.
Gegen 2 Uhr morgens, als der junge Mann uns schlaflos blassen, stark duftenden chinesischen Tee einschenkte, der nach blühendem Heu roch, kamen eine Frau und zwei Männer herein und brachten die Kälte der Nacht, die sich in ihren Pelzmänteln festgesetzt hatte, in die duftende, trübe Luft der Werkstatt. Einer der Neuankömmlinge fragte, ob „Charlotte“ da sei. Am anderen Ende des Raumes zerbrach eine Tasse, und ich hörte wieder die wütende Stimme des Jungen:
„Ja, sie ist da. Sie ist hier bei mir, und das geht niemanden etwas an. Lasst sie einfach in Ruhe.”
Der Neuankömmling zuckte mit den Schultern, warf seinen Pelzmantel und seinen Smoking zu Boden, als wolle er sich auf einen Kampf einlassen, zog jedoch nur einen schwarzen Kimono an, ließ sich neben einem der Pfeifentabletts nieder und begann, mit einer unangenehmen Gier den Rauch zu inhalieren, dass man ihm am liebsten Sandwiches, kaltes Kalbfleisch, Rotwein, gekochte Eier irgendetwas anderes, das seine Völlerei besser stillen könnte. Seine pelzbedeckte Begleiterin suchte die betrunkene junge Frau auf, die sie „meine Hübsche” nannte, und ich hatte keine Zeit, ihre Freundschaft zu verurteilen, denn sie schliefen sofort ein, der Bauch der einen an den Po der anderen geschmiegt wie Löffel in der Besteckschublade.
Die Kälte sank trotz der eingeschlossenen Wärme von der Glasdecke herab und kündigte das Ende der Nacht an. Ich zog meinen Mantel enger um mich und bedauerte, dass eine Trägheit, die aus dem dunklen Duft und der späten Stunde herrührte, mich noch davon abhielt, mein Bett aufzusuchen. Nach dem Vorbild der Weisen und Verlassenen, die dort lagen, hätte ich ohne Angst schlafen können, aber wenn ich nicht auf einer Terrasse oder auf einem Bett aus Tannennadeln vertrauensvoll schlummere, weckt jeder geschlossene und mir unbekannte Ort mein Misstrauen.
Die schmale Treppe aus gewachstem Holz knarrte unter Schritten, dann die obere Galerie. Ich hörte über mir das Rascheln von Stoffen, das sanfte Fallen von Kissen auf den hallenden Boden, und dann kehrte wieder Stille ein. Aber aus dieser Stille heraus entstand unmerklich ein Laut in einer Frauenkehle, ein Laut, der sich heiser anhörte, klarer wurde, an Festigkeit und Fülle gewann, indem er sich wiederholte, wie die vollen Töne, die die Nachtigall wiederholt und anhäuft, bis sie in einer Trillerfloskel zerfallen... Eine Frau oben kämpfte gegen ihre überwältigende Lust, trieb sie zu ihrem Ende und ihrer Zerstörung, zunächst in einem ruhigen Rhythmus, so harmonisch, so regelmäßig beschleunigt, dass ich mich dabei ertappte, wie ich mit einem Nicken ihres Kopfes ihrem ebenso perfekten Rhythmus wie ihrer Melodie folgte.
Der unbekannte Nachbar richtete sich halb auf und sagte leise:
„Das ist Charlotte.“
Keine der schlafenden jungen Frauen wachte auf; keiner der undeutlichen, vermummten jungen Männer lachte laut oder applaudierte der Stimme, die in einem leisen Schluchzen abbrach. Alle Seufzer verstummten dort oben. Und die Weisen unten spürten alle zusammen die Kälte der Winterdämmerung. Ich zog meinen pelzigen Mantel enger um mich, ein liegender Nachbar zog sich einen bestickten Stoff über die Schulter und schloss die Augen. Im Hintergrund, in der Nähe einer Seidenlaterne, rückten die beiden schlafenden Frauen noch näher zusammen, ohne aufzuwachen, und die kleinen Flammen der Öllampen flackerten unter der Last der kalten Luft, die vom Glasdach herabströmte.
Ich stand auf, steif von der langen Unbeweglichkeit, und zählte mit den Augen die Matratzen und Körper, über die ich steigen musste, als die Holzstufen erneut knarrten. Eine Frau in einem dunklen Mantel, die zur Tür ging, blieb stehen, um ihren Handschuh zuzuknöpfen, zog vorsichtig einen Schleier bis zum Kinn herunter und öffnete ihre Tasche, in der Schlüssel klimperten.
„Ich habe immer Angst...“, begann sie leise...
Sie sprach mit sich selbst und lächelte mich an, als sie sah, dass ich gehen wollte.
„Gehen Sie auch, Madame? Wenn Sie den Zeitschalter nutzen möchten ... Ich gehe vor, ich weiß, wo der Knopf ist.“
Auf der Treppe, wo ihre Hand ein grelles Licht hervorbrachte, sah ich meine Begleiterin besser, weder groß noch klein, eher rundlich. Mit ihrer kurzen Nase und ihrem fleischigen Gesicht ähnelte sie den Lieblingsmodellen von Renoir, den Schönheiten von 1875, so sehr, dass man ihr trotz des olivgrünen Mantels mit Fuchskragen und dem kleinen Hut, der vor achtzehn Jahren in Mode war, etwas Altmodisches annehmen konnte. Ihre vermutlich fünfundvierzig Jahre hatten ihr nichts von ihrer Frische genommen, und in den Wendungen der Treppe hob sie ihre großen grauen Augen zu mir, sanft und ein wenig grün wie ihr Mantel.
Die frische, noch dunkle Luft stillte meinen Durst. Ein tägliches Verlangen nach klaren Morgenstunden, nach Ausflügen in die Felder und Wälder, zumindest in den nahe gelegenen Wald, ließ mich am Straßenrand zögern.
„Hast du kein Auto?“, fragte meine Begleiterin. „Ich auch nicht. Aber um diese Uhrzeit findet man in dieser Gegend immer ein Auto ...“
Während sie sprach, tauchte ein Taxi aus dem Wald auf, wurde langsamer, hielt an und meine Freundin trat beiseite.
„Bitte, Madame...“
– Aber nein, machen Sie mir doch eine Freude...
– Auf keinen Fall. Oder soll ich dich nach Hause fahren?“
Sie unterbrach sich, machte eine entschuldigende Geste, die ich leicht deuten konnte und gegen die ich protestierte:
„Aber das ist doch nicht indiskret. Ich wohne nicht weit weg, am Außenboulevard ...“
Wir stiegen ein und das Taxi machte kehrt. Die kleine, schräg stehende Lampe des Taxameters beleuchtete immer wieder das Gesicht der Frau, die ich nur mit ihrem echten oder falschen Vornamen kannte: Charlotte...
Sie unterdrückte ein Gähnen und seufzte:
„Ich bin noch nicht da, ich wohne am Lion de Belfort... Ich bin müde...“
Ich musste unwillkürlich lächeln, denn sie sah mich unverfroren an, mit einer bürgerlichen Freundlichkeit, die ihr gut stand:
„Ah ja“, sagte sie, „Sie lachen über mich... Ich weiß genau, was Sie denken.“
Der charmante Klang ihrer Stimme, das raue Ansetzen bestimmter Silben, eine resignierte und sanfte Art, das Ende der Sätze in den tiefen Tonfall fallen zu lassen... Wie verführerisch!... Der Wind, der durch das offene Fenster rechts von „Charlotte“ hereinwehte, trug ihren recht gewöhnlichen Duft und einen gesunden, lebhaften Geruch von Haut zu mir herüber, der durch den Geruch von kaltem Tabak verdorben wurde.
„Das ist bedauerlich...“, begann sie wie zufällig. „Der arme Kleine...“
Frage ich gehorsam:
„Welcher arme Kleine?“
– Hast du ihn nicht gesehen? Nein, du hast ihn bestimmt nicht gesehen... Dabei warst du doch schon da, als er sich oben über die Balustrade beugte. Er trug einen weißen Kimono.
– Und blonde Haare?
„Genau“, sagte sie leise. „Das ist er. Er macht mir große Sorgen“, fügte sie hinzu.
Ich erlaubte mir dieses verschmitzte Lächeln, das mir so schlecht steht:
„Nur Sorgen?“
Sie zuckte mit den Schultern:
„Glaub doch, was du willst.
„Dieser junge Mann hat dich am Singen gehindert, nicht wahr?“
Sie nickte ernst:
„Ja. Er ist eifersüchtig. Nicht, dass ich eine schöne Stimme hätte, aber ich singe gut.
„Ich wollte dir gerade das Gegenteil sagen. Du hast eine Stimme ...“
Sie zuckte wieder mit den Schultern.
„Wie du willst. Die einen sagen dies, die anderen sagen das... Soll ich das Taxi vor deiner Tür anhalten lassen?“
Ich hielt ihren hilfsbereiten Arm zurück.
„Überhaupt nicht. Bitte nicht.“
Sie schien ein wenig enttäuscht, dass sie sich zurückgehalten hatte, und stellte mir eine Frage, die wie ein vertraulicher Hinweis klang:
„Ein bisschen Opium ab und zu ist doch nicht so schlimm für einen jungen Mann mit empfindlichen Lungen, oder?“
„Nein ... nicht so schlimm ...“, sagte ich vage.
Ein tiefer Seufzer hob ihre hohen, vollen Wangen.
„Das ist eine große Sorge“, wiederholte sie. „Na ja, wenn man zwei Wochen lang brav seine Tabletten genommen, rotes Fleisch gegessen und bei offenem Fenster geschlafen hat, hat man sich doch ab und zu eine Belohnung verdient.“
Sie lachte leise mit ihrem harmonischen, heiseren Lachen:
„Er sagt, das sei eine Orgie, stellen Sie sich das vor ... Er ist stolz ... Madame“, sagte sie lebhaft, „die Schlammschicht liegt vor Ihrer Tür, stört es Sie nicht, vor ihnen hinunterzugehen? Nein? Umso besser. Die Freiheit ist schön. Ich ... ich bin nicht frei.“
Sie verschloss sich plötzlich, reichte mir abwesend ihre Hand und schenkte mir das kleine bürgerliche Lächeln ihrer großen Augen, die grün schimmerten wie die Wasserpfützen, die das Meer beim Ebbe zurücklässt.
*
Ich sah Charlotte nicht sofort wieder. Ich suchte sie nicht, zumindest nicht an den Orten, an denen ich sie mir vorstellen konnte, zum Beispiel bei einer Hochzeit am linken Seineufer oder in einer alten Wohnung, in einer dieser Familien, die in Paris stark an ihrer Provinz festhalten. Ich stelle mir vor, dass mir ihre Anwesenheit an einem sechseckigen Tischchen, umgeben von Keksen, ganz natürlich erschienen wäre. Ich sah sie vor mir, wie sie in ihrem olivgrünen Mantel saß, den kleinen Hut über die Augen gezogen, den Schleier wie eine Jalousie über die Nase gezogen und eine Tasse faden Tee zwischen zwei Fingern haltend. Ich erfand sie, hörte ihren bescheidenen, ehrlichen Akzent, mit dem sie alte, mürrische Gastgeberinnen zu überzeugen wusste: „Ich, wissen Sie, um Ihnen meine Meinung zu sagen ...“
Ich suchte sie nicht, weil ich Angst hatte, das Geheimnisvolle zu zerstören, das wir mit Menschen verbinden, die wir nur in ihrer Einfachheit kennen. Aber ich war nicht überrascht, sie eines Tages vor mir zu sehen, als ich Bücher für einen guten Zweck verkaufte. Sie kaufte einen Band und lächelte mich ganz diskret an. Ich fragte sie mit einer Eile, die sie zu überraschen schien:
„Soll ich das Buch widmen, Madame?“
„Oh, Madame... Wenn es nicht zu viel verlangt ist...“
– Aber natürlich, Madame... Für wen?
– Nun, Madame... Schreiben Sie einfach „Für Madame Charlotte“...“
Zu all diesen „Madame”, die wir feierlich austauschten, fügte Charlotte ein Lachen hinzu, das ich wiedererkannte, ein leises Lachen, so sanft und ergreifend wie die Sprache der kleinen Nachtvögel, dieser Schattentauben...
Und ich fragte unbeholfen:
„Bist du ganz allein?“
– Ich gehe kaum allein aus, antwortete Charlotte. Wir haben Sie dort nicht wieder gesehen...“
Sie sagte leise, während sie in dem Buch blätterte, das sie gerade gekauft hatte:
„Sonntagabends sind sie immer dort...“
Ich nahm diese indirekte Einladung an, um Charlotte wiederzusehen, eine Freude, die größer war, als ich gehofft hatte, denn sie war allein in dem einladenden und ungemütlichen Atelier, das wie ein Bahnhof wirkte. Kein aufbrausender Junge stand neben ihr im roten Schatten, der sich unter der Galerie sammelte. Mit unbedecktem Kopf, wohlgeformt und ein wenig rund in ihrem schwarzen Kleid, hatte sie den rituellen Kimono nicht angezogen. Sie trank Mate und bot mir in einer gelb-schwarzen Kalebasse das Getränk an, das nach Tee und blühender Wiese roch:
„Nimm die Bombilla, die ich gerade abgekühlt habe“, sagte sie und reichte mir den spatenförmigen Trinkhalm. „Geht es dir gut? Hast du ein Kissen hinter dem Rücken? Sieh nur, wie ruhig es heute Abend ist ... Keine Frauen ... Die da hinten? Engländer, seriöse Leute, die nur wegen des Opiums kommen.“
Ihre ruhige Hilfsbereitschaft, ihre gedämpfte Stimme und ihr graugrüner Blick hätten selbst die härtesten Herzen erweicht. Ihre molligen Arme, die bürgerliche und stumme Geschicklichkeit jeder ihrer Bewegungen, was für Fallen für den jungen, jähzornigen Liebhaber!
„Sie sind allein, wie ich sehe, Madame Charlotte?“
Sie nickte ruhig mit dem Kopf.
„Ich ruhe mich aus“, sagte sie einfach. „Sie werden mir sagen, dass ich mich zu Hause ausruhen könnte ...
Zu Hause kann man sich nicht richtig ausruhen.“
Sie ließ ihren selbstbewussten, wohlwollenden Blick um uns schweifen und atmete tief den Duft des Opiums ein, den ich selbst genoss, wie es nur Nichtraucher tun.
„Wo sind wir hier?“, fragte ich.
„Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht“, sagte Charlotte. „Ich kenne diesen Ort von Malern. Möchten Sie es wirklich wissen?“
– Nein.
„Das hat mich auch gewundert ... Es ist so schön, nicht zu wissen, wo man ist ...“
Sie lächelte mich vertrauensvoll an. Damit sie sich noch mehr hingeben konnte, hätte ich mir gewünscht, dass sie meinen Namen nicht wusste.
„Ist dein junger Freund nicht krank, Madame Charlotte?“
– Gott sei Dank, nein. Er ist bei Verwandten auf dem Land. Er kommt in acht Tagen zurück...“
Sie verdüsterte sich ein wenig und verlor ihren Blick in der rötlichen, rauchigen Tiefe des Ateliers.
„Es ist so anstrengend, jemanden zu lieben!“, seufzte sie. „Ich mag nicht gerne lügen.“
– Wie, lügen? Warum? Du liebst ihn doch?
– Natürlich liebe ich ihn.
„Aber dann ...“
Sie warf mir einen herrlichen Blick von oben herab zu, den sie dann milderte:
„Nehmen wir mal an, ich hab keine Ahnung davon“, sagte sie höflich.