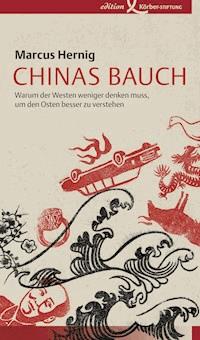2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wo einst endlose Kamelkarawanen den Mittelmeerraum mit Ostasien verbanden, entsteht heute das Megaprojekt der Volksrepublik China: die Neue Seidenstraße. Chinas Staatschef Xi Jinping will an die Größe Chinas zu Zeiten Marco Polos anknüpfen und investiert fast eine Billion Dollar in die neue Handelsroute von Shanghai nach Rotterdam. Es ist das größte Infrastrukturvorhaben seit dem Marshallplan. Doch nicht überall stößt Chinas Renaissance auf Begeisterung: Viele Länder entlang der Handelsrouten fühlen sich von der Machtdemonstration Chinas herausgefordert, und die EU fürchtet eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Zu Recht? In seinem neuen Buch berichtet Chinaexperte Marcus Hernig nicht nur von Chinas Vision der Rückkehr zu historischer Größe und der Angst vor der »Gelben Gefahr«, sondern auch davon, wie Europa auf die Renaissance der Seidenstraße reagieren muss – eine faszinierende Reise entlang der legendärsten Handelsroute der Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
MARCUS HERNIG
DIE RENAISSANCE DER SEIDENSTRASSE
DER WEG DES CHINESISCHEN DRACHENS INS HERZ EUROPAS
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Originalausgabe, 1. Auflage 2018
EDITION TICHYS EINBLICK
© 2018 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Anne Horsten
Korrektorat: Astrid Treusch
Umschlaggestaltung: Manuela Amode
Umschlagabbildung: iStock/ly86
Abbildungen im Innenteil: Abbildung 1: MicroOne/Shutterstock, Abbildung 2: Pasticcio/ istock, Abbildung 3: dikobraziy/Shutterstsock, Abbildung 7: Peteri/Shutterstock, Abbildung 4-6: Marc-Torben Fischer
Satz: Röser MEDIA GmbH & Co. KG, Karlsruhe
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-95972-138-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-252-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-253-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Man verkennt China vollständig, wenn man seine gewaltige historische Dimension außer Acht lässt.
JACQUES GERNET
INHALT
Kapitel 1 Der Wind weht von Osten
Brennpunkt Neue Seidenstraße – Größenwahn oder große Chance?
Die Ära des Westens geht zu Ende
Eine veränderte Weltsicht
Nationale Renaissancen
West und Ost – Wetteifernde Zwillinge
China als Alternative
Kapitel 2 Die Seidenstraße
Was bezweckt China mit der Neuen Seidenstraße?
Eine alte Geschichte – Wer erfand die Seidenstraße?
Eine moderne Geschichte – Die Belt-and-Road-Initiative
Belt and Road versus Achse des Guten
Neue Verbindungen im Osten
Chinesische Grenzüberschreitungen
China »in action« – Aktivitäten auf vier Arbeitsfeldern
Kapitel 3 Sandstürme und Monsunwinde
Die Wahrnehmung Chinas wird negativer
Handel erzeugt Profit, aber auch Konflikt
Hegemonie und große Pläne
Zwischen Misstrauen und Rivalität
China ist fremd
China steht für nichts – Das muss sich ändern
Kapitel 4 Westwindflaute
Sinkende Sterne
Europas Krisen sind hausgemacht
Einer träumt, die anderen rechnen – Das TRACECA-Dilemma
Deutschland – Ein Paradox
Kapitel 5 Europa und der Drache
Europa, der Stier und der Drache – Zeit für einen Wechsel?
Die Hanse – Eine frühe »Belt-and-Road-Initiative« made in Germany
Den Drachen reiten – Hinein in die Zukunft
Anmerkungen
KAPITEL 1 DER WIND WEHT VON OSTEN
Brennpunkt Neue Seidenstraße – Größenwahn oder große Chance?
Der Drache schnaubt laut mitten in Europa. Er macht dabei viel Wind, der uns ins Gesicht weht: Firmenkäufe, Touristenmassen und eine neue Politik namens Belt-and-Road-Initiative, kurz: BRI. Auch bekannt als Neue Seidenstraße. Das ist der lange Schwanz des Untiers. Bis zurück nach China reicht er. Sein Schwanz ist gegabelt, denn es sind zwei Systeme von Wegen nach China, insgesamt deutlich länger als der halbe Erdumfang.
Während die Nasenspitze des Drachens in Rotterdam liegt und neuen Wind Richtung England bläst, windet sich der Gabelschwanz über Land und durch die Meere. Der eine Teil davon wühlt den Sand der eurasischen Steppe auf, der andere peitscht durch den Indischen Ozean.
Abbildung 1: Die zwei Systeme der Belt-and-Road-Initiative (BRI)
Doch der Drache ist nicht irgendein Tier. Er ist ein Fabelwesen und daher unheimlich, phantastisch. Zudem schätzen ihn West und Ost sehr unterschiedlich ein: In China symbolisiert die Kreatur das Männliche, Starke, den Herrscher. Sie verkündet das neue Jahr und damit pulsierendes Leben. In Deutschland sieht das anders aus: Im Mittelalter glaubte man fest daran, dass Drachen existierten und die Menschen bedrohten. Das machte diese Epoche noch etwas finsterer. Die Angst vor China, dem Untier in Drachengestalt, ist noch immer da – nicht zuletzt, weil der heutige Lindwurm kein europäisches Geschöpf mehr ist. Skeptische Fragen kommen auf, etwa diese:
• Wie sehen die Chinesen die Welt, und was haben sie mit ihr vor?
• Was bezweckt China mit diesem »Drachenschwanz«, der Neuen Seidenstraße?
• Ist die Neue Seidenstraße eine Form des neuen Imperialismus aus dem Reich der Mitte in Asien und weltweit?
• Unterwandert China so die Demokratie hierzulande?
• Werden unsere Nachbarn im Osten mit chinesischen Krediten abhängig gemacht?
• Wird China mit seiner aggressiven Globalstrategie einen Krieg provozieren?
• Welche Fehler haben wir in Europa gemacht, dass es so weit kommen konnte?
• Welche unserer Fehler haben die Chinesen als solche erkannt und nutzen sie möglicherweise für sich?
• Wie können Deutsche und Europäer mit dem chinesischen Drachen klarkommen? Können wir ihn reiten?
• Was haben wir selbst zu bieten?
• Wie sieht unsere Zukunft aus?
Widmen wir uns zunächst der ersten Frage, die eine doppelte ist: Wie sehen die Chinesen die Welt, und was haben sie mit ihr vor? Um Antworten zu finden, müssen wir reisen. Nach Astana in Kasachstan. In das Auditorium einer Hochschule. Dort stehen zwei rote und zwei blaue Flaggen ordentlich über Kreuz vor einer Leinwand. Darüber eine goldene Aufschrift: Nazarbayev University. Davor ein Podium mit vier Sitzplätzen. Der zweite Sessel von links ist frei. Der Mann, der soeben noch darauf saß, geht gemessenen Schrittes zu einem Rednerpult, das links daneben steht. Alles ist aus dunklem Holz und könnte auch das Auditorium einer beliebigen US-amerikanischen Universität sein, wären da nicht die beiden Flaggen und der Name »Nazarbayev«.
Nursultan Nazarbayev, Jahrgang 1940, regiert seit 1990 dieses Land. Die Stadt heißt Astana, doch im Grunde müsste sie »Nazarpolis« heißen. Astana ist das Werk des Staatsführers, eine Retortenhauptstadt, die in nur zwei Jahrzehnten aus der Steppe emporgehoben wurde. Nazarbayev ist jemand, der niemanden über oder neben sich duldet. Doch jetzt schweigt der kasachische »Führer der Nation (ult lideri)« und versucht, sich auf den Redner zu konzentrieren.
»Verehrter Herr Präsident ...«, beginnt der Mann in schwarzem Maßanzug und mit blauer Krawatte seine Rede in chinesischer Sprache.1 Die Form ist gewahrt, der 13 Jahre ältere Führer der Nation nickt. Über die ergrauten Züge des Machthabers huscht ein leichtes Lächeln. Er trägt einen Kopfhörer, um die Worte des Redners zu verstehen, denn Chinesisch beherrscht er offenbar nicht. Der Mann im Maßanzug redet weiter. Er nennt einen Namen: Zhang Qian, ein Landsmann, der vor 2100 Jahren lebte und bereits die »Seidenstraße erschlossen« haben soll. Der Redner wird sentimental, wechselt ins Persönliche. Bilder von Kamelkarawanen ziehen an seinem geistigen Auge vorüber, so real, dass er »sogar das Läuten von Kamelglocken zwischen den Bergen« höre und »aus der Wüste, welche die Karawane durchzieht, Rauch kräuselnd in Schwaden aufsteigen« sehe. Für Sekunden hält er inne, kräuselt die Nase – so als röche er den Rauch.
»Ich stamme vom Anfangspunkt dieser Straße«, sagt er, »aus der chinesischen Provinz Shaanxi. Kasachstan ist ein Land, durch das die Seidenstraße zieht.« Er sei »vertraut und verbunden« mit dem Land seines Gastgebers, das er als »nahen Nachbarn« bezeichnet. Dann folgen weitere Bilder aus ferner Zeit: Er sehe »einen unaufhaltsamen Strom von Gesandten, von Händlern, Reisenden, Gelehrten, Handwerkern aus Ost und West«, ein »gegenseitiges Geben und Nehmen«, er fühle den damaligen »Austausch und das gegenseitige Lernen, was gemeinsam zum Fortschritt der Menschheit beitrug«. Geschichte wird lebendig, indem Xi Jinping sie zitiert.
Der Mann am Rednerpult, Staatspräsident der Volksrepublik China, fixiert sein Publikum. Er fährt fort: »Seit über 20 Jahren hat die Alte Seidenstraße durch die rasche Entwicklung der Beziehungen zwischen China und den Staaten Eurasiens Tag für Tag neue Vitalität, neue Lebenskraft gewonnen, und gegenwärtig bietet sich China und den Seidenstraßenländern eine einmalige Chance, einen neuen Wirtschaftsgürtel entlang dieser alten Route aufzubauen.«
»Wirtschaftsgürtel« und »Seidenstraße«. Daraus prägt Xi Jinping einen neuen Begriff: yi dai – yi lu, wörtlich »ein Gürtel – eine Straße«. »Zusammenarbeit« (hezuo) lautet sein Credo, und »Zusammenarbeit soll im Politischen stattfinden, wo wir gemeinsam nach Wegen und Strategien zur wirtschaftlichen Entwicklung suchen wollen«. Suchen westliche Denker und Strategen gern nach dem Trennenden, das die Zusammenarbeit einschränken könnte, so folgt Xi dem Prinzip des »Gemeinsamkeiten-Suchens«. »Nicht von der Maas bis an die Memel« – das wäre viel zu kleinteilig und zu wenig ambitioniert – reichen die künftigen Verkehrsverbindungen. Sie sollen dagegen »den Pazifik mit der Ostsee verbinden«.
Der Redner macht eine Kunstpause, eine genüssliche Handbewegung, bevor er den wichtigen dritten Punkt des neuen Seidenstraßenzeitalters nennt – den freien Handel: »Möglichkeiten für drei Milliarden Menschen entlang des Seidenstraßengürtels«, eine einzigartige Chance ökonomischer Vernetzung und Beseitigung der Tarifschranken zwischen den Seidenstraßenökonomien. Diese im Einklang damit, dass eine »beschleunigte Geldzirkulation« so wie die bereits verbesserten Bedingungen zwischen China und Russland den Handel entlang der Routen noch stärker befeuern mögen. »Ja, und am Ende«, so schließt Chinas Präsident, »soll dann die Annäherung der Herzen aller Völker des Seidenstraßengürtels stehen.«
Gefühle am Ende einer Rede. Gefühle für Großes. Die Zukunft glänzt in den Augen des Redners. Unter dem Pathos seiner Wortwahl wird klar, dass dieser Mann mit der Seidenstraße einen Baustein von Jahrhundertformat auf die Baustelle politischer Gestaltung des 21. Jahrhunderts gehievt hat. Dieser Baustein ist Teil eines Arsenals von Baumaterialien, die unter dem Sammelbegriff »Wiedergeburt« oder »Renaissance« für Größe stehen.
Das chinesische Wort dafür lautet fuxing. Fuxing steht daher auch als Motto auf jedem neuen Hochgeschwindigkeitszug, der seit dem 25. Juni 2017 ausgeliefert wird. Mit kommerziell nutzbaren Spitzengeschwindigkeiten von 350 km/h übertrifft er den deutschen ICE 3. Züge dieser Art symbolisieren Chinas Drang in die Welt. Die chinesische Führung würde es begrüßen, wenn sie bald in ganz Eurasien unterwegs wären.2Fuxing mit modernster Technik, fuxing als Auferstehung bewährter Außenpolitik, die China schon um die Zeit Christi Geburt mit dem römischen Kaiserreich in Verbindung brachte.
Der Mann am Rednerpult spricht es nicht offen aus, doch er meint es: In Wahrheit geht es um die Verknüpfung Chinas mit Europa. Die eurasischen Brückenländer sind Quellen noch längst nicht ausgeschöpfter Bodenschätze, Partner eines gigantischen neuen Transportnetzes. Ihre Ergebenheit sichert die souveräne Spitzenstellung auf unserem Planeten. Von dieser enormen Herausforderung handelt dieses Buch – und davon, wie Europäer darauf reagieren können und mehr noch: reagieren müssen.
Das Bild der Kamelglocken und rauchenden Wüstenfeuer ist nicht allein rhetorisches Pathos ohne Gefühl, sondern entstammt den Visionen eines chinesischen Führers. Dieses Gespür für die Bedeutung der Geschichte – im kaiserzeitlichen China gehörten Historiografen zu den einflussreichsten Ministern – unterscheidet das chinesische Denken vom deutschen politischen Denken und Handeln der Gegenwart. Bei uns versickert deutsche Geschichte oft genug im Dritten Reich. Mehr ist nicht gefragt, Geschichte endet da, wo sie anfangen müsste – bei dem, was unser Land formte.
Die Seidenstraße war einst ein Geflecht von Handelsrouten durch Zentralasien zwischen China und Europa. Sie steht für eine Zeit, als das Reich der Mitte sich anschickte, eine aktive Handelsbilanz mit der Welt aufzubauen, dazu noch in einer Region, welche die führenden Kulturen ihrer Zeit umfasste.
China, das mongolische Weltreich, die Genese der Türken, die persische Ästhetik, einschließlich des Erbes griechischer Expansion unter Alexander dem Großen, bis zu den Römern, ohne die unser Europa heute nicht denkbar wäre. All diese Völker, Kulturen und »Länder«, von denen Xi spricht, gehören dazu. Sie waren einst eng verbunden durch diese Straßen. Es braucht im Grunde nicht mehr, um zu verstehen, warum der britische Historiker Peter Frankopan hier vom »Mediterra in seiner wörtlichen Bedeutung«, von der wahren Mitte der Welt, spricht.3 Frankopans Mitte der Welt besteht aus einem Netz von Straßen, das über viele Jahrhunderte fast alle Bereiche menschlicher Zivilisation zum Gegenstand des Austauschs zwischen den Völkern Europas und Asiens machte: Glaube und Religion, Revolutionen, Handel, Geldwesen, Tod und Zerstörung, himmlische Sehnsüchte, weltliche Reiche, Krisen, Rohstoffe, Kalter Krieg, Rivalität zwischen Supermächten und vieles andere, allzu Menschliches mehr.4 Die Seidenstraßen waren Schlagadern im Organismus der großen Zivilisationen. Sie beförderten Weltreligionen, Welthandel und eine Außenpolitik, die, statt ständiger Beschränkung durch Dauerbeschäftigung mit inneren Problemen, den großen Ausblick auf Neues wagte. Die Seidenstraße gebar Visionen.
Wir empfinden oft das Gegenteil, wenn wir weiter nach Osten, mitten nach Asien blicken. Wir sind beunruhigt von den Feuern der aktuellen Kriege, dem Elend des radikalen Islamismus, von den tristen Monokulturen, die gestern das Sowjetreich und heute der überall dominante Islam dieser Region beschert haben und noch bescheren. Es ist nicht unbedingt ein Bild des Glanzes, das Zentral- und Westasien derzeit liefern. Selbst Osteuropa bietet nicht immer Positivbilder.
Nur wenige Monate nach seiner Grundsatzrede von Astana ist Xi am 3. Oktober 2013 zurück auf der Bühne. Diesmal in Jakarta, als Ehrengast des indonesischen Parlaments, was die BBC immerhin zu der Meldung veranlasst, dass Xi wohl der »erste ausländische Staatsführer« sei, dem es vergönnt ist, dort zu reden. Wie schon in Astana scheint es Xi auch in Djakarta nichts auszumachen, unter dem Namen oder Konterfei eines anderen starken Mannes zu reden. Waren es die goldenen Schriftzüge, die in Astana Nazarbayevs Namen über dem Redner glänzen ließen, so ist es hier ein Porträt des Staatspräsidenten Susilo Bambang Yudhoyono, der als ehemaliger General den Inselstaat zwischen 2004 und 2014 führte.
Obwohl Indonesien und China enge Handelspartner sind und ethnische Chinesen einen gewichtigen Teil der indonesischen Bevölkerung ausmachen, ist die Inseldemokratie muslimischer Prägung Mitglied der ASEAN-Staaten, zu denen auch Chinas Dauergegner Vietnam gehört. Indonesien, als bevölkerungs- und auch ökonomisch stärkstes Land der ASEAN, ist auch Sitz des Verbandes. Nicht ganz einfach ist also die Ausgangsposition für Xi Jinping.
Doch der bleibt unbeirrbar am Rednerpult und lässt wie in Astana das Bildnis des einheimischen Machthabers hinter ihm unscharf werden: Wieder sind es Emotionen, welche die Rede des Chinesen durchziehen. Er spricht von »Blutsverwandtschaft, gemeinsamen Flüssen und Bergen«, die man sich teile. Trotz aller Spannungen, die China mit einzelnen ASEAN-Mitgliedern, wie etwa Vietnam, hat, zieht der Staatspräsident wieder die Harmoniekarte. Ausgesprochen persönlich wird er, als er einen früheren Besuch des damals amtierenden Staatschefs Yudhoyono in China 2006 anspricht: »Berge und Flüsse in China bewegten Präsident Yudhoyono damals sehr. Sie erinnerten ihn an seine Kindheit und seinen Heimatort.« Auch hier wieder das Gefühl. Bande zwischen zweien, die sich schon aufgrund ihrer »Blutsverwandtschaft« bestens verstehen müssten.
Für den Redner am Pult sind die Gefühle des Indonesiers – vorausgesetzt, sie waren echt – Beweise der »starken Bande« und der Affinität beider Staaten zueinander. Und diese Affinität ist nun der Schlüssel, der den Mann, der heute eine merkwürdig blass glänzende, fast rostrote Krawatte trägt, zum Kern seiner Botschaft vorstoßen lässt, die nicht nur an das indonesische Volk und seine Gastgeber allein gerichtet ist: »Südostasien bildete schon im Altertum einen wichtigen Knotenpunkt der maritimen Seidenstraße« und gemeinsame Aufgabe sei es, »eine maritime Seidenstraße des 21. Jahrhunderts aufzubauen«.
Damit kommt auch das zweite Großprojekt offen zur Sprache. Die aktive Wiederbelebung und Verstärkung einer der wichtigsten maritimen Handelsrouten der Welt wird historisch legitimiert. Schon längst bewegt sich mehr als die Hälfte des Welt-Container-Aufkommens über eine lange Route. Diese verläuft vom Suezkanal durch die Straße von Hormus, den Persischen Golf, den Golf von Bangalen. Sie führt vorbei an der Südspitze Indiens und Sri Lankas, wonach sie schließlich die ASEAN-Staaten erreicht, um nach Durchfahren der Straße von Malakka, jenem Engpass zwischen Singapur und Sumatra, auf die umstrittenen Hoheitsgewässer des Südchinesischen Meeres zu treffen. Um dieses Territorium streitet sich China mit einigen ASEAN-Staaten.
In diesen Gewässern materialisiert sich der Welthandel des 21. Jahrhunderts in kilometerlangen Schiffskolonnen, in modernen Stahlkarawanen zur See. Wie an Perlen auf einer Schnur kämpfen sie sich die südostchinesische Küste entlang nach Norden, um schließlich Shanghai oder Qingdao zu erreichen. Wer sich mit dem Flugzeug von Japan der chinesischen Küste bei Shanghai nähert und das Glück hat, in einem dunstfreien Moment auf das graubraune Meer unter sich zu blicken, sieht die modernen Armadas unserer Zeit. Tausende Kilometer weiter südwestlich steigt er auf einen Wolkenkratzer in Singapur und sieht sie erneut unter sich – die wartende Schiffskarawane. Sie versinnbildlicht die Dimensionen globalisierter Warenwirtschaft.
Zu den kommerziellen Gütern kommt das Öl, das in unterschiedlichen Derivaten per Tanker entlang der Küsten des Indischen Ozeans verschifft wird. Die Tankerkarawanen sind schwimmende Zeitbomben, denn schon ein Teil der verladenen Ölmengen würde reichen, um die Gewässer und ihre angrenzenden Küsten tödlich zu kontaminieren. Wir nehmen das in Kauf, benötigen den schmierigen Stoff weiterhin: »70 Prozent des weltweiten Verkehrs mit Ölprodukten zieht an den Küsten des indischen Ozeans vorüber«,5 schreibt Robert Kaplan, der im Jahr 2010 mit seinem Buch Monsoon als Erster das gewaltige Potenzial dieser »maritimen Seidenstraße« beschrieb – noch bevor Xi Jinping Staatspräsident wurde.
Die Ära des Westens geht zu Ende
»Ich sehen in der Weltgeschichte das Bild einer ewigen Gestaltung und Umgestaltung, eines wunderbaren Werdens und Vergehens organischer Formen«, schrieb Oswald Spengler.6 Geschichte ist wie das Leben eines Menschen oder der Jahreslauf. Sie besteht aus Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – aus Kindheit, Jungend, Blüte des Erwachsenseins und aus dem Alter. Sie ist dynamisches Leben unterschiedlicher Akteure.
Die Akteure des Westens stehen dabei mitten im Winter. Spengler sah uns bereits vor einem Jahrhundert am Anfang der kalten Jahreszeit. Der Winter des Westens ist eine lange Altersphase, deren Ende – und damit ihr Tod – schwer abzuschätzen ist. Der Zusammenbruch der stabilen zweipoligen Welt aus Ost und West, der beginnende Rückzug Amerikas von der globalen Zivilisation auf sich selbst, die innere Krise Europas, die Dauerbeschäftigung mit einer Flüchtlingspolitik, die von kreativer Arbeit für die Zukunft abhält, der Visionsmangel des Westens gegenüber dem Ehrgeiz des Ostens, der nun vom Westen Besitz zu ergreifen beginnt. Ohne tief zu graben, sind viele Symptome des Niedergangs zu entdecken. Sie halten Spenglers Wort vom Untergang der abendländischen Zivilisation aktuell.
Der wundersame Erfolg des Westens über Jahrhunderte ist nicht zuletzt China zu verdanken – oder besser: einem Irrtum. Dem Irrtum, dass das, was man für China hielt, in Wirklichkeit Amerika war. Christopher Kolumbus (1451–1506) war Zeit seines Lebens davon überzeugt, den Seeweg nach China gefunden zu haben.
China, das »India Superior« damaliger Kartenwerke, musste unter Segeln gefunden werden. Und zwar dringend: Europa war abhängig von Seide und Gewürzen, die aus dem Reich der Mitte und aus Indien stammten. Doch nach der Eroberung von Konstantinopel im Jahre 1453 machten die Osmanen den europäischen Importeuren das Leben schwer. Sie diktierten hohe Zolltarife, und die begehrten Waren wurden langsam unbezahlbar. Der Abfluss an Gold und Silber aus Europa war enorm.
Marco Polos Reisebericht hatte Kolumbus infiziert. Darin fand er das Ziel seiner bevorstehenden Reisen: die Stadt Hangzhou, bei Marco Polo Quin-sai genannt, eher bekannt unter dem Namen Lin’an. Hangzhou, die einstige Hauptstadt der südlichen Song-Dynastie, war lange die größte Stadt der Welt. Kolumbus, der 200 Jahre später als Polo lebte, glaubte noch immer, dort den Herrscher über das einst größte Weltreich aller Zeiten zu finden, den großen Kublai Khan, Enkel des Dschingis Khan und Kaiser der Yuan-Dynastie (1279–1368).
Kolumbus suchte die maritime Seidenstraße nach Indien und weiter nach China, um die Abhängigkeit der osmanischen Türken zu umschiffen. Die neue Seeroute nach Osten war der Weg in den globalen Freihandel. Der Genueser in spanischen Diensten war ein Entdecker im Dienste des Homo oeconomicus, der immer mehr Waren zu günstigeren Preisen benötigte.
Der Rest der Geschichte ist bekannt: Alle vier Reisen des Christopher Kolumbus zwischen 1492 und 1506 führten den Genueser Reisenden in die Karibik und zuletzt ans mittelamerikanische Festland. Damit begann die Kolonialisierung und weiße Expansion über die Welt, die über fünf Jahrhunderte dauerte.
Was Xi Jinping, der künftige Herr über die begehrteste Seehandelsroute der Welt, vermutlich nicht weiß, ist ein Satz, den Kolumbus dem Schatzmeister seiner Majestät Ferdinand II. von Aragon Luis de Santángel schrieb: »Ihre Majestäten können sehen, dass ich ihnen Gold geben werde, so viel sie Bedarf haben […] und Sklaven, so viele sie [auf die Schiffe, M. H.] zu laden befehlen.«
Obwohl Kolumbus nie nach Quin-sai gekommen war, wurden die Menschen, die er an den neuen Küsten fand, zu Sklaven. Er versklavte Menschen einer Zivilisation, die Marco Polo noch bewunderte. Wenn Kolumbus bis zu seinem Lebensende daran glaubte, dass er India Superior, also China, entdeckt hatte, dann versklavte er Menschen, die seine europäischen Ahnen noch als gleichberechtigt empfunden hatten. Das ist das wirklich Erstaunliche an den Entdeckungsreisen des Christophers Kolumbus. Unverhohlenes Überlegenheitsgefühl, ein damals noch klar zur Sprache gebrachter Rassismus, prägte das Denken und Handeln des Entdeckers. Vielleicht liegt in seinem Verhalten der Beginn des unseligen Überlegenheitsgefühls des Europäers, das als bitterer Beigeschmack Renaissance und Aufklärung begleitete und in den Imperialismus mündete. Mit Kolumbus begann das europäisch-amerikanische Zeitalter.
Europas erstaunliche Erfolgsstory scheint auf friedliche Weise ihr Ende zu finden. Das ist schon einmal eine gute Nachricht, denn die Erfolgsgeschichten westlicher Nationen basieren einem Naturgesetz gleich auf Kriegen. Nach über 500 Jahren Dominanz des weißen Mannes beginnt sich das Schicksal zu drehen, und die Achse kultureller Vorherrschaft wandert wieder nach Osten.
Die Welt ist nicht mehr, wie sie war, oder besser: sie wird vielleicht wieder so, wie es ihrer Natur zukommt. Eine Ära, in der das Licht nicht – wie es die Natur vorschreibt – aus dem Osten kam, sondern aus dem Westen, geht zu Ende. Mit dem Aufstieg Chinas könnte der Satz »Ex oriente lux« – »das Licht kommt aus dem Osten« – auch für die Menschheitsgeschichte wieder Sinn enthalten, sofern die Menschheit überhaupt noch eine weitere Geschichte hat, die sie schreiben kann. Doch das ist nicht Thema dieses Buches.
Europa ist jedenfalls in der Krise, weil es sich einst von Asien abgespalten hat, um seinen eigenen Sonderweg zu gehen. Die »splendid isolation« eines Teilkontinents, der im Grunde das westliche Anhängsel Asiens ist. Daher empfinden wir heute unseren Doppelkontinent als zwiegespalten. Bereits Goethe thematisierte diesen Zwiespalt in seinem Gedicht vom Ginkgo biloba und lenkte dabei den Blick auf den gemeinsamen Stengel des gekerbten Ginkgoblattes:
Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als Eines kennt?
Dieses Gedicht ist als spielerisches Liebesgedicht bekannt geworden. Der Großdichter sendete es aus der späteren Hauptstadt deutscher Romantik, aus Heidelberg, zu seiner Angebeteten Marianne Willemer ins heimische Frankfurt. Doch Goethe wäre nicht Goethe, wenn er hier nicht doppelt gedacht hätte – nicht zuletzt, weil er wissend mit dem Getrennten im Einen und umgekehrt spielt.
Wie die beiden Blätterteile des jungen Gingko in ihrem Stengel zusammenlaufen und daraus ihre Nährstoffe erhalten, so verhalten sich auch Europa und Asien zueinander. Keine klare Trennungslinie scheidet uns vom Osten, denn der Ural ist die unspektakulärste gedachte Trennlinie, die man sich vorstellen kann. Im Kaukasus wird es schwer, die Grenzlinie festzumachen. Kasachstan, Chinas Nachbar, spielt in den europäischen Fußballwettbewerben mit. Die Türkei will, obwohl überwiegend geografisch in Asien beheimatet, unbedingt nach Europa – so wie das Osmanische Reich nach Europa griff. Trotz dieser Nähe empfinden wir den Osten als viel weiter entfernt von uns als Amerika, das ein ganzer Ozean von uns scheidet und letztendlich Kolumbus um den gewünschten Erfolg seiner teuer bezahlten Unternehmungen gebracht hat.
EURASIEN ist ein Begriff, der vom kleinen Europa ausgeht und sich das große Asien anhängt. Mit China ist der Osten nach Jahrhunderten der Kolonisation durch den Westen nun aufgebrochen, sich den Westen »anzuhängen« – vorsichtig, aber immer bestimmter mit Mitteln der Internetzensur, der digitalen Parallel- und Konkurrenzwelten, mit Wirtschaft und Technologie. Die Absicht dazu findet sich nirgendwo formuliert, China selbst wehrt sich gegen jeden Vorwurf von Hegemonie. Doch wer die Führung übernimmt, wird automatisch zur Alphagröße.
Mit Technologie hat sich der Westen auf kriegerische Art und Weise den Osten aneignen können. Nun wird EURASIEN zu ASIAROPA. Besonders ironisch, vielleicht sogar zynisch scheint der Verdacht, dass es gerade die Nachfahren der britischen Kolonialherren sind, die Asiens Partnerschaft suchen – oder sich besonders gern von China suchen lassen. Jene einst stolzen Begründer der ostindischen Kompanie und des weltweiten Empires setzen nun weit bescheidener, aber durchaus nicht ohne Vorausschau, die Hoffnung ihrer eigenen Fortexistenz verstärkt auf den Osten. Dazu wollen sie das zu enge Haus Europa verlassen.
Eine veränderte Weltsicht
Wie sieht China die Welt? Anders als Europäer und Amerikaner. Wir sind Landkarten gewohnt, die den Atlantik im Mittelpunkt zeigen. Daneben sind die beiden Protagonisten der westlichen Welt, Amerika zu Linken, Europa zur Rechten, platziert, die diesen westlichen Ozean wie Wächter flankieren. Südamerika und Afrika wirken wie Stützen, auf denen Amerika und Europa stehen. Hier sind vielfältige Deutungen möglich. China, Japan, die asiatische Welt sind weit davon entfernt – ihr naher Ozean, der Pazifik, ist zweigeteilt, da man ihn auf der planen Fläche der Karte nicht zusammenhängend darstellen kann. Wie die dunkle Seite des Mondes wirken dieser Ozean und sein randständiges Westufer Ostasien abgewandt, fern – für die Konstitution des Weltbildes marginal.
Dieses Kartenbild kennt jeder von uns von Kindheit an. Doch kaum einer denkt darüber nach, dass an entfernteren Orten andere Weltbilder vorherrschen. Eine chinesische oder japanische Karte rückt den Pazifik selbstverständlich in den Mittelpunkt der Darstellung. Der Stille Ozean ist, gemeinsam mit dem Indischen Ozean, das zentrale Gewässer. Amerika und Europa, die Hauptgebiete unserer atlantischen Karte, sind für diese Sichtweise an die Ränder verschoben. Durch die zwangsweise Dehnung der Breitenkreise an den Kartenrändern wirkt der Westen merkwürdig gestreckt, unnatürlich, fast verschwommen peripher. Der pazifisch-südostasiatische Raum, jene Gegend, welche die maritime Seidenstraße verbindet, ist zentral, der Indische Ozean liegt ebenfalls im zentralen Blickfeld des Betrachters.
Dieser pazifische Blick auf die Welt findet sich auch in historischen Karten wieder. Sie entstanden am chinesischen Kaiserhof, vor allem während der Qing-Dynastie (1644–1912), und sind eine Art Umkehrung der bekannten europäischen Kartendarstellung. Für die europäische Sicht der Welt, wie wir sie gewohnt sind, sind die bekannten Kartenentwürfe Gerhard Mercators (1512–1594) maßgeblich. Sein Kartenbild von 1569 zeigt zwei Kreise und damit einen auf die zweidimensionale Fläche projizierten Globus. Der linke Kreis enthält den amerikanischen Doppelkontinent, während der rechte Kreis Europa, Asien und Afrika abbildet.
Es ist offensichtlich, dass Mercators Kartenentwurf das Vorbild der 200 Jahre jüngeren Karte aus dem Reich der Mitte war. Diese chinesische Karte ließ Kaiser Qianlong (1731–1796), unter Anleitung der damals bei Hofe tätigen europäischen Jesuiten, erstellen. Sie enthält schon die Mittenstellung Chinas und damit auch die zentrale Lage des Pazifiks. Die chinesische Küstenlinie und Japan bilden in etwa die Schnittstelle zwischen beiden Globushälften. Die Qianlong-Karte ist eine antithetische Darstellung zum Weltbild der Europäer: Der chinesische Küstenverlauf und die Läufe der großen Flüsse sind in der jüngeren chinesischen Karte genauer dargestellt, die europäische Karte ist exakter bei der Abbildung Europas, das die 200 Jahre jüngere Version nur grob und wenig detailreich wiedergibt.
Abbildung 2: Gerhard Mercators Sicht auf die Welt – Prototyp der modernen europäischen Weltkarte
Von den neuen Kolonien in Amerika bis an die Ränder Europas am Atlantik waren Chinawaren – nicht nur »chinaware«, das Porzellan – heiß begehrt. Große Silbermengen flossen von Europa und Amerika ins Reich der Mitte, um die Chinawaren zu bezahlen. Umgekehrt hatten die Mandschu-Kaiser des 17. und 18. Jahrhunderts, von denen Kang Xi (1654–1714) und Qianlong je rund 60 Jahre lang China kontinuierlich regierten, kein Interesse an westlichen sogenannten Barbarenwaren. Was sie besonders interessierte, war die Erschließung des weiten Raumes Zentralasiens, einschließlich Tibets, wodurch sich enorm viel neues Siedlungsgebiet – politisch etwas inkorrekt formuliert – als eine Art chinesischer Lebensraum im Westen öffnete. Chinas Interesse an Zentralasien, an der Region, durch die seit vielen Jahrhunderten der Seidenstraßenhandel lief, war ebenso ökonomisch wie geopolitisch motiviert. Er sicherte den Einfluss und die Kontrolle Beijings in einer damals wohlhabenden, rohstoffreichen Region.
Genau wie Chinas aktuelle Herrscher setzten die Kaiser der Qing-Zeit auf ständige Kontrolle und Austausch mit allen Regionen des groß gewordenen Reiches. Zentralasien war eine Schlüsselregion. Wer die Handelswege kontrollierte und beherrschte, dem stand eine glorreiche Zukunft offen. Die territoriale Expansion, und nicht zuletzt der entscheidende Schritt nach Westen, sorgten für mehr Wohlstand, neuen Siedlungsraum und damit für eine Bevölkerungsexplosion, eine Verdoppelung der Einwohnerzahl in 60 Jahren Qianlong-Zeit.
Das vormoderne China des 17. und 18. Jahrhunderts war ökonomisch und technologisch Europa in fast allen Belangen überlegen. Führende Köpfe unter den Europäern jener Zeit, wie der deutsche Universalgelehrte und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz, waren klug genug, Chinas Entwicklung schon zu Zeiten des Großvaters Qianlongs, des Kangxi-Kaisers, so genau wie möglich zu studieren. Leibniz hatte zum damaligen Zeitpunkt, im krisengeschüttelten Europa des 17. Jahrhunders, kein Problem damit, von China die besten landwirtschaftlichen Anbaumethoden der Zeit zu erlernen. Darüber hinaus studierte er die Verwaltung des chinesischen Staates und empfahl die Vorzüge von Kangxi, dem führenden Herrscher der damaligen Welt, europäischen Politikern zum Nachahmen und Lernen.
Leibniz war bewusst, dass dieser Führer der »Sinenser« zwei maßgebliche Fähigkeiten besaß, große zusammenhängende Reiche zu steuern: zum einen den Blick für das Große überhaupt, das »big picture«, die Vision eines starken, territorial weit ausgreifenden Chinas und zum anderen die Gelassenheit gegenüber Neuem und die Neugier an Unbekanntem.
Die Adaption der Mercator-Karte für die chinesische Geografie und Weltsicht hielt Chinas andere Sicht auf den Planeten fest. Nun wird der chinesische Blick auf die Welt, vor allem gen Westen, erneut interessant. Eine nicht ganz ernst gemeinte Karte aus unseren Tagen zeigt, welche Klischeebilder die Chinesen den unterschiedlichen Völkern und Regionen der Welt zuweisen: Auf dieser Karte der Klischees sind Russland und damit auch die Staaten der ehemaligen Sowjetunion »alte Freunde« mit einem »riesigen Territorium«. Die arabisch-türkische Region gilt als ewiges »Kriegsgebiet«. Afrika, als der Kontinent der Wüsten, schwarzen Menschen, aber auch der sozialistischen Bruderstaaten, zu denen man besondere Bande hat. Amerika ist das Land, das »gern Kriege führt«. Und wofür steht Europa in diesem chinesischen Weltbild der Klischees? Hier reichen die Zuweisungen von »Schneeregion für Skandinavien« zu »Stierkampfgegend« (Spanien) und immerhin die Reiche von »Romantik, Literatur und Kunst« für Frankreich und Deutschland. Reizvoll ist Europa, aber es ist weder ein alter Freund wie Russland noch ein ebenbürtiger Gegner, an dem man sich reiben kann, wie die USA.
1935 veröffentlichte ein Mann namens Lin Yutang in den Vereinigten Staaten ein Buch mit dem Titel Mein Land und mein Volk. Er begann es mit dem Satz: »Wenn man in China ist, muss man auch immerfort an China denken, voller Mitgefühl, manchmal auch voller Verzweiflung ...«7 Der Autor, chinesischer Abstammung, 40 Jahre alt und bereits mit einer bewegten Karriere als Politiker und Hochschullehrer hinter sich, war in das Land des American Dream aufgebrochen. Der Begriff war noch neu, nur vier Jahre früher – im Jahr 1931 – von James T. Adams in dessen Erfolgswerk The Epic of America formuliert.
Der vierzigjährige Emigrant aus China hat sich sicher nicht träumen lassen, dass sein Buch – in englischer Sprache verfasst – ein ebensolcher Erfolg werden und an die Spitze der amerikanischen Best-sellerliste aufsteigen sollte. Für ihn erfüllte sich ein amerikanischer Traum von Leistung und harter Arbeit, die sich auszahlte. Dabei war er Chinese, und von Chinesen schrieb der Autor Lin Yutang gleich auf der ersten Seite, dass China ein »aller Ordnung spottendes Chaos« sei, das es »ein manchmal tragisches, manchmal komisches Schauspiel« böte, immer aber »vom durchdringendsten, derbsten Realismus«.8
Gefangen in einem solchen tagtäglichen Realismus des dauerhaften Beschäftigtseins mit dem Leben träumt man nicht. Man lächelt zum Dilemma des Alltags, hält ihn aus, überlebt: »Inmitten von Krieg und Pestilenz, von der Bettelschar seiner Kinder und Enkel umgeben, schlürft Merry Old China in aller Ruhe seinen Tee und lächelt dazu, und in diesem Lächeln erblicke ich seine eigentliche Stärke«,9 schreibt der Autor weiter.
China war zerrissen, eine unfertige Republik widerstreitender Kommandeure und Intellektueller, voller Intrigen und Ränkespiele, noch immer den strategischen Plänen der westlichen Mächte und Japans ausgeliefert. Sie spielten mit dem chinesischen Panda wie ein mächtiges Raubtier, das eine dem Tode geweihte Beute zwischen den Klauen hatte.
In seinem zweiten Bestseller – Lin Yutang ist nach Mao Zedong wohl bis heute der erfolgreichste chinesische Autor im Westen – The Importance of Living (oder deutsch Die Weisheit des lächelnden Lebens) hat Lin Deutschland und China als Gegensätze in Sachen Traum herausgestellt. Für den bald im amerikanischen Exil lebenden Autor war der German Dream, der zum German Nightmare werden sollte, das Gegenstück zum traumlosen chinesischen Realismus. China vermochte nicht zu träumen, so schien es zu Zeiten Lins in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts.
Heute, mehr als 80 Jahre später, hat sich das geändert. Nun träumt China den Chinese Dream, während Deutschland durch einen traumlosen Alltag dümpelt. China träumt, weil sein Führer es so möchte, denn er braucht eine Vision, die das ökonomisch explodierende, sich globalisierende Land zusammenhält. Dabei geht es gleichzeitig um eine langfristige Perspektive. Der Traum ist für die Volksrepublik vielleicht sogar überlebenswichtig. Xis Traum ist die Überwindung des chinesischen Traumas, das der Chinasucher Kolumbus einleitete und das in den maritimen Unternehmungen der Portugiesen und später der Engländer seine Gründe fand. Gemeint ist die erzwungene Unterwerfung einer sich stets auf sich selbst beziehenden Zivilisation, eines kulturellen Gravitationspunktes unter eine überlegene Kraft: die der Europäer und Amerikaner.
Diese Erschütterung ist Ursache des chinesischen Traumas. Lin Yutang, der dessen Symptome in seinem Buch beschrieb, litt darunter, ebenso wie unzählige andere chinesische Intellektuelle und weitsichtige Politiker, wie der erste Staatspräsident des Landes Sun Yatsen (1866–1925).
Abbildung 3: Die andere Weltsicht Chinas
Xi Jinpings chinesischer Traum ist die »große Renaissance der chinesischen Nation«. Ob China früher jemals eine Nation im modernen westlichen Sinne war, lässt sich zwar mit guten Argumenten bezweifeln, doch diese Diskussion ist hier nebensächlich, also übergehen wir sie einfach. Xi schien das Trauma des chinesischen Niedergangs während eines Museumsbesuchs am 29. November 2012 vor Augen zu haben, als er über die Schande des Opiumkriegs (1840–1842) sprach. 1840 machte ein Haufen Engländer, auf damals supermodernen Schiffen mit Opium im Gepäck, Hunderte von Millionen Chinesen von sich und ihrer Art zu leben abhängig. Wie tief dieses Trauma der Demütigung noch immer in den Herzen und Köpfen chinesischer Führer steckt, lässt sich nur erahnen.
In weiteren Reden, die Xi in den Jahren 2013 und 2014 vor unterschiedlichen Auditorien hielt, wurde der Traum der »großen Renaissance« zum Glaubensbekenntnis der KPCh. Sie allein sieht sich dazu berufen, jetzt, da sie die richtige und passende Strategie gefunden habe, den Traum in den nächsten Jahrzehnten zu realisieren – und bis 2049 China endgültig an den angestammten Platz unter dem Himmel zurückzubringen, rund 250 Jahre nach Kaiser Qianlong.
Unter diesem chinesischen Kaiser erreichte China möglicherweise seinen politischen, kulturellen und ökonomischen Höhepunkt. Die Bevölkerung hatte sich verdoppelt, Besucher aus dem Westen sprachen von wohlhabenden Bewohnern, das Land erwirtschaftete »ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts aller Staaten«10 der damaligen Welt zusammengenommen und seine Landwirtschaft war in allen Belangen der Agrarproduktion des Westens weit überlegen. Es war die Zeit, als China alles hatte (oder alles zu haben glaubte) und sein Kaiser an Georg III. von England ausrichten ließ: »[...] wir haben nicht den geringsten Bedarf für die Waren Eures Landes.«
So wie Qianlong es formulierte, wird es der künftige Herrscher Chinas 2049 nicht formulieren können, doch es ist durchaus das Ziel aller »Entwicklung« (fazhan) bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts, dass andere Staaten »Bedarf an den besten Waren der Erde« haben sollen. Und die stammen dann wieder aus China und erreichen in Hochgeschwindigkeitsgüterzügen und mit Expressgleitern über die Wege der Neuen Seidenstraße in wenigen Stunden die übrige Welt. Dazu soll sich die chinesische Zivilisation als eine der wichtigen Leitkulturen neben Islam und Christentum etabliert haben – in welcher Form, weiß keiner so genau, doch sie soll. Das ist der Imperativ zum Handeln.
Das Kollektiv steht dazu in der Pflicht, einschließlich der chinesischen Diaspora: Möglichst alle Chinesen weltweit sollen den Traum der Renaissance träumen. Als Realisten, die wissen, dass ihnen nichts geschenkt wird – schon gar nicht vom Staat –, müssen sie hart dafür arbeiten: »Die ganze Gesellschaft soll Liebe zur Arbeit entwickeln, fleißiges Arbeiten als Ehre und Müßiggang als Schande ansehen.«11 Fleiß als eine chinesische Kerntugend soll die Renaissance kultureller Größe ermöglichen, die das Land in neue goldene Zeiten führen soll. Xis »fuxing«-Begriff meint nicht dasselbe wie der europäische Begriff der Renaissance. Es geht weder um kulturelle Besonderheiten einer wie auch immer zu definierenden Antike noch um die Neu- und Wiederentdeckung des Individuums, seiner künstlerischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten.
Fuxing lässt sich am besten mit chinesischen Begriffen beschreiben und erklären. Das sind vier Schriftzeichen »Wen gu zhi xin« (温故知新). Zu Deutsch bedeuten sie etwa so viel wie »sich mit dem Alten vertraut machen und damit das Neue erkennen«. Das klingt nach Konfuzius, und es sind tatsächlich Worte des Konfuzius (551–479).12 Historisches Denken ist notwendig, um »mit dem Erbe unserer Vorfahren unseren Nachfahren Perspektiven zu eröffnen«.13 Unter Mao Zedong wäre ein solcher Satz undenkbar gewesen. Es hätte denjenigen, der so redete, in der Kulturrevolution (1966–1976) womöglich den Kopf gekostet. Heute jedoch gehört das Historische zum Selbstverständnis des politischen Denkens und Handelns in China. Alles Handeln für die Zukunft kann nur mit der Kenntnis des Vergangenen funktionieren. Das ist ein Kern der chinesischen Renaissance, nicht die Wiedergeburt des Individuellen oder des Menschen an sich.