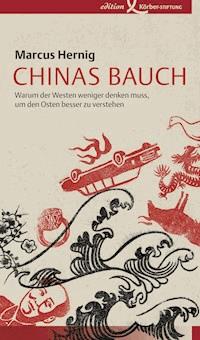
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition Körber-Stiftung
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Siebenmal Fühlen ist besser als hundertmal Denken, weiß man in China. Während im Westen der Kopf regieren will, entscheidet im Osten weit freimütiger der Bauch. Freude, Wut, Trauer, Angst, Liebe, Hass und Begehren: In China bilden diese sieben Grundgefühle die sozial akzeptierte Grundlage des menschlichen Verhaltens. In 14 Episoden und ungewöhnlichen Begegnungen spürt der Journalist und Asienkenner Marcus Hernig dem Fühlen der Menschen nach. Nichts entgeht dem genauen Beobachter. Ungeschönt, aber voller Humor und mit großer Empathie erzählt er von ihrem Miteinander, ihrem Glück, ihrem Leid. Schnell wähnt sich hier der Leser in ihrer Mitte. Ein sehr persönliches Porträt der chinesischen Gesellschaft. Und ein Kultur(ver)führer für alle, die das Reich der Mitte von seiner anderen Seite kennenlernen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Allen Menschen gewidmet, die mich China haben fühlen lassen.
»Ein großer Bauch kann alle Dinge der Welt in sich aufnehmen.«
Budai
Warm, satt, dunkel und süßWer China verstehen will, muss es erfühlen
1992 kam ich nach China. Zum ersten Mal. Ich habe vergessen, was ich damals dachte, weiß aber noch sehr genau, wie sich Nanjing anfühlte. Die Stadt, in der ich mehrere Jahre lang studieren sollte, war warm, pulsierend, aufregend. Dabei konnte ich fast nichts erkennen, die wenigen funzeligen Glühlampen kamen gegen die Dunkelheit nicht an. Was ich aber fühlte und vor allem roch, war dramatisch genug. Die fremden Gerüche strömten aus der Richtung der lichtschwachen Lampen. Ich strengte meine vom Jetlag gestressten Augen an und erkannte die schemenhaften Umrisse der Männer und Frauen, die, hinter kleinen Wagen, alle das Gleiche zu tun schienen. Sie kochten. Vor ihnen standen Menschen. Junge Menschen. Studenten, vermutete ich, denn das Taxi, mit dem ich gekommen war, sollte mich ja vor dem Tor jener Universität absetzen, für die ich ein Stipendium erhalten hatte.
Als ich mich den Garküchen näherte, kicherten mir junge Frauen entgegen. Ihre leichten Baumwollkleider und Schnallenschuhe erinnerten mich an die Mode aus den Jugendtagen meiner Mutter. Sie knabberten an ihren Tofu-Spießen, scherzten und hatten ihren Spaß. Männer saßen mit hochgerollten T-Shirts um die Garküchen herum, aßen Fleischspieße und gebratene Nudeln. Sie strichen sich dabei über die nackten Bäuche und prosteten mir mit großen Bierflaschen zu. Die Botschaft war einfach und klar: »Setz dich, iss mit und nimm wahr, was wir dir erzählen.« Mein Verstand protestierte, es sei doch sehr spät und das Hotel noch nicht gefunden. Doch ich hörte auf meinen Bauch und setzte mich. Nicht zum ersten Mal hatte mein Bauch entschieden: Er ist nämlich kein oberflächliches Organ, wie Haare, Haut oder Fingernägel, die man beliebig schminken und verändern kann. Der Bauch war und ist unveränderlich das Zentrum unseres Körpers. Zunächst muss er all das verdauen, was wir im Laufe unseres Lebens in uns hineinstopfen. Das sind nicht nur die Nudeln, Fleischspieße, Gemüsepfannen, Reisgerichte, Süßigkeiten und was dem Menschen auf der Welt so alles zur Nahrung dient, sondern auch die vielen Erlebnisse, die er dann zu Gefühlen »verarbeitet«. Wir sprechen vom Bauchgefühl, fühlen Liebe als »Schmetterlinge im Bauch«, spüren, dass Ärger uns auf den Magen schlägt und sogar den Appetit verderben kann. Ein beträchtlicher Teil der menschlichen Wahrnehmung scheint rund um Magen und Darm verortet zu sein.
Das hat die Wissenschaft längst bestätigt. Neurowissenschaftler sprechen von einem »zweiten Gehirn« in der Bauchregion, das aus rund 100 Millionen Nervenzellen besteht. Diese Nervenzellen sind eng mit dem »Kopfgehirn« verbunden, wo schließlich alle Wahrnehmungen des Bauchs weiterverarbeitet werden. Was wir also vage als »Bauchgefühl« bezeichnen, hat seine reale Grundlage in diesem äußerst feinen Nervengeflecht in der Mitte unseres Körpers. Dabei ist erstaunlich, dass die Dinge, die der Bauch dem Kopf weitergibt, 90 Prozent aller ausgetauschten Informationen zwischen diesen beiden Körperregionen ausmachen. Der Bauch hat dem Kopf deutlich mehr zu sagen als umgekehrt.
An meinem ersten Abend im sogenannten Fernen Osten traf ich diese kleine »Bauchentscheidung« und blieb ganz glücklich mit den anderen unbeschwerten Genießern sitzen. Daher ist auch das erste Gefühl, das ich mit China verbinde, das Glück. Später, als ich mehr von und über China wusste, lernte ich, dass einst der Glücksgott zu den wichtigsten Göttern des Landes zählte – und alle Menschen bis heute immer irgendwie nach dem Glück suchen. »Nie zu groß darf es sein, das Glücksgefühl«, erzählte mir Jahre später einmal ein Künstler. In jener warmen, dunklen Septembernacht war es mir jedenfalls vergönnt, mein kleines Glück mit anderen zu teilen: in eine warm gefüllte Teigtasche zu beißen und zu spüren, wie mein Magenknurren in träge Zufriedenheit überging. »Warm, satt, dunkel und süß«, stellte vor fast einem Jahrhundert Chinas Bestsellerautor Lin Yutang einmal fest, sei die chinesische Vorstellung vom Glück.1
Eigentlich ist es in China mit dem Gefühl eine besonders einfache Sache. Gefühle hängen eng mit Geschmack zusammen, und das englische Wort taste, wiederum eng verwandt mit dem deutschen Begriff »Tasten«, kommt der Bedeutung des Geschmacks im chinesischen Gefühlsleben recht nahe. Im gemeinsamen Essen guter Dinge steckt bekanntlich ein hohes Freude-, ja sogar Glückspotenzial. Nie habe ich Menschen zufriedener, ausgelassener, entspannter erlebt als am Esstisch. Von behaglicher Zufriedenheit bis hin zur Glückseligkeit, etwa in einer ausgelassenen Hochzeitsrunde, reichen die Nuancen positiver Gefühle rund um das gesellige Mahl. Das brachte mich vor Jahren darauf, allein diesem Thema ein Buch zu widmen.
Ich halte es mit Lin Yutang, der das Essen neben dem Sex, der weniger verlässlich sei, für eine der beiden wirklich soliden Freuden des menschlichen Daseins hält. Es ist daher nur konsequent, dass mein Buch über »Chinas Bauch« auch mit der Freude am Esstisch beginnt.
Im Buch der Riten, einem der fünf konfuzianischen Klassiker, die von Schülern des Konfuzius während der Zeit der Streitenden Reiche (475–221 v.Chr.) verfasst wurden, findet sich die Freude zudem am Anfang einer Klassifizierung der menschlichen Gefühle, die als »Sieben Gefühle« und »Sechs Begierden« bis heute bekannt ist. Folgende sieben Gefühlsdimensionen (qi qing) sind dort gelistet:
Vor rund 2000 Jahren unterteilte ein Gelehrter namens Gao Xiu die siebte Dimension yu in weitere sechs Unterkategorien, die er als die Sechs Begierden (liu yu) oder physiologischen Grundbedürfnisse des Menschen bezeichnete: der Wille zum Leben, der Wunsch, nicht zu sterben, der Seh-, Hör-, Geschmacks- und der Geruchssinn. Auffällig ist, dass der Tastsinn in dieser Aufzählung fehlt. Er wurde offenbar nicht als etwas empfunden, nach dem der Mensch »giert«.
Die sieben Gefühlsdimensionen entsprechen in etwa den fünf Grundgefühlen in der westlichen Psychologie. Diese unterscheidet intentionale Gefühle, also physiologische Hungergefühle, im weitesten Sinne, Gefühle, die dazu da sind, eine Leere zu füllen. Begehren nach etwas wäre ein passender verbaler Ausdruck für diese erste aller Gefühlsdimensionen. Ihm folgt an zweiter Stelle die Angst, gefolgt von Aggression und Schmerz als dritter Dimension, Trauer als vierter und schließlich Freude als fünfter Dimension.
Damit haben wir uns im Westen fast an eine umgekehrte Reihenfolge der Gefühlswelten gewöhnt, während die positive Einstellung der Chinesen zum »Hier und Jetzt« die Freude xi ganz an den Anfang aller Gefühle gesetzt hat. Neben den genannten Grundbedürfnissen des Menschen schließt das Begehren immer auch das Streben nach materiellen oder ideellen Zielen ein, zum Beispiel nach Reichtum, Karriere und Erfolg. Aufstieg spielte stets eine große Rolle in der hierarchisch dimensionierten Gesellschaft Chinas. Dabei ist bemerkenswert, dass dem Begriff yu nicht der Beigeschmack der Sucht anhaftet, die Christentum oder Hinduismus mit dem Begehren verbunden haben. Chinesen neigen nicht sehr zu Enthaltsamkeit oder gar weltabgewandter Askese.
Gefühle sind die Abbilder der Seele, dominanter und daher oft einflussreicher als das menschliche Denken, sagt der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung. Er hält Intuition, Empfindung, Fühlen und Denken für die vier grundlegenden psychologischen Größen, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Das Fühlen geht also dem Denken voran. In diesem Punkt sind sich Jung und das chinesische Buch der Riten einig: »Freude, Wut, Trauer, Angst, Liebe, Hass und Gier – diese sieben Gefühle beherrscht man, ohne sie erlernen zu müssen.« Gefühle sind einfach da, gehen jedem Lernen und Nachdenken voraus und sind unabhängig davon vorhanden. Gefühle prägen das Denken, die »rationale Welt« des Menschen. Intuieren und Empfinden sind dabei eng mit der Gefühlswelt und damit dem »Fühlen« an sich verbunden. Die Gefühlswelt bestimmt das Bewusstsein – und intellektuelle Leistungen sind ohne vorausgehende, bisweilen heftige Gefühle oft nicht möglich. Physiker wie Albert Einstein hegen nicht selten eine besonders starke Empfindung für das Göttliche, das ultimative Prinzip des Daseins. Aus dieser Empfindung heraus entsteht ihre Passion für die Wissenschaft und nähren sich Intensität und Leistung ihres Denkens. Nicht umgekehrt. In neurobiologischen Tests wurde bestätigt, dass Gefühle mehr Einfluss auf das Denken nehmen als das Denken auf die Gefühle, und damit sind wir wieder bei dem eingangs skizzierten Primat des Bauches über den Kopf angelangt, jener Körperzone, die für das Entstehen von Gefühlen so bedeutsam ist.
Wenn Gefühle das Denken bestimmen, dann macht es Sinn zu verstehen, was die Menschen fühlen. Erst dann lässt sich der Mensch selbst und schließlich die Welt, die er geschaffen hat, verstehen. »Die Menschen sind es!«, hat mir Eva Siao, langjährige Freundin aus Peking mit 50 Jahren Lebenserfahrung in China, einmal gesagt. Ähnlich denkt der Schriftsteller Yu Hua. Konsequent beginnt er seinen Essay China in zehn Worten mit dem Begriff »Das Volk«. Es ist das Gefühl, das Yu zum Schreiben treibt, besonders stark das Gefühl des Schmerzes, den sein Volk »erlitten« habe. Das waren oft körperliche Schmerzen durch schlechte medizinische Versorgung, durch politische Kampagnen und wirtschaftliche Modernisierungsmaßnahmen, die mit Geschmack und Gefühl der Menschen wenig zu tun hatten. Vom Gefühl des Schmerzes ist gerade China noch immer besonders stark betroffen, ebenso von Angst und Unsicherheit, bisweilen auch von Gleichgültigkeit oder gar Gefühllosigkeit. Und manchmal brechen sich Wut über andere und Stolz auf das Eigene in breiten Wellen ihren Weg durch das Internet. Viele unterschreiben den Satz: »Ich bin stolz darauf, Chinese zu sein, stolz auf mein großartiges Land – trotz aller Probleme.« Und das ist keine Politpropaganda.
Es ist wichtig, zu wissen und zu verstehen, wie ein Volk fühlt und was es bewegt. Als die Menschen in der Ex-DDR ihrem drängenden Gefühl nach Freiheit seinen Lauf lassen konnten, skandierten sie: »Wir sind das Volk!« Dieser Satz mahnte jeden, zunächst einmal nachzuempfinden, was dieses »Volk« fühlte. Ich kann oft nicht nachvollziehen, wieso gerade die Medien als die Quelle, aus der wir etwas über die Welt und seine Kulturen erfahren (sollten), Volksgefühle besonders gern missachten. Wir erfahren rein gar nichts darüber, was die Menschen in Russland, in China oder in Japan wirklich bewegt, wenn sich die Berichterstattung auf die Unzulänglichkeiten der jeweiligen Regierungen – im Falle Chinas und manchmal auch Russlands gern als »Regime« bezeichnet – beschränkt. Wer China oder Russland oder den Iran verstehen will, muss zuallererst »das Volk« und dessen Gefühle verstehen. Erst dann eröffnen sich seine Probleme, erklärt sich seine Wirtschaft, seine Geschichte oder Geografie.
Im Umgang mit China und dem Osten ganz allgemein konzentriert man sich gern auf die »objektive Welt« –die Sphäre des Denkens, die Welt des Objektiven und Rationalen. C.G. Jung hat einst diesen Begriff in Abgrenzung zur subjektiven Welt des Fühlens geprägt. Aber genau dieses nüchterne Kalkül des »rationalen Verstehens« gegenüber dem Osten funktioniert nicht. Weder gegenüber Putins Russland noch gegenüber dem China der Kommunistischen Partei. Die scheinbar »objektive Analyse« mündet in einem alle Nähe unmöglich machenden »Die überflügeln uns« oder »Die unterdrücken die Demokraten«.
Bewunderung und Angst setzten sich auf diese Weise durch. Gefühle bestimmen die Analyse, allerdings ohne die Gefühle auf der analysierten Seite wirklich differenziert wahrzunehmen. So manch ein Buch über China folgt dann auch genau dieser groben Dichotomie und fokussiert den »China-Code« oder China-Superlative auf der einen und »China-Ängste« auf der anderen Seite. Kopfgeborene China-Analysen polarisieren die Gefühle der Deutschen und vermutlich die des Westens im Allgemeinen:
Die einen fühlen sich beglückt und im wörtlichen Sinne bereichert, wenn sie sich den ökonomischen Herausforderungen und neuen Möglichkeiten stellen, die das energie- und konsumhungrige Reich bietet. Ich erinnere mich an eine Einladung in Shanghais »Old Chinahand Club« vor einigen Jahren. Dort saßen erfolgreiche China-Geschäftsleute, meist deutscher Herkunft, beieinander, um sich angeregt über die Chancen im China-Geschäft zu unterhalten. Für viele von ihnen war China der Ort ihres persönlichen Erfolgs, ein Synonym der eigenen Karriere. Kritik jeglicher Art war nicht opportun, weil mit der China-Kritik auch eine Kritik an der eigenen Person verbunden gewesen wäre.
Doch die China-Enthusiasten sind in der Minderheit. Bei einer, wie mir scheint, deutlichen Mehrheit in Deutschland geht die Angst um. Es ist die Angst vor dem Unverstandenen, dem Neuen, das sich offensichtlich überall völlig unkontrolliert breitmacht: der chinesische Rohstoffkonsument, der Bodenkäufer, der nicht abreißende Strom konsumhungriger Touristen, die dem Einzelhandel weltweit in die Kassen spielen, bei westlichen Beobachtern aber nur Kopfschütteln und Unbehagen hervorrufen, wenn sie in Schweizer Luxusuhrengeschäften ganze Kollektionen aufkaufen.
Angst entsteht spontan, unbeabsichtigt, ist mit C.G. Jung ein »Affekt« oder eine »Emotion«, im Unterschied zu einem aktiv gelebten Gefühl, wie etwa »Mitfühlen« oder »Lieben«. Freunde baten mich, »ihnen die Angst vor China zu nehmen«. Angst ist meist ein Affekt des Nichtverstehens. Ähnlich der Angst vor dem berüchtigten »schwarzen Mann«, vor dem ich mich als Kind unter die Bettdecke verkrochen habe, um dort das von Lin Yutang eingangs genannte Gefühl des Warmen, Dunklen und Vertrauten zu spüren, das einen gut gefüllten Magen begleitet. Angst entsteht, wenn Mitfühlen und Nachempfinden fehlen. Wenn die Bedrohung – begründet oder nicht – keine Möglichkeit mehr bietet, das, wovor man sich fürchtet, zu verstehen.
Die Fähigkeit des »Nachempfindens« ist ein Schlüssel für Verständigung und damit Frieden zwischen verschiedenen Kulturen. Kulturen bestehen in erster Linie aus Menschen, nicht aus Regierungen oder Regimen. Für ein erfolgreiches Miteinander ist es wichtig, anderen Menschen offen und mit »emotionaler Intelligenz« zu begegnen. Seit Daniel Goleman den Begriff im Jahr 1995 popularisiert hat, wird der »Emotionalitätsquotient« gern dem »Intelligenzquotienten« gegenübergestellt. Goleman geht davon aus, dass »ein Mensch, der erkennt, was andere fühlen, viel früher die oftmals versteckten Signale im Verhalten anderer erkennen und herausfinden kann, was sie brauchen oder wollen«.2
Das aber funktioniert natürlich nicht in der verallgemeinernden Weitwinkel-Perspektive auf »die Chinesen«, »die Japaner« oder »die Russen«. Empathie kann nicht funktionieren, wo große Distanz herrscht. Für ein ganzes Land wird man nur schwer Empathie aufbringen können, wohl aber für einzelne Menschen, deren Schicksale nachvollziehbar sind. Verdichten sich diese zu einem komplexeren Bild, werden auch die Strukturen des Ganzen feiner sichtbar. Sie wirken wie mit höherer Auflösung gefilmt. Induktiv, das heißt aus dem Einzelfall heraus, entsteht ein größeres Gesamtbild. Eine Gesellschaft erhält ein Gesicht, weil sie aus vielen Gesichtern und Facetten besteht. Ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich das facettenreiche Gesicht der chinesischen Gesellschaft anhand von Geschichten zeichnen, die thematisch den sieben skizzierten Gefühlsdimensionen folgen. Dabei geht es gar nicht darum, nun alles genau nachzuempfinden, was andere Menschen – wenn sie dazu noch im weit entfernten China leben – empfinden. Weit wichtiger ist es zu wissen, was die »andere Empfindung« ausmacht und sie verursacht. Wem das gelingt, der verfügt über eine Fähigkeit, die Psychologen »kognitive Empathie« nennen.
Natürlich ist es verwegen, China in sieben Gefühlen erzählen zu wollen. Chinas Gefühlswelt in nur einem Buch zu erfassen wäre so genial wie unmöglich. Doch die sieben Gefühlsdimensionen sind ein wunderbarer Leitfaden, Ereignisse und Beobachtungen zu erzählen, die ich entweder selbst erlebt oder aus anderen Quellen mit eigenen Worten nacherzählt habe. Inspiriert hat mich dazu nicht zuletzt Yu Huas Buch China in zehn Wörtern.3 Yu Hua, den ich als einen der interessantesten und scharfsinnigsten Schriftsteller im gegenwärtigen China schätze, hat dort anhand von zehn persönlich ausgewählten Begriffen versucht, ebenfalls ein sehr persönliches Porträt der chinesischen Gesellschaft zu zeichnen.
Chinas Bauch erzählen zu lassen bedeutet schließlich, das Leben wahrzunehmen. Setzt man dann auch seinen Verstand ein, um diese Lebensgeschichten zu deuten, könnte man dies in chinesischer Tradition eine »vernünftige« Vorgehensweise nennen. Der Begriff der Vernunft qingli setzt sich in der chinesischen Sprache nämlich zusammen aus Gefühl qing und Verstand li gleichermaßen.
Marcus Hernig
Shanghai, im März 2015
FREUDE
Die Freuden der Bauern
Wir verließen die breit ausgebaute Straße, die direkt in das Neubaugebiet führte, wo mein Freund Jin bereits zwei Wohnungen gekauft hatte. Die sollten fürs Erste reichen. Jin war zufrieden. Seine schwarzen Augen erinnerten an den Amida-Buddha im größten Tempel der Stadt. Eine stille Freude spiegelte sich darin. Ich habe diesen Ausdruck oft in den Augen meiner chinesischen Freunde gesehen, meist dann, wenn sie in einem Spiel etwas gewonnen hatten. Und Häuser kaufen war seit vielen Jahren das beliebteste Spiel Chinas, gleichzeitig auch das mit den höchsten Einsätzen.
Wir suchten einen Ort der Entspannung. Jins Peugeot holperte über eine grobe Teerstraße, auf der große Lehmbrocken verstreut lagen. Dreiradtraktoren transportierten all das hin und her, was die Erde an Verwertbarem zu bieten hatte. Die Menschen an und auf dieser Straße waren ähnlich geschäftig wie ihre Landsleute in der Großstadt, die hinter uns zurückgeblieben war.
Mitten zwischen den saftig grünen Gemüsefeldern links und rechts der Straße tauchten plötzlich Holzgerüste und Häuser auf. Hinweisschilder und neue Stichstraßen luden Vorbeifahrende ein, dort vorbeizuschauen. Wir fuhren weiter. Die Häuser, die wir passierten, wirkten unfertig und kahl, als hätte man sie in den letzten Monaten einfach schnell aus Beton zusammengegossen. Vermutlich war es genau so gewesen. Die Bauern hatten rote Lampions davorgehängt, um dem Beton etwas Leben einzuhauchen. Rot ist die Farbe des Lebens und des Glücks, die Farbe der Freude. Freude und Glück beginnen in China immer mit dem irdischen Leben, »Abstrakterem« steht man seit Jahrhunderten eher skeptisch gegenüber.
Auf den Hinweisschildern und an den Hauswänden las ich drei Schriftzeichen in sattem Gelb: Bauer, Familie, Freude. Ich schaute Jin fragend an. »Freude der Bauern«, sagte er nur kurz. »Das sind Ausflugsrestaurants für Städter wie uns. Sie sind vor einigen Jahrzehnten über die Berge von Süden aus Sichuan zu uns gekommen.« – »Wozu brauchen wir das?«, fragte ich zurück. Jin dachte kurz nach und zog die Stirn in Falten. »Vielleicht damit die Chinesen wieder etwas Freude verspüren, wenn sie dahin zurückkommen, woher sie in die Großstädte aufgebrochen sind. Vielleicht auch um uns alle zu vergewissern, dass es das Land ist, das uns ernährt«, antwortete Jin und zog tief an seiner »Double Happiness«-Zigarette. »Doppelte Freude im Munde«, sagte ich. Jin lachte: »Klar, Freude ist Geschmack, und das gleich doppelt. Die Freude, hier auf dem Land zu sein und gleich etwas Gutes zu essen zu bekommen. Das Rauchen werde ich dabei nicht los.«
Wir bogen nach rechts ab. Im Schatten alter Granatapfelbäume lag ein ebenso graues Bauernhaus wie die, an denen wir vorbeigefahren waren. Freude der Bauernfamilie las ich in den bekannten gelben Schriftzeichen. Die Luft hing feucht und schwül über dem Land. Die Zikaden hatten ihr lärmendes Spätnachmittagskonzert bereits begonnen. Ein hagerer kleiner Mann kam uns entgegen, schüttelte Jin die Hand, der mich sogleich vorstellte. »Ah«, sagte He, der kleine Mann nur, und: »Willkommen, willkommen.« – »Wie lange machen Sie das hier schon?«, fragte ich. »Zwei Jahre«, antwortete er. »Und geht das Geschäft gut?« – »Kann nicht klagen. Die Leute kommen aus der Stadt, essen gern bei mir. Ich zeige Ihnen auch, warum«, antwortete He. Wir folgten ihm zwischen die Gemüsebeete, mitten hinein in seinen »Besitz«, der ihm als Bauer Chinas zwar nicht gehörte, für den er aber die Nutzungsrechte besaß. Er und seine Familie. Er hatte kleine Teiche zwischen den Gemüseparzellen angelegt. »Die Freuden der Fische«, lachte Jin. Das waren Worte des taoistischen Philosophen Zhuangzi, der vor über 2000 Jahren einmal darüber spekuliert hatte, ob Menschen in der Lage seien zu spüren, worüber Fische sich freuten.4
An einfachen Bambusgerüsten mit Strohdächern hingen die roten Lampions unbeweglich in der Schwüle des angegrauten Tages. Die meisten dieser Separees waren besetzt. Darin lärmte es fröhlich. »Lai, lai – komm, komm«, hörte ich. Worte, die nicht mehr und nicht weniger bedeuteten als die gegenseitige Aufforderung, sich zuzuprosten. Ich schaute verstohlen in einen der kleinen Räume. »Waiguo pengyou – ausländischer Freund. Komm, iss mit und trink.« Privatsphäre? Fehlanzeige. Wer kommt, isst mit. Hier auf dem Land sowieso. Die Männer tranken starken Schnaps mit über 50 Prozent Alkohol. Ich kannte das Zeug, das den Kopf zum Glühen bringt. Die Hosenbeine und Polohemden trug man hochgekrempelt. Nackte Bäuche demonstrierten das alte chinesische Sprichwort »Da steckt Freude drin«. Das Vorbild für die Nabelschau waren die dickbauchigen Maitreya-Buddhas in den Tempeln, die barbäuchig lachend zeigen, was das Leben an Freuden bereithält.
Chinesische Bäuche müssen jedenfalls gefüllt werden. Ich erinnerte mich an die pausbäckigen Glücksknaben, die man noch vor wenigen Jahrzehnten zum Neujahrsfest an die Türen klebte. Sie verkündeten eine simple Botschaft: Was brauchst du mehr als einen Sohn und einen gut gefüllten Bauch, um glücklich zu sein? Lang ist’s her, dass China so bescheiden war, doch hier auf dem Land wurde die Erinnerung an damals wieder lebendig: »Lai ba – nun komm endlich«, forderte die Tischgesellschaft erneut. »Habe noch nicht gegessen«, sagte ich. »Dann iss doch mit uns.« – »Habe Freunde hier.« – »Sollen rüberkommen. Lasst uns alle zusammen essen.« – »Ich komme später, einverstanden?« – »Yiding – bestimmt?« – »Yiding, yiding – bestimmt, bestimmt.« Nur mit Mühe kam ich wieder zurück zu He und Jin, die draußen auf mich warteten. He lächelte. Mittlerweile rauchte auch er und deutete mit seiner »Double Happiness«-Zigarette auf die lärmende Gruppe im Separee. »Sind gute Gäste, aus der Stadt. Kommen regelmäßig. Stammkunden.«
Wir wandten uns wieder den Gemüsebeeten zu. »Was ihr essen möchtet, findet ihr in den Teichen und auf den Feldern«, sagte He mehr zu Jin als zu mir, denn die meisten Chinesen, besonders auf dem Land, gehen immer noch davon aus, dass Ausländer sie nur schwer oder gar nicht verstehen. »Eine kleine Weile später habt ihr es fertig gekocht auf dem Tisch stehen.« He strahlte über sein hageres Gesicht, in das sich die Falten jahrzehntelanger harter Feldarbeit gegraben hatten. Last und Bürde des einfachen Menschen, dachte ich, hatten dieses Gesicht geformt.
Doch was war, das war vorbei. In diesem einen Moment, in dem wir seine Gäste waren, zählten nur unsere Wünsche. Wir zeigten auf knackig frische Bohnen, tiefgrünes Blattgemüse und bestanden darauf, dass er genau das Huhn fing und zubereitete, das genau vor unseren Füßen herlief. Jin insistierte auf diesem flinken Tier, denn er glaubte, mit einem Blick erkannt zu haben, welch köstliches durchblutetes Fleisch und wunderbare Hühnersuppe es abgeben würde. »Gute Wahl, auf jeden Fall eine gute Wahl«, sagt Hes Frau, die ihrem Mann bei der Bestellungsaufnahme assistierte. Das Pak-Choi-Gemüse sah aus, wie es sein sollte: klein, zart, aber fest, dazu in frischem Grün und mit weißlichem Blattansatz. Weiteres Gemüse wurde ausgegraben. Das Jadegrün des Staudenselleries versprach würzigen Geschmack. Dann fehlte noch das Hauptgericht. He suchte dafür ein besonders agiles Huhn aus. An den Beinen gepackt und laut gackernd musste das vielversprechende Opfer seinem unausweichlichen Ende entgegensehen. Dazu passte der rauchige, grobe Tofu, den Hes Frau uns präsentierte. Er war sogar noch warm. Ein kühles Bier dazu – mehr war nicht mehr nötig.
Was frisch vor uns lag, stammte alles von der Erde, auf der wir standen. Ich bin mir sicher, dass jeder Chinese, egal, wie wohlhabend er war, wie viele Wohnungen, deutsche Luxusautos oder Schweizer Markenuhren er besaß, in diesem Moment gesagt hätte: »Ein Moment der Freude. Mehr braucht es nicht.« Er würde seinem Vorfahren, dem Zen-Buddhisten und Literaturkritiker Jin Shengtan (1610–1661) zustimmen, der einmal genug Muße gefunden hatte, um über die »33 glücklichen Augenblicke«5 in seinem Leben nachzudenken: Ein Haus oder eine Wohnstatt mit Platz zum Anbau von »Gemüse und Melonen« gehörte unbedingt dazu. Einen solchen Platz konnte der moderne Stadtchinese nun bei Lao He finden und sich Gemüse und Obst aus dem Garten bringen lassen.
Gestresst von den Meldungen über die »fünf großen Probleme im chinesischen Gemüsekorb«6, konnten Hes Gäste hier entspannen und sich wie ihre Vorfahren vergewissern, woher ihr Essen stammte. Wer kennt heute noch den Herkunftsort der Ware, die er kauft? Chinesische Konsumenten wissen oft nicht, dass das erhältliche Gemüse fernab der eigenen Region produziert wird und oft minderwertiger ist. Eine verlässliche Warendeklaration fehlt. Die Medien diskutieren regelmäßig über Qualitätsstandards und Markenprodukte: Lange Logistikketten sind dafür verantwortlich, dass den Produkten die noch vor wenigen Jahren gewohnte Frische fehlt. Die Preise sind gestiegen, und die Preiskontrolle wurde unmöglich, weil Produzenten und Händler natürlich gleichermaßen profitieren wollen. Verbraucher im Westen kennen das Problem seit vielen Jahrzehnten aus den Supermärkten; seitdem in den 1990er Jahren die ersten Supermärkte in China eröffneten, ist auch hier die »Nähe« zur eigenen Nahrung nicht mehr gegeben.
Diese Nahrung, wichtigste Grundlage für das »kleine Glück (xiao xingfu)« des Alltags, ist in den Jahrzehnten rasant steigenden Wohlstands zum großen Problem geworden. Innerhalb einer Generation haben sich Chinesen als Städter von ihrer ländlichen Herkunft radikaler entfremdet als Europäer und Amerikaner in drei. Wenn ich durch die neuen Vorstädte mit den neuen Hochhauskomplexen lief, fühlte ich, wie die wachsenden Wohnsilos die Menschen vom angestammten Boden mit in die Höhe rissen.
Umso schöner das Gefühl, nun bei Lao He daran erinnert zu werden, dass es noch anders sein konnte. Mir kam ein ähnliches Erlebnis aus meiner Shanghaier Vorstadt in den Sinn: »Eine alte Marktfrau hockt auf dem Boden und bietet grünes Gemüse feil. Ich frage nach dem Preis, und sie antwortet: ›Drei Yuan (40 Cent) das Pfund.‹ Ich greife in ihren Bambuskorb und lege das Gemüse auf die Waage. Sogleich füllt sie das fehlende auf und sagt: ›Drei Yuan.‹ Die Obstverkäuferin von nebenan tritt hinzu und bestätigt: ›Das ist leckeres Gemüse, wirklich.‹ Die alte Frau strahlt über ihr faltiges Gesicht und sagt stolz: ›Selbst gezogen, gleich um die Ecke.‹ Ich hebe den Daumen, wir alle lachen.« Ist das vielleicht nicht Glück?
Ich setzte mich mit dem Freund in eines der kleinen Separees aus Bambus und Stroh. Darin nur ein schlicht gezimmerter Tisch aus Holz, schon fleckig von den vielen Speisen, die hier aufgetragen worden waren. Eine Fliege störte die Ruhe. Chinesen geraten gern in Aufregung, manche Frauen gar in Hysterie, wenn einer dieser »schmutzigen« schwarzen Brummer es wagt, sich auf ein Gemüseblatt der frisch hereingetragenen Speise zu setzen. Jin zündete sich eine weitere »Double Happiness« an – und der Rauch verscheuchte den ungebetenen Gast. Wieder erlebten wir kurz und intensiv eine der kleinen Freuden des Jin Shengtan. Der meinte nämlich: »Das Fenster öffnen und eine Wespe aus dem Zimmer lassen. Ist das vielleicht nicht Glück?« Wir taten es ihm nach und entließen die störende Fliege in die heraufziehende Dämmerung.
Der nächste Glücksmoment folgte, als Jin seine Zigarette ausdrückte. Er rauchte Kette wie viele chinesische Männer meiner Generation. Jin war ein großer Raucher, der niemals über irgendetwas wirklich in Wut geraten konnte, ganz einfach weil er immer einen Glimmstängel im Mundwinkel trug. Auch das war natürlich Glück. Lin Yutang, selbst Pfeifenraucher, schrieb dazu einmal: »Man kann nicht die Pfeife (oder die Zigarette) zwischen den Zähnen halten und gleichzeitig mit Stentorstimme brüllen.«7




























