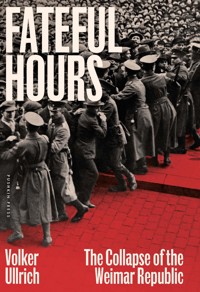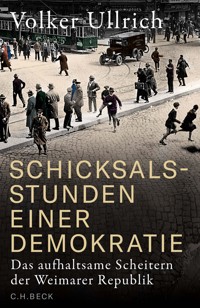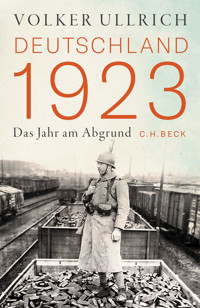9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zum Buch
Mit ihren Revolutionen haben sich die Deutschen in der Vergangenheit schwer getan. Das gilt auch für die Revolution von 1918/19 und ihre Bewertung. Am Anfang des revolutionären Geschehens standen der Matrosenaufstand in Kiel und der Staatsumsturz im November 1918, an ihrem Ende die blutige Niederwerfung der Münchner Räterepublik Anfang Mai 1919, die Unterzeichnung des Friedensvertrages von Versailles am 28. Juni und die Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung am 31. Juli. Volker Ullrich schildert mit souveräner Kennerschaft Ursprung und Verlauf der Revolution und geht zugleich der zentralen Frage nach, inwieweit die Konstellation von 1918/19 das katastrophale Scheitern der Weimarer Republik 1930 bis 1933 bereits in sich barg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Volker Ullrich
DIE REVOLUTION VON 1918/19
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Mit ihren Revolutionen haben sich die Deutschen in der Vergangenheit schwer getan. Das gilt auch für die Revolution von 1918/19 und ihre Bewertung. Am Anfang des revolutionären Geschehens standen der Matrosenaufstand in Kiel und der Staatsumsturz im November 1918, an ihrem Ende die blutige Niederwerfung der Münchner Räterepublik Anfang Mai 1919, die Unterzeichnung des Friedensvertrages von Versailles am 28. Juni und die Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung am 31. Juli. Volker Ullrich schildert mit souveräner Kennerschaft Ursprung und Verlauf der Revolution und geht zugleich der zentralen Frage nach, inwieweit die Konstellation von 1918/19 das katastrophale Scheitern der Weimarer Republik 1930 bis 1933 bereits in sich barg.
Über den Autor
Volker Ullrich, Dr. phil., Dr. h.c., ist Historiker und ZEIT-Autor. Er ist durch zahlreiche Beiträge zur Geschichte des Ersten Weltkriegs und der Revolution von 1918/19 ausgewiesen. Bei C. H. Beck ist zuletzt von ihm erschienen: Das erhabene Ungeheuer. Napoleon und andere historische Reportagen (bsr 1774)
Inhalt
Einleitung
I. Die Vorgeschichte der Revolution
1. Die Revolutionierung der wilhelminischen Gesellschaft im Ersten Weltkrieg
2. «Burgfriede» und Spaltung der Sozialdemokratie
3. Die verspätete Reform
II. Die erste Phase der Revolution (November 1918 – Februar 1919)
1. Der Aufstand in Kiel und die Ausbreitung der revolutionären Bewegung
2. Der 9. November in Berlin und die Bildung der Regierung der Volksbeauftragten
3. Der Alltag der Revolution
4. Revolution und Konterrevolution
5. Der Rätekongress
6. Die Weihnachtskrise und das Ausscheiden der USPD aus der Regierung
7. Von der Gründung der KPD zur Niederschlagung des Januaraufstands
8. Die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
9. Die Wahlen zur Nationalversammlung und die Bildung der Weimarer Koalition
III. Die zweite Phase der Revolution (Februar 1919 – August 1919)
1. Der Ruf nach Sozialisierung
2. Die Berliner Märzmassaker
3. Die Münchner Räterepublik
4. Versailler Vertrag und Kriegsschuldfrage
5. Die Weimarer Verfassung
6. Ausblick
Zeittafel
Literatur
Personenregister
Einleitung
Als «die größte aller Revolutionen» feierte Theodor Wolff, der Chefredakteur des liberalen «Berliner Tageblatts», in einem Leitartikel vom 10. November 1918 den Sturz der Hohenzollernherrschaft am Tag zuvor. In seinen 1936 im französischen Exil geschriebenen Erinnerungen zeigte er sich hingegen stark ernüchtert: «Bei Berührung mit diesem Ereignis verflüchtigt sich aus der Sprache des Chronisten gewissermaßen jedes Atom einer pathetischen Substanz.» Mit dem Wandel seines Urteils stand der prominente Journalist nicht allein da, denn dieses Urteil entsprach dem Prozess der Verdrängung und Umwertung der Revolution, der schon bald nach 1919 eingesetzt hatte. In der Rückschau erschienen die umwälzenden Ereignisse des November 1918 in immer grellerem Licht. Mit dieser Revolution mochte sich kaum mehr jemand identifizieren, nicht einmal die Sozialdemokraten, die von der politischen Rechten und später den Nationalsozialisten als «Novemberverbrecher» diffamiert wurden. So wurde der November 1918 nicht zum Gründungsmythos der Weimarer Republik, und in ihrer Schlussphase, erst recht nach ihrem Scheitern, verstärkten sich die Zweifel, ob das, was sich in ihrer Geburtsstunde zugetragen hatte, überhaupt den Namen einer Revolution verdiente.
Diese Sicht auf die Revolution von 1918/19 änderte sich nach 1945 grundlegend. Die führenden Repräsentanten der Sozialdemokratie wurden vom NS-Stigma der «Novemberverbrecher» befreit. Gleichzeitig hieß es, für ihren Kurs der scharfen Abgrenzung nach links und der engen Zusammenarbeit mit den alten Eliten des Kaiserreichs habe es keine Alternative gegeben, denn andernfalls wäre Deutschland ins Fahrwasser des «Bolschewismus» geraten. Diese Deutung, die ganz im Zeichen einer antikommunistisch ausgerichteten Geschichtspolitik stand, fasste Karl Dietrich Erdmann 1955 so zusammen: entweder «die soziale Revolution im Bündnis mit den auf eine proletarische Diktatur hindrängenden Kräften oder die parlamentarische Republik im Bündnis mit den konservativen Kräften wie dem alten Offizierskorps».
Erdmanns These erlangte in der westdeutschen Geschichtswissenschaft der 50er Jahre nahezu kanonische Bedeutung, während in der offiziellen Geschichtskultur der DDR, anknüpfend an die Polemik der KPD in der Weimarer Republik, ein Bild der Novemberrevolution gepflegt wurde, in dem die vermeintlich verpassten Chancen für eine grundlegende sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft hervortraten. Der SPD-Führung wurde in diesem Zusammenhang «Verrat» an den Interessen der Arbeiterklasse vorgeworfen. An diesem Bild sollte sich auch in den folgenden Jahrzehnten wenig ändern. Die DDR feierte sich selbst als den deutschen Staat, in dem «das Vermächtnis der Novemberrevolution verwirklicht» worden sei.
In der Bundesrepublik aber setzte in den frühen 60er Jahren mit dem Ende der Adenauer-Ära und den damit einhergehenden Veränderungen des politischen Klimas eine Revision ein. Erdmanns Deutung wurde nun aufgegeben zugunsten der These von einer «Offenheit» der Situation, die den verantwortlichen Politikern einen relativ großen Handlungs- und Entscheidungsspielraum geboten habe. In diesem Zusammenhang rückten Eberhard Kolb (1962) und Peter von Oertzen (1963) die Rätebewegung in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses – und mit ihr die Frage nach den versäumten Chancen einer durchgreifenden Demokratisierung des Obrigkeitsstaates. Die Räte, vordem als Werkzeuge des «Bolschewismus» verdächtigt, erschienen jetzt als Träger eines «radikaldemokratischen Potentials», das, wäre es genutzt worden, der Republik von Weimar zu größerer Stabilität hätte verhelfen können. Scharfe Kritik richtete sich an die Adresse der SPD-Volksbeauftragten, weil sie es versäumt hätten, sich dieses Potenzial zunutze zu machen.
Das neue Bild der Revolution beherrschte die Forschungsdiskussion auch der folgenden Jahrzehnte, doch seit den späten 70er Jahren wurden daran einige Korrekturen vorgenommen. Von einer romantisierenden Überhöhung der Rätebewegung, wie sie im Gefolge der Studentenbewegung von 1968 im Schwange war, ist man längst abgerückt. Die Räte wurden nicht mehr daran gemessen, was sie hätten sein sollen, sondern was sie tatsächlich waren, und da zeigte sich, dass die meisten, jedenfalls in der ersten Phase der Revolution, weder radikaldemokratisch noch gar revolutionär waren, sondern sich eher als der verlängerte Arm der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften verstanden und ihre Aufgabe vornehmlich in der Sicherung von «Ruhe und Ordnung» erblickten. Mit der Entmythologisierung der Räte verbunden war eine deutliche Abschwächung der Kritik an der SPD-Führung. Ihr wurde nicht mehr vorgeworfen, dass sie mit den Vertretern des alten Regimes zusammengearbeitet, sondern dass sie diese Zusammenarbeit über das unbedingt notwendige Maß hinaus betrieben habe. Heinrich August Winkler hat diese gleichsam gezähmte Kritik an den SPD-Volksbeauftragten in seinen wegweisenden Arbeiten auf die Formel gebracht: «Die Sozialdemokraten hätten bei stärkerem Gestaltungswillen mehr verändern können und weniger bewahren müssen.»
Nachdem sich die Forschungen zunächst auf die Brennpunkte des revolutionären Geschehens in den Metropolen und Industriegebieten konzentriert hatten, rückten seit den 80er Jahren auch die agrarischen Regionen und die Provinz ins Blickfeld. Eine Fülle von regional- und lokalgeschichtlichen Untersuchungen hat das Bild ergänzt und zum Teil differenziert, an den grundlegenden Erkenntnissen aber nichts mehr verändert.
Der frühe Begriff «Novemberrevolution» ist mittlerweile preisgegeben worden, weil er die Perspektive zu sehr auf den bloßen Vorgang des Staatsumsturzes im November 1918 reduziert hat. Dieser bildete jedoch nicht den Abschluss, sondern den Auftakt des revolutionären Geschehens, das sich über mehrere Monate erstreckte und zwei Phasen durchlief: eine erste, die von der Bildung der Arbeiter- und Soldatenräte Anfang November 1918 bis zur Niederschlagung des Berliner Januaraufstands und den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 reichte; eine zweite, die durch eine Radikalisierung der revolutionären Bewegung gekennzeichnet war und mit der Niederwerfung der Münchner Räterepublik Anfang Mai 1919, der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages am 28. Juni und der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung durch die Nationalversammlung am 31. Juli endete. Der heute übliche Begriff «Die Revolution von 1918/19» trägt dem Charakter dieses Prozesses Rechnung. Gelegentlich unternommene Versuche, dem noch eine dritte Revolutionsphase vom Sommer 1919 bis zum Kapp-Putsch im März 1920 hinzuzufügen, können kaum überzeugen, weil diese Phase bereits deutlich im Zeichen der Gegenrevolution stand.
Der hier nur kurz umrissene Gang der Forschung zeigt, dass die Revolution von 1918/19 bis heute ein Politikum geblieben ist, auch wenn das Interesse, verglichen mit früheren Jahrzehnten, nachgelassen hat: Es ist, wie Reinhard Rürup schon 1993 konstatierte, «insgesamt eher still um die Revolutionsgeschichte geworden». Im Wandel der Deutungen lassen sich jeweils Verschiebungen im gesellschaftlichen Klima der Bundesrepublik und im politischen Kategoriensystem der Historiker ausmachen. Eine Frage allerdings hat die Revolutionsforschung durch alle ihre Phasen begleitet: Inwieweit nämlich die Gründungskonstellation von 1918/19 das katastrophale Scheitern der Weimarer Republik 1930 bis 1933 bereits in sich barg. Vielleicht kann diese Überblicksdarstellung dazu beitragen, auch auf diese Frage eine Antwort zu geben.
I. Die Vorgeschichte der Revolution
1. Die Revolutionierung der wilhelminischen Gesellschaft im Ersten Weltkrieg
Am 9. November 1918, dem Tag, als die Revolution die Reichshauptstadt Berlin erreichte, notierte Thomas Mann in sein Tagebuch: «Alles in Allem habe ich ziemlich kaltes und nicht weiter unwilliges Blut. Revolutionen kommen erst, wenn sie gar keinen Widerstand mehr finden (auch bei dieser war es so) und eben dieses Fehlen beweist, daß sie natürlich und berechtigt sind. Die alten Machthaber sind im Grunde froh, ihre Macht, die keine mehr war, los zu sein, und es ist zuzugeben, daß ihre Autorität der Lage, wie sie ist und demnächst sein wird, nicht gewachsen gewesen wäre. Überhaupt sehe ich den Ereignissen mit ziemlicher Heiterkeit und einer gewissen Sympathie zu. Die Bereinigung und Erfrischung der politischen Atmosphäre ist schließlich gut und wohlthätig.»
So entspannt wie der in München lebende Schriftsteller reagierten nur die wenigsten Zeitgenossen auf die umwälzenden Ereignisse der ersten Novembertage 1918. Im Gegenteil: Für die meisten brach damals eine Welt zusammen, so auch für den Schriftsteller Gerhart Hauptmann: «Das Ungeheure ist zur Tatsache geworden», schrieb er ebenfalls am 9. November. «Die Bahn Wilhelms II., dieses eitlen, überheblichen, fleißigen Monarchen ist beendet.» Und Harry Graf Kessler, der Kunstmäzen und Diplomat, bemerkte: «Mir griff es doch an die Gurgel, dieses Ende des Hohenzollernhauses; so kläglich, so nebensächlich: nicht einmal Mittelpunkt der Ereignisse.» Den 9. November nannte er einen «der denkwürdigsten, furchtbarsten Tage der deutschen Geschichte».
So plötzlich, wie viele meinten, war die Revolution jedoch keineswegs ausgebrochen, und es hatte auch mehr als nur eines Anlaufs bedurft, um die scheinbar so festgefügte Bastion der Hohenzollernherrschaft zu schleifen. Die Umwälzung vom November 1918 war nicht nur eine unmittelbare Folge der militärischen Niederlage und der dadurch ausgelösten Schockreaktion in der deutschen Bevölkerung; vielmehr war sie seit Langem in einem Prozess kumulativer Radikalisierung im Schöße der wilhelminischen Gesellschaft herangereift. Unter der Hülle des «Burgfriedens» hatten sich seit August 1914 die gesellschaftlichen Spannungen außerordentlich verschärft. Hauptursache waren die schweren Belastungen, die der Krieg der großen Mehrheit der Bevölkerung aufbürdete. Nicht nur Arbeiter, sondern auch Angestellte und Beamte mussten eine bedeutende Verschlechterung ihres Lebensstandards hinnehmen. Die Einkommen konnten mit der raschen Verteuerung aller lebensnotwendigen Güter, vor allem der Nahrungsmittel, nicht Schritt halten. Die Reallöhne sanken im Schnitt weit unter Vorkriegsniveau. Gleichzeitig wurden Arbeitszeiten verlängert und – besonders in den Rüstungsbetrieben – Schutzbestimmungen außer Kraft gesetzt. Die Erbitterung darüber entlud sich seit 1916 in einer wachsenden Zahl «wilder» Streiks – «wild» deshalb, weil die Gewerkschaftsleitungen seit Kriegsbeginn auf alle Arbeitsniederlegungen verzichtet hatten und die Streikenden von dieser Seite weder mit moralischer noch finanzieller Unterstützung rechnen konnten.
Neben der Verteuerung bildete die zunehmende Knappheit der Lebensmittel eine Quelle ständiger Unzufriedenheit. Vor dem Krieg hatte das Deutsche Reich 20 Prozent seiner Lebensmittel importiert; die alliierte Wirtschaftsblockade schränkte die Zufuhren stark ein. Verschärft wurde die Mangelsituation allerdings durch die Unfähigkeit der Behörden, eine halbwegs gerechte Verteilung sicherzustellen. Unter den anhaltenden Versorgungsschwierigkeiten hatten vor allem Frauen der unteren Bevölkerungsschichten zu leiden. Seit Ende 1915/Anfang 1916 gehörten Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften zum Alltagsbild vieler Großstädte. «Es herrscht hierbei eine äußerst gereizte Stimmung unter diesen Proletarierfrauen, und die Maßnahmen der Regierung erfahren häufig eine recht gehässige Kritik», beobachtete ein Berliner Polizist Ende September 1915. Nicht selten wurden «Lebensmittelpolonaisen» zum Ausgangspunkt von Hungerrevolten: Frauen und Jugendliche demonstrierten für «Frieden und Brot», stürmten Rathäuser und plünderten Geschäfte. Gegen solche Proteste gingen Polizeibeamte oft mit übertriebener Härte vor, was wiederum den Zorn der hungernden Menschen steigerte. Über den ersten großen Hungerkrawall auf dem Münchner Marienplatz im Juni 1916 schrieb ein Augenzeuge, der Anarchist Erich Mühsam, in sein Tagebuch: «Die Polizisten hatten blank gezogen und ritten jetzt, nach allen Seiten schlagend, über den Platz. Man hörte Schreie von Verwundeten, namenlose Wutäußerungen: Pfui! Sauhunde! Preußenknechte! Helden! Auf Weiber und Kinder habt ihr Mut! Pfui! Pfui!»
Die ersten Äußerungen der Unzufriedenheit und des Aufbegehrens waren noch bestimmt durch ökonomische Beschwernisse, mochte dahinter auch bereits das Verlangen nach Frieden als Grundmotiv erkennbar sein. Mit zunehmender Dauer des Krieges verbanden sich Missstimmung über die materielle Not und Kriegsmüdigkeit mit Ressentiments gegen die Privilegierten und Herrschenden, mit sozialer Kritik und politischem Protest. Eine wesentliche Rolle spielte dabei der immer schlimmere Auswüchse annehmende «Schleichhandel». Kolonnen von Großstädtern durchkämmten an Wochenenden die ländlichen Gebiete, um die schmalen Rationen, die über Karten zu bekommen waren, aufzubessern. Große Erbitterung löste es jedes Mal aus, wenn Polizeibeamte den kleinen «Hamsterern» die mühsam erworbenen Lebensmittel abnahmen, während die Großspekulanten und erwerbsmäßigen Schieber ungeschoren davonkamen. Der größte Teil der auf dem Schwarzmarkt gehandelten Waren landete in den Vorratskellern der Vermögenden. So hatte der «Schleichhandel» eine die Klassengegensätze zugleich enthüllende und verschärfende Funktion. «Alles wird für die Reichen, für die Besitzenden reserviert. Sobald es heißt, Entbehrungen mitmachen zu müssen, dann wollen die Herrschaften keine Brüder und Schwestern mehr von der arbeitenden Klasse sein. Die schönen Reden vom Durchhalten gelten nur für die arbeitende Klasse, die herrschende Klasse hat sich mit ihrem Geldsack schon genügend versorgt», empörte sich eine Hamburger Arbeiterin im Winter 1916/17, der als «Steckrübenwinter» in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
Noch zermürbender als Hunger und Mangel in der «Heimat» wirkte die Erfahrung des massenhaften Sterbens an den Fronten. Von der Begeisterung der Augusttage 1914 war gerade hier bald nichts mehr zu spüren. An die Stelle des idealistisch gestimmten Kriegsfreiwilligen trat der desillusionierte, harte Frontkämpfer, für den das Töten zur mechanischen Pflichterfüllung wurde. Alltag im Schützengraben – das hieß ein Maulwurfsleben in Unterständen, manchmal bis zu zehn Metern unter der Erde, mit Dreck, Gestank und Ungeziefer, das hieß das nervenzehrende Warten auf den nächsten Angriff, inmitten einer von Laufgräben und Stacheldrahtverhauen durchzogenen Schlachtlandschaft, wo verstümmelte und faulende Leichenteile herumlagen, wieder und wieder umgepflügt vom oft stundenlangen Trommelfeuer. «Ihr könnt Euch keine Vorstellung von diesem Schrecken machen», schrieb ein Infanterist im Juni 1916 über das Gemetzel bei Verdun. Abstumpfung, Verrohung, Hass auf die militärischen Vorgesetzten und Verachtung für die «Etappenhengste» prägten den Umgangston in dieser Zwangsgemeinschaft des Schützengrabens.