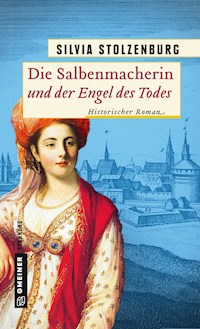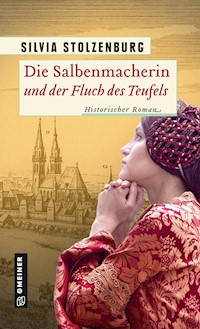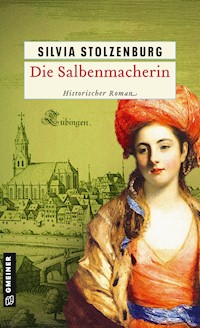
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Salbenmacherin
- Sprache: Deutsch
Als die sechzehnjährige Olivera aus Konstantinopel ihren Vater mit einer List dazu bringt, sie mit einem seiner Handelspartner zu verheiraten, ahnt sie nicht, welche lebensverändernden Folgen dies haben wird. Schon bald nimmt sie Abschied von der Heimat und bricht mit ihrem Gemahl auf zu einer langen Reise ins ferne Tübingen. Dort angekommen stößt sie nicht nur auf das Misstrauen der Einheimischen, auch ihr Liebster scheint sich mehr und mehr zu verändern. Es dauert nicht lange, bis Olivera herausfindet, dass er ein furchtbares Geheimnis hütet. Ihre Entdeckung bringt nicht nur sie in höchste Lebensgefahr …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Salbenmacherin
Historischer Roman
Zum Buch
Falsche Liebe Konstantinopel 1408: Die sechzehnjährige Olivera bringt ihren Vater mit einer List dazu, sie mit einem seiner Handelspartner aus dem deutschen Reich zu verheiraten. Dabei ahnt sie nicht, welche Folgen dies haben wird. Schon bald nimmt sie Abschied von der Heimat und bricht mit ihrem Gemahl Laurenz auf zu einer langen und gefährlichen Reise ins ferne Tübingen. Dort angekommen stößt die junge Salbenmacherin nicht nur auf das Misstrauen der Einheimischen, auch ihr Liebster scheint nicht mehr er selbst zu sein. Er zieht sich von ihr zurück, wird wortkarg und abweisend. Wäre da nicht Götz, der Spitalapotheker und Bruder ihres Gatten, wüsste sie nicht, wem sie ihre Sorgen anvertrauen sollte. Denn es dauert nicht lange, bis Olivera herausfindet, dass Laurenz ein furchtbares Geheimnis hütet. Doch ihre Entdeckung bringt nicht nur sie in höchste Lebensgefahr …
Dr. phil. Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen. Im Jahr 2006 promovierte sie dort über zeitgenössische Bestseller. Kurz darauf machte sie sich an die Arbeit an ihrem ersten historischen Roman. Die Vollzeitautorin lebt mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb, fährt leidenschaftlich Rennrad, gräbt in Museen und Archiven oder kraxelt auf steilen Burgfelsen herum - immer in der Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken.
Impressum
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Neuausgabe 2022
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mrs._Richard_Paul_Jodrell_by_Sir_Joshua_Reynolds.jpeg und http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuebingen-1643-Merian.jpg
ISBN 978-3-8392-4724-2
Widmung
Für meinen Schatz, die Sonne in meinem Leben
Prolog
Tübingen, Ende März 1408
Die Nacht war wie geschaffen zum Töten.Tiefhängende Wolken verdeckten einen schwindsüchtigen Mond und die Schatten der Häuser waren so undurchdringlich, dass man kaum die Hand vor den Augen erkennen konnte. Schon längst hatten Sturm und Regen die meisten Fackeln erlöschen lassen. Nur hie und da malten die Flammen gespenstisch zuckende Schatten auf das Kopfsteinpflaster. Wer keinen Wert darauf legte, sich in der Kälte den Tod zu holen oder von den Nachtwächtern befragt zu werden, befand sich schon längst im Bett. Doch die Gestalt, welche sich in einen schmalen Kelleraufgang duckte, hatte weder Angst vor dem eisigen Regen noch vor den Fragen der Stadtwachen. Denn diese, das wusste sie, befanden sich in ihrer Wachstube, wo es warm und trocken war. Mit kalten Fingern umklammerte der Mann einen leeren Sack, den er schon bald zu füllen gedachte. Wenn das Klappern der Hufe und das Knarren der Räder sich weiterhin in der gleichen Geschwindigkeit seinem Versteck näherten, dann würde sein Opfer schon bald den letzten Atemzug tun. Dieser würde ihm leichter fallen, als die letzten beiden. Schließlich hatte dieser vor fast einem halben Jahr mit einem »unehrlichen Messer« in seinem Türpfosten dafür gesorgt, dass die Leute sein Haus gemieden hatten, als ob darin die Pest ausgebrochen wäre! Und das nur, weil sein Weib den alten, räudigen Hund selbst getötet hatte, anstatt ihn von ihm, dem Hundeschinder, abholen zu lassen! Sein Gesicht verzog sich zu einer hässlichen Grimasse. Nicht mehr lange, und der Hundeschinder würde für seine Unverschämtheit bezahlen! Das verstummte Quietschen der rostigen Räder verriet ihm, dass seine Beute ein weiteres Mal angehalten hatte, um einen der Kadaver aufzulesen, für deren Beseitigung die Tübinger ihn bezahlten. Wie die Prostituierten, die Betrunkenen und die Bettler gehörten auch der Hundeschinder und seine uralte Märe zu den Nachtschwärmern, an denen selbst die Obrigkeit der Stadt vorbeisah.
Eine eisige Bö fegte durch die Gasse und ließ den Lauernden frösteln. Obwohl das Jagdfieber durch seine Adern pulsierte und dafür sorgte, dass sich ein Schweißfilm auf seiner Oberlippe bildete, spürte er dennoch, wie die Kälte allmählich bis auf seine Knochen durchdrang. Wenn der verfluchte Hundeschinder nicht bald das Versteck passierte, würde er die Geduld verlieren! Er spielte gerade mit dem Gedanken, den Kelleraufgang zu verlassen und den Unehrlichen in eine der Seitengassen zu zerren, als der Klepper des Schinders auftauchte. Dieser selbst saß zusammengekauert auf dem schiefen Bock – die Zügel so lose in der Hand, dass sie beinahe den Boden streiften. Einen kurzen Moment lang trat der Mond hinter den Wolken hervor und beleuchtete die ausgemergelte Fratze des Mannes. Seine Augen wanderten müde von rechts nach links und blieben an dem Köder hängen, welchen der Wartende ausgelegt hatte. »Hoh«, krächzte er, hustete und spuckte einen Klumpen Schleim aus. Dann ließ er sich ungelenk vom Bock fallen und trottete auf den toten Hund zu, der keine zwei Fuß vor dem Kelleraufgang lag. Die Muskeln des Jägers spannten sich. Und als der Schinder sich bückte, um das verendete Tier aufzuheben, schnellte er vor, legte ihm von hinten den Arm um die Kehle und rammte ihm ein Messer in den Rücken. Das gurgelnde Geräusch, das der Getroffene von sich gab, war beinahe komisch. Mit einer Mischung aus Ekel und Erregung spürte der Mörder, wie warmes Blut aus der Wunde sprudelte und über seine Hand lief. Ohne viel Federlesens ließ er den Unehrlichen los und wich einen Schritt zurück, als dieser in sich zusammenfiel wie ein leerer Sack. Dann kniete er sich neben ihn, setzte das Messer an und begann sein grausiges Werk. Keine zehn Minuten später stopfte er das letzte Teil in seinen Beutel – der noch blutig war von seinem letzten Ausflug – und zurrte ihn zu. Nachdem er ihn geschultert hatte, hob er das Gefäß auf, das er sorgsam gefüllt hatte, verkorkte es und klemmte es sich unter den Arm. Zwar hatte er in der Dunkelheit nicht genau gesehen, was er tat, aber sein Auftraggeber würde dennoch zufrieden sein. Je mehr er erntete, desto mehr bezahlte er ihm. Wen interessierte es da, wie sauber die Schnitte waren? Er warf einen letzten Blick über die Schulter, um sich zu versichern, dass ihn niemand beobachtet hatte, und lächelte. Noch ein paar dieser Streifzüge, und er würde sich ein neues Pferd leisten können!
Teil 1
Kapitel 1
Konstantinopel, Juli 1408
»Das kann doch nicht sein Ernst sein, Yiayia!« Die sechzehnjährige Olivera spürte, wie ihr die Hitze in die Wangen schoss. »Wie lange soll ich denn noch warten?«
Nur mit Mühe hielt sie sich davon ab, wie ein Kind mit dem Fuß aufzustampfen. Ungeduld und Empörung brodelten so heftig in ihr, dass sie meinte, fühlen zu können, wie ihre Gallensäfte überschäumten. Wütend starrte sie auf den Stößel in ihrer Hand hinab, den sie am liebsten mitsamt dem Mörser auf den Boden gepfeffert hätte. Warum konnte ihr Vater ihrem Wunsch nicht endlich nachgeben? Was hatte sie nur getan, um diese Ungerechtigkeit zu verdienen? Sie ließ den Stößel los und verschränkte die Arme vor der Brust.
»War ich nicht immer eine gehorsame Tochter?«, fragte sie und wischte ungehalten die Tränen der Enttäuschung aus den Augen. Diese füllten sich jedoch umgehend wieder, was ihren Verdruss noch mehr steigerte.
»Hab noch ein Jahr Geduld, Kind«, erwiderte die alte Frau, mit der sie seit Tagesanbruch in der Offizin – der Salbenküche – hantierte. »Er will nur das Beste für dich.«
»Das Beste?«, brauste Olivera auf. »Wenn er noch lange wartet, wird mich keiner mehr ansehen!« Ihre Stimme klang schrill in dem hohen Raum.
»Beruhige dich«, ermahnte ihre Großmutter sie und stellte den Tiegel ab, in dem sie Populeon – eine Salbe aus Pappelknospen, Mohn und Rosenöl – gemischt hatte. »Du weißt doch, dass steter Tropfen den Stein höhlt.« Ihr faltiges Gesicht verzog sich zu einem listigen Lächeln. »Und dein Vater ist kein besonders harter Stein.« Sie säuberte sich die Hände an einem Tuch und trat auf ihre Enkelin zu. »Merke dir eines, mein Kind«, sagte sie. »Wenn du einen Mann dazu bringen willst, etwas zu tun«, sie hob den Zeigefinger, »dann umschmeichle ihn und gib ihm das Gefühl, dass es sein Einfall war.« Der Zeigefinger wackelte hin und her. »Auf keinen Fall darfst du ihn so bedrängen, dass er denkt, er würde einem Weib nachgeben.«
Olivera presste die Lippen aufeinander und stieß ärgerlich die Luft durch die Nase aus. Obwohl die Worte ihrer Großmutter sie eigentlich beruhigen sollten, schienen sie das Gegenteil zu bewirken.
»Alexia ist erst vierzehn und sie wird in einem Monat die Frau des Goldschmiedes«, brummte sie.
Einige Augenblicke lang sah ihre Großmutter sie mit einem Lachen in den Augen an. Dann tätschelte sie Olivera die Wange und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder ihrer Arbeit zu.
»Es nützt nichts, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht ändern kann«, sagte sie und griff nach einem Glaskolben. »Die Arbeit wird dich auf andere Gedanken bringen.« Mit diesen Worten zog sie eine Leiter heran und deutete auf eines der bis an die Decke reichenden Regale. »Deine Beine sind jünger als meine. Ich brauche Bärenklau und Wolfsmilch.«
Obgleich Olivera bittere Widerworte auf der Zunge brannten, schluckte sie diese und tat, wie geheißen. Geschickt erklomm sie die Sprossen und angelte nach den hohen Tontöpfen, in denen das Gewünschte lagerte. Nachdem sie ihrer Großmutter noch dabei geholfen hatte, ein Feuer zu entzünden, kehrte auch sie zu ihrer Arbeit zurück und wog die Zutaten für eine Salbe gegen Sonnenbrand ab. Derweil sie eine Handvoll Lilienwurzeln abkochte, Bleiweiß, Mastix und Weihrauchharz mit etwas Campher und Schweinefett vermengte, gingen ihre Gedanken auf Wanderschaft. Ihre Großmutter hatte leicht reden! Geduld schien ein Allheilmittel der Alten zu sein! Sie schürzte die Lippen, während sie ihren Vater in Gedanken verwünschte. Wieso suchte er nicht endlich einen Bräutigam für sie? Sollte sie etwa ewig unter seinem Dach leben – als Tochter, ohne eigenen Rang und Namen? Sie stocherte so heftig in der zähen Masse herum, dass diese ein schmatzendes Geräusch von sich gab. Als eine Blase zerplatzte und etwas von dem Gemisch auf ihrem Handrücken landete, verrieb sie es mit der Fingerkuppe und runzelte die Stirn.
Ob die Frau, für die sie diese Mixtur anfertigte, glücklicher war als sie? Die Falten auf ihrer Stirn vertieften sich, als sie sich die Dame vorstellte. Vermutlich handelte es sich um eine der vermögenden venezianischen Kaufmannsgemahlinnen. Oder um eine der Florentinerinnen, Jüdinnen oder Ragusanerinnen, die ebenfalls in den prächtigen Vierteln in der Nähe des Hafens wohnten. Sie strich sich eine Strähne ihres dunklen Haares aus der Stirn und sah dabei zu, wie die Zutaten nach einigem weiteren Rühren zu einem sämigen Brei verschmolzen. Wie sehr sie die Damen beneidete! Nur mit Mühe unterdrückte sie ein Seufzen und wünschte sich zum ungezählten Mal, die biblische Stärke einer Delila, einer Debora oder Judit zu besitzen; den Mut und die Kraft zu haben, gegen Althergebrachtes aufzubegehren und das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Ein Schweißtropfen löste sich von ihrer Stirn, rann an ihrer Schläfe entlang die Wange hinab, bis er ihr Kinn erreichte und in den Mörser tropfte. Das Feuer ihrer Großmutter verstärkte die brütende Sommerhitze, die selbst die dicken Wände inzwischen nicht mehr auszusperren vermochten. Leise prustend fuhr Olivera sich mit dem Ärmel über die Stirn. Und nicht zum ersten Mal fragte sie sich, wie ihre Yiayia es unter dem schweren schwarzen Stoff aushielt, aus dem all ihre Kleider gefertigt waren. Olivera selbst war nur mit zwei leichten Seidengewändern bekleidet, derer sie sich nur allzu gern entledigt hätte. Der Anflug eines Lächelns huschte über ihr Gesicht, als sie sich ausmalte, wie ihre Großmutter darauf reagieren würde. Doch die Heiterkeit blieb nicht lang, und schon bald versank sie wieder in dumpfem Brüten.
Lange Zeit verging in konzentrierter Arbeit. So vertieft war die junge Frau in das Abwiegen, Seien, Vermischen und Zerstoßen weiterer Arzneipflanzen, dass sie das Klopfen an der Tür der Arzneiküche erschrocken zusammenfahren ließ.
»Der Medicus schickt nach Euch«, stieß die Magd, die kurz darauf in dem Spalt erschien, atemlos hervor. »Der Bote meint, es sei dringend. Eine Frau ist an Hysterike erkrankt und liegt wie tot da!« Ihre Wangen waren von der Eile gerötet. Vollkommen aufgelöst, schien sie nicht zu wissen, ob sie den Raum betreten sollte oder nicht. Weshalb Oliveras Großmutter mahnend die Hand hob.
»Verlier nicht den Kopf«, tadelte sie das Mädchen. »Lauf und lass die Sänfte bereitmachen.« An ihre Enkelin gewandt sagte sie: »Pack Schwefel und ein Büschel Pferdehaar ein.« Sie selbst griff nach einem Weidenkorb und füllte diesen mit einem Honigtopf, Moschuswasser, Baumwolle und etwas Minze.
Sobald Olivera das Geforderte ebenfalls in den Korb gestopft hatte, verbarg sie ihr Haar unter einem Tuch und folgte ihrer Großmutter hinaus ins Freie. Dort buken Hof und Gärten unter einem wolkenlosen Himmel in der Sonne vor sich hin. Allerdings erschien Olivera die schwüle Luft nach der Hitze in der Offizin beinahe wie ein frischer Hauch. Einige Augenblicke reckte sie die Nase in den Wind und atmete gierig ein und aus. Eine Bö trug den Geruch von Salz und Algen vom Meer hinauf, nach dessen kühlen Fluten sich die junge Frau so sehr sehnte wie schon lange nicht mehr. Als sie sich wieder in Bewegung setzte und dem überdachten Säulengang folgte, der rings um den quadratischen Hof lief, gesellte sich der Duft von frischem Brot und Gewürzen zu dem Geruch des Bosporus. Oliveras Magen begann zu knurren. Später!, ermahnte sie sich schuldbewusst, da ihre Großmutter bereits mehrere Schritte Vorsprung hatte. Eilig hastete sie ihr hinterher. Bis auf ein paar Hühner und Singvögel regte sich weit und breit kein Leben. Selbst der Esel, der für gewöhnlich die Kornmühle antrieb, stand mit gesenktem Kopf im Schatten eines knorrigen Olivenbaumes. Obschon sie nicht viel mehr als einen Steinwurf zurücklegen mussten, atmete die junge Frau erleichtert auf, als sie das Tor erreichten, vor dem die Sänfte auf sie wartete. Die Träger verharrten geduldig neben dem Gebäude, in dem Kontor und Laden ihres Vaters untergebracht waren – einem hohen Bau mit spitzen Fenstern, zwei kleinen Türmchen und einer gekachelten Fassade. Auch der Bote des Medicus trat dort nervös von einem Fuß auf den anderen – als verspüre er immensen Harndrang. Kaum erblickte er die beiden Frauen, warf er erleichtert die Hände in die Höhe.
»Schnell, schnell«, drängte er. »Es ist die Donna Vincenzo!« Sein Gesicht verzog sich zu einer beinahe komischen Grimasse. »Sie ist doch noch so jung!«
Nachdem sie ihrer Großmutter in die Sänfte geholfen hatte, kletterte Olivera ebenfalls in den Tragsessel, welchen die Männer ihres Vaters augenblicklich aufnahmen. Sie wollte gerade die Haken des Vorhangs schließen, da erblickte sie eine Gruppe Reiter, die auf das Haus zusteuerten. Neugierig schob sie die Nase zwischen den Spalt und beäugte die Fremden, denn sie vermeinte, einen von ihnen zu erkennen. Aufrecht und stolz saß er im Sattel eines riesigen Rappen. Ihr Herz machte einen Sprung, als sie rotblondes Haar unter seiner Kappe hervorblitzen sah. Ehe sie sich jedoch versichern konnte, dass ihre Augen ihr keinen Streich spielten, zog ihre Yiayia sie von dem Spalt zurück und schalt: »Die Neugier ist die Tugend des Teufels. Was soll man denn von dir denken, wenn du dich benimmst wie eine Elster?«
Olivera errötete. »Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen«, murmelte sie schuldbewusst.
»Das hast du ganz sicher«, entgegnete ihre Großmutter. »Aber ob derjenige es wert ist, dass du allen Anstand vergisst …« Sie schüttelte den Kopf und fasste ihre Enkelin forschend ins Auge.
Da Olivera die Betrachtung unangenehm war, senkte sie den Kopf und es herrschte Schweigen in der Sänfte, bis die Träger sie vor einem palastähnlichen Haus absetzten. Dort winkte der Bote des Medicus sie in eine Eingangshalle, von der aus zwei Treppen ins Obergeschoss führten.
»Hier entlang«, ließ er die Frauen wissen. Er scheuchte sie auf den schmaleren der beiden Aufgänge zu. Oben angekommen wies er nach links, und wenig später betraten Olivera und ihre Großmutter ein Gemach von gewaltigen Ausmaßen. In der Mitte des Raumes prangte eine Bettstatt, in deren Himmel Gold- und Silberfäden funkelten. Trotz der zahllosen Kissen, die sie umgaben, wirkte die Dame in diesem Bett so klein und zerbrechlich wie eine Puppe. Ein halbes Dutzend Mägde kniete auf dem Boden und betete, während der Medicus eine Schale mit Wasser auf der Brust der Kranken platzierte.
»Da seid Ihr ja endlich!«, fuhr er die Frauen an. »Sie lebt noch.« Er wies auf das Wasser in der Schale, das sich mit jedem – mit dem bloßen Auge kaum sichtbaren – Atemzug der Dame kräuselte. »Aber es ist höchste Eile geboten. Ihr Uterus ist zu trocken. Er ist nach oben gewandert und behindert die Atmung«, erklärte er. »Sie wird ersticken, wenn es uns nicht gelingt, die Bewegung umzukehren!«
Oliveras Großmutter nickte. Sie trat an die Kranke heran und hielt ihr einen Finger unter die Nase. Dann wandte sie sich wieder um und wies Olivera an: »Nimm eine Schale und entzünde das Pferdehaar darin. Sobald es glimmt, gib etwas Schwefel hinzu und sorge dafür, dass die Kranke den Dampf einatmet.« Sie selbst griff nach den Zutaten in ihrem Korb und vermengte diese mit geübten Bewegungen in einem Tiegel. »Macht sie frei«, befahl sie den Mägden.
Verwundert verfolgte Olivera, wie ihre Yiayia die Schenkel der Patientin mit der Arznei aus dem Tiegel bestrich und ein Stück Baumwolle damit tränkte. Dieses führte sie in die Kranke ein, während der Arzt begann, mit Schröpfköpfen zu hantieren. Zwar hatte Olivera schon von diesen Maßnahmen gegen die gefährliche Hysterike pnix gehört, allerdings war sie noch nie bei einer Behandlung zugegen gewesen.
»Ich habe sie vor dem Gelübde der Enthaltsamkeit gewarnt«, brummte der Arzt und hielt einen der Glaskolben über eine Kerzenflamme. »Aber sie wollte und wollte nicht auf mich hören.«
Was bei allen Heiligen hatte die Enthaltsamkeit mit dem Zustand der Frau zu tun?, fragte Olivera sich. Da just in diesem Moment das Pferdehaar in ihrer Schale anfing zu qualmen, vergaß sie die Verwunderung jedoch genauso schnell, wie sie gekommen war, und blies in die Glut. Vorsichtig gab sie etwas von dem Schwefelpulver hinzu und hielt schleunigst den Atem an. Innerhalb weniger Augenblicke stank der gesamte Raum so entsetzlich, dass eine der Mägde auf das Fenster zueilte, um es zu öffnen. Allerdings hielt der Medicus sie mit einem herrischen Befehl davon ab.
»Der Gestank soll den Uterus nach unten treiben, wohin der Wohlgeruch ihn lockt«, fauchte er. »Nicht durch das Fenster entweichen!« Er beugte sich über die Kranke, um die Glaskugel aufzusetzen. Doch bevor er dazu kam, begann die Frau zu husten und um sich zu schlagen, als ob sie sich gegen alle Dämonen der Hölle gleichzeitig zur Wehr setzen müsste.
»Herr im Himmel, hab Dank für dieses Wunder«, hörte Olivera eine der Bediensteten flüstern. Neugierig verfolgte sie, wie der Arzt der Patientin zuerst den Puls fühlte und dann in seine Tasche griff und eine Fliete – ein Messer für den Aderlass – zutage förderte.
»Das Unheil ist abgewendet«, murmelte er nach einigen Herzschlägen und richtete sich wieder auf. »Thomas wird Euch bezahlen«, ließ er Oliveras Großmutter wissen. »Ihr könnt gehen.« Er lenkte seine Aufmerksamkeit zurück auf die Kranke. »Ihr seid nur mit Mühe dem Tod entronnen. Bitte hört in Zukunft auf meinen Rat«, sagte er streng. Obgleich Olivera den Mann nicht ausstehen konnte, musterte sie ihn neugierig. Was es wohl für ein Rat war? Ehe sie weiter darüber nachgrübeln konnte, mahnte ein Husten des Boten sie zur Eile. Mit fliegenden Fingern verstaute sie die Zutaten wieder in dem Weidenkorb. Dann huschte sie aus dem Raum und wartete, bis der Mann ihre Großmutter bezahlt hatte. Als sie sich wenig später wieder in der Sänfte befanden, konnte sie ihre Neugier allerdings nicht mehr im Zaum halten.
»Was für ein Rat war es, den der Medicus der Donna gegeben hat?«, platzte es aus ihr heraus. »Warum wollte er sie von ihrem Enthaltsamkeitsgelübde abbringen?«
Ihre Großmutter zuckte die Achseln. »Man sagt, dass besonders Witwen und Jungfrauen von der Hysterike bedroht sind«, entgegnete die alte Frau. »Weil sie nicht mit einem Mann liegen und daher die Gefahr der Austrocknung besonders hoch ist.«
Olivera riss staunend die Augen auf. Und plötzlich kam ihr ein Gedanke, der sie den Verdruss des Morgens vergessen und ihr Herz davongaloppieren ließ.
Kapitel 2
Konstantinopel, Juli 1408
Sobald sie vor dem Haus ihres Vaters von den Trägern abgesetzt wurden, sah sie sich nach allen Seiten um. Ihr Herzschlag hatte sich mit jedem Schritt weiter beschleunigt, und sie betete, dass ihre Großmutter ihr die Aufregung nicht an der Nasenspitze ansah. Hatte die Eile, mit der sie das Haus der Kranken erreichen mussten, alle Gedanken an die Reiter verdrängt, waren diese auf dem Rückweg mit aller Macht zurückgekehrt. Wenn ihre Augen ihr beim Aufbruch keinen Streich gespielt hatten, dann war er wieder da! Eine Vorstellung, die dafür sorgte, dass sie ein seltsames Gefühl durchströmte. Um eine ausdruckslose Miene bemüht, folgte sie ihrer Großmutter zurück in den Hof. Dort herrschte wesentlich mehr Leben als vor nicht ganz einer Stunde. Fuhrleute luden vor dem Lager ihres Vaters Waren ab, die von Sklaven oder bezahlten Trägern aufgenommen und in das flache Gebäude gebracht wurden. Zwei Hunde balgten sich in der Nähe des Springbrunnens um einen Knochen. Und einige Knechte waren damit beschäftigt, das Fell von fünf Pferden auf Hochglanz zu striegeln. Bei einem der Reittiere handelte es sich um den riesigen Rappen, in dessen Sattel der Mann gethront hatte, von dem Olivera seit beinahe einem Jahr immer wieder träumte. Jedenfalls hoffte sie inständig, dass es sich um ihn handelte und nicht um einen anderen Fremden mit goldenem Haar. Auch wenn sie wusste, dass es unschicklich war, verrenkte sie sich beinahe den Hals bei dem Versuch, hinter den Fenstern des Kontors etwas zu erkennen. Zweifelsohne hatte ihr Vater die Besucher dort empfangen – handelte es sich doch um Geschäftspartner.
»Tu mir einen Gefallen, Kind«, riss ihre Yiayia sie aus den Träumereien. »Der Ausflug hat mich erschöpft.« Sie strich sich mit der Hand über den Teil ihres silbernen Haares, der nicht von einem Tuch bedeckt war. »Ich werde mich ein wenig ausruhen. Sag einer Küchenmagd, sie soll mir Brot, Oliven und etwas Wein bringen.« Ihr Blick wanderte zu dem Korb in Oliveras Hand, dann sah sie ihrer Enkelin in die Augen. »Du solltest auch etwas essen. Vielleicht bringt dich das auf andere Gedanken.«
Flammende Röte schoss Olivera in die Wangen. Woher wusste ihre Großmutter, was sie dachte? War es so offensichtlich? Oder spielte ihre Yiayia auf das Gespräch vom Morgen an? Bevor sie eine Antwort auf diese Fragen finden konnte, verschwand die alte Frau jedoch in den Schatten des Säulenganges. Hatte sie sich durch irgendetwas verraten? Sie blinzelte die Fragen beiseite und sah sich mit brennendem Gesicht ein letztes Mal sehnsüchtig um. Da allerdings immer noch keine Spur von dem Neuankömmling zu entdecken war, unterdrückte sie ein Seufzen. Nachdem sie eine Küchenmagd ausfindig gemacht und ihr die Wünsche ihrer Großmutter aufgetragen hatte, begab sie sich zur Arzneiküche. Dort angekommen, lehnte sie sich von innen gegen die Tür und starrte einige Zeit lang Löcher in die Luft. Die Kühnheit ihres Einfalles erschreckte sie. Doch gleichzeitig verwandelte sie die Enttäuschung und Bitterkeit in ihr in etwas, für das sie keine Worte fand. Um sich von den wild in ihrem Kopf durcheinanderwirbelnden Gedanken abzulenken, sog sie ganz bewusst die schweren Dämpfe der Arzneiküche ein. Während sich die Würze von Weihrauchharz mit dem Aroma von Lavendel, Nelken und Theriak vermischte, bemühte sie sich, die Schmetterlinge in ihrem Bauch unter Kontrolle zu bringen.Ein weiterer Seufzer stieg in ihr auf, und dieser fand den Weg über ihre Lippen. Würde er sie überhaupt eines Blickes würdigen?, war die Frage, die sie am meisten quälte. Oder würde er sie wieder behandeln wie ein kleines Mädchen? Scham übergoss sie, als sie daran zurückdachte, wie er ihr bei seinem letzten Besuch eine Handvoll gezuckerter Feigen geschenkt hatte. Sein Lächeln war das eines großen Bruders gewesen – und noch niemals zuvor hatte Olivera sich so klein und unansehnlich gefühlt wie in diesem Augenblick. »Äffchen« hatten ihre eigenen Brüder sie immer genannt. Doch zum Glück war keinem der drei der Einfall gekommen, sie in Anwesenheit des Fremden so zu rufen! Sie presste die Lider aufeinander und beschwor sein Gesicht herauf: die grauen Augen unter den hellen Brauen; den energischen Mund; die leicht gebogene, etwas schiefe Nase; und den rotblonden Schopf. Als sie ihn das erste Mal gesehen hatte, war sie versucht gewesen, sich zu kneifen. Denn einen Augenblick lang hatte sie gedacht, eine der Märchengestalten aus den Erzählungen ihrer Großmutter wäre zum Leben erwacht und wollte sie foppen. Doch dann hatte er über einen Scherz ihres ältesten Bruders gelacht und war mit diesem in den Stallungen verschwunden – als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre.
Sie öffnete die Augen wieder und biss sich auf die Unterlippe. Schon bald würde sie ihn wiedersehen. Und bis dahin musste sie den Einfall, der ihr in der Sänfte gekommen war, sehr sorgfältig durchdenken. Wenn sie einen Fehler beging, würde sie sich nicht nur zum Narren machen. Vermutlich würde ihr Vater sie dann zur Strafe niemals verheiraten! Sie löste sich von der Tür und stellte ihren Korb auf einer der Arbeitsflächen ab. Dann trat sie an das Regal, in dem ihre Großmutter ihre Kräuter- und Rezeptbücher aufbewahrte, und zog einen in Leder gebundenen Folianten hervor. Dieser enthielt eine Zusammenfassung der wichtigsten medizinischen Schriften. Unter anderem fanden sich dort Auszüge aus Galens Methodi Medendi – den Methoden des Heilens –Avicennas Canon Medicinae – dem Kanon der Medizin – und Trotulas Passionibus Mulierum – den Leiden der Frau. Dieses letzte Werk beschrieb nicht nur typisch weibliche Krankheiten, sondern enthielt auch Rezepte für Schönheitsmittel und Tinkturen zur besseren Empfängnis. Zudem fanden sich dort Arzneien zur Stimulierung der Monatsblutung, zur Verhütung, zum Wiederherstellen der Jungfräulichkeit und Beschreibungen von Hautkrankheiten. Zielsicher schlug Olivera das Buch an der Stelle auf, wo die italienische Ärztin die Symptome der Hysterike pnix oder Suffocatio matricis beschrieb.
»Wenn ein Anfall auftritt«, las sie laut, »bricht die Leidende ohnmächtig zusammen. Sie bekommt kaum mehr Luft, ringt pfeifend um Atem und nicht selten tritt Schaum zwischen ihren Lippen hervor. Oftmals beißt die Kranke so heftig die Zähne aufeinander, dass sich der Kiefer verkrampft – ebenso wie ihre Extremitäten. Der Puls hört auf zu schlagen oder ist kaum mehr wahrnehmbar. In seltenen Fällen kann er auch rasen.« Olivera legte den Finger auf die Stelle und dachte nach. Dann ließ sie den Blick über die zahllosen Töpfe, Tiegel und Weidenkörbe wandern, bis dieser an einem Behältnis mit Süßholz haften blieb.
Ein Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht. Mit mehr Wucht, als eigentlich nötig gewesen wäre, schloss sie den Folianten wieder und stemmte ihn zurück an seinen Platz. Nachdem sie ein kleines Säckchen mit geraspelter Süßholzwurzel gefüllt hatte, ließ sie es in der Tasche ihres Gewandes verschwinden. Ein Teil ihres Planes war somit vorbereitet. Jetzt galt es nur noch, dafür zu sorgen, dass der Fang, den sie damit zu machen gedachte, ihr nicht durchs Netz schlüpfen konnte! Sie räumte den Korb aus, säuberte die Schale, in der sie das Pferdehaar und den Schwefel entzündet hatte, und griff nach einer Flasche voller Seifenlauge. Wenngleich sie immer noch hungrig war, wusste sie, dass sie nicht dazu in der Lage sein würde, etwas zu essen. Viel zu groß war die Aufregung, die Furcht davor, einen Fehler zu begehen. Sie bemühte sich, die Unruhe zu vertreiben, und verließ nach kurzem Zögern die Offizin. Vor der Tür sah sie einige Momente lang unschlüssig von rechts nach links. Dann straffte sie entschlossen die Schultern und steuerte auf die Treppe zu. Diese führte etwa zwanzig Schritte von der Arzneiküche entfernt ins Obergeschoss, wo sich die Wohnräume der Familienmitglieder befanden. Kurz bevor sie die Stiege erreichte, fing sie eine der osmanischen Sklavinnen ab.
»Lale«, rief sie und winkte das Mädchen zu sich. »Geh und bereite mir ein Bad.« Sie drückte der Dienerin die Seifenflasche in die Hand.
Erst als die zierliche Gestalt in der Badestube am anderen Ende des Hofes verschwunden war, erklomm Olivera die Stufen. Oben angekommen, folgte sie dem Arkadengang, bis sie die kleine Eckkammer über der Kornmühle erreichte, in der sie schlief. Kaum hatte sie die Tür geöffnet, schlug ihr drückende Hitze entgegen. Obwohl die Fenster weit offen standen, trug der Wind an diesem Tag nicht einmal den Hauch einer Meeresbrise herbei. Selbst den Zypressen hinter dem Haus schien es zu heiß, da sie schlaff und verdorrt wirkten. Mit einem Prusten schlüpfte die junge Frau aus ihren verschwitzten Gewändern und stand einige Augenblicke vollkommen unbekleidet im Raum. Was sollte sie nur anziehen? Gewiss würde ihr Vater die Besucher am Abend zum Essen laden, und Olivera war fest entschlossen, Eindruck auf den Fremden zu machen. Sie würde ihn mit ihrer Schönheit bezaubern, ihn gefangen nehmen und betören, als wäre sie eine Prinzessin aus Tausendundeine Nacht! Er würde den Blick nicht mehr von ihr abwenden können. Und sobald sie sicher war, dass er frei war, dass er weder Gemahlin noch Braut hatte, würde sie ihn für immer an sich binden. Es konnte kein Zufall sein, dass er ausgerechnet jetzt in ihr Leben zurückgekehrt war!
Sie trat an den hohen Silberspiegel, der – genau wie viele ihrer Seidenkleider – ein Geschenk ihres Onkels war. Dieser befand sich zurzeit mit Oliveras jüngeren Brüdern auf einer Handelsreise nach Samarkand, von der er ihr gewiss wieder eine Kostbarkeit mitbringen würde. Allerdings war ihr im Moment – im Gegensatz zu anderen Tagen – vollkommen gleichgültig, was es sein würde! Sie streckte die Hand nach dem Spiegel aus und drehte ihn ein wenig, sodass mehr Sonnenlicht auf ihn fiel. Die auf Hochglanz polierte Fläche warf ihr Bild unverzerrt und klar zurück. Ihr Blick strich über ihre straffe Brust, den leicht gewölbten Bauch und die schlanken Beine. Wenn sie ihr Haar löste, fiel es in einem dichten Vorhang bis auf ihre Hüften. Sie hob die Hand und strich sich mit dem Zeigefinger die Augenbrauen glatt. Diese waren ebenso schwarz wie ihr Haar und ihre Augen. Es war einzig ihre Nase, die ihr hie und da Verdruss bereitete. Ein wenig zu groß und nicht ganz gerade, erschien sie ihr manchmal wie ein Störenfried in ihrem ansonsten makellosen Gesicht. Auch heute erlag sie der Versuchung, sie zu rümpfen und eine Fratze zu schneiden. Doch anders als sonst, erheiterte sie das Ergebnis nicht besonders.
»Als ob du nichts Besseres zu tun hättest«, schalt sie sich selbst und kehrte dem Spiegel den Rücken. Mit einem Kopfschütteln bückte sie sich, um den Deckel einer kostbar verzierten Holztruhe zu öffnen, in der sich Ober- und Untergewänder stapelten – manche einfach geschneidert, andere prunkvoll und aufwendig bestickt. Unentschlossen wühlte sie eine Zeit lang darin herum, zog Kleider heraus, nur um sie gleich darauf wieder hineinzulegen. Auf keinen Fall durfte sie etwas tragen, womit sie das Misstrauen ihres Vaters oder ihrer Großmutter erweckte! Sollten diese auch nur im Geringsten ahnen, was sie vorhatte, war ihr Plan zum Scheitern verurteilt. Nach langem Suchen entschied sie sich schließlich für ein kirschrotes Untergewand mit weiten Ärmeln und ein eng geschnittenes saphirblaues Obergewand, dessen Säume mit Goldfaden verziert waren. Zusammen mit einer silbernen Brosche und einer Korallenhalskette würde sie damit sicherlich Eindruck machen, ohne allzu herausgeputzt zu wirken. Wenn sie sich dann noch das Haar flechten ließ und einige Duftnelken darin verbarg, würde er sich ihrem Zauber nicht entziehen können. Dafür hätte sie am liebsten ein Gebet zum Himmel geschickt. Doch war sie sich seit Langem sicher, dass Gott kein Ohr für die Anliegen der Frauen hatte. Sie faltete die Gewänder sorgfältig zusammen und schlüpfte zurück in die alten Kleider. Dann verließ sie ihre Kammer und eilte in die Badestube. Wenn sie rechtzeitig zum Abendmahl fertig sein wollte, musste sie sich beeilen. In weniger als einer Stunde würde die Sonne untergehen!
Als sie eine halbe Stunde später aus der Badestube zurück ins Freie trat, fühlte sie sich frisch wie eine Blume. Allerdings hatte sich ihre Aufregung mit jeder Minute, die verstrich, verstärkt, sodass es in ihrem Inneren inzwischen summte wie in einem Bienenstock.
»Olivera!«
Der Ruf ließ sie zusammenfahren und erschrocken herumwirbeln. Von dem überdachten Gang im Obergeschoss winkte ihre Großmutter zu ihr hinab. Sie klatschte ungeduldig in die Hände.
»Wo steckst du denn? Das Mahl wird gleich aufgetragen.«
Oliveras Puls machte einen Satz und ein Stich der Vorfreude fuhr ihr in die Glieder. »Ich komme!«, rief sie und raffte die Röcke, um auf ihre Großmutter zuzueilen. Sobald sie die alte Frau erreicht hatte, schüttelte diese tadelnd den Kopf.
»Du weißt doch, dass dein Vater ärgerlich wird, wenn er warten muss«, schalt sie. »Besonders heute, wo er Gäste hat.« Sie ergriff Oliveras Hand und zog ihre Enkelin auf die Stirnseite des Gebäudes zu. Dort – direkt über dem Kontor und den Verkaufsräumen – befand sich die Stube, in der die Familie ihre Mahlzeiten einnahm, wenn Besuch im Haus war. Hinter den bunt verglasten Fenstern herrschte schon reges Treiben. Olivera spürte, wie ihre Hände feucht wurden. Ehe sie sich versah, öffnete ihre Großmutter die Tür und schob sie über die Schwelle in den mit Zierfliesen geschmückten Raum. Die Tafel war bereits gedeckt und die Küchenmägde verteilten frisch gebackene Brotfladen und Krüge mit schäumendem Rotwein. Die Farben des Wandteppichs über der Feuerstelle schillerten im Licht des Kerzenleuchters. Doch Olivera hatte keine Augen für dessen Schönheit. Stattdessen wurde ihr Blick von der Gruppe Männer angezogen, die soeben – heftig diskutierend – aus der angrenzenden Kammer die Stube betraten. Allen voran polterte ihr Vater herein, dicht gefolgt von ihrem Bruder Markos und dem Goldschmied, den Oliveras Freundin bald heiraten würde. Als Letzter erschien der hochgewachsene Fremde im Rahmen. Und Olivera musste alle Selbstbeherrschung aufbringen, um ihn nicht anzustarren. Er überragte seine beiden Begleiter um mehr als Haupteslänge. Das rotblonde Haar war unter einer kleinen schwarzen Kappe verborgen und die dunkle Kleidung betonte seine helle Haut. In seinem Gürtel steckte ein prachtvoller Dolch, dessen Scheide mit Edelsteinen besetzt war. Als er die Augen auf Olivera und ihre Großmutter richtete, durchrieselte die junge Frau ein Schauer. Für den Bruchteil eines Augenblicks hielt sie dem halb prüfenden, halb überraschten Blick stand. Dann senkte sie den Kopf und starrte auf ihre Zehenspitzen. Das Herz in ihrer Brust flatterte wie ein Vogel. Warum hatte sie nur auf ihre Vernunft gehört und nicht ihr bestes Gewand angezogen?, war alles, was ihr durch den Kopf schoss, als er auf sie zutrat.
Kapitel 3
Konstantinopel, Juli 1408
Laurenz Nidhard war erstaunt. Vielleicht war er sogar ein wenig mehr als erstaunt, doch er versuchte, sich seine Überraschung nicht anmerken zu lassen.
»Meine Tochter Olivera«, wiederholte sein Gastgeber.
Und Laurenz verneigte sich hastig vor der jungen Frau, die der Grund für seine Verblüffung war. Konnte diese Schönheit dasselbe Mädchen sein, an das er sich von seinem letzten Besuch erinnerte? Er rang um eine ausdruckslose Miene. Bedauernd riss er sich von dem liebreizenden Anblick los, da er nicht rüde erscheinen wollte. Wenn es sich um dasselbe Mädchen handelt, dachte er, dann ist aus dem hässlichen Entlein ein wahrlich prächtiger Schwan geworden!
»Setzt euch«, lud ihn der alte Philippos ein, bevor Laurenz in seiner Erinnerung nach den Bildern des linkischen Kindes graben konnte, über das er mit dessen Brüdern gescherzt hatte. Weiterhin bemüht, seine Verwunderung nicht zu zeigen, trat er von den Damen zurück und folgte seinem Gastgeber zum Tisch. Doch zu Laurenz’ Leidwesen platzierte ihn der Grieche nicht neben seiner Tochter, sondern neben dem Goldschmied Andreas. Allerdings währte die Enttäuschung nicht allzu lange, da sich die junge Frau auf einem Stuhl gegenüber dem seinen niederließ.
»Lass auftragen«, sagte der Hausherr an eine Magd gewandt, und wenig später füllte sich die Tafel mit allerlei Köstlichkeiten. Einer Eiersuppe mit Safran, Pfefferkörnern und Honig folgten Lamm mit Zwiebeln, gebratenes Huhn in Mandelsoße und eine Pastete aus Krebsfleisch. Ergänzt wurden diese Speisen durch frische Oliven und geröstete Nüsse, von denen der Goldschmied offenbar nicht genug bekommen konnte. »Wo kauft Ihr nur immer diese wundervollen Nüsse«, nuschelte dieser mit vollem Mund und langte erneut zu.
»Auf dem Markt, wo Ihr auch einkauft«, gab Philippos trocken zurück. »Aber wir sind nicht hier, um uns über Nüsse zu unterhalten, sondern um Geschäftliches zu klären«, setzte er hinzu.
Laurenz verkniff sich ein Stöhnen. Nahm die Diskussion denn nie ein Ende? War immer noch nicht alles gesagt? Was änderte all das Reden? Er warf Olivera einen verstohlenen Blick zu und sah zu seinem Entzücken, dass sie errötete. Hatte er noch am Morgen das Los verflucht, das ihn – gegen seinen Willen – erneut nach Konstantinopel geführt hatte, erschien es ihm auf einmal gar nicht mehr so furchtbar.
Wenn er schon warten musste, bis dieser verfluchte Goldschmied endlich die letzten Behältnisse für die falschen Reliquien, mit denen er und die anderen handelten, angefertigt hatte, dann konnte er sich die Zeit sicher auch auf angenehme Art vertreiben. Er schenkte der jungen Frau ein Lächeln, das ihre Wangen erneut mit Feuer überzog.
»Ich habe Euch doch gesagt, dass es nicht meine Schuld ist«, riss ihn das Genörgel des Schmiedes aus den angenehmen Gedanken. »Durch den Zwist zwischen Sultan Bayezids Söhnen sind die Handelswege nicht mehr sicher. Ich bin nicht der Einzige, der vergebens auf seine Waren wartet.«
Laurenz verzog das Gesicht. »Dann nehmt eben etwas anderes als Elefantenzähne und Straußeneier für die …« Er zögerte kurz mit einem Blick auf die Frauen, da er nichts verraten wollte, was diese nicht wissen sollten. »Waren«, setzte er betont hinzu. »Wen interessiert das denn schon?«, brummte er.
Der Gastgeber hob beschwichtigend die Hände. Als der Goldschmied vom Lateinischen ins Griechische wechselte und etwas hervorstieß, das wie eine Schimpfkanonade klang, fuhr er ihn barsch an: »Sprecht Latein, damit Euch alle am Tisch verstehen können! Ihr vergesst die Gebote der Gastfreundschaft!«
Der Gescholtene knurrte etwas Unverständliches und stopfte sich einen Bissen Hühnerfleisch in den Mund. Nachdem er diesen geschluckt hatte, fauchte er: »Ich dachte, Ihr wollt Eure Ware so teuer wie möglich verkaufen!« Auch er bedachte die Frauen mit einem Blick, dann funkelte er Laurenz zornig an. »Gewiss könnte ich Ochsenhörner verwenden. Aber wer würde Euch dann den Preis zahlen, den Ihr fordert?« Sein rundes Gesicht glühte. »Wenn Ihr nicht endlich aufhört, mich dafür verantwortlich zu machen, müsst Ihr Euch eben einen anderen suchen!«
Laurenz seufzte. Der Mann hatte ja recht. Allerdings hatte ihn die Vorstellung, länger in der Stadt bleiben zu müssen, bis vor wenigen Minuten noch mit Missmut erfüllt. Sein Blick kehrte wie magisch angezogen zu der Tochter des Hausherrn zurück. Seine Mundwinkel stahlen sich kaum merklich nach oben. Was sein Gastgeber wohl sagen würde, wenn er seine Gedanken lesen könnte? Er zwang sich, ein ernstes Gesicht zu wahren, und lenkte die Aufmerksamkeit zurück auf den Goldschmied.
»Es tut mir leid, Andreas«, entschuldigte er sich lahm. »Aber Ihr wisst, dass ich nicht ewig hierbleiben kann. Die Nachfrage steigt und die Käufer werden immer ungeduldiger.«
»Ja, ja«, schnaubte der Goldschmied. »Aber mit Ungeduld kommt man nicht weit.«
»Warum vertreibt Ihr Euch die Zeit nicht auf dem Markt?«, warf Philippos ein, um den Streit zu schlichten. »Kauft etwas für Eure Gemahlin, bringt ihr Geschmeide oder Stoffe mit.«
Laurenz lachte. »Wenn ich eine Gemahlin hätte, würde ich Euren Rat vermutlich befolgen.« Ein gepresster Laut, der in ein Husten überging, veranlasste ihn, den Kopf zu wenden und Olivera anzusehen.
Diese schien sich an einem Stückchen Lammkeule verschluckt zu haben. Ihre Großmutter beugte sich mit besorgtem Gesicht zu ihr hinüber und klopfte ihr auf den Rücken.
»Iss langsam, Kind«, ermahnte die alte Frau das Mädchen.
Und Laurenz stellte erstaunt fest, dass sie ebenso Latein sprach wie die Männer. Wie ungewöhnlich!, dachte er. Aber Philippos’ nächste Bemerkung führte dazu, dass er seine Aufmerksamkeit wieder seinem Gastgeber zuwandte.
»Begleitet mich morgen zu dem venezianischen Glaser«, schlug der Grieche vor. »Sein Glas ist so rein, dass es einem Bergkristall gleicht.« Er legte Daumen und Zeigefinger aneinander, sodass sie einen Kreis bildeten, und küsste seine Fingerspitzen. »Wenn Andreas dieses Glas in die Behältnisse einfügt, dann werden Eure Gewinne Euch für die Wartezeit entschädigen, glaubt mir.«
Laurenz hob erstaunt die Brauen. »So rein wie ein Kristall?«, fragte er ungläubig. Wenn das stimmte, dann würde der Wert seiner Waren in der Tat ins Unermessliche steigen. Sein Gewissen wollte sich zu Wort melden, aber er vertrieb die Reue mit einem Kopfschütteln. Was sollte er denn tun? Schließlich war das Ganze nicht sein Einfall gewesen! Gewiss, er steckte bis zum Hals mit in der Sache. Aber nur, weil er so dumm gewesen war, einem angeblichen Freund einen Gefallen zu tun. Diese Reise würde seine letzte sein, und der Teufel sollte ihn holen, wenn er nicht das Beste daraus machte! Daher hob er seinen Becher und prostete Philippos zu. »Ihr habt mich überzeugt«, sagte er. »Aber dennoch darf sich die Angelegenheit nicht so sehr verzögern, bis die Herbststürme beginnen.« Denn dann wäre die Heimreise ein größeres Wagnis, als den Schultheißen seiner Heimatstadt Tübingen in sein Haus einzuladen!
*
Olivera rang immer noch nach Luft. Der verteufelte Bissen steckte irgendwo tief in ihrer Kehle, wo sie ihn weder schlucken noch freihusten konnte. Zwar hatte das Klopfen ihrer Großmutter ein wenig geholfen. Aber sie griff dennoch nach ihrem Becher und nahm gierig einen viel zu großen Schluck Wein. Kaum hatte dieser ihren Magen erreicht, spürte sie, wie ihr Kopf leicht und ihre Beine schwer wurden. Sie hatte ohnehin schon viel zu viel getrunken – in dem vergeblichen Versuch, ihre Unsicherheit zu überspielen. Warum hörte ihre Hand nicht auf zu zittern? Sie umklammerte das Trinkgefäß mit aller Kraft, um beim Abstellen nichts zu verschütten. Wenn er sie noch einmal so ansah wie vor einigen Augenblicken, dann würde sie vor Scham im Boden versinken. Wieso hatte sie sich auch verschlucken müssen? Sie spürte, wie der Wein ihre Wangen noch heißer machte, als sie ohnehin schon waren. Doch da die Aufmerksamkeit ihres Gegenübers auf Andreas und ihren Vater gerichtet war, ebbte das Gefühl wenig später wieder ab. Zu ihrer Erleichterung fiel ihr auch das Atmen wieder leichter – offensichtlich hatte der Wein die erwünschte Wirkung gezeigt. Mit gesenktem Kopf stocherte sie in dem Essen auf ihrem Teller herum, während die Worte des Fremden – dessen Namen sie nun endlich kannte – in ihrem Kopf nachhallten.
»Wenn ich eine Gemahlin hätte, würde ich Euren Rat vermutlich befolgen.« Erneut spürte sie, wie ihr Herzschlag sich beschleunigte und in ihre Kehle stieg. Es musste ein Wink des Schicksals sein, dass diese wichtigste aller Fragen so schnell beantwortet worden war. Obschon sie fürchtete, ein weiteres Mal Missfallen zu erregen, schielte sie unter halb gesenkten Lidern über den Tisch.
»Eure Begleiter sind über den Ställen einquartiert«, ließ ihr Vater den Besucher soeben wissen. »Ich kann sie aber auch in einem Gasthof unterbringen lassen.«
»Nein, nein«, erwiderte Laurenz mit einer wegwerfenden Geste. »Es sind Knechte. In meinem Haus schlafen sie über der Küche. Wenn Ihr sie zu sehr verwöhnt, dann habe ich in Zukunft nichts als Scherereien.« Er lachte, und es war dieses Lachen, das Olivera endgültig das Herz stahl.
Wie unglaublich er war! Ein Prickeln kroch über ihren Rücken und ließ sie frösteln. Sommersprossen tanzten auf seiner Nase und seine Augen leuchteten, als er sich ihr unvermittelt zuwandte.
»Was denkt Ihr?«, sprach er sie an. »Wenn das Gesinde seinen Platz nicht kennt …« Er ließ den Satz unbeendet, da Oliveras Großmutter ihm einen strafenden Blick zuwarf. Ganz gewiss fand ihre Yiayia es ungehörig von dem Fremden, die Tochter des Hauses bei Tisch anzusprechen. Wenn Gäste im Haus waren und die Männer sich unterhielten, schwiegen die Frauen – so verlangte es die Tradition. Dass Laurenz Olivera um ihre Meinung fragte, war vollkommen unziemlich.
»Ja, kleine Schwester, was denkst du?«, mischte sich ihr Bruder ein.
Olivera funkelte ihn wütend an, da sie ganz genau wusste, was er vorhatte. Zu oft hatten er und seine Brüder sich als Kinder einen Spaß daraus gemacht, sie vor Fremden zu ärgern; hatten sie hinter dem Rücken der Erwachsenen ausgelacht, wenn sie scheu von einem Bein auf das andere getreten war und nicht gewusst hatte, was sie sagen sollte. Sie räusperte sich und überlegte fieberhaft, was wohl die richtige Antwort auf die Frage sein mochte. Doch zum Glück kam ihre Großmutter ihr zur Hilfe.
»Das sind Angelegenheiten der Männer«, sagte diese und bedeutete Olivera aufzustehen. »Es ist an der Zeit, dass wir Euch alleine lassen. Dann könnt Ihr über solcherlei Dinge reden.« Sie erhob sich und griff nach dem Arm ihrer Enkelin, damit Olivera sie aus dem Raum führen konnte.
Hin- und hergerissen zwischen Erleichterung und Verstimmung nickte die junge Frau Laurenz und ihrem Vater zu und murmelte: »Gute Nacht.« Leises Bedauern schwang in seiner Stimme mit, als er ihr ebenfalls eine gesegnete Nachtruhe wünschte.
Viel zu schnell fand sie sich mit ihrer Yiayia draußen auf dem überdachten Säulengang wieder, der inzwischen von Fackeln erleuchtet wurde. Auch im Hof hatten die Bediensteten Fackeln entzündet. Der von Westen her aufkommende Wind ließ die Flammen wild hin und her zucken. Nur wenige Sterne standen am Himmel und der sichelförmige Mond lugte scheu hinter einer Wolke hervor. Der Geruch von Regen lag in der Luft. In weiter Ferne zuckten Blitze über den Horizont, allerdings war das Unwetter zu weit entfernt, weshalb Olivera keinen Donner hörte.
»Ein gänzlich ungesitteter junger Mann«, schimpfte ihre Großmutter. »Ich frage mich, aus was für einem Land er kommt. Offenbar herrschen dort barbarische Sitten!«
Olivera verkniff sich ein Grinsen. Wenn ihre Yiayia doch nur nicht so entsetzlich altmodisch wäre! Sicher kam Laurenz aus einem wundervollen Land, dachte sie. Aus einem Land, das genauso golden war wie sein Haar. Sie verdrehte die Augen über ihre eigene Schwärmerei. Nun, vielleicht nicht unbedingt golden. Aber bestimmt anders als Konstantinopel, das nicht nur die Alten eine sterbende Stadt nannten.
»Bring mich zu meiner Kammer«, forderte ihre Großmutter. Als sie dort angekommen waren, bot sie ihrer Enkelin die Wange, damit diese einen Kuss darauf drücken konnte. »Vergiss dein Nachtgebet nicht«, ermahnte sie Olivera. Noch bevor die junge Frau etwas darauf erwidern konnte, fiel die Tür ins Schloss. Oliveras Hand zuckte zu dem silbernen Kruzifix an ihrem Hals und sie seufzte. Wie viel einfacher alles wäre, wenn sie den blinden Glauben ihrer Großmutter teilen könnte! Diese hatte bestimmt nicht ständig mit Zweifeln und sündigen Gedanken zu kämpfen. Sie blies die Wangen auf und ließ das Kreuz wieder los, bevor sie sich auf den Weg zu ihrer eigenen Kammer machte. Unterwegs hielt sie an einem der von wildem Wein umrankten Stützbalken an. Sie starrte hinüber auf die andere Seite des Gebäudes, wo die Männer immer noch tafelten. Ob sie wohl über sie sprachen? Die Vorstellung trieb ihr erneut das Blut in die Wangen, und sie verfluchte ihren Körper für dieses verräterische Zeichen. Wenn sie nicht achtgab, würde Laurenz sie für eine alberne Gans halten! Sie legte den Kopf in den Nacken und sog die laue Nachtluft ein. Hoffentlich tat er das nicht schon, weil sie sich beinahe durch diesen dummen Hustenanfall verraten hätte!
Die tiefen Atemzüge machten sie schwindelig. Die Wirkung des Weins war immer noch nicht ganz abgeklungen. Sie sollte sich besser auch schlafen legen, wenn sie morgen früh frisch und erholt sein wollte! Nach einem letzten Blick auf die erleuchteten Fenster der Stube löste sie sich vom Geländer des Ganges und betrat kurz darauf ihre eigene Kammer. Dort war es inzwischen wesentlich kühler als am Nachmittag. Um keine Stechmücken anzulocken, schälte Olivera sich im Dunkeln aus ihren Gewändern, legte diese auf dem Tisch neben ihrem Bett ab und löste ihr Haar. Unbekleidet und aufgewühlt ließ sie sich auf ihre Matratze sinken und lauschte auf die Geräusche der Nacht. In irgendeinem Garten zirpten Grillen und eine Eule stieß in regelmäßigen Abständen lang gezogene Rufe aus. Das Unwetter schien inzwischen näher gekommen zu sein, da sie das ferne Grollen von Donner vernahm. Der Wind frischte immer mehr auf, und sie spürte, wie er durch das Fenster über ihren Körper strich.
»Wenn ich eine Gemahlin hätte, würde ich Euren Rat vermutlich befolgen«, hörte sie Laurenz erneut sagen – so deutlich, als wäre er bei ihr im Raum. Ein Zittern durchlief sie, das nichts mit dem kühlen Wind zu tun hatte. Auch wenn sie die Kühnheit ihres Planes zuerst erschreckt und sie gefürchtet hatte, der Mut könne sie verlassen, war sie sich inzwischen sicher. Sie durfte diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen! Wenn sie es richtig anstellte, dann würde der Mann, von dem sie so oft geträumt hatte, sie bald als seine Gemahlin mit in seine Heimat nehmen. Dafür würde sie alles tun, ganz egal, was für Folgen es haben mochte!
Kapitel 4
Konstantinopel, Juli 1408
Als am nächsten Morgen der Hahn krähte, erwachte Laurenz aus einem Traum, der gewiss etwas mit dem schmerzhaften Pochen zwischen seinen Beinen zu tun hatte. Widerwillig öffnete er nach einigen Momenten die Augen und vermeinte, immer noch die verlockenden Bilder zu sehen, welche ihm den Schlaf versüßt hatten. Mit einem Stöhnen rollte er sich auf die Seite und versuchte, seine erregte Männlichkeit zu ignorieren. Durch das offene Fenster seiner Kammer fiel bereits die Sonne auf den bunt gefliesten Boden. Das Klappern von Eimern verriet, dass das Gesinde schon längst auf den Beinen war. Eine Zeit lang lag er regungslos da, bis sich sein Blut etwas beruhigte und er klar denken konnte. Es war ein Traum gewesen, nichts weiter! Vielleicht sollte er bei nächster Gelegenheit ein Freudenhaus aufsuchen, um seine Körpersäfte wieder ins Gleichgewicht zu bringen! Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann setzte er sich auf. Es war schon wieder unglaublich heiß, hatte in der Nacht kaum abgekühlt. Sein Mund war wie ausgetrocknet. Gierig griff er nach dem Krug auf dem Tisch neben seinem Bett und nahm einen tiefen Schluck mit Wasser verdünnten Weins. Nicht ein Lüftchen regte sich, und der Geruch von heißem Staub schien überall zu sein. Er leerte den Krug, leckte sich die Lippen und starrte auf seine nackten Füße. Die Hitze erschöpfte ihn. Obwohl er eigentlich ausgeruht und frisch sein sollte, fühlte er sich wie gerädert. Lange Zeit saß er einfach nur da, während der Schweiß auf seiner bloßen Haut allmählich trocknete. Als schließlich ein Klopfen an der Tür ertönte, war er gerade dabei, nach Bruch und Beinlingen zu angeln, um sich anzuziehen.
»Ich komme«, rief er. Aber erst, als sein Latz fest angenestelt war, öffnete er der Magd. Diese, ein junges Ding mit rosigen Wangen, huschte zu dem Waschgestell in der Ecke des Raumes und füllte die Schüssel mit frischem Wasser aus dem Brunnen im Hof.
»Der Herr wartet in der Stube auf Euch«, informierte sie Laurenz. »Er hat mir aufgetragen, Euch daran zu erinnern, dass Ihr ihn zu dem Glaser begleiten wolltet.« Sie mied seinen Blick.
»Ach, ja, der Glaser«, brummte Laurenz. Die Wonnen des Traumes hatten alle Gedanken an den bevorstehenden Besuch vertrieben. Nachdem die Magd die Kammer wieder verlassen hatte, wusch er sich Gesicht und Hände, brachte sein Haar in Ordnung und kleidete sich fertig an. Dann trat er in den Hof hinaus, der trotz der frühen Stunde bereits in der Sonne buk. Nicht mehr lange, dann würde der Sand unter seinen Sohlen wieder so heiß sein, dass er ihn durch das dünne Leder spüren konnte. Er sah sich um – in der Hoffnung, einen Blick auf Olivera zu erhaschen. Allerdings war von dieser weit und breit keine Spur zu entdecken. Wie sie wohl den Tag verbringen würde?
Das gleißende Weiß der Gebäude blendete ihn, sodass er schließlich blinzelnd den Blick senkte und den Schatten des Arkadenganges suchte. Im Wipfel eines Olivenbaumes trällerte ein bunt gefiederter Vogel – als ob ihm die Hitze nicht das Geringste ausmachen würde. Vermutlich tat sie das auch nicht, dachte Laurenz. Bereits wieder schwitzend erklomm er die Treppe ins Obergeschoss und betrat wenig später die Stube.
»Ihr seht erschöpft aus«, begrüßte Oliveras Vater Philippos ihn. »Habt Ihr nicht gut geschlafen?«
»Zu Hause wird es nie so warm«, erwiderte Laurenz. Er ließ sich auf einem der Stühle nieder und wartete, bis eine Bedienstete ihm eine Schüssel mit Hirsebrei gefüllt hatte. Dazu gab es gezuckerte Feigen, Datteln, Nüsse und Honig.
Philippos lachte. Die schwarze Kappe auf seinem Kopf erschien Laurenz viel zu warm – genau wie die prunkvollen Gewänder, deren Gold- und Silberstickereien im Licht funkelten. In dem grauen Bart des Griechen glitzerten einige Tropfen, doch diese waren das einzige Anzeichen, dass auch ihm die Hitze zusetzte.
»Seid froh, dass die Winde vom Meer her wehen«, versetzte Philippos. »In den vergangenen Jahren war es weitaus unangenehmer zu dieser Jahreszeit.«
Laurenz lutschte an einer Dattel. »Dann kann ich wohl von Glück sagen«, erwiderte er trocken. Dann widmete er sich seinem Hirsebrei und versank in Gedanken, während Philippos ihm von dem reinsten Glas vorschwärmte, das er je gesehen hatte.
Sobald die beiden Männer ihr Mahl beendet hatten, befahl der Grieche einem Knecht, die Pferde zu satteln. Diese warteten bereits ungeduldig neben dem Stallgebäude, als Laurenz und sein Gastgeber sich schließlich in den Hof hinab begaben. Laurenz’ Rappe warf den Kopf und stieß ein freudiges Wiehern aus.
»Ein wirklich schönes Tier«, lobte Philippos. Er erklomm mithilfe eines seiner Männer den Rücken einer lohfarbenen Stute.
Laurenz nickte. Der Hengst war das Erste gewesen, das er sich geleistet hatte, als er begriffen hatte, wie einträglich das Geschäft mit Reliquien war. Schon als Knabe hatte er sich ein feuriges Ross mit glänzendem Fell gewünscht – genau wie das Tier, in dessen Sattel er sich soeben schwang. Stolz tätschelte er dem Pferd den Hals, ritt an und genoss das Gefühl der unter ihm spielenden Muskeln.
»Es ist nicht weit bis zu dem Phiolarius – dem Glaser«, erklärte Philippos, als sie den Hof verließen und sich auf der Straße nach Süden wandten. »Er hat seine Werkstatt unten am Hafen.«
Auch wenn Laurenz am liebsten davongeprescht wäre, um den kühlenden Wind auf seiner Haut zu spüren, gewann seine Neugier allmählich die Oberhand. Während sie an ummauerten Gärten, Basaren, Läden und Faktoreien vorbeiritten, fragte er sich, ob Philippos nur aufgeschnitten hatte. Sollte es stimmen, was der Grieche behauptete, und das Glas des Venezianers tatsächlich so rein sein wie ein Kristall … Er brach den Gedanken ab, da sie eines der Tore erreichten, welche die Bezirke der Venezianer, Florentiner, Katalanen, Ragusaner und Juden voneinander trennten. Zwei Bewaffnete vertraten ihnen den Weg, hoben drohend die Lanzen und fordernd die Hände. Ein kurzer Wortwechsel auf Griechisch sorgte dafür, dass sie die Waffen senkten. Mit einer leichten Verbeugung öffneten sie die Flügel des Tores, damit Philippos und Laurenz ungehindert passieren konnten. Hinter der Mauer fielen die Hügel sanft zum Meer ab. Je dichter die Häuser beim Ufer standen, desto mehr Abstand befand sich zwischen ihnen, desto saftiger und farbenprächtiger lockten die Gärten. Eine sanfte Brise fächelte die Gesichter der erhitzten Reiter. Und mit jedem Schritt, den sie sich dem Wasser näherten, vermeinte Laurenz, leichter atmen zu können. Zahllose Schiffe tanzten in der Ferne auf den Wellen – viele davon bauchige Koggen oder schlanke Galeeren aus der Serenissima, der venezianischen Republik. Immer weiter ritten sie gen Süden, bis sie schließlich ein Gebäude erreichten, neben dem sich übermannshohe Holzstapel türmten. Aus mehreren Kaminen quoll dicker, schwarzer Rauch, und ein beißender Gestank brachte Laurenz zum Husten.
»Wir sind da«, sagte Philippos. »Tränk die Pferde«, trug er dem schmutzigen Burschen auf, der auf sie zugeeilt kam. »Wo ist Matteo?«, fragte er den Jungen.
»In der Hütte«, erwiderte der Knabe. Er wies mit dem Daumen auf das Gebäude, aus dem laute Stimmen ins Freie drangen.
»Ihr werdet staunen«, prophezeite Philippos. Ohne auf eine Antwort zu warten, steuerte er auf die Hütte zu und öffnete die Tür.
Laurenz folgte ihm und musste augenblicklich erneut husten. Der stechende Geruch war im Inneren des Gebäudes wesentlich stärker als draußen, wo der Wind ihn gemildert hatte. Schwer und metallisch hing der Gestank in der Luft – so überwältigend, dass Laurenz einen Augenblick lang den Eindruck hatte, danach greifen zu können. Zudem erfüllten dichte Dampfschwaden die Hütte, sodass er die Männer an den gemauerten Öfen erst sah, als Flammen aus den großen, runden Öffnungen schlugen. Mit ledernen Schürzen geschützt, hantierte ein halbes Dutzend Glaser mit rot glühenden Klumpen an langen Stöcken, die sie immer wieder an den Mund führten. Während die Männer ihre Werkzeuge hin und her drehten, schaufelten rußverschmierte Knaben Holz in die Befeuerungsluken der Öfen und sammelten die Asche in Körbe. Diese warfen sie in einen Kessel mit Schmelze, in dem ein Hüne mit einem Metallstab herumrührte. Neben ihm standen je ein Karren voller durchsichtiger Steine, zerriebenem Marmor und Salz.
»Ihr kommt zu früh«, knurrte der Glaser anstatt einer Begrüßung. »Das Crystallo ist noch nicht fertig. Wir hatten Probleme mit der Schmelze.«
Philippos winkte wegwerfend ab. »Wir sind nicht hier, um die Ware abzuholen.« Er deutete auf Laurenz. »Ich wollte ihm nur zeigen, wie rein dein Glas ist.«
Der Phiolarius griff in das Salz und warf eine Handvoll davon in die Schmelze, die zischend Blasen warf. »Es ist noch nicht viel, aber die fertige Ware lagert nebenan«, ließ er seine Besucher wissen. »Ich habe auch Lattimo – Milchglas – gemacht. Falls Ihr davon auch eine Ladung benötigt.«
Ohne Antwort fasste Philippos Laurenz am Arm und schob ihn an den Öfen vorbei zu einer Tür, die in einen Nebenraum führte. Dort hingen ebenfalls Rauchschwaden in der Luft, aber wenigstens hatte man nicht das Gefühl, sich im Fegefeuer zu befinden. Der Gedanke an die läuternden Flammen, in denen die Sünder ihre Strafe verbüßten, bereitete Laurenz Unbehagen, weshalb er froh war, als der Grieche ihm einen Gegenstand unter die Nase hielt.
»Ist es nicht von unglaublicher Reinheit?«, schwärmte er. Tatsächlich war das Gefäß in seiner Hand so durchsichtig wie ein Bergkristall – ganz so, wie Philippos behauptet hatte.
Staunend betastete Laurenz die glatte Oberfläche. Es war wirklich unglaublich! Wie konnte etwas von solch vollkommener Reinheit sein?
»Offenbar gelingt es nicht immer«, fuhr Philippos fort. Er deutete auf einen Haufen Scherben, bei denen es sich allem Anschein nach um Abfall handelte. Laurenz’ Fingerkuppen strichen über die makellose Oberfläche. Dadurch würde man tatsächlich alles sehen, was sich dahinter verbarg – anders als bei dem grünlich gefärbten Waldglas, das er bisher kannte. Trotz der Hitze kroch ihm ein Schauer über den Rücken, als er sich vorstellte, was die Augen der Käufer erblicken würden, wenn sie die gefälschten Reliquiare in Händen hielten.
»Matteo ist einer der Besten weit und breit«, unterbrach Philippos seine Gedanken. »Sein Buntglas ziert die Fenster so mancher Kirche bis weit, weit in den Osten.«
Laurenz nickte. Er nahm einen weiteren Gegenstand in die Hände und hielt ihn gegen das Licht, das durch einen schmalen Fensterspalt hereinfiel.
»Unglaublich«, murmelte er. Die Beklemmung verwandelte sich in Ehrfurcht. Dieses Glas würde den Wert der Behältnisse tatsächlich so gut wie verdoppeln. Ein Grinsen stahl sich auf sein Gesicht. Schon bald würde er ein sehr, sehr reicher Mann sein! Zusammen mit Philippos sah er sich noch eine Zeit lang in dem Lager um, dann verabschiedeten sie sich von dem Glaser. Es würde noch einige Tage dauern, bis alles fertig war. Aber was machte das, wenn alle Stücke von solch kristallener Klarheit waren?
»Ich weiß nicht, wie er es bewerkstelligt, dass sein Glas keine Verfärbungen aufweist«, sagte Philippos, als sie ihre Pferde wieder bestiegen. »Für mich grenzt es beinahe an Hexenwerk.« Er lachte, als er den Ausdruck auf Laurenz’ Gesicht sah. »Keine Sorge, es geht alles mit rechten Dingen zu.«
Laurenz ärgerte sich über das belustigte Funkeln in den Augen des Griechen. Um sich nicht anmerken zu lassen, wie unangenehm ihm das Gerede von Hexen war, gab er seinem Hengst die Sporen und trabte einige Schritte voraus. Obschon die Sonne höher am Himmel stand als bei ihrer Ankunft, erschien ihm die Hitze nach der stickigen Glashütte weniger drückend. Die Luft wirkte beinahe frisch. Während der Zeit, die sie bei dem Phiolarius verbracht hatten, waren die Straßen voller geworden. Dutzende von Fuhrwerken schlängelten sich vom Hafen die Straßen hinauf und überall hatten fliegende Händler ihre Stände errichtet. Bunt gekleidete Frauen in offenen Sänften zogen genauso die Blicke auf sich wie das funkelnde Geschirr der Kamele und Pferde. Überall wieselten Boten zwischen den Beinen der Zug- und Reittiere hindurch, während die Marktschreier lautstark ihre Ware feilboten. Wesentlich langsamer als auf dem Hinweg legten Philippos und Laurenz die wenigen Meilen zum Haus des Griechen zurück. Auch dort herrschte inzwischen reges Treiben, weshalb Philippos sich kurz nach ihrer Ankunft von Laurenz verabschiedete. Allein mit den Knechten sah er sich unschlüssig im Hof um. Was sollte er jetzt anfangen? Sein Blick suchte den überdachten Gang im ersten Stock ab. Doch egal, wie sehr er sich anstrengte, es war weit und breit kein Zeichen von Olivera zu entdecken.
Kapitel 5
Konstantinopel, Juli 1408
Beinahe drei Tage vergingen, ehe Olivera Laurenz wieder aus der Nähe sah. Drei Tage voller Unsicherheit, Ärger und Sehnsucht. Zwar hatte sie ihn mehr als einmal aus der Ferne erspäht, allerdings nie länger als ein paar flüchtige Augenblicke.
»Es ist besser, wenn die Männer ihre Angelegenheiten ohne uns besprechen«, wiederholte ihre Yiayia