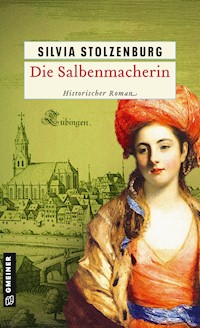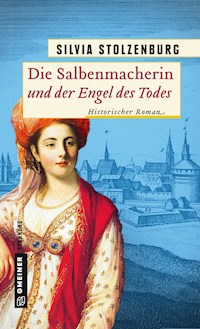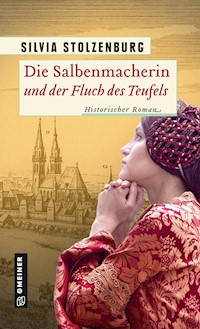Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Begine von Ulm
- Sprache: Deutsch
Anno Domini 1413: Als ein Grab auf dem Friedhof des Heilig-Geist-Spitals geschändet wird, herrscht Aufregung im Orden. Anna Ehinger, die trotz ihres Ausscheidens aus der Beginensammlung weiterhin in der Siechenstube hilft, wird in die Angelegenheit hineingezogen, als der neue Magister Hospitalis ihrem Bruder Jakob, dem Spitalpfleger, die Schuld an dem Frevel gibt. Da Anna ihrem Bruder zu Dank verpflichtet ist, beschließt sie, der Sache auf den Grund zu gehen und gerät schon bald selbst in höchste Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Begine und der lebende Tote
Historischer Kriminalroman
Zum Buch
Mord an einem Toten Anno Domini 1413: Als nach dem Tod eines reichen Pfründners ein Grab auf dem Friedhof des Heilig-Geist-Spitals geschändet wird, herrscht Aufregung im Orden. Anna Ehinger, die trotz ihres Ausscheidens aus der Beginensammlung weiterhin in der Siechenstube des Spitals hilft, wird gegen ihren Willen in die Angelegenheit hineingezogen. Denn der neue Magister Hospitalis gibt ihrem Bruder, dem Spitalpfleger Jakob, die Schuld an dem Frevel. Weil Anna ihrem Bruder zu Dank verpflichtet ist, da er ihr und ihrem Gemahl Lazarus ein Haus geschenkt hat, beschließt sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch dann taucht ein Leichnam mit durchschnittener Kehle am Pranger der Stadt auf, und Anna gerät schon bald in höchste Gefahr …
Dr. phil. Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen. Im Jahr 2006 promovierte sie dort über zeitgenössische Bestseller. Kurz darauf machte sie sich an die Arbeit an ihrem ersten historischen Roman. Sie ist hauptberufliche Autorin und lebt mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb, fährt leidenschaftlich Mountainbike, gräbt in Museen und Archiven oder kraxelt auf steilen Burgfelsen herum – immer in der Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Elnur / shutterstock und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogier_van_der_Weyden_-_Triptych-_The_Crucifixion_-_Google_Art_Project.jpgund https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerard_David,_Netherlandish_(active_Bruges),_first_documented_1484,_died_1523_-_Lamentation_-_Google_Art_ProjectFXD.jpg
ISBN 978-3-8392-7276-3
Widmung
Für meinen allerliebsten Lieblingsmenschen
Kapitel 1
Ulm, Oktober 1413
Die Nacht war sternenklar und eisig kalt. Ein nicht ganz voller Mond hing bleich am Himmel und beleuchtete die Pforte, an der sich eine dunkle Gestalt zu schaffen machte. Der Mann war nach vorn gebeugt und stocherte mit einem langen Messer nach dem Schlossriegel der schweren Holztür, durch die man auf den Gottesacker des Heilig-Geist-Spitals gelangte. Neben ihm lag ein Sack auf dem Boden.
»Geh schon auf!«, zischte er ärgerlich, als die Klinge zum wiederholten Mal abrutschte. Mit einem Fluch richtete er sich auf und schien zu überlegen, ob er sein Unterfangen aufgeben sollte. Er hob den Kopf und starrte den Turm der Spitalkirche an. Währenddessen schlug am nahe gelegenen Donauufer ein Wasservogel mit den Flügeln. Nachdem er einige Augenblicke reglos dagestanden hatte, umfasste er sein Messer mit neuer Entschlossenheit und wandte sich wieder dem Schloss zu.
Das Klacken, als es aufsprang, hallte gespenstisch durch die Nacht.
»Na endlich!«, murmelte er, steckte sein Messer ein, schulterte den Sack und zog die Tür auf. Das leise Quietschen der Angeln ging unter im Läuten der Kirchturmuhr, die die volle Stunde verkündete.
Behände schlüpfte er durch den Spalt und lehnte die Tür hinter sich an, um, falls nötig, schnell die Flucht ergreifen zu können. Da er auf keinen Fall entdeckt werden wollte, versicherte er sich, dass die Gebäude des Spitals im Dunkeln lagen und kein schlafloser Pfründner über den Hof geisterte. Dann wandte er sich dem Gottesacker zu, dessen Grabsteine sich im Mondlicht von der dunklen Erde abhoben. Während sich die Faust, die nicht den Sack hielt, immer wieder ballte und öffnete, schlich er zwischen den Gräbern entlang, bis er ein Holzkreuz fand, das von einer frischen Bestattung zeugte. Die Mischung aus Genugtuung und Hass, die in ihm aufstieg, vernebelte ihm einen Moment lang den Verstand, ehe sein Kopf wieder klar wurde und er den Sack fallen ließ.
Nachdem er sich ein letztes Mal umgesehen hatte, kniete er sich auf den kalten Boden und öffnete den Sack. Mit zitternden Händen holte er den Inhalt hervor, legte ihn beinahe ehrfürchtig neben sich und nahm eine kleine Schaufel zur Hand, die er ebenfalls mitgebracht hatte. Getrieben von einer brodelnden Wut, grub er das Blatt in die feuchte Erde und fing an, sie aufzuwühlen.
Es dauerte bis zum nächsten Schlagen der Kirchturmuhr, bis ein schmutziges Leichentuch auftauchte, dessen Anblick sein Herz einen Satz machen ließ. Trotz der Kälte schwitzend ließ er die Schaufel sinken, griff nach dem, was in seinem Sack gesteckt hatte, und warf es in die Grube.
»Vom Mutterschoße an sind die Frevler treulos«, stieß er gepresst hervor. »Von Geburt an irren sie vom Weg ab und lügen. Ihr Gift ist wie das Gift der Schlange, wie das Gift der tauben Natter, die ihr Ohr verschließt, die nicht auf die Stimme des Beschwörers hört, der sich auf Zaubersprüche versteht. Oh Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund! Zerschlage, Herr, das Gebiss der Löwen! Sie sollen vergehen wie verrinnendes Wasser, wie Gras, das verwelkt auf dem Weg, wie die Schnecke, die sich auflöst in Schleim; wie eine Fehlgeburt sollen sie das Paradies nicht schauen.« Er hielt inne, um Atem zu schöpfen, und blickte sich um. War irgendetwas von dem Toten zu entdecken? Bis zu seinem endgültigen Eingang ins Totenreich war er auf dem Gottesacker als Seelentier, Windhauch oder Spukgestalt anzutreffen. Doch es rührte sich nichts außer den kahlen Bäumen, die im Wind knarrten.
»Ehe eure Töpfe das Feuer des Dornstrauchs spüren, fege Gott die Feinde hinweg«, fuhr er fort, »ob frisch oder verdorrt.« Bevor er die nächsten Worte sprach, griff er nach seinem Messer und beugte sich über das Grab. »Wenn er die Vergeltung sieht, freut sich der Gerechte«, knurrte er. »Er badet seine Füße im Blut des Frevlers.« Er holte mit der Waffe aus und stach auf den Leichnam ein.
Sein Stoß ging ins Leere, als die Klinge das Leichentuch zerschnitt.
»Was zum Teufel …« Er ließ das Messer sinken und streckte die Hand aus, um an dem schmutzigen Tuch zu ziehen.
Es gab ohne viel Widerstand nach.
Mit einem weiteren Fluch schleuderte er es beiseite, grub die Hände in die Erde und wühlte darin herum, bis kein Zweifel blieb.
Das Grab war leer.
Eine so gewaltige Welle des Zorns ergriff ihn, dass er alle Vorsicht in den Wind schlug, aufsprang und mit dem Fuß gegen das Holzkreuz trat. »Wo bist du, du verdammter Mistkerl?«, fauchte er. »Welcher Teufel steckt in dir?« Er riss das Kreuz aus dem Boden, drehte es um und rammte es in das leere Grab. Dann steckte er die Schaufel in den Sack und eilte blind vor Wut zurück zu der angelehnten Pforte. Als in einem der Spitalhöfe ein Hund anfing zu bellen, schlug er die Tür hinter sich zu und stürmte in die Dunkelheit davon.
Kapitel 2
Der Stadtpfeifer Gallus erwachte mit einem Völlegefühl im Bauch, das dem des vergangenen Abends in nichts nachstand. Die Hochzeitsgesellschaft, bei der er und die anderen Musikanten aufgespielt hatten, war erst eine Stunde vor Mitternacht aufgelöst, die Reste des üppigen Mahls an die Spielleute verteilt worden. Danach waren er und ein paar der Fiedler in ein Gasthaus weitergezogen, in dem der Wein in Strömen geflossen war. Dumpf und dunkel erinnerte sich Gallus an ein Würfelspiel, aus dem er – in einem seltenen Anflug von Besonnenheit – rechtzeitig ausgestiegen war, bevor man ihm das letzte Hemd hatte abnehmen können. Anders als noch vor einigen Monaten bemühte er sich, etwas zu sparen, um endlich aus der billigen Absteige ausziehen zu können, in der er sich eingemietet hatte. Seit er den Posten des Stadtpfeifers wiederhatte, verspürte er einen seltsamen Drang, mehr aus seinem Leben zu machen als bisher. Auch wenn ihm das ständige Feiern und Prassen nach wie vor gefiel, schlich sich manchmal am Morgen danach ein schales Gefühl ein, wenn er neben einer billigen Hure erwachte oder, angewidert von seinem eigenen Gestank, trotz allen Grübelns nicht mehr wusste, was er am Abend zuvor getan hatte.
An diesem Morgen war es anders. Während er sich mit dem abgestandenen Wasser aus der Schale des Waschgestells das Gesicht wusch, erinnerte er sich an die hübsche Magd, die ihn und die Fiedler bedient hatte. Sie war schlank, aber nicht zu mager, und hatte ihn mit ihren lachenden blauen Augen bezaubert. Die Grübchen in ihren Wangen hatten es ihm von der ersten Sekunde an angetan, und er fragte sich, ob sie der Grund war, dass er rechtzeitig nach Hause gegangen war.
»Glaubst du nicht, dass du genug hast?«, hatte sie ihn mit einem tadelnden Unterton gefragt, als er den nächsten Krug Wein bestellt hatte. Dann hatte sie sich zu ihm hinuntergebeugt und ihm zugeflüstert: »Ich kenne diese beiden.« Ihr Blick war zu zwei Würfelspielern gewandert, die sich zu Gallus und den Fiedlern an den Tisch gesetzt hatten. »Ich glaube, ihre Würfel sind falsch.« Als sie ihm die Hand auf den Arm gelegt hatte, war ein warmes Gefühl in ihm aufgestiegen.
Mit einem Kopfschütteln griff er nach seinem Rasiermesser und betrachtete seine Hand einen Moment lang. Erleichtert darüber, dass sie nicht zitterte, kratzte er sich die Stoppeln von den Wangen. Anschließend schlüpfte er in die schwarz-weiße Tracht, die ihn als Angestellten der Stadt kennzeichnete, und ging in die Schankstube, um ein leichtes Mahl zu sich zu nehmen, obwohl er keinen Hunger verspürte.
Da es seit Neuestem auch Aufgabe des Stadtpfeifers war, den Beginn der Ratsversammlungen zu signalisieren, musste er sich beeilen, um nicht zu spät zum Rathaus zu kommen. In Gedanken immer noch bei der hübschen Magd, erklomm er den kurzen Anstieg zum Marktplatz, wo an diesem Morgen ein Markt stattfand. Trotz der frühen Stunde waren bereits zahlreiche Käufer auf den Beinen und drängten sich zwischen den windschiefen Buden und Karren der aus dem Umland angereisten Bauern. Mühsam schob sich Gallus an Käse, Brot, Milchkannen und Butterfässern vorbei durch die Menschen, während die Marktschreier lauthals ihre Waren feilboten.
»Feines Gebäck, frisch aus dem Ofen!«, brüllte ein Bäcker mit einem fahrenden Ofen.
»Schweinehälften! Gut und billig!«, posaunte ein Metzger.
»Käse von der Alb!«
Die Stimmen vermischten sich mit dem Blöken von Schafen und dem Brüllen von Ochsen, die zum Viehmarkt getrieben wurden. Überall hüpften Spatzen um die Füße der Ulmer herum, auf der Suche nach ein paar Krumen.
Der Wind, der von Osten her durch die Stadt pfiff, war kalt und schneidend, der Himmel klar. Die Sonne blendete Gallus, als er sich nach einem Weg aus dem Getümmel umsah.
Er hatte gerade eine Gasse bei einer Ansammlung von Buden entdeckt, als er ein Zupfen an seinem Gürtel spürte. Blitzschnell wirbelte er herum und versuchte, den Straßenbengel zu packen, der versucht hatte, seine Geldkatze abzuschneiden. Der kleine Rotzbengel war allerdings flinker als er.
»Fang mich doch!«, höhnte er, machte einen Satz nach hinten und drehte ihm eine lange Nase.
Gallus unterdrückte einen Fluch, schwor sich, dem nächstbesten Bettelknaben eine Tracht Prügel zu verabreichen, und setzte den Weg fort. Kurz darauf langte er beim Rathaus an, dessen bunt bemalte Fassade im Sonnenlicht leuchtete. Die Türen, die in die Eingangshalle führten, standen bereits weit offen, und die ersten hohen Herren waren schon da. Hastig stellte sich Gallus bei einer der Säulen auf, setzte die Schalmei an, die ihm eigens für diesen Zweck ausgehändigt worden war, und blies das Signal, bis alle Ratsherren eingetroffen waren und einer der Ratsknechte die Türen schloss. Dann ließ er das Instrument sinken und benetzte die trockenen Lippen.
Als etwas dicht vor seinen Füßen auf den Boden klatschte, hob er ärgerlich den Kopf.
Zwei der Gassenjungen, mit denen er immer wieder aneinandergeriet, krümmten sich vor Lachen und holten erneut zum Wurf aus.
Mit einem Sprung zur Seite brachte Gallus sich in Sicherheit, als der nächste Pferdeapfel in seine Richtung flog und an ihm vorbeipfiff. »Na wartet, ihr kleinen Mistkerle!«, knurrte er, packte die Schalmei wie einen Prügel und ging auf die Bengel los.
»He! Stadtpfeifer!« Ein Pfiff folgte.
Kochend vor Wut sah Gallus dabei zu, wie die Jungen in der Menge verschwanden, bevor er sich umdrehte, um zu sehen, wer ihn gerufen hatte.
Zu seinem Verdruss entdeckte er den Hauptmann der Wache. »Was ist?«, fragte er missmutig.
»Bleib auf deinem Posten!«, wies der Hauptmann ihn zurecht.
»Aber sie …«, hob Gallus an, brach den Satz jedoch ab und trottete zurück zum Rathaus. Der Hauptmann war ohnehin nicht gut auf ihn zu sprechen. Auf keinen Fall wollte Gallus ihm einen Grund geben, das Versprechen wahrzumachen, das er ihm gegeben hatte: Wenn er Gallus noch mal bei etwas Unredlichem erwischte, würde er ihn eigenhändig aus der Stadt prügeln, hatte der Hauptmann ihn gewarnt. Mit grimmiger Miene stellte Gallus sich wieder bei der Tür auf und starrte geradeaus.
Kapitel 3
Mit einem Prusten blies Anna Ehinger sich eine Strähne des dunklen Haars aus der Stirn und richtete sich auf. Das Feuer in dem gemauerten Kamin ihrer Kräuterküche prasselte munter vor sich hin, trotzdem hatte sie ein paar Scheite nachgelegt, damit es nicht zu schnell niederbrannte. Während sie sich den Schweiß von der Stirn wischte, wanderte ihr Blick zum Wohnhaus, dessen hinterer Teil durch das offen stehende Fenster zu sehen war. Obwohl sie sich gerade erst von ihrem Gemahl Lazarus verabschiedet hatte, fehlte ihr seine Gegenwart jetzt schon, und sie hoffte, dass die Herstellung der Arzneien nicht allzu lange dauern würde. Seit ihrem Einzug in das Haus, das ihr Bruder Jakob ihnen zur Hochzeit geschenkt hatte, schien ihre Liebe noch inniger geworden zu sein. Sie spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg, als sie an die letzte Nacht zurückdachte, in der Lazarus und sie einen weiteren Versuch unternommen hatten, ein Kind zu zeugen. Eine Gänsehaut legte sich über ihre Arme, als sie sich an seine zärtlichen Berührungen erinnerte, die ihre Haut prickeln ließen und ihr Innerstes zum Schmelzen zu bringen schienen.
Kopfschüttelnd säuberte sie sich die schmutzigen Hände an ihrer Schürze und schob die Gedanken an das Liebesspiel beiseite, da sich ihre Liebe trotz ihrer Vermählung nach wie vor sündig anfühlte. Bis vor Kurzem war Lazarus ein Mönch, sie eine Begine gewesen. Die Gewohnheiten des nach Gottes Willen ausgerichteten Lebens ließen sich nicht einfach abstreifen – ein Gefühl, das Lazarus und sie teilten. Obwohl sie so gut wie nie darüber sprachen, wusste sie, dass er ähnlich empfand. Zwar war die Sorge, dass Gott ihnen wegen des Austritts aus ihren Orden zürnte, inzwischen in den Hintergrund getreten, dennoch regten sich manchmal Bedenken in ihr. War Gottes Missfallen der Grund dafür, dass sie immer noch kein Kind empfangen hatte? Oder lag es an etwas anderem? Ihre Schwägerin Ella löcherte sie ständig mit Fragen, die Anna stetig unangenehmer wurden.
Seufzend ging sie zu dem großen Hacktisch in der Mitte des Raumes und suchte Mörser, Stößel, Tongefäße und Flaschen für die Mittel heraus, die sie herstellen wollte. Zwar hatten sich im Heilig-Geist-Spital kurz nach ihrem Ausscheiden aus der Beginensammlung böse Zungen geregt, doch inzwischen störte sich niemand mehr daran, dass sie weiterhin in der Siechenstube, bei den Wöchnerinnen und bei den Pfründnern ein und aus ging. Viele der reichen Insassen vertrauten auf ihre selbstgemachten Salben und Tränke, mit denen sie so unterschiedliche Leiden wie Fieber, Krampfadern, Rheuma, Gicht und Warzen heilte. Da die reichen Pfründner sie gut für ihre Dienste bezahlten, hatte selbst ihr Bruder Jakob, der Spitalpfleger, nichts gegen ihre tägliche Anwesenheit im Spital einzuwenden. Ihm war es auch zu verdanken, dass Lazarus dort immer noch als Siechenmeister arbeitete – angestellt vom Rat statt von den frommen Brüdern.
In Gedanken versunken stellte sie Wermutwein und Steinbrechsamenwein zur Linderung von Gallenbeschwerden her und kochte eine Liebstöckel-Dotter-Suppe zur Anregung des Blutflusses. Gegen nächtliche Atemnot mischte sie Meerrettich mit Galgant und Honig, gegen Beingeschwüre stellte sie eine Arznei aus Brennnesselsaft, Wasser und Seilerhanf her. Auf Arzneien gegen Zahnschmerzen und Ohrensausen folgten Heilmittel gegen Frauenleiden, die sie auch an reiche Ulmerinnen verkaufte. Darunter befanden sich Betonienwein, Mutterkrautsalbe, Hirschzungenelixier und Veilchencreme gegen Zysten in der Brust oder andere Knoten, außerdem Weinraute und ein Mittel aus Hainbuchensprossen gegen drohenden Abort.
Bei der Herstellung von Arzneien gegen Frauenkrankheiten war es wichtig zu wissen, dass jeder Frauentyp unter anderen Beschwerden litt, die – bei fehlender Blutreinigung – zu schweren Erkrankungen führen konnten. Laut der vorherrschenden Lehren gab es vier verschiedene Typen oder Temperamente: Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker.
Bei den Sanguinikerinnen handelte es sich meist um mollige, schöne Frauen, die liebenswürdig und fruchtbar waren. Bei Ehe- oder Kinderlosigkeit drohte diesen Frauen Krankheit, bei vorzeitigem Ausbleiben der Monatsreinigung neigten sie zu Krebsleiden.
Die Cholerikerinnen hingegen zeichneten sich meist durch gut entwickelte Muskeln und Knochen aus und waren so klug und gefürchtet wie die Meisterin der Beginensammlung, aus der Anna ausgeschieden war. Obwohl Männer sie fürchteten, zogen Cholerikerinnen sie an wie ein Magnet das Eisen. Ihre Leiden betrafen meist die Adern oder die Leber.
Phlegmatikerinnen sagte man nach, dass sie ernst und fleißig waren, allerdings erinnerte ihre Art an die der Männer. Dennoch waren sie äußerst fruchtbar, litten allerdings häufig an Kopf- und Nervenleiden, Wassersucht oder Jähzorn.
Die letzte Gruppe, die Melancholikerinnen, war schlank und knochig, ihr Gesichtsausdruck war meist dunkel und finster und die Launen wechselhaft. Die meisten lehnten die Freuden des Ehegemaches ab und starben kinderlos. Viele von ihnen erkrankten an Gicht, Rheuma, Rücken- oder Nierenschmerzen.
All dies hatte Anna von den Beginen gelernt, deren Hof sich in der Frauengasse befand. An manchen Tagen, wenn sie sich gedankenverloren auf den Heimweg vom Spital machte, ertappte sie sich dabei, wie sie den Weg zur Frauengasse einschlagen wollte, obwohl sie schon lange nicht mehr dort lebte. Nach ihrem Ausscheiden, als sie bei ihrem Bruder und ihrer Schwägerin im Haus Unterschlupf gefunden hatte, hatte ihr die Gemeinschaft schmerzlich gefehlt. Dennoch hatte sie den Schritt nie bereut.
»Tante Anna!« Die Stimme ihres Neffen Heinrich riss sie aus den Gedanken. »Wo bist du?« Kurz darauf flog die Tür auf, und der Junge steckte seinen roten Kopf in die Kräuterküche. »Du musst kommen!«, platzte es aus ihm heraus. »Eine der Stuten kriegt ein Fohlen!«
Anna verkniff sich mit Mühe ein Lächeln. Anders als Jakobs ältester Sohn Martin, der bei ihm in die Lehre ging, war der neunjährige Heinrich ungestüm und wild. Er hatte ein ähnliches Talent dafür, Ärger anzuziehen, wie Anna, weshalb sie ihm nie wirklich böse sein konnte. »Ich habe zu tun«, entgegnete sie und goss eine dunkelgrüne Flüssigkeit in eine Flasche.
Heinrich verzog das Gesicht. »Das stinkt«, stellte er fest.
»Nur was stinkt, hilft«, neckte Anna ihn.
»Bitte! Du musst kommen!«, quengelte er.
»Ich kann nicht.«
»Heinrich!«
Die Stimme seiner Mutter ließ den Jungen den Kopf einziehen. Hastig trat er in die Kräuterküche und schloss die Tür hinter sich.
»Hier kannst du dich nicht verstecken«, sagte Anna und verkorkte die Flasche. »Solltest du nicht beim Rechenmeister sein?«
Heinrichs Ohren färbten sich rot. »Ich wollte mal schnell nach dem Fohlen sehen«, murmelte er.
»Heinrich! Wo bist du jetzt wieder?«
»Ich glaube, du solltest zurück ins Haus gehen«, riet Anna. »Sonst bekommst du Ärger.«
»Den krieg ich sowieso«, brummte er.
Anna fasste ihn forschend ins Auge. »Warum?«
»Weil ich die Rechenübungen nicht fertig gemacht hab.« Er verzog das Gesicht und versteckte die Hände hinter dem Rücken, die mit Sicherheit bereits des Öfteren in Kontakt mit dem Stecken des Rechenmeisters gekommen waren.
»Dann geh und mach sie fertig«, riet Anna. »Vielleicht kommst du so um eine Strafe herum.«
Er zog die Nase hoch. »Meinst du?«
Anna zuckte mit den Schultern. »Du kannst dich nicht ewig verstecken. Und das Fohlen ist später auch noch da.«
»Hm.« Er schien zu überlegen. Schließlich holte er tief Luft und steckte vorsichtig den Kopf ins Freie.
»Na los!«, ermunterte Anna ihn. Je länger er sich vor seiner Mutter versteckte, desto größer würde der Ärger ausfallen.
Als sie wieder allein war, schnitt und hackte, mischte und mörserte sie, bis alle Arzneien fertig und in passende Gefäße abgefüllt waren. Diese verstaute sie in einem flachen Weidenkorb, mit dem sie sich auf den Weg zum Spital machte. Sie hatte die Kräuterküche gerade verlassen, als ihre Schwägerin an dem Zaun auftauchte, der ihre Gärten von Annas Haus trennte.
Ella hielt eine kleine Sichel in der Hand, mit der sie offensichtlich verdorrte Stauden und Sträucher beschnitten hatte. »Bist du unterwegs ins Spital?«, erkundigte sie sich.
Anna nickte.
»Falls du Jakob dort antriffst, könntest du ihn bitten, nach Hause zu kommen?«
»Natürlich.«
»Es ist dringend.« Sie führte nicht weiter aus, worum es ging.
Anna nahm an, dass es Schwierigkeiten mit einer der Warenlieferungen gab. Wie ihr Vater, der seit dem letzten Sommer nicht mehr lebte, war Jakob ein einflussreicher Kaufmann, der kostbare Stoffe, Gewürze und allerlei andere Spezereien aus dem Morgenland einführte. An den meisten Tagen standen die reichen Ulmer und Ulmerinnen Schlange, um seltene Weine, Edelsteine, bunt gefärbte Seide oder ausgefallene Federn für einen Kopfputz zu erstehen. Da Jakob das Geschäft ihres Vaters übernommen hatte, musste er nun auch dessen bisherige Kundschaft zufriedenstellen, die Wunder zu erwarten schien. Sank ein Schiff im Sturm oder wurde von Korsaren überfallen, entstanden häufig Engpässe, von denen die Wohlhabenden nichts hören wollten.
Nachdem Anna sich mit einem Nicken von Ella verabschiedet hatte, ging sie ums Haus herum zu dem mit Steinplatten befestigten Weg, der zu einer Tür in der Mauer führte. Diese schützte sowohl Jakobs als auch ihr Haus, durch Ellas Gärten und einen Zaun herrschte jedoch genügend Abstand zwischen ihnen. Im Sommer verschwand der Rest des Anwesens hinter dem Laub der Büsche und Bäume und den Blüten der Ranken, die Ella erst vor Kurzem gestutzt hatte. In Gedanken längst bei Lazarus trat Anna auf die Straße hinaus, auf der zahlreiche Ulmer in Richtung Münsterplatz strömten.
Kapitel 4
Der Mailand, die breite Straße, in der sich Annas Haus befand, führte schnurgerade nach Süden auf den Platz zu, an dem der gewaltige Kirchenbau in den Himmel wuchs. Bis heute weckte er furchtbare Erinnerungen in ihr. In manchen Nächten schreckte sie schweißgebadet aus dem Schlaf auf, weil sie ein Alptraum wieder auf das Gerüst des Münsters geführt hatte, auf dem sie nur knapp dem Tod entronnen war. Zwar waren die Wunden an ihrer Schulter längst verheilt, doch die Narben erinnerten sie täglich an einen der schlimmsten Augenblicke in ihrem Leben. Sie hatte Lazarus die Wahrheit verschwiegen, und manchmal fragte sie sich, ob er sie jemals erfahren würde. Sollten er oder ihr Bruder herausfinden, was wirklich geschehen war, würde das die Beginen in unnötige Schwierigkeiten bringen. Der Mörder war tot, der Bau des Münsters ging seinen Gang. Schlafende Hunde sollte man nicht wecken, auch wenn ihr der Gedanke, ihrem Gemahl etwas zu verheimlichen, Bauchschmerzen bereitete. In ihren Gebeten bat sie Gott regelmäßig um Vergebung für diese Lüge und hoffte, dass er ihr deswegen nicht zürnte.
Es dauerte nicht lange, bis sie das Ende der Straße erreichte und die Mauern des Barfüßerklosters vor ihr auftauchten, die von feuerrotem Wilden Wein umrankt waren. Auch die uralten Linden im Hof des Klosters trugen noch ihr buntes Kleid, das im schwachen Sonnenlicht leuchtete. Wie jeden Herbst lag seit Wochen Nebel über der Stadt, der sich an diesem Tag allerdings früh aufzulösen begann. Da sich das Spital im Osten der Stadt befand, führte ihr Weg sie unweigerlich an der Baustelle vorbei.
Der Anblick des riesigen Bauwerks, an dem wie immer emsig gearbeitet wurde, erfüllte sie trotz allem, was passiert war, mit Ehrfurcht. Der weiße Kalkstein erstrahlte im trüben Licht der Sonne, die sich in den Werkzeugen der Steinmetze fing. Das Geräusch von Metall auf Stein war weithin zu vernehmen. Überall klopften, zimmerten und hämmerten Handwerker, während über ihren Köpfen Mörtelträger ihre Lasten über Laufschrägen in schwindelerregende Höhen schleppten. Obwohl der Wind nicht besonders stark war, schwankten die hölzernen Stangengerüste gefährlich, und Anna senkte hastig den Blick, da ihr die Beine schwach wurden.
Seit ihrem Unfall schien der Bau keine großen Fortschritte gemacht zu haben, auch wenn die Kirche längst geweiht worden war. Die Seitenschiffe standen erst bis zum neunten Joch unter Dach, das Mittelschiff war nur mit einem Notdach versehen. Das Nordostportal besaß bereits bunte Fenster, doch von dem ungeheuren Westturm waren lediglich die Vorhalle, das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss abgeschlossen. Unter dem Baumeister Hans Kun wurde vor allem an diesem Teil der Kirche gebaut, an einem riesigen Bogen zwischen Turmhalle und Mittelschiff.
Mit einem Schaudern riss sie sich vom Anblick des Turms los und eilte vorbei an zwei Galgenkränen, in deren Laufrädern junge Burschen schwitzten. Ihren Korb umklammerte sie mit beiden Händen, um das plötzliche Zittern zu unterdrücken. Der Mann, der sie fast ermordet hatte, war tot. Sie hatte ihn mit eigenen Augen in die Tiefe stürzen sehen. Ihr Herz schlug in ihrer Kehle, als sie wenig später das Ochsenbergle erreichte, von wo aus sie sich in Richtung Predigerkloster wandte. Vorbei an den Gebäuden der Dominikaner begab sie sich zum Heilig-Geist-Spital, vor dem wie immer zahlreiche Fuhrknechte, Werkleute und Bedürftige ausharrten, um Einlass vom Torhüter zu verlangen. Die Sonne tauchte den Komplex in ein warmes Licht, als Anna den kleineren der beiden Spitalhöfe betrat. Um ihr klopfendes Herz zu beruhigen, verlangsamte sie die Schritte und holte einige Male tief Atem. Zu ihrer Rechten befanden sich Fruchtkästen, Scheunen und Ställe, zu ihrer Linken ragte die Spitalkirche in den blassblauen Himmel. Zahlreiche Wirtschaftsgebäude, eine Schmiede und eine Bäckerei schlossen an das Gotteshaus an, dessen Uhr das Licht zurückwarf. Gegenüber dem Tor befand sich die Dürftigenstube, hinter der einer der Türme der Stadtbefestigung aufragte. Ein von Rosenstauden umrankter Bogengang neben der Kirche führte in einen zweiten, größeren Hof, in dessen Mitte sich ein tiefer Ziehbrunnen befand. Nicht weit entfernt vom Brunnen waren die größeren Fuhrwerke und landwirtschaftlichen Geräte des Ordens abgestellt, von denen einige im kommenden Frühjahr repariert werden mussten. Östlich der Kirche prangte das stattliche Haus des Spitalmeisters mit einer Kapelle. Den Abschluss des größeren Hofes bildeten eine Badestube, ein Speisesaal und die Häuser für die Pfründner, die alten Insassen des Spitals. Im Schatten der Stadtmauer lagen ein kleiner Friedhof und ein Kräutergarten.
Wie beim Tor herrschte auch hier reger Betrieb, da nicht nur zahlreiche Kranke und Bedürftige im Spital untergebracht waren. Außer ihrem Gemahl Lazarus, dem Siechenmeister, kümmerten sich Dutzende von Ordensbrüdern um die männlichen Kranken, wohingegen die weiblichen Insassen von der Meisterin, der Milchmutter und zwei im Spital wohnenden Schwestern versorgt wurden. Aus dem einheitlichen Schwarz der Mönche und Schwestern stachen die Knechte und Mägde hervor, deren Tracht meist aus einfachem blauem Tuch bestand. An manchen Tagen vermischte sich das Weinen der Neugeborenen mit dem Brüllen der Kranken, doch an diesem Morgen herrschte eine fast unheimliche Stille.
Sie hatte den Hof erst zur Hälfte überquert, als ein schriller Schrei an ihr Ohr drang. Sie schrak zusammen, und auch die Umstehenden sahen sich beunruhigt um.
»Da!« Eine der Mägde zeigte zur Pforte, durch die man zum Gottesacker gelangte.
Ein junges Mädchen, vermutlich eine der Küchenhilfen, rannte wie vom Leibhaftigen gehetzt in Richtung Brunnen, wo es von einer der Schwestern aufgehalten wurde.
»Was ist denn los, um alles in der Welt?«, hörte Anna die Schwester fragen.
»Ich … Es … Der Teufel …!«
»Nimm seinen Namen nicht in den Mund!« Die Schwester schüttelte das Mädchen. »Warum veranstaltest du so ein Geschrei?«
»Das Grab!«
»Welches Grab?«
»Es ist leer!«
Während Anna erstarrte, tauschten die anderen Anwesenden, welche die Behauptung gehört hatten, erschrockene Blicke aus.
»Was redest du da?«, fragte die Schwester ungehalten.
»Der Tote ist aus seinem Grab gestiegen!« Das Mädchen bekreuzigte sich.
»Welcher Tote? Was hast du auf dem Gottesacker zu suchen?« Die Schwester fasste das Mädchen bei den Schultern und schüttelte es erneut. »Komm doch zu dir, Kind!«
»Ich wollte Kräuter holen«, hörte Anna es sagen. Sie wusste, dass in dem Garten mehrere winterharte Stauden standen, von denen selbst sie ab und zu etwas abschnitt.
»Und dann hab ich das Grab gesehen.« Das Mädchen schloss schaudernd die Augen.
Einige Neugierige traten dichter heran.
»Zeig es mir!«, befahl die Schwester.
Das Mädchen schüttelte entsetzt den Kopf. »Da geh ich nicht mehr hin!«, keuchte es.
»Benimm dich nicht wie eine dumme Gans!«
»Aber was, wenn …?«
»Der barmherzige Gott wohnt in diesem Spital«, wies die Schwester sie zurecht. »Es gibt nichts, wovor du dich fürchten musst.«
Anna runzelte die Stirn. Was um alles in der Welt hatte die Kleine so erschreckt? Obwohl es sie in die Siechenstube zu Lazarus zog, gewann ihre Neugier die Oberhand, als die Schwester das Mädchen energisch in Richtung Friedhof schob. Also schloss sie sich den anderen Schaulustigen an und betrat wenig später den Gottesacker.
Es dauerte nicht lange, bis der kleine Zug ein Grab in der Nähe der Mauer erreichte, dessen Erde allem Anschein nach aufgewühlt worden war. Das Holzkreuz, auf dem der Name des Toten stand, war herausgerissen und verkehrt herum in die Erde gerammt worden.
Ein entsetztes Flüstern ging durch die Reihen.
Als sie näher kam, erkannte Anna ein schmutziges Leichentuch, das neben dem offenen Grab auf dem Boden lag. Doch es war nicht das Tuch, das ihren Blick wie magisch anzog, sondern etwas, das sich daneben befand, in seiner Farbe kaum zu unterscheiden von der aufgewühlten Erde.
»Keinen Schritt weiter!«, warnte sie, da die Schwester und das Mädchen das Ding nicht zu sehen schienen.
Die Schwester sah sie erstaunt an. »Wieso?«
»Eine Schlange.« Anna zeigte auf den Boden.
»Heilige Jungfrau Maria!« Die Schwester machte einen Satz nach hinten. »Satanas, weiche!« Sie bekreuzigte sich hastig und umklammerte das Kruzifix an ihrem Hals.
»Gütiger Gott!«, murmelte eine Magd, die bei Anna stand.
»Der Leibhaftige ist unter uns!«
»Herr, beschütze uns!«
Obwohl Anna ein flaues Gefühl im Magen hatte, stellte sie ihren Korb ab, hob einen dürren Ast auf und wagte sich dicht an das geschändete Grab heran. Vorsichtig, von Dutzenden neugierigen Augen beobachtet, stach sie mit dem Stock nach der Schlange, die sich nicht rührte. »Ich glaube, sie ist tot«, stellte sie fest, als sie sah, dass der Bauch des Tieres aufgeschlitzt worden war.
»Jemand muss den Spitalmeister holen!«, rief ein Ordensbruder, der einen Blick in das geöffnete Grab warf. »Der Leichnam ist fort!«
Kapitel 5
»Keine Angst, du wirst wieder gesund.« Der Siechenmeister Lazarus legte dem Jungen, der sich vor Schmerzen auf dem Lager krümmte, an dem er stand, beruhigend die Hand auf die Stirn. Der Bursche arbeitete in der ordenseigenen Schmiede und war mit schlimmen Schmerzen im Unterleib zu ihm gekommen. Eine Harnschau hatte ergeben, dass er Blut im Urin hatte, weshalb Lazarus auf einen Blasenstein geschlossen hatte. Diese traten vor allem bei Knaben und alten Menschen auf, als Ursache kamen unreine Muttermilch oder schlechtes Wasser in Betracht. Dadurch entstanden sandige Rückstände im Harn, die durch die enge Harnröhre nicht ausgeschieden werden konnten.
Da ein Steinschnitt ein gefährlicher Eingriff war und stets als das letzte Mittel galt, um das Leben eines Leidenden zu retten, flößte Lazarus ihm seit einigen Tagen eine Arznei aus Spechtwurz und Wermutwein ein, die allerdings nur langsam Linderung brachte. Er wusste, wie schmerzhaft der Abgang eines Blasensteines sein konnte, weshalb er außerdem einem der Spitalhelfer aufgetragen hatte, dem Jungen warme Waschungen zu verabreichen, um sein Leid zu lindern.
»Es tut immer noch so weh«, stöhnte der Kranke, dessen Gesicht aschfahl war.
»Ich weiß«, seufzte Lazarus. »Du musst Geduld haben.« Er sah auf, als unvermittelt die Glocke der Spitalkirche anfing zu läuten. »Ist es schon wieder Zeit fürs Stundengebet?«, fragte er erstaunt.
Der Helfer, der den Kranken waschen sollte, schüttelte den Kopf.
»Warum läutet dann die Glocke?« Obwohl es in der Siechenstube noch reichlich zu tun gab, beschloss Lazarus dem aufgeregten Bimmeln auf den Grund zu gehen, da er es für ein schlechtes Zeichen hielt. Weshalb hatte der Kaplan den Auftrag dazu gegeben? Gab es Ärger im Hof? Brannte eines der Gebäude? Er wusch sich die Hände in einer Schüssel mit warmem Wasser, trocknete sie ab und machte sich auf den Weg zum Ausgang, der ihn an Dutzenden von Lagern vorbeiführte.
Die starken Säulen, die das Kreuzrippengewölbe des Raumes stützten, unterteilten die Stube in drei Bereiche: einen für Männer, einen für Frauen und einen für Schwerkranke. An der westlichen Stirnseite befanden sich ein Brunnen und eine Kanzel, von welcher einer der Ordensbrüder zweimal die Woche die Predigt für die Sterbenden las. Jedes Mal, wenn die Glocke zum Stundengebet rief, kam Leben in die Insassen, doch Lazarus gab den Mägden und Knechten zu verstehen, dass die Kranken in ihren Betten bleiben sollten.
»Ich bin gleich wieder da«, ließ er den Wundarzt wissen, der damit beschäftigt war, einen Knochenbruch zu richten.
»Mhm.« Der Wundarzt blickte kaum auf. Seit er zu Beginn des Jahres bei einer Leichenschau gegen Lazarus ausgesagt hatte, war das Verhältnis zwischen ihm und dem Siechenmeister unterkühlt.
Lazarus vermutete, dass der ehemalige Magister Hospitalis den Wundarzt dafür bezahlt hatte, bei der Leichenschau zu lügen, hatte den Vorfall jedoch nie angesprochen. Was hätte er auch fragen sollen? Eine ehrliche Antwort hätte er vermutlich ohnehin nicht bekommen. Ihm genügte, dass der Magister Hospitalis nach Rom beordert worden war und sein Posten seitdem von Bruder Benedict, dem ehemaligen Kellerer, bekleidet wurde. Benedict war ein gutmütiger und aufrichtiger Mann, dem das Wohl der Ordensbrüder und Insassen am Herzen lag.
Als Lazarus die Siechenstube verließ und ins Freie trat, beschirmte er geblendet die Augen. Die Sonne, die inzwischen die von der Donau aufsteigenden Nebelschwaden vertrieben hatte, warf ein gleißendes Licht in den Hof, auf dem zahlreiche Insassen und Helfer zusammengelaufen waren. Sie alle strömten zum Gottesacker, bei dessen Pforte der kahle Kopf von Bruder Benedict glänzte. Zu Lazarus’ Erleichterung waren nirgends Rauchschwaden zu entdecken. Das helle Läuten der Glocke hallte von den Gebäuden wider und ließ ihn die Stirn runzeln. Was um alles in der Welt hatte für eine solche Aufregung gesorgt? Was konnte es beim Friedhof zu sehen geben? Es gab nur einen Weg, es herauszufinden.
»Lasst mich durch!« Beherzt bahnte er sich einen Weg durch die Schaulustigen.
»Weißt du, was passiert ist?«, erkundigte sich einer der älteren Brüder.
Lazarus verneinte.
»Warum läutet die Glocke?«
Lazarus ließ ihn stehen und eilte mit langen Schritten zur Pforte, durch die man auf den kleinen Gottesacker gelangte. Schon von Weitem entdeckte er Anna. Sie hatte sich mit einigen anderen um ein offenes Grab herum versammelt und starrte auf den Boden. Ihr Anblick ließ Sorge in ihm aufsteigen. In was war sie nun schon wieder hineingeraten? Seit dem furchtbaren Vorfall auf der Münsterbaustelle war ihr Leben in ruhigen Bahnen verlaufen, und Lazarus hatte gehofft, dass es so bleiben würde. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als mit Anna eine Familie zu gründen und irgendwann in einem Haus voller Kinder zu wohnen. Seit der Orden ihn von seinem Gelübde entbunden hatte, sehnte er sich noch mehr nach einem normalen Leben.
Mit einem Seufzen eilte er Bruder Benedict hinterher und erreichte kurz nach ihm das Grab.
»Was soll die Aufregung?«, erkundigte sich der Spitalmeister. »Was ist denn bloß passiert? Wer hat die Glocke läuten lassen?«
Anstelle einer Antwort zeigte eine der Schwestern auf das geöffnete Grab, neben dem ein beflecktes Leichentuch lag.
»Wo ist der Tote?« Bruder Benedict beugte sich über das Loch.
»Er ist fort«, keuchte ein junges Mädchen, das mit kreidebleichem Gesicht am Rand stand. »Der Leibhaftige hat ihn geholt!«
»Ich habe gesagt, du sollst nicht so einen Unsinn erzählen!«, fuhr die Schwester es an, ehe sie sich an den Spitalmeister wandte. »Er ist wie vom Erdboden verschluckt.«
Lazarus suchte Annas Blick.
Als sie ihn bemerkte, wirkte sie erleichtert. Während Bruder Benedict die Schwester befragte, löste sie sich von der Gruppe, bei der sie gestanden hatte, und gesellte sich zu ihm.
»Was ist los?«, flüsterte er, als sie ihn erreichte.
»Jemand hat das Grab geschändet«, entgegnete Anna. »Und eine tote Schlange dagelassen.«
»Eine tote Schlange?«, tönte der Spitalmeister, der das Gleiche von der Schwester erfahren haben musste. »Was soll das?«
»Der Tote ist aus seinem Grab aufgestanden und wandelt unter den Lebenden«, hauchte eine Magd.
»Nur der Herr Jesus ist von den Toten auferstanden!«, wies Bruder Benedict sie zurecht. »Was auch immer hier vorgefallen ist …« Er sah auf das Holzkreuz, das verkehrt herum in der Erde steckte. »Warum verübt jemand einen solchen Frevel? Wer lag in dem Grab?« Er bedeutete zwei Knechten, das Kreuz wieder richtig aufzustellen. »Vinzenz Bitterlin«, las er den Namen des Verblichenen vor. »Wer war er?«
»Ein ehemaliger Zunftmeister der Kaufleute«, wusste einer der Umstehenden.
»Einer der reichen Pfründner«, sagte ein anderer.
»Wann ist er denn beerdigt worden?«, fragte Lazarus verwundert.
Der Spitalmeister nannte den Tag, der auf dem Kreuz stand.
»Seltsam«, murmelte Lazarus. Zwar starben zahlreiche Alte und Kranke im Spital und er wohnte nicht jeder Totenmesse bei, aber seiner Ansicht nach war im letzten Monat niemand verstorben.
»Wo ist er hin?«, fragte einer der Brüder.
»Das werden wir herausfinden«, brummte der Spitalmeister. »Davonspaziert wird er wohl kaum sein.« Seine Miene war grimmig.
»Und wenn doch?« Das bleiche Mädchen zeigte auf Spuren im feuchten Boden, die zu einer Pforte in der Mauer führten. »Was, wenn er doch aus dem Grab aufgestanden ist und jetzt die Ulmer heimsuchen will?«
»Sei nicht albern, Kind!«, rügte Bruder Benedict sie. »Es gibt keine lebenden Toten!«
»Ist nicht schon mal ein Leichnam aus dem Spital verschwunden?«, wunderte sich einer der Knechte.
Lazarus verkniff sich ein Stöhnen, als er an den Fall der verstorbenen Reisenden Gertrud zurückdachte, die bei den Beginen Unterschlupf gesucht hatte und schließlich im Spital gestorben war.
»Damals gab es auch eine Erklärung dafür«, brummte Bruder Benedict, dem anzusehen war, dass er dasselbe dachte wie Lazarus. Es würde nicht lange dauern, bis sich der Vorfall bis zum Rat und somit bis zu Annas Bruder Jakob, dem Spitalpfleger, herumsprechen würde. »Sucht alles ab!«, befahl der Spitalmeister. »Vielleicht hat ihn ein Hund ausgegraben.«
»Das glaubst du ja wohl selbst nicht!«, hörte Lazarus jemanden zischen.
Kapitel 6
Anna sah zu Lazarus auf, als Leben in die Umstehenden kam. »Was glaubst du?«, fragte sie mit einem Blick auf das geschändete Grab. Der Schreck, der beim Anblick der leeren Grube in sie gefahren war, hatte sich ein wenig gelegt, doch die Aufregung war nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Wieso mussten solche Dinge immer im Spital passieren? Wer war Vinzenz Bitterlin gewesen? Und warum war sein Leichnam verschwunden?
Lazarus blies die Wangen auf. »Was ich glaube? Dass wir uns am besten aus der Sache raushalten«, entgegnete er nach kurzem Zögern.
»Wirklich?« Ihre Brauen wanderten nach oben.
»Es geht uns nichts an.«
»Und die Fußspuren? Interessiert es dich denn gar nicht, was passiert ist?«
»Ehrlich gesagt, nein«, behauptete er, aber Anna wusste, dass er log. Die Neugier stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Wenn der Rat davon erfährt, bedeutet das Schwierigkeiten für Jakob«, gab sie zu bedenken. »Wir sind ihm Dank schuldig, weil er uns das Haus geschenkt hat. Ich finde, wir sollten alles unternehmen, um so schnell wie möglich herauszufinden, was passiert ist.«
Lazarus verzog das Gesicht und überlegte eine Weile. »Mir gefällt nicht, was du sagst«, seufzte er schließlich, »aber ich fürchte, du hast recht. Bruder Benedict könnte in Schwierigkeiten geraten, wenn der Orden davon erfährt.«
»Meinst du?«
Lazarus schwieg. Er warf einen Blick auf den Spitalmeister und die anderen, die sich inzwischen näher an das leere Grab herangewagt hatten, und schien einen Entschluss zu fassen. »Die Spuren führen zur Pforte«, stellte er fest. »Wer auch immer das war, muss auf diesem Weg ins Spital gelangt sein.«
»Oder das Spital verlassen haben«, wandte Anna ein.
»Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der Tote aus seinem Grab gestiegen ist?«
Sie schüttelte den Kopf. »Aber warum sollte jemand einbrechen, um einen Leichnam zu stehlen?«
»Das gilt es wohl in Erfahrung zu bringen«, brummte Lazarus. »Etwas Ähnliches ist immerhin schon mal passiert.«
»Du meinst Gertrud?«
Er nickte.
»Mir kommt es eher so vor, als hätte jemand das Grab geschändet, um der Seele des Verstorbenen Schaden zuzufügen«, sagte Anna. »Warum sonst hätte er eine Schlange mitgebracht und das Kruzifix umgedreht?«
»Das ist Frevel.«
»Absichtlich begangener Frevel.«