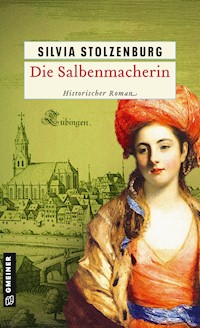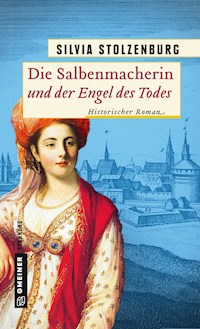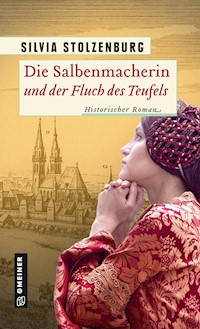
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Salbenmacherin
- Sprache: Deutsch
September 1412. Ein verzweifelter Ratsherr bittet Olivera um Beistand. Seine Tochter leidet unter unkontrollierten Zuckungen und einer Schwäche bis hin zur Ohnmacht. Gegen die rätselhafte Krankheit weiß selbst der Medicus keinen Rat. Olivera verspricht Hilfe, doch auch sie kann das Leid des Mädchens nicht lindern. Bald erkranken weitere Nürnberger, und es dauert nicht lange, bis das Gerücht entsteht, der Teufel hätte die Kranken verflucht. Olivera gerät unter Verdacht, mit den dunklen Mächten im Bunde zu stehen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Salbenmacherin und der Fluch des Teufels
Historischer Roman
Zum Buch
Der Teufel in Nürnberg Seit der Entführung von Oliveras Sohn sind zweieinhalb Jahre vergangen. Es hat den Anschein, als würde Normalität in ihr Leben einkehren, bis eines Morgens ein Ratsherr um ihren Beistand bittet. Seine Tochter leidet an einer rätselhaften Krankheit, die selbst den Medicus ratlos macht. Olivera verspricht Hilfe, doch auch sie kann das Leid des Mädchens nicht lindern. Bald erkranken weitere Nürnberger, und es dauert nicht lange, bis das Gerücht entsteht, der Teufel hätte die Kranken verflucht. Als wäre das nicht genug, tauchen die Leichen der Männer auf, die Oliveras Bruder ermordet hat. Zu ihrem Entsetzen soll sie bei der Leichenschau helfen, bei der die Toten erkannt werden. Kann sie den Verdacht von sich ablenken oder drohen ihr und ihrem Gemahl das Lochgefängnis und die Hinrichtung? Die Ereignisse überschlagen sich und zwingen Olivera zu einer folgenschweren Entscheidung.
Dr. phil. Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen. Im Jahr 2006 promovierte sie dort über zeitgenössische Bestseller. Kurz darauf machte sie sich an die Arbeit an ihrem ersten historischen Roman. Sie ist hauptberufliche Autorin und lebt mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb, fährt leidenschaftlich Rennrad, gräbt in Museen und Archiven oder kraxelt auf steilen Burgfelsen herum - immer in der Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken.
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © Alex Shadrin / stock.adobe.com und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuernberg-1650-Merian.jpg
ISBN 978-3-8392-6908-4
Widmung
Für Horschi – zu wenig, zu kurz. Du fehlst.
Kapitel 1
Vor den Toren von Nürnberg, September 1412
Die Sonne schien aus einem makellos blauen Himmel, den nur ein dünner Schleier im Osten trübte. Am Horizont jagten sich ein paar vorwitzige Vögel, als ob der Herbst noch in weiter Ferne läge. Das Laub der Bäume am Ufer der Pegnitz färbte sich in diesem Jahr nur langsam bunt, doch das schöne Wetter konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Sommer vorbei war. Zwischen den Grashalmen am Wegesrand spannten sich Spinnennetze, die taunass glitzerten. Der schwere Geruch von feuchter Erde stach Jona in die Nase, als er sich mit Cristin der Hallerwiese vor den Toren der Stadt näherte.
»Warum willst du ausgerechnet hier suchen?«, fragte das Mädchen und sah mit großen Augen zu ihm auf. Sie hatte Mühe, mit Jona Schritt zu halten. Ihre wilden dunklen Locken tanzten um ein vor Anstrengung gerötetes Gesicht. »Vor dem Wöhrder Türlein wächst viel mehr Schafgarbe.«
Jona schüttelte ungehalten den Kopf. »Wenn du lieber zurück nach Hause gehen willst …«
»Nein!« Cristins Wangen färbten sich noch röter. »Ich bin doch kein Kind mehr!«
Jona verkniff sich ein Lachen. Sie war beinahe zehn Jahre alt und benahm sich seit geraumer Zeit seltsam, vor allem in seiner Gegenwart. Er mochte sie wie eine kleine Schwester, allerdings fürchtete er, dass sie in ihm mehr sah als den großen Bruder. Seit seine Stimme tiefer und seine Schultern breiter geworden waren, klebte sie bei jeder Gelegenheit an seinen Fersen. Er fragte sich, wann Götz bemerken würde, was vor sich ging. Allein die Vorstellung bereitete ihm Unbehagen. Er schob den Gedanken hastig beiseite und sah sich um. Etwa eine halbe Meile vor ihnen hob sich etwas vom Blau des Himmels und dem Braun der Stoppelfelder ab, bei dem es sich um das verfallene Gehöft handeln musste. Der Hof des Alten Endris, dachte er und zog die Schultern hoch, weil es ihn plötzlich fröstelte. Seit der Entführung von Oliveras Sohn Lukas vor zweieinhalb Jahren war im Haus des Stadtapothecarius nie mehr von jener Nacht gesprochen worden, in der auch Mathes, der Knecht, fast sein Leben verloren hätte. Mit gemischten Gefühlen erinnerte Jona sich an alles, was damals vorgefallen war. Wäre er nicht neulich durch Zufall Zeuge eines Gesprächs auf dem Grünen Markt geworden, hätte er dasselbe getan, was die ganze Stadt zu tun schien: den Adepten Alphonsius und seine betrügerischen Helfer vergessen.
»Was, glaubst du, geschieht mit dem Hof?«, hatte ein Knecht eine Frau mit einem Handkarren gefragt, während Jona in der Schlange hinter ihnen gewartet hatte, bis er beim Metzger an der Reihe war.
»Mit welchem Hof?«
»Mit dem des Alten Endris. Wenn die neue Straße gebaut wird, ist der doch mitten im Weg.«
Die Frau hatte mit den Schultern gezuckt. »Dann wird man ihn dem Erdboden gleichmachen. Was geht’s mich an?«
Zuerst hatte Jona sich nicht für das Gerede interessiert, doch auf dem Weg zurück zum Haus in der Burgstraße war ihm der halb verkohlte Zettel eingefallen, den er kurz nach Lukas’ Rettung im Kamin gefunden hatte. …tore zum Hof des Alten E… Mehr hatte er nicht entziffern können. Der Rest des Papiers war verbrannt. Obwohl er vermutet hatte, dass es sich um eine Nachricht des Entführers handelte, hatte er dem Fund keine weitere Beachtung geschenkt, da Lukas wohlauf und der Täter über alle Berge war. Erst einige Zeit später war ihm klar geworden, dass etwas mit der Nachricht nicht stimmte. Waren Lukas und die Amme nicht in einer Kate innerhalb der Stadtmauern gefangen gehalten worden? Je länger er darüber nachgedacht hatte, desto heftiger hatte ihn die Neugier geplagt. Deshalb hatte er beschlossen, der Sache endlich auf den Grund zu gehen. Er hatte keine Ahnung, was er sich von dem Ausflug versprach, vermutlich hatte der halb verbrannte Zettel überhaupt nichts mit der Entführung zu tun. Dennoch zog ihn der Hof an wie ein Magnet.
»Ich glaube nicht, dass wir so weit weggehen sollten«, gab Cristin zu bedenken.
Jona ignorierte sie und steuerte zielstrebig auf eine Ansammlung von verfallenen Gebäuden in der Nähe des Flussufers zu.
»Jona?«, quengelte sie.
»Geh Pappelrinde sammeln«, brummte er.
»Aber wir sollen doch Schafgarbe mitbringen!«
»Jetzt mach schon!« Er zeigte ungehalten auf die Bäume und wartete, bis Cristin sich widerstrebend trollte. Dann sah er sich um. Dicht beim Ufer stand ein windschiefer Holzschuppen, dessen Dach an einigen Stellen eingefallen war. Überall wucherten mannshohe Disteln und auf dem Schornstein des Hauptgebäudes hatten Störche ihr Nest gebaut. In den Wänden klafften Durchbrüche, wo die Nürnberger Holz und Steine herausgebrochen hatten, um sie anderweitig zu verwenden. Trotz des frischen Windes lag der Geruch von Schimmel, Fäulnis und Tierkot schwer in der Luft. Jona rümpfte die Nase. War er auf dem Holzweg? Er betrat das Gebäude und blinzelte, bis sich seine Augen an das Dämmerlicht im Inneren gewöhnt hatten. Im Erdgeschoss befand sich nichts außer einer gewaltigen Feuerstelle und einigen alten Töpfen. In einer Ecke türmten sich kaputte Stühle und Bänke, die zum Teil zu Feuerholz zerkleinert worden waren. Das Obergeschoss war ebenfalls verwaist, die Treppe so morsch, dass er mehrmals fast eingebrochen wäre. Zurück im Erdgeschoss sah er sich nach einem Keller um und entdeckte eine Luke.
»Was ist das denn?«, murmelte er, ging näher und kniete sich auf den Boden. Die Klappe der Luke war aufgestoßen und lag auf einem Haufen schwerer Steine. Bei näherem Hinsehen wurde deutlich, dass sich jemand mit einem Messer daran zu schaffen gemacht hatte. Ein Loch klaffte in der Mitte der Bretter, an einem rostigen Nagel hing ein Stück Stoff. Jona befreite es und runzelte die Stirn. Er überlegte gerade, ob er in den Keller klettern sollte, als ein gellender Schrei an sein Ohr drang.
»Cristin!«, keuchte er. Mit einem Satz kam er zurück auf die Beine und rannte zur Tür.
Kapitel 2
Nürnberg, September 1412
Olivera richtete sich mit einem Seufzen auf und legte die Hand an den schmerzenden Rücken. Sie stand schon mehrere Stunden in der Salbenküche, gebückt über Hackblock, Mörser und Tiegel verarbeitete sie die frischen Heilpflanzen, die Jona und Cristin in den letzten Tagen gesammelt hatten. Seit dem vergangenen Sommer überließ sie Jona viele der einfacheren Arbeiten in der Offizin und auch Cristin hatte sich inzwischen zu einer tauglichen Helferin gemausert. Dank der Unterstützung der beiden konnte Olivera viel Zeit im Heilig-Geist-Spital verbringen, wo sich immer mehr reiche Pfründner in den Kreis ihrer Kunden einreihten. Nach der Enttäuschung über das angebliche Allheilmittel, das der Adept Alphonsius den Alten und Kranken für teures Geld verkauft hatte, waren ihre Arzneien beliebter denn je. Kein Wunder, dachte sie. Immerhin halfen ihre Tränke und Salben, die Zipperlein der Insassen des Spitals zu lindern.
Da der Gedanke an den Adepten unweigerlich schlimme Erinnerungen zurückbrachte, schüttelte sie ihn ab und warf eine Handvoll getrocknete Blüten der Akelei in einen Mörser. Sie zerstieß sie mit geübten Bewegungen und füllte sie in kleine Säckchen. Vermischt mit Apfelmus half diese Heilpflanze gegen das Fieber, das bald wieder in Nürnberg grassieren würde. Mit Beifuß und Brennnessel gegen Magen- und Darmbeschwerden, Tausendgüldenkraut zur Linderung von Ohrensausen und Eisenkraut für Kompressen verfuhr sie genauso. Außerdem legte sie Apfelbaumblätter zum Trocknen auf ein Gestell, mischte eine Lärchensalbe zur Behandlung von Ekzemen und bereitete ein Elixier aus grünen Wacholderbeeren. Immer wieder wischte sie sich dabei den Schweiß von der Stirn, da das Feuer unter der Kochstelle dafür sorgte, dass es in der Salbenküche drückend heiß war. Bald würde sie mehr Platz benötigen, denn die Regale an den Wänden des Raumes würden nicht mehr viele Tiegel, Töpfe und Flaschen fassen. Das Geschäft brummte, obwohl Götz aufgrund seines Sitzes im Stadtrat weniger Zeit hatte, im Verkaufsraum zu stehen.
Als hätten diese Überlegungen ihn angelockt, betrat in diesem Moment ein Käufer den angrenzenden Raum, begleitet vom Bimmeln des Glockenspiels über der Tür.
»Ich komme gleich!«, rief Olivera und griff nach einem Tuch, um sich die Hände zu säubern. Dann rückte sie die Haube auf ihrem Haar zurecht, verstaute eine Strähne hinter dem Ohr und ging nach nebenan.
Ein vornehmer Herr in einer von Silberfäden durchwirkten Schecke blickte ihr entgegen. Er trug einen gezwirbelten Bart. »Seid Ihr die Salbenmacherin?«, fragte er ohne Begrüßung.
Olivera nickte.
»Ich brauche Eure Hilfe!«
Olivera trat hinter den Tresen. »Was kann ich für Euch tun?«
»Ihr müsst mit mir kommen! Meine Tochter ist krank!«
Olivera runzelte die Stirn. »Habt Ihr Euch an den Medicus gewandt?«
Der Mann nickte. »Er hat ihr lauter nutzloses Zeug gegeben, das nicht hilft!«
»Mein Gemahl …«, hob Olivera an, aber der Patrizier schnitt ihr mit einer Geste das Wort ab.
»Ihr müsst mit mir kommen! Eure Arzneien haben meiner Mutter das Leid vor dem Tod erspart.«
»Eurer Mutter?«
»Sie war Pfründnerin im Spital«, erklärte er. »Ohne Euch hätte sie furchtbar unter ihrem Krebs gelitten. Ihr müsst auch meiner Tochter helfen!«
»Ich kann Eurer Tochter nur in Absprache mit dem Medicus Arzneien geben«, hielt Olivera entgegen. »Alles andere könnte vom Rat als Kurpfuscherei angesehen werden.« Obwohl sich ihre Feinde in den vergangenen zweieinhalb Jahren ruhig verhalten hatten, wollte sie niemandem die Möglichkeit geben, erneut gegen sie oder Götz zu intrigieren.
»Lasst das meine Sorge sein.« Der Mann zog eine Geldkatze aus der Tasche und legte sie vor ihr auf den Tresen. »Ich bezahle Euch fürstlich.«
Olivera schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich kann nur helfen, wenn Ihr auch nach dem Medicus schicken lasst.«
»Verdammt!«, schimpfte er, hob jedoch sofort beschwichtigend die Hände. »Es tut mir leid. Meine Tochter … Sie ist …« Er suchte nach Worten.
»Wie alt ist sie?«, wollte Olivera wissen.
»Neun.« Tränen traten in seine Augen.
Wider besseres Wissen beschloss Olivera, seinem Wunsch nachzugeben. Der Medicus Matthäus war weder abweisend noch hochmütig wie sein Vorgänger und würde es vermutlich nicht missbilligen, wenn man auch sie zu Rate zog. Dennoch würde sie darauf bestehen, dass man nach ihm schickte. »Ich werde sie mir ansehen«, sagte sie.
Der Ratsherr wirkte erleichtert.
»Beschreibt mir ihren Zustand ganz genau«, forderte sie ihn auf.
Er fuhr sich mit der Hand durch den Bart. »Sie hat furchtbare Krämpfe. Immer wieder krümmt sie sich schreiend zusammen, hat Schaum vor dem Mund und erbricht sich. Vor zwei Tagen hat sie wie wild um sich geschlagen und etwas vom Feuer der Hölle gestammelt. Es ist, als ob Gott sie für etwas bestrafen wollte.« Seine Augen wurden feucht. »Sie ist doch unschuldig!«
Olivera überlegte einen Augenblick. »Wie lange leidet sie schon an den Krämpfen?«
»Seit drei Tagen. Es fing mit einem starken Zittern an und wird immer schlimmer. Wenn Ihr ihr nicht helft …« Er schluckte mühsam. »Die Kindermagd hat nach einem Pfaffen geschickt, um die Heiligen anrufen zu lassen. Aber wie soll das gegen die Schmerzen helfen?«
Obwohl die Symptome auf verschiedene Krankheiten hindeuten konnten, ging Olivera zurück in die Offizin, um Mutterkraut, Kamille und Fenchel einzupacken, die allesamt krampflösend wirkten. Außerdem füllte sie Leinsamen in ein kleines Säckchen, da dieses Mittel mit Honig gemischt gegen Verstopfung half. Wenn Gott dem Mädchen gnädig war, handelte es sich lediglich um einen verdorbenen Magen. Falls nicht … Sie bedeutete dem Mann, den Verkaufsraum zu verlassen, und sah sich im Hof nach Mathes um. Als sie ihn bei einem der Stallgebäude entdeckte, winkte sie ihn zu sich.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte er mit einem misstrauischen Blick auf den Patrizier.
Olivera schüttelte den Kopf. »Ich bin eine Weile weg. Falls in der Zwischenzeit jemand nach mir oder Götz fragt, sag ihm, er soll später wiederkommen.«
»Soll ich dich begleiten?«
»Nein.«
»Was soll ich Götz sagen, wenn er fragt, wo du bist?«
Olivera sah zu dem Ratsherrn auf.
»Im Haus von Martin Groß«, sagte er. »Meine Tochter ist krank.«
Olivera ließ sich ihre Überraschung nicht anmerken. Zwar trug der Mann feine Kleider, doch dass er zu einem der ältesten Patriziergeschlechter der Stadt gehörte, hatte sie nicht angenommen.
»Bitte! Beeilen wir uns«, drängte Groß und schritt hastig zum Hoftor.
Auf der Burgstraße angekommen, liefen sie den Abhang hinunter, überquerten den Marktplatz beim Rathaus und machten schließlich vor einem gewaltigen vierstöckigen Fachwerkhaus halt, dessen bunt bemalte Fassade im Sonnenlicht leuchtete. Nicht nur die vielen Giebel, die senfgelben Holzbalken und das silberne Schild über der Tür zeugten vom Reichtum des Besitzers. Auch die zahlreichen Wirtschaftsgebäude innerhalb der übermannshohen Mauer machten deutlich, dass hier jemand wohnte, dessen Wohlstand beträchtlich war. Nachdem der Patrizier einen Laufburschen losgeschickt hatte, um den Medicus zu holen, führte er Olivera durch eine mit Schnitzereien verzierte Eingangstür, die in eine große, von einem Rippengewölbe überspannte Halle führte. Ein lang gezogener, gequälter Schrei drang aus der Ferne an Oliveras Ohr, als sie dem Hausherrn zu einer breiten Holztreppe folgte, die in die oberen Stockwerke führte.
Vorbei an Heiligenbildern und Kruzifixen gelangten sie ins zweite Obergeschoss, wo die Schreie lauter wurden.
»Gebenedeit seist du, Heilige Jungfrau Maria«, hörte Olivera einen Mann in Priestertracht tönen, als sie mit Martin Groß den Raum betrat, in dessen Mitte ein Bett stand. Darin krümmte sich ein junges Mädchen vor Schmerzen, auf seinem Gesicht glänzte der Schweiß. Immer wieder zuckten die Arme und Beine des Kindes wie in einem furchtbaren Tanz und die Schreie schwächten sich zu einem Wimmern ab.
In einer Ecke stand eine Magd, deren bleiches Gesicht sich kaum von der weißen Wand abhob.
Als der Priester Olivera und Groß bemerkte, stand er auf und kam mit einem Kopfschütteln auf sie zu. »Du wirst nicht viel ausrichten können, meine Tochter«, sagte er an Olivera gewandt. »Der Herr hat der armen Seele eine Prüfung auferlegt, die sie allein durch ihren Glauben bestehen kann.«
»Gebt uns einen Moment, Pater«, bat Groß. »Ich lasse nach Euch schicken, sobald wir fertig sind.«
Einen Augenblick sah es so aus, als wolle der Gottesmann zögern, dann schlug er ein Kreuz vor der Brust, murmelte ein letztes Gebet und wandte sich zum Gehen.
Kapitel 3
»Vater! Hilf mir!« Die Worte waren kaum zu verstehen, da die Zähne des Mädchens heftig aufeinanderschlugen. Es sah Martin Groß so flehend an, dass sich Oliveras Herz zusammenzog.
»Die Frau wird dir den Schmerz nehmen«, sagte er mit einem Blick auf Olivera, nachdem er sich auf die Bettkante gesetzt und die zur Faust geballte Hand seiner Tochter vorsichtig in die seine genommen hatte. Er schien das Kind von ganzem Herzen zu lieben. »Bitte!« Die geröteten Augen richteten sich auf Olivera.
Erst jetzt sah sie, dass sich das Mädchen die Haare büschelweise ausgerissen hatte. Blutige Löcher klafften in ihrer Kopfhaut und ihre Beine begannen wieder, unkontrolliert zu zucken.
Olivera stellte ihren Korb ab, zog sich einen Schemel ans Bett und legte eine Hand auf die Stirn des Kindes. »Sie hat Fieber.«
»Könnt Ihr es senken?«
Oliveras Antwort ging in einem weiteren Schrei unter. Ohne Vorwarnung entriss das Mädchen seinem Vater die Hand und fing an, wild um sich zu schlagen und zu treten. Dabei schien ihr jede Bewegung Höllenqualen zu bereiten, da sich ihre Augen verdrehten und Schaum aus ihrem Mund quoll.
»Helft ihr! Bitte!« Martin Groß wich von der Bettkante zurück, da die Krämpfe seine Tochter immer stärker schüttelten.
Olivera holte Mutterkraut, Kamille und Fenchel aus ihrem Korb, vermischte alles miteinander und gab es in einen Becher. »Bring mir Wein!«, trug sie der Magd auf und rührte die Arznei an, sobald die junge Frau mit dem Gewünschten zurückkehrte. Dann wartete sie, bis sich der Anfall etwas legte, und flößte dem Mädchen den Trank ein.
»Wird sie das gesund machen?«, fragte Groß.
»Es sollte ihre Krämpfe lösen«, erwiderte Olivera, die etwas Derartiges noch nie gesehen hatte. Sie betastete den Bauch des Mädchens, doch anders als erwartet war dieser weder hart noch aufgedunsen.
Eine Weile sah es so aus, als ob die Heilpflanzen Linderung bringen würden, aber schon bald fing das Mädchen aufs Neue an zu stöhnen.
»Herr?« Ein Bursche tauchte im Türrahmen auf. »Der Medicus.«
Martin Groß bedeutete ihm, den Arzt ins Zimmer zu führen, der so hager war, dass er fast ungesund aussah. Sein Gesicht war lang und schmal, die braunen Augen sanft. Er war jung, doch etwas in seinem Gesicht verriet, dass er schon zu viel Leid gesehen hatte. Er nickte Olivera zum Gruß zu und sah den Hausherrn mit hochgezogenen Brauen an. »Geht es ihr immer noch nicht besser?«
Groß verneinte. »Ihr Zustand verschlechtert sich stündlich. Eure Kur hat nichts bewirkt.«
Die Zuckungen fingen erneut an.
»Ich habe ihr einen Trank gegen die Krämpfe verabreicht«, erklärte Olivera, als Matthäus’ Blick auf ihren Korb fiel. »Mehr wollte ich nicht tun ohne deinen Rat.«
Der Medicus seufzte. »Ich fürchte, hier bin ich ratlos«, gestand er. »Solch ein Leiden ist mir noch nie begegnet.« Er rieb sich das Kinn. »Zwei weitere Kinder sind daran erkrankt.«
»Was?« Martin Groß sah ihn ungläubig an. »Wollt Ihr behaupten, es handle sich um eine Seuche?«
»So weit würde ich nicht gehen«, entgegnete der Medicus. »Allerdings scheint es, als ob sich die Krankheit in der Stadt ausbreiten würde.« Er ging zum Bett und nahm die Hand des Kindes, um den Aderschlag zu fühlen. »Ihr Herz rast.«
»Dann tut etwas dagegen!«
»Ich wünschte, das könnte ich«, seufzte Matthäus. »Aber ich fürchte, in diesem Fall seid Ihr mit einem Priester besser beraten als mit einem Arzt. Alles, was ich tun kann, ist, ihr das Leid erträglicher zu machen.« Er suchte Oliveras Blick. »Oder ist dir etwas Ähnliches bekannt?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Verabreicht ihr stündlich zehn Tropfen hiervon«, sagte er und holte eine Flasche aus seiner Tasche.
»Was ist das?«
»Ein Elixier aus Bilsenkraut. Falls sich ihr Zustand trotzdem weiter verschlechtert, schickt nach mir.«
»Ihr wollt schon gehen?«, fragte Groß empört. »Was ist mit der Salbenmacherin? Sie sagt, sie dürfe meiner Tochter keine Arznei ohne Eure Zustimmung verabreichen!«
»Ich vertraue auf Oliveras Kenntnisse«, entgegnete der Medicus. »Alles, was sie für richtig hält, hat meinen Segen.« Mit diesen Worten verschloss er seine Tasche wieder, nickte Groß zu und machte Anstalten, den Raum zu verlassen.
»Wartet!« Der Ratsherr fasste ihn beim Arm. »Was …? Wie soll ich wissen …?«
»Vertraut auf Gott«, riet Matthäus ihm. »Und betet für ihre Seele.«
»Was ist mit den anderen Kranken?«, fragte Olivera. »Sollten wir nicht den Rat und den Spitalpfleger davon in Kenntnis setzen, was vor sich geht?«
Matthäus nickte. »Das hatte ich gerade vor.«
»Was soll denn das bringen?«, erboste sich Martin Groß, sobald der Medicus gegangen war.
»Falls es sich um eine Seuche handelt, ist es wichtig, den Rat rechtzeitig zu informieren«, antwortete Olivera.
Groß brummte etwas Unverständliches, dann sagte er: »Seht Ihr? Ich hatte Euch gesagt, dass seine Behandlungen nutzlos sind. Alles, was ihm einfällt, sind Suppen und Aderlass!«
Olivera betrachtete das Mädchen, dessen Gesicht wächsern dalag. Nach kurzem Zögern griff sie eine kleine Flasche aus ihrem Korb und gab sie dem Vater. »Falls das Bilsenkraut nicht anschlägt, gebt ihr alle zwölf Stunden zwei Tropfen hiervon.« Sie hob warnend den Zeigefinger. »Nicht mehr. Ihr könntet sie sonst damit umbringen.«
Er betrachtete das Fläschchen mit gerunzelter Stirn.
»Es enthält Mohnsaft«, erklärte Olivera, griff nach ihrem Korb und atmete schwer. »Ich wünschte, ich könnte mehr für sie tun, aber solch ein Leiden ist auch mir noch nie begegnet.«
»Es ist das Feuer des Antonius«, sagte die Magd tonlos. Sie hatte sich wieder in die Ecke zurückgezogen und umklammerte das Kruzifix an ihrem Hals.
Olivera sah sie fragend an. »Das Feuer des Antonius? Wie kommst du darauf?« Bei dieser Krankheit handelte es sich um etwas, das Oliveras Yiayia in Konstantinopel mehrfach versucht hatte zu heilen. Allerdings färbten sich die Glieder der Befallenen bei dieser Krankheit schwarz wie Kohle, da sie von Fäulnis zerfressen wurden. Die meisten starben elendig, einige blieben einem noch elendigeren Leben erhalten, nachdem sie die verfaulten Hände und Füße verloren hatten. Die Krankheit war nach dem Feuer benannt worden, das in den Kranken loderte und viele von ihnen dazu brachte, sich ins Meer zu stürzen.
»Das Dorf, aus dem ich komme«, sagte die Magd. »Dort gab es so was vor ein paar Jahren. Alle haben es das Antoniusfeuer genannt.«
Olivera schüttelte den Kopf. »Du musst dich irren. Das Antoniusfeuer äußert sich anders.«
»Was ist dieses Antoniusfeuer?«, wollte Martin Groß wissen. »Wie könnt Ihr sicher sein, dass meine Tochter nicht daran leidet? Mit welchen Arzneien wird es behandelt?«
Olivera nahm die Hände und Füße des kranken Mädchens genauer in Augenschein. »Die Leute in deinem Dorf müssen an einer anderen Krankheit gelitten haben«, beschied sie schließlich. »Dennoch solltet Ihr nach mir schicken, falls sich ihre Extremitäten verfärben«, sagte sie an den Vater gewandt. Dann, nach einem letzten Blick auf das leise stöhnende Mädchen, verließ sie die Kammer und trat wenig später auf die Straße. Wenn sie doch nur wüsste, wie sie dem Kind helfen konnte! Trotz aller Ratlosigkeit beschloss sie, zurück in die Offizin zu gehen und in den gelehrten Büchern nachzuschlagen, die sie von ihrer Großmutter geerbt hatte.
Kapitel 4
Vor den Toren von Nürnberg, September 1412
Jona starrte entgeistert auf die Stelle hinab, an der Cristin wie festgenagelt stand. Sie war totenbleich und ihre Hand zitterte, als sie auf das zeigte, was sie zum Schreien gebracht hatte. Zu ihren Füßen ragte etwas aus der Erde, das selbst bei flüchtigem Hinsehen als ein Arm zu erkennen war – weiß, wachsartig und mit Stofffetzen bedeckt.
Jona brauchte nur wenige Augenblicke, um zu reagieren. Energisch schob er sie hinter sich und stupste den Arm mit der Schuhspitze an.
Nichts passierte.
»Ist das ein toter Mensch?«, fragte Cristin so leise, dass es kaum zu hören war.
Jona überlegte fieberhaft. Was hatte das zu bedeuten? Wer war der Tote? Und warum war er hier beim Fluss, außerhalb eines Gottesackers verscharrt worden? War er das Opfer von Wegelagerern? Oder handelte es sich gar um den Alten Endris, von dem niemand Genaueres zu wissen schien? Ein anderer, dunklerer Gedanke schlich sich in seinen Kopf, doch er zwang sich, ihn zu unterdrücken. »Das ist nur ein Tierkadaver«, log er, um Cristin zu beruhigen.
»Bist du sicher? Es sieht aus wie eine Hand.«
»Ich bin sicher.« Er drehte sich zu ihr um und sah ihr in die Augen, die immer noch vor Furcht geweitet waren. »Geh weiter Pappelrinde sammeln! Ich vergrabe das Tier wieder, damit die Ratten nichts zu fressen haben.« Zu seinem Verdruss zitterte seine Stimme leicht.
»Aber …«
»Nun mach schon!« Er fasste sie bei den Schultern und schob sie energisch in Richtung Flussufer. Bei dem, was er vorhatte, konnte er sie nicht gebrauchen.
»Soll ich nicht lieber …?«
»Geh!« Er bedachte sie mit einem Blick, der jeglichen weiteren Widerspruch im Keim erstickte.
Obwohl ihr anzusehen war, dass es ihr widerstrebte, ihm Folge zu leisten, ging sie zurück zum Ufer, wo sie ihren Sack hatte fallen lassen.
Jona wartete, bis sie so weit fortgegangen war, dass sie ihn nicht mehr beobachten konnte, dann kniete er sich hastig hin und fing an, die Erde mit den Händen zur Seite zu schaufeln. Je weiter er grub, desto mehr wurde von dem Leichnam sichtbar, und schließlich kam der Kopf zum Vorschein. Leere Augenhöhlen glotzten ihn an. Schaudernd betrachtete er den Toten, von dessen Kleidern genug übrig war, um zu erkennen, dass es sich nicht um einen Bauern handelte. »Wer bist du?«, murmelte er. Obwohl sich alles in ihm dagegen sträubte, den Leichnam zu berühren, zupfte er am halb zerfallenen Stoff des Ärmels, unter dem etwas hervorblitzte. Ein Siegelring. »Herr, vergib mir«, flüsterte er, bekreuzigte sich und biss die Zähne zusammen, um den aufsteigenden Ekel zu unterdrücken. Dann zog er an dem Ring, bis er ihn befreit hatte. Schaudernd hielt er ihn ins Licht, wischte den Schmutz ab und runzelte die Stirn. Das Wappen, das noch deutlich auszumachen war, kam ihm bekannt vor. Es war viergeteilt, bestand aus je zwei blau-gelben Feldern mit einem Löwen und zwei schwarz-weißen Feldern mit einem Vogel. Er war sicher, es im Rathaus gesehen zu haben, dort, wo die Wappen der Patrizierfamilien hingen.
Sein Unbehagen wuchs. Was sollte er tun? Der dunkle Verdacht verstärkte sich, weshalb er beschloss, den Leichnam wieder mit Erde zu bedecken und in Ruhe zu überlegen, was das Klügste war. Ehe er anfing, die Erde zurück auf das Grab zu schaufeln, fiel sein Blick auf die Kehle des Toten. Obwohl er schon eine Weile hier liegen musste, war zu deutlich, dass man sie durchgeschnitten hatte. Fröstelnd zog Jona die Schultern hoch. Er wollte den Leichnam gerade wieder verscharren, als er durch Zufall etwas entdeckte, das ihn zögern ließ. War das ein Schwertknauf, der in einiger Entfernung aus dem Boden ragte?
»Jona!«
Er zuckte zusammen.
»Was machst du denn so lange?« Cristin näherte sich vom Ufer und er beeilte sich aufzustehen und dem Grab den Rücken zu kehren. Auf keinen Fall durfte sie sehen, was er gefunden hatte. »Ich komme sofort!«, rief er.
»Wieso dauert das so lange? Ich kann nicht noch mehr Rinde sammeln!« Ihre Stimme klang vorwurfsvoll.
»Ich helfe dir gleich. Mach einfach weiter und geh Schafgarbe suchen!« Er bedeutete ihr mit einem Wink, wieder an die Arbeit zu gehen, und hoffte, dass sie ihn nicht mit Fragen löchern würde. Dann ging er zurück zu dem Grab und stieß mit dem Fuß gegen den vermeintlichen Schwertknauf.
Das Erdreich hob sich und brachte ein Stück Leder ans Tageslicht.
»Was zum Henker …?« Erneut kniete Jona sich auf den Boden und fing an, mit den Händen zu graben. Innerhalb kurzer Zeit hatte er ein Schwert, Stiefel und einen weiteren Leichnam von Erde befreit. »Gütiger Jesus!« Er grub weiter und stieß auf noch zwei Tote. Das Grab war flach und schien hastig ausgehoben worden zu sein. Wer auch immer die Männer hier begraben hatte, war davon ausgegangen, dass sie nie gefunden würden.
Jona spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Obwohl er fürchtete, was ein Teil von ihm längst wusste, zog er das Stück Stoff aus der Tasche, das er im Haus gefunden hatte. Im Sonnenlicht war eindeutig ein Muster zu erkennen, das seine Hand zum Zittern brachte. War das, was er zu wissen glaubte, überhaupt möglich? Die anderen Männer im Grab schienen ebenfalls gewaltsam zu Tode gekommen zu sein. Hatte Gott ihn zu dieser Stelle geführt? Oder war es das Werk des Teufels, der Zweifel in seiner Seele säen wollte? Er stöhnte. Ihm blieb keine Wahl. Hastig schaufelte er das Grab wieder zu, steckte den Ring ein und klopfte sich den Schmutz von der Hose. Niemand durfte jemals erfahren, was er gefunden hatte.
Mit wild durcheinanderwirbelnden Gedanken machte er sich auf zur Wiese hinter dem Haus, auf der er Cristin fand.
»Das hat aber lange gedauert!«, beschwerte sie sich. »War es wirklich ein Tier?«
Jona nickte. Er traute seiner Stimme nicht und fürchtete, sich mit seiner Aufgewühltheit zu verraten. Hastig wandte er sich von ihr ab, bückte sich und fing an, Blumen auszurupfen.
Kapitel 5
Die nächsten beiden Stunden verbrachten Jona und Cristin mehr oder weniger schweigend. Wo er konnte, wich er ihr aus. In seinem Kopf herrschte ein wildes Durcheinander, das er nicht zu ordnen vermochte. Vielleicht täuschte er sich. Solange er nicht wusste, wem der Siegelring gehörte, gab es immer noch die Möglichkeit, dass sein Verdacht nichts weiter war als ein Hirngespinst. Warum hatte er seiner Neugier nachgegeben? So oft, wie er deswegen schon in Schwierigkeiten geraten war, sollte er es inzwischen eigentlich besser wissen. Er fuhr sich mit dem Ärmel über das verschwitzte Gesicht und schnürte den letzten Sack zu. »Wir sind fertig«, sagte er.
»Endlich!« Cristin wirkte genauso erhitzt wie er. »Ich habe Durst.«
»Dann lass uns nach Hause gehen.« Jona schulterte zwei der Säcke und überließ Cristin den kleinsten. Dann machte er sich auf den Weg zu dem windschiefen Hoftor und trottete in Richtung Stadt.
»Was für ein Tier war es?«, fragte Cristin, als sie kaum eine halbe Meile hinter sich gebracht hatten.
»Tier?« Jona war so in Gedanken versunken, dass er die eigene Lüge vergessen hatte.
»Das ich gefunden habe!« Cristin sah ihn misstrauisch an. »Was ist los mit dir? Du bist schon die ganze Zeit so komisch.«
»Ich bin nicht komisch!«
»Doch!«
»Es war ein Pferd«, log Jona.
»Wer begräbt denn ein Pferd? Das schlachtet man doch.«
Jona zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.«
»Es sah gar nicht aus wie ein Pferd«, bohrte Cristin weiter.
»Himmelherrgott!«, brauste Jona auf. »Glaubst du, ich binde dir einen Bären auf?«
Sie sah mit vorgeschobener Unterlippe zu ihm hoch, während ihre Augen anfingen zu schwimmen.
Jona stöhnte innerlich. »Fang doch nicht gleich an zu heulen«, sagte er etwas netter. »Ich wollte dich nicht anblaffen. Tut mir leid.«
»Ehrlich?«
Er nickte. »Und jetzt komm. Olivera wartet sicher auf die Pflanzen.«
Etwas beschwichtigt folgte Cristin ihm zum Hallertürlein, das sie ohne Schwierigkeiten passierten. Von dort gingen sie am Flussufer entlang bis kurz vor das Heilig-Geist-Spital, wo sie sich nach Norden wandten, um über den Marktplatz zur Burgstraße zu gelangen. Als sie das Rathaus passierten, kam Jona ein Einfall. Er bedeutete Cristin, den Sack abzustellen, wurde seine Last ebenfalls los und suchte in der Tasche nach dem Siegelring.
»Was hast du vor?«, fragte sie, als er Anstalten machte, ihr den Rücken zu kehren.
»Ich bin gleich wieder da.« Bevor sie protestieren konnte, ließ er sie stehen und lief zu dem tagsüber offen stehenden Tor des Rathauses, das in die große Eingangshalle führte. Auch wenn er schlimme Erinnerungen mit dem Gebäude verband, vor allem mit dem darunter liegenden Lochgefängnis, betrat er die Halle und sah sich um. Es dauerte nicht lange, bis er fand, wonach er Ausschau gehalten hatte. An den Wänden bei der breiten Treppe, die ins Obergeschoss zu den Ratssälen führte, hingen die Wappen der Nürnberger Patrizierfamilien. Trotz des gedämpften Lichts entdeckte Jona den Schild, der dasselbe Motiv trug wie der Ring in seiner Tasche. Familie Paumgartner. Er hatte es befürchtet, nun war es Gewissheit.
Der Mann, der Oliveras Sohn entführt hatte, war nicht über alle Berge. Er lag auf dem Hof des Alten Endris mit drei weiteren Männern in einem flachen Grab. Und irgendjemand hatte ihm vor dem Verscharren die Kehle durchgeschnitten.
Als drei Wachen aus dem Obergeschoss auftauchten, machte Jona hastig kehrt und eilte zurück nach draußen.
Cristin sah ihn mit empört in die Hüften gestemmten Fäusten an. »Was war denn jetzt schon wieder los?«
»Nichts«, erwiderte er kurz angebunden, hob die Säcke auf und setzte den Weg zum Haus in der Burgstraße fort. Dort angekommen, zwang er sich zu einer ausdruckslosen Miene, ehe er den Verkaufsraum betrat und auf die Offizin zusteuerte. Er hatte keine Ahnung, wie er mit dem, was vorgefallen war, umgehen sollte. Er konnte Götz und Olivera nicht einfach zur Rede stellen und sie mit seinem Verdacht konfrontieren. War es überhaupt möglich, dass sie etwas mit dem Tod der Männer zu tun hatten? Oder waren die Kerle in andere Verbrechen verwickelt gewesen, die sie das Leben gekostet hatten? Er versuchte, nicht an den halb verbrannten Zettel und den Stofffetzen in seiner Tasche zu denken, die anderes vermuten ließen.
»Olivera ist nicht da«, stellte Cristin fest, als sie die Salbenküche betraten.
»Dann stell den Sack mit der Pappelrinde dorthin.« Jona zeigte auf eine Ecke, in der sich bereits Weidenkörbe und Tongefäße stapelten.
Cristin befolgte die Anweisung.
Da er nicht wusste, wie er sich sonst ablenken sollte, beschloss er, die Schafgarbe auf eines der großen Gestelle im Schuppen zu legen, die eigens zum Trocknen von Kräutern errichtet worden waren. Wenn er sich nicht mit irgendetwas beschäftigte, würde er sich nur weiter mit dem martern, was er entdeckt hatte. Mit Cristin auf den Fersen überquerte er den Hof, zog das schwere Tor auf und betrat den Schuppen. Das Gebäude war groß und trocken und roch nach Heilpflanzen und den Strohballen, die verhindern sollten, dass es zu feucht wurde. Tief in Gedanken versunken schnürte er einen der Säcke auf und holte ein Büschel Pflanzen hervor.
Cristin tat es ihm gleich.
Während er die Pflanzen sorgfältig auf dem Gestell verteilte, grübelte er weiter darüber nach, was er tun sollte. Vermutlich ist es das Beste, alles zu vergessen, riet ihm eine innere Stimme. Doch das war leichter gesagt als getan. Schlafende Hunde soll man nicht wecken, dachte er, allerdings ließ ihn die Ungeheuerlichkeit dessen, was er in dem Grab entdeckt hatte, nicht los. Vier tote Männer. Ohne Zweifel entweder im Kampf getötet oder ermordet. Machte er sich nicht mitschuldig, wenn er seine Entdeckung geheim hielt? Und was war mit Cristin? Hatte sie ihm die Lüge abgekauft? Oder ahnte sie, dass er geschwindelt hatte? Wenn sie ausplauderte, was passiert war, würden Olivera und Götz über kurz oder lang dahinterkommen, dass er auf die Leichen gestoßen war. Nachdem er den Sack geleert hatte, wandte er sich Cristin zu und fasste sie nachdenklich ins Auge.
»Was?«, fragte sie und errötete.
»Ich glaube, es wäre besser, wenn du niemandem sagst, wo wir die Pflanzen gepflückt haben«, sagte er.
Sie runzelte die Stirn. »Wieso nicht?«
»Weil wir uns eigentlich nicht so weit von der Stadt entfernen sollten.«
»Glaubst du, du bekommst Ärger?«
Jona nickte.
»Dann sage ich, wir waren beim Wöhrder Türlein.«
»Du brauchst meinetwegen nicht lügen, es reicht, wenn wir gar nicht erwähnen, wo wir waren.«
Cristin nickte.
»Versprich es!«
Sie spuckte in die Hand und hielt sie ihm hin. »Versprochen!«
Jona schlug ein.
Ehe er noch etwas sagen konnte, ertönte vom Hof her eine Stimme, die ihn aufhorchen ließ.
»Jona!«
Ein Prickeln kroch über seine Haut.
»Jona! Wo bist du?«
»Ist das Froni?« Cristins Miene verdunkelte sich.
Jona ließ ihre Hand los, wischte sie sich an der Hose ab und ging so gelassen wie möglich zum Tor. Froni, die neue Küchenmagd, stand im Hof und sah sich suchend um. Sie war ein Jahr jünger als er, zierlich, blond und hatte eine freche Stupsnase. Ihre Locken kräuselten sich unter der kleinen Haube hervor, die keck auf ihrem Hinterkopf saß.
»Da bist du ja«, rief sie, als sie ihn entdeckte. Sie schien außer Atem zu sein. Ihre Ärmel waren hochgekrempelt, das Gesicht rot vor Anstrengung. Vor ihr auf dem Boden stand ein Korb, halb voll mit Feuerholz.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte Jona.
Cristins missfälliges Hüsteln hörte er kaum.
Froni nickte. »Ich weiß nicht, wie ich so viel Holz schleppen soll«, sagte sie verzweifelt. »Aber Irmla wird schimpfen, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe.«
Jona spürte, wie sich sein Gesicht zu einem einfältigen Lächeln verzog. Ganz gleich, was er anstellte, in Fronis Gegenwart fiel das Gefühl der Überlegenheit, das er in Cristins Nähe verspürte, von ihm ab wie ein mottenzerfressenes Gewand. Mit mehr Kraft als nötig hob er den Korb vom Boden und fragte: »Wie viel brauchst du?« Vergessen war alles, was ihn noch vor wenigen Augenblicken beschäftigt hatte.
Kapitel 6
Die Schreie des Mädchens verfolgten Olivera den ganzen Weg von Martin Groß’ Haus bis zu ihrem eigenen Heim in der Burgstraße. Das arme Kind litt Höllenqualen und sie hatte nicht die geringste Ahnung, was ihm fehlte. Matthäus hatte gesagt, zwei weitere Kinder wären an demselben Leiden erkrankt, und auch er schien ratlos zu sein. Olivera dachte an die Worte der Magd. Das Antoniusfeuer war heimtückisch und tödlich, aber wenn sie sich nicht irrte, äußerte es sich auf eine vollkommen andere Art und Weise. Tief in Gedanken versunken, betrat sie den Hof ihres Hauses, der bis auf den Hofhund und ein paar freilaufende Hühner verlassen dalag. Mathes war vermutlich unterwegs, um von einem der Bauern Getreide für den Winter zu kaufen, der Rest des Gesindes befand sich im Haus. Jona und Cristin schienen bereits zurück zu sein, da sie den dunklen Schopf des Mädchens durch die offen stehende Tür des Schuppens sehen konnte.
Grübelnd überquerte sie den Hof, betrat das Haus und ging in die Offizin. Dort holte sie ein halbes Dutzend ledergebundene Bücher aus dem Regal und legte sie auf einen Tisch. Außer Kräuter- und Steinbüchern besaß sie Abschriften von Galens Methodi Medendi – den Methoden des Heilens –, Avicennas Canon Medicinae – dem Kanon der Medizin – und Trotulas Passionibus Mulierum – den Leiden der Frau. Diese, eine Mitgift ihrer Großmutter, stellten einen unvorstellbaren Schatz dar. Zudem befand sich eine Anzahl orientalischer Traktate in ihrer Sammlung, zusammen mit Schriften des Hippokrates und Heilkräuterbüchern mehrerer Mönche, die sie von einem fahrenden Händler gekauft hatte.
Da sie sämtliche Bücher mehrmals gelesen hatte, brauchte sie nicht lange, um zu finden, wonach sie suchte. In einem Folianten, der die Schriften des Hippokrates enthielt, stieß sie auf eine Beschreibung dessen, was er die »Heilige Krankheit« nannte. Diese äußerte sich in anfallartigen Krämpfen, Schreien und dem Niederstürzen der Kranken, wenn diese sich nicht im Bett befanden. Dem populären Glauben nach handelte es sich um ein göttliches oder dämonisches Eingreifen in die menschliche Natur, doch der gelehrte Arzt hatte eine andere Erklärung. Für Hippokrates ging diese Krankheit vom Gehirn aus, verursacht durch kalten Schleim, der das Blut erstarren ließ. Nicht ein Miasma, eine göttliche »Unreinheit«, war seiner Ansicht nach die Ursache für die Krämpfe, sondern das in den Adern stockende Blut. Folglich empfahl er als Heilmittel Schröpfen und Purgieren, falls nötig, auch die Öffnung des Schädels.
Hastig klappte sie das Buch zu und stellte es zurück ins Regal. Nach kurzem Überlegen beschloss sie, ins Spital zu gehen, um mit Matthäus über das zu reden, was sie gelesen hatte. Er wusste, dass sie die Schriften der gelehrten Ärzte kannte, und hatte bisher stets ihren Rat gesucht. Anders als sein Vorgänger war er vor allem anderen auf das Wohl der Kranken bedacht. Persönliche Eitelkeiten waren ihm fremd.
Sie verließ die Offizin und ging zurück in den Hof, wo Mathes vom Bock des Einspänners sprang, dessen Ladefläche mit Säcken vollgepackt war. Der vergangene Sommer war regnerisch und kühl gewesen, die Ernte nicht so gut wie erwartet. Deshalb hatte Olivera darauf bestanden, mehr Vorräte als gewöhnlich anzulegen, damit sie den Winter über genügend Mehl in der Speisekammer hatten. Sie winkte ihm zum Gruß zu, ehe sie zum Tor lief und zurück auf die Straße trat.
Die Burg im Rücken, eilte sie den Hügel hinab zum Rathaus, vor dem an diesem Tag ein großer Viehmarkt stattfand. Das Blöken von Schafen vermischte sich mit dem Brüllen der Ochsen und dem Meckern der Ziegen, die sich um den Schönen Brunnen drängten. Zahlreiche Käufer sammelten sich zwischen den Verschlägen der Händler, die zum Teil von weit her angereist waren. Auf einem Teil des Marktplatzes, der mit einer roten Kordel abgetrennt worden war, warfen feurige Vollblüter wiehernd die Köpfe. Dort tummelten sich die reichen Nürnberger, die Fern- und Gewürzhändler, für die es eine Frage des Ansehens war, ein Pferd von solch edlem Blut zu besitzen.
Ohne auf das Getümmel zu achten, setzte Olivera ihren Weg fort, bis das Heilig-Geist-Spital vor ihr auftauchte. Auf den spitzen Dächern hockten Zugvögel, die schimpfend das Weite suchten, als sich ein Flügel des großen Tores mit einem lauten Schlag hinter einem Fuhrwerk schloss. Obwohl der übliche Andrang von Mägden, Knechten, Werkleuten und Bedürftigen herrschte, gelangte Olivera rasch in den Hanselhof, in dem es auch an diesem Tag geschäftig zuging. Sie fröstelte, als sie in die Schatten des riesigen Gebäudekomplexes eintauchte, hinter dem die Pegnitz rauschte. Zu ihrer Linken ragte die Spitalkirche in den Himmel, deren Glocke in diesem Moment die halbe Stunde schlug. Eine Gruppe von Insassen des Spitals war mit Holzhacken beschäftigt, andere kehrten oder holten Wasser aus dem Ziehbrunnen. Einige der stärkeren Männer halfen beim Entladen des Fuhrwerks, das unter einer alten Linde zum Stehen gekommen war. Die Kranken und Schwachen waren in der Siechenstube untergebracht, in der Tag und Nacht die Kusterin und mehrere Mägde über ihr Wohlergehen wachten. In den beiden größten Gebäuden des Spitals, die parallel angeordnet waren, befanden sich die Stuben. Daran grenzten je eine Küche für die Patienten der unteren und oberen Stuben an, ein Waschraum, eine Badestube für die Männer und eine für die Frauen und das heimliche Gemach für die Insassen. Außerdem waren hier die Einrichtungen für die armen Pfründner, das Narrenhäuslein und die Unterkunft für die Findlinge und Waisen untergebracht.