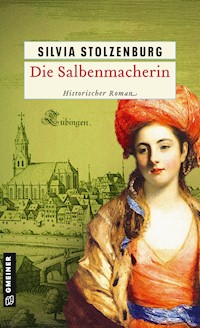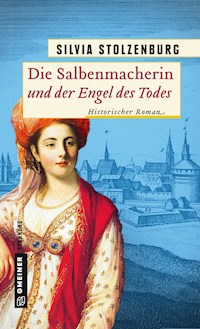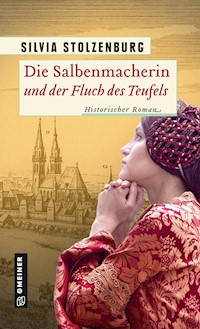Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Salbenmacherin
- Sprache: Deutsch
Brütende Sommerhitze liegt über der Stadt. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet, und die Menschen der Handelsmetropole werden zusehends dünnhäutiger und gereizter. Während immer mehr Nürnberger an einem rätselhaften Fieber erkranken, wird ein grauenhaft zugerichteter Leichnam am Ufer der Pegnitz an Land gespült. Dem Toten fehlen nicht nur der Kopf und die Hände – er scheint fachmännisch ausgeweidet worden zu sein. Die Nürnberger sind entsetzt. Als zwei Nächte später angeblich ein Werwolf in den Wäldern rings um die Stadt gesichtet wird, greift Panik um sich. Gehen Dämonen um?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Die Salbenmacherin und die Hure
Historischer Roman
Zum Buch
Mord in Nürnberg Brütende Sommerhitze liegt über der Stadt. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet, und die Menschen der Handelsmetropole werden zusehends dünnhäutiger und gereizter. Während immer mehr Nürnberger an einem rätselhaften Fieber erkranken, wird ein grauenhaft zugerichteter Leichnam am Ufer der Pegnitz an Land gespült. Dem Toten fehlen nicht nur der Kopf und die Hände – er scheint fachmännisch ausgeweidet worden zu sein. Die Nürnberger sind entsetzt. Als zwei Nächte später angeblich ein Werwolf in den Wäldern rings um die Stadt gesichtet wird, greift Panik um sich. Gehen Dämonen um? Einzig die Salbenmacherin Olivera und der Henker Jacob scheinen nicht daran zu glauben, dass übernatürliche Mächte ihre Hände im Spiel haben. Kurze Zeit später taucht jedoch ein zweiter Leichnam auf, und es beginnt eine Hexenjagd nach dem angeblichen Schuldigen. Als ein junges Mädchen aus dem Freudenhaus mit einer unfassbaren Behauptung zu Olivera kommt, gerät die Salbenmacherin selbst in höchste Gefahr …
Dr. phil. Silvia Stolzenburg studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen. Im Jahr 2006 promovierte sie dort über zeitgenössische Bestseller. Kurz darauf machte sie sich an die Arbeit an ihrem ersten Roman. Sie arbeitet als Vollzeitautorin und lebt mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb, fährt leidenschaftlich Rennrad und recherchiert vor Ort bei der Bundeswehr, dem SEK und der Gerichtsmedizin – immer in der Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Blutfährte (2017)
Die Salbenmacherin und der Bettelknabe (2016)
Die Salbenmacherin (2015)
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mrs._Richard_Paul_Jodrell_by_Sir_Joshua_Reynolds.jpeg;https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuernberg-1650-Merian.jpg;https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppina_Grassini_by_Louise_Élisabeth_Vigée_Le_Brun_2.jpg
ISBN 978-3-8392-5552-0
Prolog
Nürnberg, Juli 1409
Der Tote war kaum mehr als Mensch zu erkennen. Das, was das Wasser der Pegnitz an Land gespült hatte, glich auf den ersten Blick einem aufgedunsenen Tierbalg. Erst bei genauerem Hinsehen war zu erkennen, dass es sich um den kopflosen Leichnam eines Mannes handelte. Die sengende Sommerhitze und der Gestank hatten die Fliegen angelockt, die in schillerndem Gewimmel über den schaurigen Fund krochen.
Obwohl an diesem Tag eine schwache Brise durch die Gassen der Stadt strich, hatte Jona den Tod schon von Weitem gerochen. Es war dieser typische süßliche Geruch, der sich in den Nasenlöchern einzunisten schien und der noch Stunden später nicht zu vertreiben war. Wie die anderen Schaulustigen war auch er von der Alarmglocke herbeigelockt worden. Vergessen waren der Botengang für Olivera, die Arzneien in seiner Tasche und der Auftrag, bei der reichen Witwe Schachinger nach deren Wünschen zu fragen. Wenn die ganze Stadt in Aufregung war, konnte er doch unmöglich verpassen, was vor sich ging. Neugierig zwängte er sich zwischen den tuschelnden Männern und Frauen hindurch, bis er so dicht am Flussufer war, dass er um ein Haar den Halt verloren hätte.
»Bleibt zurück!«, warnte ein Stadtwächter die Gaffer.
»Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen«, setzte ein zweiter hinzu.
»Das könnt ihr uns nicht weismachen«, ertönte eine tiefe Stimme aus der Menge. »Wenn es hier nichts zu sehen gibt, fresse ich einen Besen.«
Damit erntete er zustimmendes Gemurmel.
»Wo ist sein Kopf?«, wollte eine Frau mit einem Kind auf dem Arm wissen.
»Seht doch! Er hat auch keine Hände!«
»Ich habe gesagt, ihr sollt zurückbleiben!«, donnerte der Wächter. Er senkte drohend seinen Spieß, als die Schaulustigen immer näher rückten.
Jona reckte sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Das Gefuchtel der Stadtwachen hatte die Fliegen aufgescheucht, weshalb sie inzwischen in wildem Tanz um den Leichnam herumsurrten. Obwohl er die Augen zusammenkniff, konnte Jona nicht mehr erkennen als einen Haufen nasser Kleider. Dort, wo der Kopf des Toten hätte sein müssen, tanzte ein Fetzen Stoff auf dem Wasser. Hätten sich die Beine des Mannes nicht in den Wurzeln einer Trauerweide verfangen, wäre er vermutlich woanders an Land gespült worden. Seine Kleidung war trotz des Wassers immer noch blutgetränkt.
Die Stadtknechte schienen merklich aufzuatmen, als wenig später weitere Männer zur Verstärkung eintrafen. Ihr Anführer war an seinem prachtvollen Harnisch und einer roten Feder am Helm zu erkennen. Augenblicklich übernahm er das Kommando und wies die Bewaffneten an, die Versammlung am Ufer aufzulösen. »Wer sich unseren Anweisungen widersetzt, wird festgenommen!«, drohte er, als die Nürnberger lautstark protestierten.
»Wir haben ein Recht, zu erfahren, was vor sich geht!«
»Wer ist es denn?«
»Ist er ermordet worden?«
»Was ist denn das für eine dämliche Frage? Denkst du, er hat sich den Kopf selber abgeschnitten?«
»Seht euch nur seine Kleidung an. Nichts als Lumpen.«
Jona zog sich ein paar Schritte zurück und machte sich hinter einem Haselstrauch so klein wie möglich. Wenn er Glück hatte, übersahen ihn die Wachen. Sorgsam darauf bedacht, die Tasche mit den Arzneien nicht aus Versehen in den Fluss fallen zu lassen, hangelte er sich an einem fingerdicken Ast etwas näher ans Ufer und lugte durch die Blätter. Während die Hitze dafür sorgte, dass der Schweiß sein dünnes Sommerhemd immer mehr tränkte, verfolgte er mit seinem Blick die Männer, die sich über den Leichnam beugten, um ihn weiter an Land zu ziehen.
Was er zu sehen bekam, ließ ihn schaudern. Sobald der Tote ausgestreckt auf dem von zahllosen Stiefeln festgestampften Boden lag, wurde das Ausmaß seiner Verletzungen deutlich. Nicht nur sein Kopf und seine Hände fehlten.
»Man hat ihn ausgeweidet wie ein Stück Schlachtvieh«, stellte einer der Bewaffneten fest.
Kapitel 1
Nürnberg, Juli 1409
Olivera summte eine heitere Melodie, während sie Veilchen in einem Topf kochte, um Trifera saracenica herzustellen. Seit sie vor einigen Wochen begonnen hatte, die reichen Pfründner im Nürnberger Heilig-Geist-Spital zu versorgen, fand dieses Mittel gegen Gelbsucht und Leberprobleme reißenden Absatz. Vor allem die Greise, die nicht von Wein, Bier und fetten Gänsepasteten lassen wollten, sorgten dafür, dass der Kessel, in dem sie die Veilchenblüten mit Zimtkassienrinde, Mannakameldorn und Tamarinde vermengte, selten vom Feuer kam.
»Ist dir denn gar nicht heiß?«, stöhnte Götz.
Olivera lachte. »Nein.« Sie zerstieß Anis, Fenchel, Mastix und Muskatblüten in einem Mörser. »Endlich ist der Sommer da, den du mir seit Monaten versprochen hast.«
Götz schüttelte den Kopf. Er wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und blies die Wangen auf. »Hier drin ist es wie in einem Backofen«, beklagte er sich.
»Geh in den Verkaufsraum«, sagte Olivera lachend. »Ich komme hier sehr gut ohne dich zurecht.«
»Bei der Hitze verstecken sich die Naschsüchtigen in ihren Kellern«, scherzte Götz. »Da stehe ich mir nur die Beine in den Bauch.«
Tatsächlich hatte sich mit dem Umzug in das neue Haus am Burgberg Oliveras Kundschaft zum Teil gewandelt. Neben den Salben und Tränken für jüngere Haut, strahlendere Augen und glänzenderes Haar wurde vor allem nach dem süßen Konfekt verlangt, das Götz inzwischen selbst herstellte.
»Außerdem höre ich, wenn jemand kommt«, sagte er. »Die Arzneien für den Medicus hat sein Laufbursche schon heute Morgen abgeholt. Die neuen Mittel, die er bestellt hat, müssen nicht vor übermorgen fertig sein. Auch nicht die fürs Spital.«
Olivera legte den Stößel zur Seite und sah ihn an. Er wirkte erhitzt und müde. Seit mehr als zehn Tagen hatte es nicht geregnet, und die Hitze lag wie eine Glocke über der Stadt. Nachts fiel es vielen Nürnbergern schwer zu schlafen, und auch Götz wurde zusehends dünnhäutiger. Sie wollte ihm gerade empfehlen, die Salzvorräte im Keller zu überprüfen, als das schrille Läuten einer Alarmglocke an ihr Ohr drang.
»Was ist denn jetzt schon wieder los?«, fragte Götz. Erst vor zwei Tagen hatte die Glocke die ganze Stadt in Aufregung versetzt.
»Sieh nach«, schlug Olivera vor. »Draußen ist es sicher kühler als hier.« Als er nicht sofort tat wie geheißen, machte sie eine Handbewegung, wie um eine lästige Fliege zu verscheuchen. »Nun geh schon!«
Er warf einen Blick auf ihren runden Bauch und zog die Oberlippe zwischen die Zähne.
»Es ist noch lange nicht so weit«, beruhigte ihn Olivera, da sie seine Gedanken erraten konnte. »Und ich bin nicht aus Glas. Ich bekomme ein Kind, das ist alles.« Auch wenn sie immer noch entsetzliche Angst vor der Entbindung hatte, verlief ihre Schwangerschaft bisher ohne Probleme. Selbst nach den Misshandlungen durch ihren ehemaligen Gemahl Laurenz war dem Kind in ihrem Leib nichts zugestoßen. Manchmal machte es sich durch leichte Tritte bemerkbar, sonst beeinträchtigte ihr Zustand Olivera kaum. Lediglich der verstärkte Harndrang machte ihr an manchen Tagen zu schaffen.
»Bist du sicher?«
Olivera nickte. Das Läuten der Glocke beunruhigte sie und sie hoffte inständig, dass nicht wieder irgendwo in der Stadt ein Feuer ausgebrochen war. Mit einem Schaudern erinnerte sie sich an den Brand ihres alten Hauses; an die Nacht, in der Laurenz nicht nur ihr Heim zerstört, sondern sie entführt hatte, um sie als sein Eigentum zu beanspruchen und das Kind aus ihrem Bauch zu prügeln. Obwohl sie immer wieder versuchte, das Gefühl zu unterdrücken, war sie gottfroh, dass Laurenz tot und begraben war. Zu ihrer Erleichterung verblasste die Erinnerung an ihn immer weiter, je mehr Zeit verstrich. Nur noch selten träumte sie von ihrer ersten Begegnung in Konstantinopel, von dem unbeschreiblichen Gefühl, das seine Nähe bei ihrem Besuch des Bazars in ihr ausgelöst hatte. Die Wärme des Sommers hatte ihr Heimweh ein wenig gemildert, weshalb ihr der Duft von Zypressen nicht mehr ganz so schmerzlich fehlte. Als der Gedanke an ihre Heimat unweigerlich zu ihrer Yiayia, ihrer Großmutter, führte, wischte sie ihn mit einem Blinzeln beiseite. Es würde gewiss noch eine ganze Weile dauern, ehe sie eine Antwort auf ihren Brief erhielt. Bis dahin musste sie sich in Geduld üben.
Nachdem Götz sich mit einem letzten Blick versichert hatte, dass es ihr gut ging, brummte er etwas Unverständliches und verließ die Salbenküche. Kurz darauf hörte Olivera die Eingangstür zuschlagen. Wie um sein Fortgehen zu kommentieren, stieß die Elster, die in einem Käfig von der Decke des Verkaufsraumes hing, ein Krächzen aus.
Olivera schmunzelte. Zwar war der Vogel nicht so farbenfroh und intelligent wie Markos – der Papagei, der beim Brand ihres alten Hauses umgekommen war. Dennoch bereitete ihr dieses Geschenk von Götz große Freude. Obwohl sie Markos’ Tod tief betrübt hatte, war damit eines der letzten Bänder durchtrennt worden, das sie an Laurenz gefesselt hatte.
Sie seufzte, vermengte die Zutaten der Trifera saracenica und stellte die Arznei beiseite. Dann trat sie an das Regal, in dem sie die ledergebundenen Bücher, die Mitgift ihrer Yiayia, aufbewahrte. Diese, eine Abschrift von Galens »Methodi Medendi« – Die Methoden des Heilens –, Avicennas »Canon Medicinae« – Der Kanon der Medizin – und Trotulas »De Passionibus Mulierum« – Über die Leiden der Frauen – stellten einen Schatz von unvorstellbarem Wert für sie dar. Außer diesen drei Folianten hatte ihre Großmutter ihr zwei Kräuterbücher mitgegeben, in denen sie all ihr Wissen über Pflanzen mit heilender Wirkung gesammelt hatte. »Damit du in der Fremde nicht alles vergisst«, hatte sie Olivera mit Tränen in den Augen gesagt.
Wenngleich Olivera wusste, dass sie sich damit nur verrückt machte, zog sie zum wiederholten Mal Trotulas Abhandlung über die Leiden der Frauen hervor. Das Werk beschrieb nicht nur typisch weibliche Krankheiten, sondern enthielt auch Rezepte für Schönheitsmittel und Tinkturen zur besseren Empfängnis. Zudem fanden sich dort Arzneien zur Stimulierung der Monatsblutung, zur Verhütung, zum Wiederherstellen der Jungfräulichkeit sowie Beschreibungen von Hautkrankheiten. Während eine Hand auf ihrem Bauch ruhte, blätterte sie bis zu einer bestimmten Stelle.
Die gefährlichen Dinge, welche Frauen während der Niederkunft zustoßen können, lautete die Überschrift.
Es gibt einige Frauen, bei denen Schwierigkeiten bei der Geburt auftreten. Dies ist dem Versagen der Geburtshelfer zuzuschreiben, die dieses Versagen vor den werdenden Müttern verbergen. Bei einigen Frauen kann es geschehen, dass der Anus und die Vagina zu einer Öffnung werden. Bei diesen Frauen tritt die Gebärmutter hervor und verhärtet sich. Wir helfen solchen Frauen, indem wir die Gebärmutter wieder an ihren Platz bringen. Dafür umwickeln wir den Unterleib der Frau mit Tüchern, getränkt mit warmem Wein, in dem Butter zerlassen worden ist, bis die Gebärmutter weich wird und wir sie dorthin zurückschieben können, wo sie hingehört. Danach nähen wir den Riss im Damm an drei oder vier Stellen mit einem Seidenfaden. Dann bestreichen wir ein Leinentuch mit flüssigem Pech und führen es in die Vagina der Frau ein. Dadurch zieht sich die Gebärmutter vor dem Gestank zurück …
Olivera schüttelte den Kopf. Je öfter sie diese Anleitung las, desto mulmiger wurde ihr. Würde ihre Niederkunft problemlos verlaufen? Oder drohte ihr das, was sie selbst schon viel zu oft gesehen hatte? Obwohl sie Götz von Herzen liebte, wünschte sie sich insgeheim manchmal, sie hätte die Mittel zur Verhütung weiter eingenommen.
»Es wird bestimmt ein prachtvoller Junge«, ermunterte er sie immer wieder, wenn er ihre Niedergeschlagenheit spürte. Er wusste nicht, was sie quälte. Und sie würde ihn auch nicht damit belasten. Geburten waren die Angelegenheit von Frauen. Männer, selbst solche wie Götz, hatten dabei nichts zu suchen. Bevor ihr Blick zu dem Kapitel über die Befreiung eines toten Fötus aus dem Mutterleib wandern konnte, schlug sie das Buch wieder zu und stellte es zurück an seinen Platz. Es hatte keinen Zweck, sich immer und immer wieder auszumalen, was alles passieren konnte. Wenn sie so weitermachte, würde sie vermutlich vor lauter Furcht unfähig sein, das Kind aus ihrem Leib zu pressen. Gott hatte keinen Grund mehr, Götz und sie zu bestrafen. Schließlich war er inzwischen ihr angetrauter Ehemann und der Segen eines Priesters schützte ihre Verbindung.
»Es wird alles gut gehen«, murmelte sie.
»Was wird gut gehen?«
Sie zuckte zusammen und wirbelte herum. Von der Schwelle der Offizin – der Arzneiküche – blickte ihr Cristin, Götz’ sechsjährige Tochter, mit fragenden Augen entgegen. Die dunklen Locken standen wie immer wild von ihrem Kopf ab. Sie wippte auf den Fußballen auf und ab. Ihr kurzärmeliges Hemdkleid wies an einigen Stellen Flecken auf. Vermutlich hatte sie versucht, der Köchin zu helfen, bis diese die Geduld verloren hatte. Von Jonata, der Kindermagd, war weit und breit nichts zu sehen. Vermutlich kümmerte sie sich um Uli, Cristins dreijährigen Bruder. Beide Kinder stammten aus Götz’ erster Ehe mit der Mutter der Kinder, die vor eineinhalb Jahren an einem Fieber gestorben war.
»Möchtest du lernen, eine Tinktur für glänzendes Haar herzustellen?«, fragte Olivera statt einer Antwort.
Cristin nickte eifrig.
»Dann komm«, forderte Olivera sie auf. Die Gegenwart des quirligen Mädchens würde sie hoffentlich von den düsteren Gedanken ablenken.
Kapitel 2
Nürnberg, Juli 1409
Das Schrillen der Glocke hallte immer noch durch die Gassen, vermischte sich mit den Rufen der Wächter und dem Rauschen des Wassers zu Jonas Füßen. Während die Stadtwachen den Toten auf einen Karren luden, verharrte er mucksmäuschenstill zwischen den Zweigen des Haselstrauches und verfolgte das Geschehen. Ohne lange zu fackeln, hatten die Männer die Eingeweide des Ermordeten zurück in seinen Bauch gestopft und ihn wie einen Tierkadaver auf die Ladefläche geworfen. Der Anblick der verstümmelten Leiche machte Jona die Knie weich, allerdings hatte er schon weitaus Schlimmeres gesehen. Jedenfalls versuchte er sich das einzureden. Der Gestank des Todes hing schwer in der Luft, und Jona war dankbar, dass der Wind gedreht hatte.
Die anderen Gaffer waren inzwischen so weit zurückgedrängt worden, dass die Männer ungehindert in Richtung Marktplatz abziehen konnten. Sobald er sicher war, dass ihn niemand bemerkte, kroch Jona aus seinem Versteck. Da er ahnte, wo die Wachen den Toten hinbringen würden, schlich er am Ufer entlang zur Fleischbrücke und machte sich von dort aus ebenfalls auf den Weg zum Grünen Markt. Während er sich in den Nebengassen einen Weg durch freilaufende Schweine, streunende Hunde und abgestellte Karren bahnte, fragte er sich, wer den Toten wohl so zugerichtet hatte. Seit einiger Zeit munkelte man, dass in Nürnberg Dämonen umgingen. Manch einer behauptete sogar, einen Werwolf gesehen zu haben. Da er aus heiterem Himmel das Gefühl hatte, verfolgt zu werden, drehte er sich mit wild klopfendem Herzen um. Doch außer einem besonders hässlichen Köter, der vor Schwäche kaum stehen konnte, war ihm nichts und niemand auf den Fersen. Plötzlich kam ihm die verwinkelte Gasse mit den Katen, deren gegenüberliegende Dachgiebel sich fast berührten, furchtbar dunkel vor. Nur wenig Licht erreichte den Lehmboden. Der auffrischende Wind erschien ihm mit einem Mal kühl, weshalb er fröstelnd die Schultern hochzog. Als er den Blick an den Hauswänden emporwandern ließ, hatte er den Eindruck, hinter den Fensterläden würden ihn Hunderte von Augen beobachten. Als könne sie ihm Halt geben, umfasste er die Tasche mit den Arzneien fester und beschleunigte die Schritte. Sei kein Narr!, schalt er sich. Immerhin war es helllichter Tag. Wusste nicht jedes Kind, dass Werwölfe und Dämonen nur im Dunkeln ihr Unwesen trieben?
Er erinnerte sich an die Schauermärchen, die einer der Priester im Elisabethenspital in Bamberg erzählt hatte – vermutlich, um die Waisenknaben davon abzuhalten, nachts das Weite zu suchen. »Wenn ein Dämon von einem Menschen Besitz ergreift, kann der sich in einen Wolf verwandeln.« Der Pfaffe hatte eine bedeutungsvolle Pause gemacht. »In einen Werwolf. Sobald die Dunkelheit hereinbricht, streifen diese teuflischen Kreaturen durch die Lande, morden Kinder und Erwachsene und fressen ihr Hirn.« Angeblich erkannte man einen Werwolf in seiner menschlichen Gestalt an seinen zusammengewachsenen Augenbrauen und daran, dass er das Tageslicht scheute. Aber Jona war nicht sicher, ob der Priester ihnen nur einen Teil der Wahrheit erzählt hatte. Auf dem Weg nach Nürnberg hatte er immer wieder von Wesen gehört, die wie rasend um sich schlugen und bissen, brüllende Laute von sich gaben und deren Zähne vor Geifer troffen.
Er bekreuzigte sich, während er immer schneller auf den Ausgang der Gasse zulief. Als er wenig später den sonnenbeschienenen Marktplatz erreichte, atmete er erleichtert auf.
Wie erwartet, holperte der Karren mit dem Toten auf die Wachstube beim Rathaus zu, gefolgt von einem wahren Rattenschwanz an Schaulustigen. Die Bemühungen der Stadtknechte schienen vergeblich gewesen zu sein, da die Ansammlung noch größer geworden war. Ehe Jona es sich versah, war er umringt von Nürnbergern, die ihn wie eine Welle erfassten und über den Grünen Markt auf das Rathaus zuschoben. Was um ihn herum getuschelt wurde, überraschte ihn nicht. Wenn er den Verdacht hegte, dass es nicht mit rechten Dingen zuging, waren andere sicher auch zu dem Schluss gekommen.
»Jetzt wird der Rat nicht anders können, als die Sache ernst zu nehmen«, hörte er einen Zimmermann sagen. »Von wegen, das sei nichts als Aberglaube! Da sieht man, wozu der Aberglaube fähig ist. Wenn nichts unternommen wird, ist man bald nicht mehr sicher in der Stadt!«
Er erntete ein zustimmendes Raunen.
»Wer weiß, vielleicht hat der Fluss den Toten von außerhalb angespült«, wandte eine Frau mit einer blütenweißen Haube ein. »Er könnte das Opfer von wilden Tieren gewesen sein. Im Wald.«
»Ach was!«, widersprach der Zimmermann. »Meinst du nicht, dass ein Toter im Fluss den Soldaten an den Stadttoren aufgefallen wäre? Die sind doch nicht blind!«
»Aber faul!«, warf jemand ein, den Jona nicht sehen konnte. »Wenn die würfeln, könnten die Sarazenen einfallen, ohne dass sie es bemerken würden.«
Einige lachten. Andere schüttelten die Köpfe.
»Es ist eine Schande.«
»Die Sache erinnert mich an den kopflosen Knaben«, brummte ein hagerer Müller, dessen Kittel voller Mehl war.
Jona machte sich instinktiv kleiner. Die Worte brachten die Schrecken des Hauses beim Weißen Turm zurück. Wie nahe er und Casper einem ähnlichen Tod gewesen waren wie der unglückliche Knabe, den man ohne Kopf im Wald vor der Stadt gefunden hatte! Wäre er nicht durch Zufall bei der Flucht in Oliveras Hinterhof gestolpert, wären weder er noch sein Freund Casper noch am Leben. Er spürte, wie sich eine Gänsehaut auf seinen Unterarmen ausbreitete.
»Nur dass dieses Mal ganz sicher nicht der Losunger dahintersteckt«, riss ihn die Stimme des Zimmermanns aus seinen Gedanken.
»Woher willst du das wissen?«, fragte jemand aus der Menge. »Vielleicht hat ein Dämon seine sündige Seele gestohlen, geht jetzt um und nimmt Rache an der Stadt.«
»Rede doch nicht solch gotteslästerliches Zeug!«, empörte sich die Frau mit der weißen Haube. Sie schlug ein Kreuz vor der Brust und murmelte ein Gebet. »Vielleicht ist die arme Seele im Fluss nur einem Unfall zum Opfer gefallen.«
»Das werden wir gewiss bald erfahren«, sagte der Müller.
Jona hoffte, dass er recht hatte. Allmählich wurde ihm die Angelegenheit nicht nur unheimlich. Das Geschwätz von den Dämonen, die Erinnerung an die Geschichten des Bamberger Pfaffen – all das ließ ihn sich wünschen, er besäße ein Amulett, das ihn vor bösen Mächten schützen könnte.
»Da kommt der Nachrichter!«, hörte er jemanden weiter vorn rufen.
»Ob die Wachen ihn gerufen haben?«
»Was denkst du denn? Er soll sich bestimmt den Leichnam ansehen.«
Das Durcheinander der Stimmen wurde immer lauter, und nach einer Weile hätte Jona sich am liebsten die Hände auf die Ohren gepresst. Er wollte all das Gemunkel nicht hören. Da er von seinem Standpunkt aus ohnehin nicht viel sehen konnte, zwängte er sich zwischen den Schaulustigen hindurch, bis er den Schönen Brunnen erreichte. Dort wollte er gerade einen Umweg über die Waaggasse machen, als er mit Götz zusammenstieß, der atemlos aus Richtung Burgberg dahergelaufen kam.
»Jona!«, rief er. »Was ist passiert? Was tust du hier?«
Jona zog schuldbewusst die Schultern hoch. »Ich …«, stammelte er.
Götz ließ den Blick über die Menge wandern und winkte ab. »Schon gut. Sag mir einfach, was passiert ist.«
Jona berichtete ihm von dem grausigen Fund.
»Ohne Kopf und Hände?«, fragte Götz fassungslos. »Und ausgeweidet?«
Jona nickte. »Sie haben nach dem Henker geschickt«, erklärte er.
»Der soll sicher feststellen, was dem armen Tropf widerfahren ist«, stellte Götz fest. Er überlegte einen Augenblick. »Geh nach Hause und sag Olivera, dass ich in der Wachstube bin. Und erzähl ihr, was vorgefallen ist.«
»Aber ich …«, protestierte Jona.
»Tu, was ich dir sage!« Götz sah ihn streng an.
Jona senkte den Kopf. Auf keinen Fall wollte er Götz’ Zorn auf sich ziehen und riskieren, dass er ihn aus dem Haus warf. Ohne die Anstellung als Apothekerjunge würde er wieder als Bettler auf der Straße landen. Und noch mal hatte Gott gewiss kein Einsehen mit ihm. Daher gehorchte er wortlos und machte sich auf den Weg zu dem Haus in der Burgstraße.
Kapitel 3
Nürnberg, Juli 1409
Götz sah Jona nach, bis er hinter einer Hausecke verschwunden war, ehe er die Schultern straffte und sich einen Weg durch die Gaffer bahnte.
»He! Was soll das?«, beschwerte sich ein gut gekleideter Mann, den er zur Seite schob.
»Glaubst wohl, du bist was Besseres?«, zischte eine Frau, die Götz aufgrund ihrer Aufmachung für ein gemeines Weib hielt.
»Wir wollen alle wissen, was los ist«, brummte ein Knecht. Zusammen mit seinem Begleiter versuchte er, sich Götz in den Weg zu stellen.
»Macht Platz. Ich bin der Stadtapothecarius«, sagte Götz ungerührt. »Oder soll ich die Wache rufen?«
Diese Drohung sorgte dafür, dass die beiden Männer ihn nach einem kurzen Austausch von Blicken widerwillig passieren ließen. »Denkst du, der Kerl braucht eine Arznei, um gut in der Hölle anzukommen?«, schickte ihm einer der beiden hinterher.
Der andere lachte höhnisch.
Götz ignorierte die Männer und schob sich weiter durch die Menge, bis er endlich bei der Wachstube ankam.
»Kommt rein, bevor Euch die Neugierigen zerfleischen«, begrüßte ihn der Hauptmann der Wache mit einem freudlosen Lächeln.
Götz betrat dankbar die Stube, in der sich bereits der Nachrichter und sein Gehilfe, der Löwe, über den Toten auf dem Karren beugten.
Der Henker nickte ihm zum Gruß zu. Seit Olivera ihn im Heilig-Geist-Spital, wo er als Wundarzt seine Einkünfte aufbesserte, mit Salben versorgte, begegneten die Männer sich beinahe freundschaftlich. Obwohl der Nachrichter ein Unehrlicher war, schätzte nicht nur Götz seine Meinung.
Götz erwiderte den Gruß und ließ seinen Blick zum Löwen wandern.
Dieser starrte wie gebannt auf die klaffende Wunde im Bauch des Toten hinab, dessen nasse Kleider eine Pfütze auf dem Boden hinterließen.
»Kannst du schon sagen, womit ihm diese Verletzungen zugefügt worden sind?«, wollte der Hauptmann der Wache vom Nachrichter wissen.
»Hm«, murmelte dieser. »Das ist nicht so einfach.«
»Wieso?«
»Weil ich nicht sicher bin, ob man ihn mit einem Messer verstümmelt hat oder mit sehr scharfen Krallen, vielleicht auch Zähnen.«
»Du meinst, an dem Geschwätz der Leute könnte etwas Wahres dran sein?«, fragte der Hauptmann ungläubig. »Für mich sieht es nicht so aus, als ob man ihm den Kopf abgebissen hat. Was sagst du?«, wandte er sich an den Löwen.
Der zuckte die Achseln. »Kann sein, kann nicht sein«, war alles, was er zu sagen hatte.
»Äußerst hilfreich«, brummte der Hauptmann. »Kannst du irgendwie herausfinden, ob mit seinem Blut etwas nicht stimmt?«, fragte er Götz.
Der schüttelte den Kopf. »Leider nicht.«
»Was ist mit deiner Frau? Oder dem Medicus? Der werte Herr ist sich zwar vermutlich zu fein, sich um einen kopflosen Toten zu kümmern, aber es geschehen doch noch Zeichen und Wunder.«
Jetzt war es an Götz, die Achseln zu zucken. »Man könnte vielleicht riechen, ob ihm Gift verabreicht worden ist«, sagte er. »Aber für mich sieht es nicht danach aus, als ob er an einer Vergiftung gestorben wäre.«
Einige der anwesenden Wächter lachten nervös.
»Himmelherrgott!«, schimpfte der Hauptmann. »Ihr wollt mir doch nicht wirklich weismachen, dass vielleicht ein Werwolf sein Unwesen in der Stadt treibt. Wie soll ich das dem Rat beibringen?«
»Das kann ich Euch nicht sagen«, gab der Henker zurück. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf und kratzte sich am Kinn. »Wenn sein Kopf noch da wäre …«
»Was, dann?«, brauste der Hauptmann auf.
»Dann würde man sehen, ob sein Gehirn gefressen worden ist«, war die trockene Antwort.
»Was würde ich nur ohne euch tun?«, knurrte der Anführer der Stadtwache.
*
Während die Männer den Toten vorsichtig auf die Seite drehten, um nach weiteren Verletzungen zu suchen, stürmte Jona in die Arzneiküche. »Olivera! Olivera!«, rief er.
Olivera hätte vor Schreck beinahe einen Topf fallen lassen, den sie gerade an den Haken über der Feuerstelle hängte. Darin befand sich Schweinefett, das sie schmelzen wollte. »Um Himmels willen, Jona. Was ist?«
Der Junge war völlig außer Atem. Seine Wangen glühten. »Götz ist im Wachhaus. Man hat einen Toten in der Pegnitz gefunden. Ohne Kopf«, sprudelte es aus ihm heraus.
Olivera wischte sich die Hände an einem Tuch ab. Wie gut, dass sie Cristin in die Küche geschickt hatte, um etwas Butter zu holen. Das, was Jona erzählte, war nichts für die Ohren des Kindes. »Setz dich erst einmal hin«, forderte sie Jona auf.
Aber der konnte nur mit Mühe stillstehen, geschweige denn sitzen. Kaum hatte er sich von ihr auf einen Schemel drücken lassen, sprang er schon wieder auf. »Alle sagen, ein Werwolf hat den Mann getötet!«
Olivera runzelte die Stirn. »Ein Werwolf?«
Jona nickte.
»Bist du sicher, dass man dir keinen Bären aufgebunden hat?«
»Sein Kopf fehlt und sein Bauch ist völlig aufgeschlitzt«, berichtete Jona schaudernd. »Er hat auch keine Hände mehr. Sie haben ihn in die Wachstube gebracht.«
Olivera überlegte nicht lange. Wenn Götz in der Wachstube war, würde sie auch dorthin gehen. Je mehr Augen den Leichnam untersuchten, desto besser. Sie nahm die Schürze ab, die sie in der Salbenküche trug, warf sich ein Tuch über die Schultern und machte Anstalten, die Offizin zu verlassen.
»Wohin gehst du?«, fragte Jona.
»Zur Wache.«
»Darf ich mitkommen?«
Olivera warf einen Blick auf die Tasche, die er immer noch umhängen hatte. »Nein. Sag Jonata, sie soll auf Cristin aufpassen, und dann tu deine Arbeit.«
Jona wollte etwas entgegnen.
Olivera hob abwehrend die Hand. »Die Kranken warten auf ihre Arzneien.« Mit diesen Worten ließ sie Jona stehen und eilte aus dem Haus. Keine Sekunde glaubte sie daran, dass ein Werwolf in der Stadt umging. Ohnehin war dieses Phänomen in den medizinischen Schriften umstritten. Bereits beim ersten Aufkommen des Gerüchtes hatte sie in den Büchern ihrer Großmutter nachgeschlagen. Bekannt als Lykanthropie, bezogen sich die ersten Berichte darüber auf Lykaon, einen König der Arkadier, der zur Strafe für ein Menschenopfer in einen Wolf verwandelt worden sein sollte. In den Texten wurde die Lykanthropie jedoch gemeinsam mit der Epilepsie als eine Gehirnkrankheit behandelt, nicht als Besessensein durch einen Dämon. Grund für diese Krankheit war laut mehrerer Gelehrter ein Ungleichgewicht der Körpersäfte, wodurch diese extreme Form der Melancholie entstehen konnte. Angeblich trieben sich die an Lykanthropie Leidenden nachts auf Friedhöfen herum, ahmten die Gebärden von Wölfen nach, waren bleich, durstig, ausgetrocknet, schwachsinnig und hatten geschwürige Waden. Selbst wenn in Nürnberg tatsächlich ein armer Tropf an dieser Krankheit leiden sollte, würde er einen anderen Menschen wohl kaum so systematisch verstümmeln, dessen war Olivera sich sicher.
Ohne auf die erbosten Blicke der Schaulustigen zu achten, kämpfte sie sich zur Wachstube vor und rümpfte die Nase, als sie über die Schwelle trat. Der Gestank, der von dem Toten ausging, war so heftig, dass sich einige der Stadtwächter Tücher vor Mund und Nase gebunden hatten. Götz, der Nachrichter und sein Gehilfe sahen auf, als sie den Raum betrat.
»Ich dachte mir fast, dass du kommen würdest«, sagte Götz, den ihr Auftauchen nicht zu überraschen schien.
Die anderen Männer begrüßten sie mit einem Nicken.
»Könnt Ihr herausfinden, ob er vergiftet worden ist?«, wollte der Anführer der Stadtwache ohne Umschweife von ihr wissen.
Olivera trat näher an den Toten heran, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Sein Anblick war alles andere als schön. Bläulich violette Flecken entstellten seine aufgedunsene Haut, die sich bereits an mehreren Stellen vom Körper zu lösen begann. Unter seinen Achseln und in dem klaffenden Loch in seiner Mitte tummelten sich winzige Fliegenlarven. Es schien, als sei er bereits längere Zeit tot. Olivera überlegte einen Moment. »Wenn ich einen Blick auf seine Leber oder Galle werfen könnte …«, murmelte sie.
»Dann schafft ihn zum Henkershaus und tut, was immer Ihr tun müsst«, sagte der Hauptmann, ohne lange zu zögern.
»Muss eine Leichenschau nicht vom Rat angeordnet werden?«, mischte sich Götz ein.
»Glaubt mir, diese Anordnung wird nicht lange auf sich warten lassen«, war die Antwort. Damit tippte sich der Wächter an den Helm und verließ eilends die Stube.
Der Henker tauschte einen Blick mit Olivera. »Ich schätze, sie werden auch eine Begutachtung und Klassifizierung der Wunden verlangen«, sagte er.
Olivera nickte. Sie hatte dem Henker schon öfter dabei geholfen, die Schwere einer Verletzung und die Art der Waffe festzustellen – allerdings bei lebenden Opfern. Das war nötig, damit der Rat in der Lage war, den Täter entsprechend dem Hoch- oder dem Niedergericht zur Aburteilung zu überstellen. Zu diesem Zweck führte Jacob, der Henker, ein Wundenbuch, in dem unterschieden wurde zwischen trockenen Verletzungen, blutenden Wunden, »beinschrötigen« Wunden mit Knochenverletzung, lähmenden Verletzungen, Hohlwunden – wie dem klaffenden Loch im Bauch des Toten – oder Verstümmelungen.
Die Frage, ob »Blut oder Blau«, ob Wunde oder Schlag, war im Fall des kopflosen Leichnams allerdings von nachgeordneter Wichtigkeit. Vielmehr würde den Rat neben dem Grund für seinen Tod interessieren, um wen es sich handelte. Anhand seiner zerlumpten Kleidung war Olivera ziemlich sicher, dass der Mann ein Bettler oder Ackerbürger gewesen sein musste.
Kapitel 4
Nürnberg, Juli 1409
Die sechzehnjährige Gerlin stand unentschlossen auf der Fleischbrücke und fragte sich, ob der Auflauf vor dem Rathaus es wert war, sich Ärger mit dem Frauenwirt einzuhandeln. Wenn sie noch länger fortblieb, würde er ihre Abwesenheit gewiss bemerken. Sie kaute auf einem ihrer Fingernägel herum, während sie mit ihrer Neugier kämpfte. Einerseits interessierte es sie brennend, warum die ganze Stadt in Aufruhr war. Andererseits fürchtete sie sich vor dem Ochsenziemer des Frauenwirtes, von dem ihr die anderen Hübschlerinnen erzählt hatten.
»Wenn du nicht tust, was er sagt, prügelt er dich grün und blau«, hatte sie erst vor Kurzem Eva, eines der älteren Mädchen, gewarnt.
Gerlin selbst war noch nie von dem Frauenwirt bestraft worden. Allerdings hielt sie sich auch erst seit etwas mehr als vier Monaten unter seinem Dach auf. Während die Schaulustigen an ihr vorbei zum Marktplatz drängten, betastete sie geistesabwesend das gelbe Band an ihrem Arm, das sie als Hure auswies. Auf dem Grünen Markt waren sie und die anderen Frauen ohnehin nicht gern gesehen, da es ihnen verboten war, die Lebensmittel zu berühren. Mehr als einmal war sie bereits von einem wütenden Bäcker oder Metzger verjagt worden, als sie auch nur in die Nähe ihrer Auslage gekommen war.
»Kauf woanders!«, hieß es meistens, wenn Gerlin einen Laden betrat oder sich einem Marktstand näherte.
Sie schnitt eine Grimasse. Im Dunkeln waren sich selbst die Pfaffen und reichen Pfeffersäcke nicht zu fein, mit ihr zu verkehren. Aber am helllichten Tag, auf offener Straße, mied man sie wie eine Aussätzige. Als eine Gruppe Handwerksburschen auf sie zukam, senkte sie hastig den Blick, um die Männer nicht zu etwas zu ermutigen, was sie nicht wollte. Oft genug kam es vor, dass ihr jemand unter die Röcke oder an die Brust fasste, lachte und dann einfach davonlief. Obwohl sie und die anderen Frauen unter dem Schutz des Rates standen, scherte sich kein Wächter darum, wenn sie um Hilfe riefen. Instinktiv wanderte ihre Hand zu der kleinen Tasche ihres Kleides, in die sie ihre gesamte Habe eingenäht hatte. Genau einhundert Pfennige hatte sie bisher gespart, was zweieinhalb Schillingen entsprach. Allerdings betrugen ihre Schulden beim Frauenwirt beinahe das Zehnfache dieser Summe. Und wenn sie nicht bis ans Ende ihrer Tage für ihn schuften wollte, musste sie sich etwas einfallen lassen.
Zweiundvierzig Pfennige kostete die Verpflegung im Frauenhaus wöchentlich, ganz gleich, ob man sie in Anspruch nahm oder nicht. Da das Essen meistens ungenießbar war, kauften viele der anderen Frauen selbst ein. Gerlin jedoch nicht. Sie wollte so schnell wie möglich den Gulden zusammensparen, mit dem sie sich von ihren Schulden freikaufen konnte.
Wenn sie doch nur nicht so furchtsam wäre und sich wie Eva einen »Schlafmann« anlachen könnte! Dieser, ein Freier, der über Nacht blieb, zahlte drei Mal so viel wie ihre normalen Kunden. Allerdings graute es ihr davor, die ganze Nacht neben einem der Kerle zu verbringen, die das Frauenhaus normalerweise besuchten.
Sie wich weiter an den Rand der Brücke aus, als sich erneut Neugierige an ihr vorbeidrängten. Sobald diese sich wieder entfernt hatten, kehrten ihre Gedanken zu dem anderen Mädchen zurück.
Eva war offenbar zufrieden mit ihrem »Schlafmann«. Er schien zwar einige Wünsche zu haben, von denen der Frauenwirt nichts wissen durfte. Dafür machte er ihr die abenteuerlichsten Versprechungen.
»Bald holt er mich hier raus«, hatte Eva ihr erst vor Kurzem anvertraut.
»Will er dich freikaufen?«, hatte Gerlin gefragt.
Wie sie hatten fast alle anderen Huren auch Schulden beim Frauenwirt.
Eva hatte den Kopf geschüttelt. »Das werde ich selber machen, sobald er mir das Geschenk gibt, das er mir versprochen hat.«
»Und was musst du dafür tun?«, wollte Gerlin wissen.
»Das darf ich nicht sagen«, war die wenig befriedigende Antwort gewesen.
»Was für ein Geschenk ist es denn?«, war Gerlin weiter in sie gedrungen.
Aber Eva hatte lediglich geheimnisvoll gelächelt und geschwiegen.
Inzwischen war sich Gerlin fast sicher, dass Eva sich etwas vormachte. Dieser Freier, der ihr das Blaue vom Himmel versprach, log vermutlich, um sie zu immer tolleren Liebesspielen zu überreden. Wenn der Frauenwirt wüsste, dass sie ihn nicht nur in der von der Kirche erlaubten Stellung bediente, würde sie vermutlich nicht nur mit dem Pranger davonkommen. Manchmal hörte Gerlin, was die beiden trieben, da Evas Kammer an die ihre angrenzte. Schon mehr als einmal war sie nicht sicher gewesen, ob es Schmerzensschreie oder Schreie der Lust waren, die durch die dünnen Wände an ihr Ohr drangen.
Sie seufzte. Es war ein gefährliches Spiel, das Eva trieb. Aber ganz egal, wie sehr sie selbst wünschte, endlich genug Geld zu haben, sie würde es ihr nicht gleichtun. So viel Selbstachtung besaß sie noch. Wenn sie endlich das Frauenhaus verlassen konnte, würde sie wieder ein normales Leben führen. Sie wusste, dass sie sich etwas vormachte, dass ein normales Leben für sie vermutlich niemals möglich sein würde. Aber ohne diese Hoffnung hätte sie sich schon längst in die Pegnitz gestürzt.
»Du bist eine Schande!«, hallte die Stimme ihres Vaters immer wieder in ihren Gedanken nach. Die Schläge, mit denen er sie vom Hof geprügelt hatte, schmerzten immer noch, obwohl die Striemen längst verheilt waren.
Warum hatte er nicht verstehen können, dass es nicht ihre Schuld gewesen war? Dass der Knecht sie gezwungen hatte …? Sie blinzelte die schlimmen Erinnerungen beiseite, raffte ihre Röcke und machte sich auf den Weg nach Hause. Je eher sie zu ihrer Arbeit zurückkehrte, desto eher würde sie eine weitere Münze verdienen, die sie in den Stoff einnähen konnte.
Kapitel 5
Nürnberg, Juli 1409
Olivera war froh, dass die Stadtknechte ihnen halfen, den Karren mit dem Toten durch eine Hintertür ins Freie zu schaffen. Im Schatten des Rathauses warfen sie ein Tuch über den Leichnam, spannten ein klappriges Pferd vor den Wagen und holperten kurz darauf unbehelligt hinter der St.-Sebaldus-Kirche in Richtung Weinmarkt. Außer ein paar Mönchen begegneten sie so gut wie keiner Menschenseele. Inzwischen schien sich die halbe Stadt auf dem Grünen Markt versammelt zu haben. Olivera und Götz teilten sich den Bock mit dem Henker, der Löwe kauerte auf der Ladefläche neben dem Toten. Da die Sonne inzwischen hoch am Himmel stand, flimmerte die heiße Luft über der gepflasterten Straße. In den Gärten summten Bienen um die üppige Blütenpracht der Büsche und Stauden, hie und da torkelte ein Schmetterling davon. Schwalben flogen so dicht an den Häusern vorbei, dass Olivera sich mehr als einmal wunderte, dass die Vögel nicht gegen die Wände prallten. Die Hitze lag erdrückend über der Stadt, und man konnte die vollen Sickergruben an jeder Ecke riechen. Kein Lüftchen rührte sich mehr. Es schien noch heißer geworden zu sein als die Tage zuvor.
Schweigend legten sie den Weg über den Weinmarkt zurück und wandten sich dann nach Süden. Es dauerte nicht lange, bis das sonnenbeschienene Wasser der Pegnitz durch das Laubwerk der Bäume blitzte. Dort, wo Enten oder Schwäne ihre Bahnen zogen, funkelten die Wellen wie winzige Diamanten. Schon bald vernahm Olivera das Rauschen des Wassers, das zahlreiche Mühlräder antrieb. Je näher sie dem Henkerturm kamen, desto stärker wurde der Gestank des Unschlittplatzes, auf dem die anwohnenden Metzger ihre Schlachtabfälle entsorgten.
Als sie auf dem Saumarkt angekommen waren, lenkte der Nachrichter den Karren nach Westen und sprang kurz darauf vor dem Henkerhaus vom Bock. Nachdem er das Pferd an einem Pfosten festgebunden hatte, befahl er seinem Gehilfen, ihm mit dem Toten zu helfen.
»Wir schaffen ihn in den Turm«, sagte er.
Dieser schloss direkt an das Henkerhaus an, das den nördlichen Arm der Pegnitz überspannte. Über dem südlichen Arm des Flusses befand sich die Wohnung des Löwen, die ebenfalls mit dem Henkerturm verbunden war. Außerdem ragte ein gewaltiger Turm, ein Teil der alten Stadtbefestigung, in den Himmel, in dem sich inzwischen ein Schuldgefängnis befand.
Olivera und Götz warteten, bis der Henker die Tür geöffnet hatte, dann folgten sie ihm und seinem Gehilfen eine schmale Stiege hinauf. Oben befand sich eine weitere Tür, die in den Henkerturm führte. Auch dort waren Gefangene untergebracht, doch ein großer Raum diente dem Nachrichter für die Untersuchung der Toten und die Aufbewahrung seiner Werkzeuge.
»Auf den Tisch!«, sagte er. Sobald der Leichnam auf dem groben Holztisch lag, öffnete er die winzigen Fensterluken, um wenigstens etwas Luft in den Raum zu lassen. »Vertreib die Fliegen, während ich die Wunden ausmesse«, befahl er seinem Gehilfen.
Das unablässige Surren verstärkte sich, nachdem der Henker die Kleider des Toten aufgeschnitten und auf den Boden geworfen hatte. Dort bildeten sie ein nasses Häuflein, unter dem sich der Dielenboden schnell dunkel färbte.
»Siehst du diesen Wirbel hier?«, fragte er nach einiger Zeit, an Olivera gewandt. Er deutete auf eine Stelle, die bei einem lebenden Menschen auf Höhe des Kehlkopfes gewesen wäre.
Olivera nickte.
Götz hielt sich etwas im Hintergrund, da er – anders als Olivera – nicht an den Anblick von klaffenden Wunden gewöhnt war.
»Das sieht eindeutig aus, als ob jemand ihm mit einer sehr scharfen Klinge den Kopf abgeschlagen hat. Fast wie bei einer Hinrichtung.« Der Henker richtete sich auf und runzelte die Stirn. »Ein Tier war das gewiss nicht.«
»Was ist mit seinen Händen?«, wollte Götz wissen.
Der Henker hob einen der Arme an und betrachtete auch diese Verstümmelung mit zusammengekniffenen Augen. »Hol das Wundenbuch«, trug er dem Löwen auf, der mit einem dünnen Brett erfolglos versuchte, die Fliegen zu verscheuchen. Als sein Gehilfe kurz darauf zurückkam, trug der Nachrichter sorgfältig die Länge, Breite und Tiefe der Verletzungen ein, ehe er Götz’ Frage beantwortete. »Auch hier handelt es sich um glatte Schnitte – wie mit einer Axt. Die Verfärbung des Gewebes rings um die Wunde lässt darauf schließen, dass er noch am Leben war, als man ihm diese Verletzungen zugefügt hat.«
»Du meinst, es ist unmöglich, dass ein Tier dafür verantwortlich ist?«, fragte Olivera.
Der Henker legte den Kopf zur Seite. »Unmöglich ist nichts«, erwiderte er. »Vor allem, wenn ich mir das Loch in seinem Bauch ansehe.« Er fasste, ohne zu zögern, in die Wunde und zog die Ränder auseinander. »Hier hat irgendjemand oder irgendetwas gewütet. Anders als die Schnitte am Hals und an den Armen erinnert diese Verletzung in der Tat an ein Lamm, das von einem Wolf gerissen worden ist.«
Olivera nahm die Wunde ebenfalls genauer in Augenschein. »Kannst du mir seine Leber und seine Galle zeigen?«, fragte sie.
Der Henker befreite die Organe.
Allerdings wiesen sie keinerlei Besonderheiten auf. »Es scheint alles normal zu sein«, murmelte Olivera.
»Ich hatte auch nicht angenommen, dass er vergiftet worden ist«, warf Götz ein. »Wozu ihn dann noch halb ausweiden und köpfen?«
Bevor er weitersprechen konnte, hämmerte unten jemand an die Tür.
»Geh und mach auf«, trug der Nachrichter dem Löwen auf.
Der kam wenig später mit einem Stadtknecht zurück. »Der Rat will so schnell wie möglich über die Ergebnisse der Leichenschau unterrichtet werden«, sagte der Mann. »Habt ihr irgendwelche Anhaltspunkte, um wen es sich handeln könnte?«
Der Henker legte die Stirn in Falten. »Seiner Kleidung nach ist er entweder ein Bettler oder ein Fahrender«, sagte er.
»Hat er eine Bettelmarke?«
»Nein. Die kann er aber im Fluss verloren haben.«
»Also ist es wahrscheinlich, dass es sich nicht um einen Nürnberger handelt?«, hakte der Wächter nach.
»Das kann man mit Sicherheit wohl erst sagen, wenn sein Kopf wieder auftaucht«, gab der Nachrichter trocken zurück.
»Wir müssen die Bürger irgendwie beruhigen«, brummte der Wachmann.
»Dann solltet ihr das Geschwätz über den Werwolf unterbinden«, riet Götz ihm. »Wenn ihr meine Meinung hören wollt: Es erinnert mehr an einen Metzger als an ein wildes Tier.«
Der Wachmann warf dem Henker einen fragenden Blick zu.
Der nickte. »Vielleicht ein Verrückter, aber kein Werwolf«, brummte er.
Der Stadtwächter wirkte erleichtert. »Kann ich das dem Hauptmann berichten?«
»Damit würde ich an deiner Stelle warten, bis ich mit der Leichenschau fertig bin«, riet der Nachrichter dem Mann.
Die Untersuchung dauerte noch etwas länger als eine halbe Stunde. Dann wischte sich der Henker die Hände an einem Tuch ab und sagte, an den Wachmann gewandt: »Bring mich zum Rat.«
»Was geschieht mit ihm?«, fragte der Löwe.
»Das, was der Rat wünscht. Lass ihn so liegen und sieh zu, dass ihn die Fliegen nicht auffressen«, gab der Nachrichter zurück.
Der Löwe schnitt eine Grimasse, tat aber wie geheißen.
»Kommt«, forderte der Wächter sie auf. Ihm war deutlich anzumerken, dass er es kaum erwarten konnte, den Raum mit dem stinkenden Leichnam zu verlassen.
Olivera und Götz begleiteten die beiden auf Umwegen zum Rathaus. Als sie wenig später den großen Saal im Obergeschoss des Gebäudes betraten, blickten ihnen viele neugierige Augenpaare entgegen.
»Was könnt ihr uns berichten?«, erkundigte sich einer der Älteren Bürgermeister, der »Frager«. Zusammen mit einem Jüngeren Bürgermeister leitete er für vier Wochen die laufenden Geschäfte der Stadt. Dann war die Reihe an zwei anderen der insgesamt sechsundzwanzig Bürgermeister. Auch Hans Tucher war anwesend – in seinem Amt als Vorderer Losunger. Er schenkte Olivera ein freundliches Lächeln. Er schien noch immer dankbar zu sein für ihre Hilfe, die ihn vor einer falschen Anklage wegen Hochverrats bewahrt hatte.
»Geht ein Werwolf um in unserer Stadt oder nicht?«
Kapitel 6
Nürnberg, Juli 1409
Der Henker berichtete, was er bei der Leichenschau festgestellt hatte.
»Wie kannst du dir sicher sein, dass es nicht doch ein Dämon war?«, wollte eines der älteren Ratsmitglieder wissen. »Man sagt, ein Werwolf habe die Kraft von einem Dutzend ausgewachsener Männer. Seine Krallen sollen so scharf sein, dass selbst ein Schwert machtlos gegen sie ist.«
Der Henker hob eine Schulter. »Für mich sieht es nach Menschenwerk aus«, gab er zurück.
»Vielleicht sollte der Medicus den Toten auch noch untersuchen?«, mischte sich ein Jüngerer Bürgermeister ein.
»Und dem Henker in die Kur pfuschen?«, schoss der Vordere Losunger zurück. »Du weißt ganz genau, dass das nicht seine Aufgabe ist.«
»Ich bin dennoch dafür, dass wir auch ihn um seine Meinung fragen«, beharrte der Bürgermeister. »Außerdem pfuscht doch wohl eher der Nachrichter dem Medicus in die Kur«, setzte er kampflustig hinzu.
Olivera warf dem Henker einen Seitenblick zu.
Doch der zuckte mit keiner Wimper. Derlei Anfeindungen war er vermutlich gewöhnt. Sein Blick wanderte lediglich hie und da zum Vorderen Losunger, den er vor einigen Monaten aufgrund einer falschen Anschuldigung im Loch hatte foltern müssen. Vermutlich fragte er sich, ob und wann sich der Groll des Losungers gegen ihn entladen würde.
»Dann lass den Medicus herholen«, unterbrach der Frager ihre Beobachtungen. »Eine weitere Meinung kann nicht schaden.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, murmelte jemand aus den hinteren Rängen.
»Die Sitzung ist für eine halbe Stunde unterbrochen«, verkündete der Frager.
Als die Versammlung wieder zusammenkam, sah der Medicus sich im Ratssaal um. Er schien außer Atem und wischte sich erhitzt den Schweiß von der Stirn. Wie immer war er makellos gekleidet, wirkte in seinem strengen Tappert – einem knielangen schwarzen Obergewand –, als habe er einen Stock verschluckt. Auch seine engen Hosen und der hohe Filzhut waren aus dunklem Stoff, wodurch er in dem Raum voller bunt gekleideter Patrizier wirkte wie eine Krähe unter Paradiesvögeln. »Was ist so wichtig, dass man mich von einem Krankenbett holen muss?«, fragte er hochmütig.
»Vergiss nicht, dass du dem Rat unterstehst«, warnte ihn Hans Tucher.
Der Arzt warf ihm einen giftigen Blick zu und ließ sich schweigend auf die lange Bank fallen, auf der auch Olivera, Götz und der Nachrichter Platz genommen hatten.
»Wiederhole, was du uns berichtet hast«, forderte der Frager den Henker auf, nachdem ein wenig Ruhe im Saal eingekehrt war.
Der kam der Aufforderung nach und schloss mit denselben Worten wie vorher: »Wie gesagt, für mich sieht es nach Menschenwerk aus.«
»Das willst du lediglich aufgrund der Wunden behaupten?«, fragte der Medicus. »Woher nimmst du diese Sicherheit?«
Der Henker zuckte die Achseln. »Erfahrung«, war seine knappe Antwort.
Der Medicus schnaubte.
»Ich sage euch, es ist ein Dämon!«, rief eines der Ratsmitglieder. »Gott will die Stadt strafen. Warum glaubt ihr, ist es dieses Jahr so heiß wie in der Hölle?«
Einige der Anwesenden bekreuzigten sich.
»Verzeiht«, meldete Olivera sich zu Wort.
»Ja?« Der Frager gab ihr nach einem kurzen getuschelten Wortwechsel mit Hans Tucher zu verstehen, dass sie sprechen durfte.
Olivera erhob sich und versuchte, die teils verwunderten, teils ärgerlichen Blicke der Ratsmitglieder zu ignorieren. Als Frau hatte sie eigentlich den Mund zu halten. Aber das Gerede von Dämonen war schlicht und ergreifend Unsinn. »Ich möchte mich auf keinen Fall in die Angelegenheiten der gelehrten Herren einmischen«, sagte sie und nickte dem Medicus zu, »aber ist es nicht so, dass in den medizinischen Schriften behauptet wird, dass es sich um eine Krankheit handelt, wenn ein Mensch sich so verhält, wie es einem Werwolf zugeschrieben wird?«