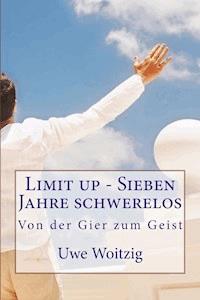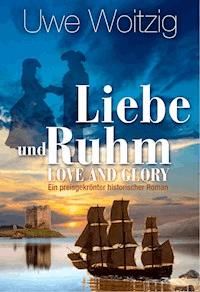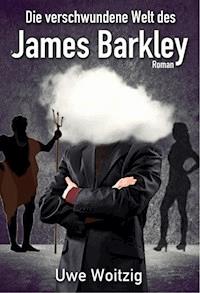Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Leidenschaftliche Liebe schafft Leiden! In gewohnt schonungsloser Offenheit schildert der Autor des Bestsellers "Hofgang im Handstand" die Konsequenzen seiner intensiven Begegnungen mit außergewöhnlichen Frauen und die wesentlichen Beziehungen seines Lebens. "Die Suppe muss scharf sein", sagte George Gurdjieff, der russische Mystiker. Wie "scharf" es werden kann, beschreibt dieses Buch. Es ist ein mit Blut, Enttäuschungen und vielen gefährlichen Verwicklungen gekennzeichneter Weg, den der Autor beschreiten musste, weil er Sex und Liebe als Mittel zu seiner Selbstfindung einsetzte, um das "Menschliche am Menschlichen" zu entwickeln, wie es in der Zeit der Aufklärung hieß. Er schildert selbst oder in seinem Umfeld erlebte dramatische Ereignisse, die Tod und Verderben über die Beteiligten brachten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse lassen ihn schließlich zu einem glücklichen und zufriedenen Mann werden, weil er die Wege zum Glücklichsein kennen gelernt und verstanden hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Woitzig
Die Schatten des Glücks
Liebe, Sex und sonstige Katastrophen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1: Liebe und Tod
Kapitel 2: Endlichkeit
Kapitel 3: Hölle im Paradies
Kapitel 4: Im Reich der Sinne
Kapitel 5: Gefährliche Verwicklungen
Kapitel 6: Eine Orgie in Rot
Kapitel 7: Eifersucht und Lügen
Kapitel 8: Ein heimtückischer Überfall
Kapitel 9: Ein denkwürdiger Nachmittag
Kapitel 10: Eine bedingungslose Liebe
Kapitel 11: Eine folgenschwere Geste
Kapitel 12: Hass und Rache
Kapitel 13: Ent-täuschung
Kapitel 14: Glück und Unglück
Kapitel 15: Spiel mit dem Feuer
Kapitel 17: Blinde Leidenschaft
Kapitel 18: Spielball des Schicksals
Kapitel 20: Vaterliebe
Kapitel 21: Eine ungewöhnliche Reise
Kapitel 22: Sex und Magie
Kapitel 23: Motiv: egoistische Liebe
Kapitel 24: Die Illusion des Todes
Kapitel 25: Der Adel des Beiläufigen
Kapitel 26: Überwindung der Wächter
Kapitel 27: Determination und Karma
Kapitel 29: Freiheit und Glück
Kapitel 30: Abschied und Aufbruch
Kapitel 31: Zeit der Ungewissheit
Kapitel 33: Im Reich des Handelns
Kapitel 34: Turnstunden
Kapitel 35: Die Nagelfeile
Kapitel 36: Erfüllung der Wünsche
Kapitel 37: Trügerische Harmonie
Kapitel 38: Die Löwin
Kapitel 39: Spiegeleier und Speck
Kapitel 40: Der Gärtner
Kapitel 41: Transformation
Kapitel 42: Der schwarze Eros
Kapitel 43: Die vier Phasen des Sex
Kapitel 44: Ein gefährliches Spiel
Kapitel 45: Angekommen
Kapitel 46: Tragik und Irrtum
Kapitel 47: Ein glückliches Leben
Kapitel 48: Freude
Epilog
Impressum neobooks
Kapitel 1: Liebe und Tod
PrologGlück ist ein großes Thema der Menschheit. Warum sind so viele Menschen nicht glücklich?Wenn ein Kind geboren wird, ist es im Nabelzentrum, im Hara verwurzelt. Es wurde neun Monate durch die Nabelschnur ernährt und am Leben erhalten. Seine ganze Aufmerksamkeit ist auf diese Stelle seines Körpers konzentriert. Es atmet mit dem Bauch, es lebt aus dem Bauch. Der Kopf und das Herz spielen noch keine Rolle.Kopf, Herz, Hara – das sind drei wesentliche Zentren, Chakras, des Menschen. Das Nabelzentrum ist im Sein, das Herzzentrum im Gefühl und das Kopfzentrum im Wissen. Das Wissen ist am Weitesten vom Sein entfernt, das Gefühl ist ihm näher. Wenn das Gefühlszentrum fehlt, ist es schwierig, eine Verbindung zwischen Kopf und Hara, zwischen Wissen und Sein herzustellen. Ein Mensch, der liebt, kann leichter erkennen, dass er einfach nur Sein muss als ein Mensch, der durch den Intellekt lebt.Nach und nach entfernt das Kleinkind sich von dem Hara. Das Kind lernt die Liebe kennen. Das Herzzentrum des Kindes muss sich entfalten, damit es zum Bindeglied zwischen den beiden anderen Zentren werden kann. Wenn ein Kind in einer lieblosen Situation groß wird, dann kann sich das Herzzentrum nicht entfalten. Ohne einen Menschen, der es liebt und ihm Wärme und Geborgenheit spendet, wird sich sein Herzzentrum nicht entfalten. In erster Linie helfen die Liebe der Mutter oder des Vaters, dieses Zentrum zu entwickeln. Es ist aber in der gestressten westlichen Gesellschaft nicht leicht, eine liebesfähige Mutter und schon gar nicht, einen liebesfähigen Vater zu finden. Vielen Menschen fehlt daher das Liebeszentrum. Wenn ein Kind aber ohne Liebe aufwächst und kein entwickeltes Herzzentrum hat, wird es niemanden wirklich lieben können. Darum lebt fast die ganze Menschheit ohne Liebe und ist unglücklich. Aber es gibt Ausnahmen.Der Dokumentarfilm „Flucht aus dem Todeslager – Camp 14“ erzählt die Geschichte eines jungen Nordkoreaners namens Shi, der in einem Arbeitslager der kommunistischen Diktatur geboren und aufgewachsen ist. Um in so ein Lager eingesperrt zu werden, reicht es, beim nennen des Namens des Parteivorsitzenden das Wort „Genosse“ zu vergessen. Oder sich eine Zigarette mit dem Papier des Volksorgans zu drehen, wenn es in der Volksrepublik mal wieder keine Zigarettenfilter gibt. Die meisten Lagerinsassen wissen nicht, warum sie dort sind. Sie wurden eines Abends heimlich von der Geheimpolizei abgeholt und ohne Angabe von Gründen verschleppt. Ihre Verwandten und Nachbarn wurden nicht informiert. Niemand hatte eine Ahnung, was mit ihnen geschehen war. In diesen Lagern des Terrorregimes herrscht die totale Willkür der Wachen, die ohne Konsequenzen fürchten zu müssen über Leben und Tod der Insassen entscheiden. Beim geringsten Vergehen wird man erschossen. Eine junge Frau wurde vor den Augen des sechsjährigen Shi wegen des Diebstahls von vier Weizenkörnern öffentlich exekutiert. Ein ehemaliger Wärter berichtet in dem Film, dass er Gefangene erschoss, nur weil er keine Lust hatte, sie zu ihren Unterkünften zu bringen. Wenn er selbst sich nicht die Hände schmutzig machen wollte, befahl er acht Insassen, einen von ihnen zu töten. Hätten sie es nicht innerhalb einer Stunde erledigt, würde er sie alle erschießen. Ohne jeden Grund, nur aus einer Laune heraus. Die schönsten Frauen des Lagers wurden von den Wärtern regelmäßig vergewaltigt. Wurden sie schwanger, wurden sie aufgehängt und zu Tode gepeitscht.Alle Lagerinsassen arbeiteten von fünf Uhr morgens bis elf Uhr abends in einer Mine. Die Erwachsenen schlugen mit Hacken die Kohle aus dem Felsen, die Kinder mussten die zentnerschweren, mit Kohlestücken vollgeladenen Loren zum Ausgang schieben.Zu essen gab es jeden Tag zwei Maisklumpen mit Chinakohlsuppe. Ohne Ausnahme. Das ganze Jahr. Die Portionen waren viel zu klein und die Insassen hungerten. Viele starben wegen der unzureichenden Ernährung. Essen war ein großes Thema im Lager. Ein älterer Mitgefangener hatte Shi von gebratenen Hähnchen und gegrilltem Fleisch erzählt. Das wollte er auch einmal essen. Deswegen riskierte er die Flucht, obwohl er wusste, dass darauf die Todesstrafe stand.Shi lebt jetzt in Seoul. In der letzten Szene des Films steht er in einer U-Bahn und spielt mit seinem Handy. Im Hintergrund sieht man die Hochhäuser der Metropole Südkoreas, die in jeder Stadt der westlichen Hemisphäre stehen könnten.„Nur mein Körper lebt hier“, sagt Shi leise. „Ich kann mich nicht darin gewöhnen, dass hier alles mit Geld geregelt wird. Ich bin sehr traurig, weil ich die Unschuld meines Herzens verloren habe.“Genau das ist der Punkt. Die Unschuld des Herzens bedeutet die Fähigkeit, zu fühlen, ein entwickeltes Herzzentrum zu haben. Im Lager war er der einzige Lebensinhalt seiner Mutter. Sie muss ihn abgöttisch geliebt haben. Und er sie. In jeder Sekunde ihres Zusammenseins hat sie ihn diese Liebe spüren lassen. Deswegen sehnt er sich ins Lager zurück. Ihrer beider Herzzentren waren weit geöffnet und ihre Energien strömten zueinander und verschmolzen. Die äußeren Umstände werden bedeutungslos, wenn man in der Liebe lebt.Aber in der westlichen Zivilisation, zu der auch das amerikanisierte Seoul gehört, wird das Kopfzentrum zum Mittelpunkt. Nur das Wissen, mit dem man zu Geld kommt, zählt. Das Herz wird nicht benötigt. Die Menschen sind entwurzelt und hasten falschen Idealen hinterher. Während der U-Bahn Fahrt erzählt Shi dem Filmteam, dass es in Seoul mehr Selbstmorde gibt als in dem Todeslager. Seine Augen leuchten, als er erklärt, dass die Menschen in dem Lager manchmal sehr glücklich waren.Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wie ein Krieger, der mit dem Schwert kämpft, haben sie keine Zeit zum Denken. Denken bedeutet Tod. Zögern sie bei der Ausführung eines Befehls werden sie auf der Stelle wegen Befehlsverweigerung erschossen. Sie müssen die Befehle der Wachen wie eine Maschine auf Knopfdruck befolgen und reflexartig handeln. Das Denken wird ausgeschaltet und ihr Bewusstsein fällt vom Kopf zum Hara herunter.Nietzsche sagt: Lebe Gefährlich! Dann lebst du im Hier und Jetzt. Du wirst zum Sein. Deshalb übt der Krieg eine solche Faszination aus. Krieg und Sex sind die Hauptattraktionen der Menschen.Auch beim Sex kommt es vor, dass der Mensch sein Hara berührt. Das Bewusstsein wird im Sex nach unten gezogen. In einem tiefen sexuellen Orgasmus fällt man nach unten zum Hara. Der Kopf ist vergessen. Es ist in Wirklichkeit die Erfahrung des Haras, die den Sex so faszinierend macht.Aber für den modernen Menschen ist sogar Sex zu einer Hirnfunktion geworden. In der zweidimensionalen Welt des Denkens ist Sexualität eine Frage der Bilder. Deshalb gibt es so viel Pornographie. Der Mensch denkt über Sex nach und das ist absurd. Je weniger der Mensch in den Sex hinein gehen kann, desto mehr denkt er darüber nach. Desto mehr wird er zu einer langweiligen Routine. Man fühlt sich am Ende frustriert und betrogen, weil man nur das tierische Element des Sexes erfahren hat. Deshalb heißt es: Omne animale post coitum triste est – jedes Tier ist nach dem Sex traurig. Wenn Sex aber in der dreidimensionalen Welt des Handelns stattfindet, man sich auf Bewegungen und Berührungen konzentriert und das Bewusstsein nach unten fällt, wird das Hara berührt und man empfindet Seligkeit. Man ist bewusst, aber denkt nicht. Man IST! Bei vielen Völkern war die Vereinigung von Mann und Frau die Transzendenz zu einem Gott. Das ist der Augenblick der Meditation. Wenn Sex zur Meditation wird, erfährt man Glückseligkeit. Der Mensch hat im Kampf, in Duellen, in Kriegen immer nach dem höchsten Bewusstsein in der Gefahr gesucht. Im Angesicht des Todes wird das Denken ausgeschaltet. Plötzlich bricht ein Glücksgefühl aus, explodiert und rieselt durch den wohlig erschauernden Körper. Egal aus welchem Anlass das Hara berührt wird, man ist wieder verwurzelt wie als Neugeborenes.Es gibt keinen tieferen Sinn im Leben, als für Liebe und Selbsterfüllung zu leben. Wenn man für die Liebe und die Freude des Selbst lebt, dann werden diese Momente der Ekstase und des Frohsinns in der Seele aufgezeichnet. Was noch mehr Augenblicke des Glücks und der Freude erschafft.Der Haken an der Sache ist das Wörtchen „wenn“ …
Jeder Tag meiner Kindheit war ein Abenteuer. Die beiden Häuser meiner Eltern und Großeltern standen etwa vierzig Meter entfernt von einander auf unserem dreitausend Quadratmeter großen Grundstück, das auf der hinteren Seite durch eine lange Weißdornhecke von einem ausgedehnten Mischwald getrennt wurde. Es war leicht abschüssig und schmiegte sich terrassenförmig an einen bewaldeten Hang, an dessen Fuß sich ein kleiner Fluss durch eine liebliche Auenlandschaft schlängelte. Auf der anderen Seite des Tales standen die ersten Häuser einer der schönsten Städte des Ruhrgebiets, die wegen ihrer mittelalterlichen Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern als Ausflugsziel sehr beliebt war. Ein staubiger, ungeteerter Weg führte von ihr hinunter ins Tal und über eine kleine Brücke steil zu unserem Anwesen hinauf. Diese exklusive, erhöhte Wohnlage gab mir das Gefühl, in einer Burg auf einem Berg zu leben. Meine beiden Spielkameraden und besten Freunde waren zwei Schäferhunde, mit denen ich den ganzen Tag durch den Wald streifte oder in den Auen des Flusses herumtollte. Ich brauchte keine Spielsachen. Mein phantasievoller und kreativer Großvater inspirierte mich ständig mit neuen Ideen. Er brachte mir bei, aus einem Haselnussstrauch Pfeil und Bogen zu schnitzen, aus Decken und Stöcken ein Indianerzelt zu errichten und mit dem Luftgewehr zu schießen. Der handwerklich sehr geschickte Mann zeigte mir, wie man eine Schaukel an einem Ast anbringt, ein Baumhaus konstruiert oder sich eine unterirdische Höhle baut und sie mit Farnblättern gegen Regen schützt. Zum Entsetzen meiner Mutter kletterte er mit mir in hohe Baumgipfel, um mir die aus Lehm und Zweigen kunstvoll konstruierten Nester der Elstern zu zeigen. Im Herbst kraxelten wir zum Ernten der Früchte in unseren Obstbäumen herum. Wenn nötig nahm er mich zum Austauschen von kaputten Dachziegeln mit auf die Dächer unserer Häuser.Oft überraschte er mich mit spontanen Ausflügen zu besonderen Sehenswürdigkeiten oder Museen. So war es nicht wirklich etwas Besonderes, dass er sich eines Nachts in mein Zimmer schlich und mich sanft an der Schulter rüttelte. Verschlafen sah ich ihn an. Diesmal war er zu meinem Erstaunen mit einer grünen Cordhose, einem grünen Pullover, einer grünen Lodenjacke und einem Jägerhut bekleidet.„Was hast du vor, Opa?“ fragte ich ihn verwundert.„Steh auf und zieh dich an. Wir gehen mit Paul auf die Jagd“, sagte er leise und lächelte mich an. „Du bist jetzt fünf Jahre und alt genug.“Paul war sein bester Freund. Im Zweiten Weltkrieg war er Leutnant in dem Bataillon meines Großvaters gewesen. Er war ein dünkelhafter Freiherr, der einen Gutshof mit großen Ländereien geerbt hatte. Wegen der gemeinsamen Kriegserlebnisse hatte er ein sehr inniges Verhältnis zu meinem Opa. Wenn sie sich trafen, lachten sie oft laut und herzhaft. Meistens aber steckten sie die Köpfe zusammen und redeten sehr leise mit angespannten Gesichtern. Paul hatte dann immer einen hämischen, brutalen Zug um den Mund. Ich mochte ihn, weil mein Opa ihn gern hatte. Begeistert sprang ich aus dem Bett. Er hatte gerade den Urinstinkt des Jägers in mir geweckt. Ich war ein Raubtier wie alle Menschen.„Psst, sei leise. Deine Mutter muss unseren frühen Aufbruch nicht mitbekommen“, flüsterte er warnend. Aus meinem Schrank suchte er eine warme Winterbekleidung zusammen und half mir, mich anzuziehen. Wenig später fuhren wir mit seinem Motorrad zu dem Wald – und Sumpfgebiet, das das Jagdrevier seines Freundes war. Die schwere BMW meines Opas hatte einen Beiwagen. Trotz der beißenden Kälte der Herbstnacht war es für mich das Höchste, in dem Wägelchen zu sitzen und unter dem wolkenlosen Sternenhimmel durch die schlafende Landschaft zu brausen.Paul erwartete uns mit seinen beiden Jagdhunden Harras und Greif, die ungeduldig an ihren Leinen zerrten. Er war ein rothaariger, kräftiger Mann von etwa fünfzig Jahren mit einem breiten Gesicht, das mich immer an einen Metzger erinnerte. Nachdem er uns herzlich begrüßt hatte, ging er zum Kofferraum seines Mercedes und holte zwei Gewehre, mehrere Schachteln mit Munition, ein Fernglas und zwei Jagdtaschen heraus. Eine Flinte, ein paar der Munitionsschachteln und eine Tasche gab er meinem Opa.„Wir werden heute Enten jagen. Mein Sumpf ist voll von ihnen. Es wird ein Vergnügen werden, du wirst sehen“, sagte er zu ihm.Im Schein des Mondes liefen wir durch seinen über hundert Jahre alten Wald, der aus mächtigen Bäumen und dichtem Unterholz bestand. Paul erklärte uns, dass seit Generationen viele Zugvögel hier Rast machten, weil ihnen das dichte Gehölz Schutz bot auf ihrer jährlichen Reise gen Süden. Nach einem anstrengenden Fußmarsch erreichten wir den Waldrand. Vor uns lag ein von einem Flüsschen durchzogenes Tal, an dessen Ufern sich saftige Wiesen ausbreiteten. Weiter unten verlor sich der Bach, der im oberen Teil des Tales noch kanalisiert dahin strömte, in einem weitem Sumpf und Moor. Wir liefen entlang des Flusslaufes, bis wir den Rand des Sumpfgebietes erreichten. Dort sah ich, dass aus dem dichten Schilf, das den Sumpf überall bedeckte, ein Weg herausgeschnitten worden war, der zu der Anlegestelle eines Kahns führte.„Der Sumpf hat sein eigenes Leben. Er hat seine festen Bewohner und seine Wandergäste, die hier gerne zu Besuch sind, weil sie reiche Beute finden. Er ist das ideale Biotop für seltene Lebewesen, die es sonst nirgendwo gibt“, sagte Paul mit gedämpfter Stimme. Ich saß auf der schmalen Bank seines Holzkahns und schmiegte mich eng an meinen neben mir sitzenden Opa, während sein Freund uns über das morastige Gewässer ruderte. Mir war unheimlich zumute. Die mysteriöse Wasserebene mit ihrem schlammigen Untergrund flößte mir Angst ein. Wir fuhren durch dichten Nebel, dessen Schwaden seltsame Phantasieungeheuer bildeten. Unbekannte Geräusche aus dem Schilf und das ständige leise Glucksen und Plätschern des Wassers verstärkten mein Unbehagen. Ich war heilfroh, als Paul den Kahn endlich an ein Ufer steuerte, anlegte und ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Auch die beiden Hunde, die sich während der Überfahrt flach an den Holzboden gepresst hatten, schienen erleichtert zu sein. Sie sprangen ans Ufer und rannten fröhlich bellend um uns herum. Wir liefen im Gänsemarsch durch das dichte Schilf, bis wir eine Lichtung erreichten, auf der eine kleine Holzhütte stand. Paul schob ein paar Holzscheite in den Eisenofen, der in der Mitte des kleinen Raumes stand und von dem ein langes Rohr zum Dach führte. Er entzündete die Holzstücke und die nasskalte Luft in der Hütte fing an, sich langsam zu erwärmen.„Wir haben noch eine gute Stunde Zeit, bis die Sonne aufgeht und die Zugvögel aufbrechen. Also macht es euch bequem“, sagte Paul zu uns. Wir folgten seiner Aufforderung und legten uns auf die zusammengefügten Holzbretter, die an den vier Wänden der Hütte befestigt waren und als Bänke dienten. Ich dämmerte vor mich hin, als plötzlich ein Schrei ertönte, der mein Herz berührte. Anscheinend hatte der schwache Schein des anbrechenden Tages die ersten Vögel aufgeweckt.„Kommt mit raus, es ist soweit“, sagte Paul. Die beiden Freunde nahmen ihre Waffen und wir traten vor die Hütte. Tatsächlich war der Himmel bleich geworden und ganze Schwärme von Wildenten flogen über das Firmament. In langen Ketten schwirrten sie durch die Luft. Ein Feuerstrahl blitzte neben mir auf. Paul hatte geschossen und die beiden Hunde stürmten davon. Auch mein Opa feuerte. Von nun an knallte es abwechselnd links oder rechts von mir, sobald über dem Schilf der Schatten eines über uns fliegenden Schwarmes erschien. Harras und Greif apportierten unaufhörlich blutüberströmte, gefiederte Körper. Wedelnd und außer Atem legten sie mir die abgeschossenen Enten zu Füßen, deren starre Körper ich gleichmäßig auf die beiden Jagdtaschen verteilte. Einige der Vögel lebten noch und sahen mich klagend an, bevor ihre Augen brachen. Schließlich stieg die Sonne über dem Sumpf empor und der Strom der abziehenden Vögel verebbte.„Lass uns aufbrechen. Wir haben genug erbeutet“, sagte Paul und deutete auf die prall gefüllten Taschen, die neben mir am Boden standen.Mein Opa nickte. Da tauchten am Himmel noch zwei Vögel auf, die mit weit vor gestrecktem Hals und ausgebreiteten Flügeln über uns dahin zogen. Mein Opa schoss und einer der beiden fiel ihm fast vor die Füße. Es war eine Krickente mit fein ziselierten, silbernen Bauchgefieder, die blutend und still vor ihm lag. Ich bewunderte ihre Schönheit, als in dem weiten Raum über uns eine Stimme erklang. Es war die Stimme ihres Gefährten, der verzweifelt nach ihr rief. Ein kurzer, herzzerreißender Schrei, der sich ständig wiederholte. Das kleine Tier, das seinem Schicksal bisher entronnen war, fing an, über uns zu kreisen. Mit klagenden Rufen suchte es seine tote Begleiterin, deren langsam erkaltenden Körper ich aufgehoben hatte und in den Händen hielt. Paul blieb von seinem Wehklagen völlig unberührt. Er hatte sein Gewehr angelegt, zielte und wartete darauf, dass der Vogel nahe genug heran kam.„Du hast das Weibchen herunter geholt und das Männchen wird nicht von hier weichen“, sagte er zu meinem Opa. Tatsächlich zog es seine Kreise über uns und stieß dabei die ganze Zeit seine klagenden Laute aus. Mein Opa beobachtete es mit versteinerter Miene. Seine Kiefer mahlten. Mir liefen die Tränen über die Wangen. Nie wieder hat mir etwas so das Herz zerrissen, wie dieser ständige Schrei der Qual, dieser klagende Ruf der Verzweiflung des armen Vogels dort oben in den luftigen Höhen. Manchmal entfernte er sich etwas von unserem Standpunkt, als sei er sich des Gewehrlaufes bewusst, der ihm drohend folgte. Ich dachte hoffnungsvoll, er würde seinen Weg am blauen Himmel alleine fortsetzen. Doch er konnte sich nicht dazu entschließen und kam immer wieder zurück, um sein Weibchen zu suchen.„Leg sie mal auf den Boden. Er wird dann schon näher kommen“, sagte Paul zu mir, ohne den Gewehrlauf sinken zu lassen und den Blick von dem über uns kreisenden und unaufhörlich klagenden Erpel zu nehmen. Ich tat, wie er mir befohlen hatte. Das Männchen erspähte endlich seine Gefährtin. Ohne sich um die Gefahr zu kümmern und verrückt in seiner Liebe flog es auf sie zu. Paul schoss. Es war, als hätte man eine Schnur zerschnitten, an der der Vogel gehangen hatte. Ich sah einen schwarzen Schatten vom Himmel herunter fallen und hörte das Aufschlagen seines kleinen Körpers im Schilf. Harras rannte los und legte das tote Tier neben seine Gefährtin. Mein Opa ging zu ihnen und steckte ihre beiden kalt und starr gewordenen Körper in seine Jagdtasche. Als wir nach Hause kamen, gingen wir in den Garten und er begrub sie nebeneinander unter einem Kirschbaum. Meine Oma hatte ihn von ihrer Küche aus beobachtet. Sie kam zu uns und fragte ihn, was er machte. Er erzählte ihr mit gesenktem Kopf die Geschichte.Sie sah ihn schweigend eine Weile an. Ihre Augen schimmerten feucht. Ohne ein Wort zu sagen drehte sie sich um und ging in ihr Haus zurück. Als ich am Abend den Garten betrat, sah ich, dass ein Strauß Veilchen auf dem kleinen Grab blühte. Veilchen waren die Lieblingsblumen meiner Oma.
Kapitel 2: Endlichkeit
Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit dem Tod aus Liebe konfrontiert wurde. Normalerweise ist der Tod weit weg und betrifft nur die anderen, denken wir. Auch ich gehörte sehr lange zu diesen Ignoranten der Endlichkeit unseres Seins. Bis mich eines Tages ohne Vorwarnung ein chronischer Husten befiel. Nach jedem Satz bekam ich einen Hustenanfall. Länger zu sprechen war unmöglich. Monatelang versuchte ich vergeblich, ihn mit alternativen Heilmethoden zu bekämpfen. Ich hatte keinen Appetit mehr und verlor kontinuierlich an Gewicht. Von Woche zu Woche wurde ich schwächer. Eines Tages bekam ich so heftige Zahnschmerzen, dass ich sofort einen Zahnarzt aufsuchte. Als ich mich in seinen Behandlungsstuhl setzte, sah er mich besorgt an.„Wie sehen Sie denn aus. Ihre Haut ist ja Gelb-Grün. Sie müssen sich unbedingt von einem Arzt untersuchen lassen.“Aber ich ignorierte seinen Rat. Ich misstraute den Ärzten der Schulmedizin. Die meisten von ihnen wollen nur Produkte der Pharmaindustrie verkaufen, die abscheuliche Nebenwirkungen haben. Also hustete und hungerte ich weiter. Bis ich an einem kalten Februarmorgen meine Mülltonnen heraus stellen wollte. Nur mühsam konnte ich sie hinter mir herziehen. Als ich sie endlich am Straßenrand platziert hatte, war ich in Schweiß gebadet und völlig kraftlos. Wie in Zeitlupe bewegte ich mich ins Haus zurück und legte mich erschöpft auf mein Bett. Nachdem ich mich etwas erholte hatte, stand ich auf und suchte mir aus dem Telefonbuch eine Ärztin heraus. Ich rief sie an und schilderte ihr meinen Zustand. „Kommen Sie sofort vorbei. Das hört sich nicht gut an.“Ich wusste selbst, dass ich ernsthafte Probleme hatte. Vorsichtshalber packte ich einen Schlafanzug und Waschzeug in eine kleine Tasche. Mit letzter Kraft schaffte ich es, mich zu meinem Geländewagen zu schleppen und einzusteigen. Erst nach einer kurzen Erholungspause konnte ich ihn starten und losfahren. Völlig erschöpft betrat ich die Praxis der Ärztin, die sich zu meiner Überraschung im Keller einer Klinik befand. Mit zitternder Hand füllte ich das Anmeldeformular aus. Danach wurde ich sofort von der Sprechstundenhilfe in ihr Behandlungszimmer geführt. Als sie mich aufforderte, meinen Pullover auszuziehen, konnte ich ihn mir ohne ihre Hilfe nicht über den Kopf ziehen. Sie schüttelte besorgt den Kopf und maß meinen Puls. Ihre Miene wurde sehr ernst.„Ich weise Sie sofort in die Klinik ein.“
Wenig später holte mich eine Schwester mit einem Rollstuhl ab. Ich in einem Rollstuhl! Mein Leben lang hatte ich mir geschworen, dass es nie so weit kommen würde, weil ich mich vorher umbringen würde. Doch gerade saß ich zusammengesunken und apathisch in so einem Gerät, weil ich tatsächlich keine Kraft mehr hatte, um alleine laufen zu können. Sie schob mich in ein mit einem Tisch, Stuhl, Bett und Schrank spärlich möbliertes Einzelzimmer. Es erinnerte mich an eine Gefängniszelle. Charles Bukowsky hatte geschrieben, dass die wahren Universitäten des Lebens die Krankenhäuser und Gefängnisse sind. Kein Wunder, dass sie sich in der Ausstattung ähnelten. Ich war so schwach, dass ich die Schwester bitten musste, meine Tasche mit meinen Utensilien aus meinem Auto zu holen. Danach half sie mir, auszupacken und meinen Schlafanzug anzuziehen. Ich legte mich ins Bett und schloss erschöpft die Augen. Ein Arzt betrat das Zimmer. Er stellte sich als Dr. Meyer vor. Routiniert nahm er mir Blut ab und ließ die Kanüle in der Vene meines rechten Arms stecken.
„Die brauchen wir noch“, erklärte er mir. „Bringen Sie ihn sofort zum Röntgen“, befahl er der wartenden Schwester.
Eine Stunde später hatte er einen Plastikschlauch an der Kanüle angeschlossen, der mit einem an einem Galgen hängenden Beutel Blut verbunden war. Das Lebenselixier eines anonymen Spenders strömte in meine Adern. Es war ein merkwürdiges Gefühl für mich, diesen besonderen Saft von einem mir Unbekannten zu erhalten. Ohne zu wissen, was er für eine Persönlichkeit war, deren Eigenschaften sich über seine DNA mit meinen vermischten. Aber ich vertraue grundsätzlich in die Gerechtigkeit des Universums. Alles hat seinen Sinn.
Die sofort durch geführte Laboruntersuchung der Blutprobe hatte nämlich ergeben, dass ich einen Hämoglobinwert Wert von nur noch 3,8 hatte. Also weniger als ein Drittel des normalen Wertes von 12 bis 13 bei gesunden Menschen.
„Sie haben eine schwere perniziöse Anämie. Es ist ein Wunder, dass Sie es noch alleine zu uns geschafft haben. Die meisten Menschen fallen mit so einem Wert um wie die Fliegen“, sagte Dr. Meyer, als er mir das Laborergebnis und die inzwischen angefertigten Röntgenbilder erklärte. „Ihr Rückenmark produziert zwar rote Blutkörperchen, aber die zerplatzen alle sofort wieder. Warum das so ist, wissen wir noch nicht. Wir müssen eine Rückenmarkpunktur machen, um die Ursache heraus zu finden. Es könnte Leukämie sein. Sind sie erblich vorbelastet?“ „Meine Mutter ist an Leukämie gestorben“, antwortete ich ruhig. Trotz der gerade gehörten Möglichkeit, dass ich an einer tödlichen Krankheit litt, blieb ich gelassen. Die Bluttransfusion fing an zu wirken und es ging mir etwas besser. Ich fühlte, wie meine Kraft langsam zurück kehrte. „Leukämie passt nicht in mein Lebenskonstrukt“, ergänzte ich.
Er sah mich ernst an.
„Ich wünsche Ihnen, dass Sie Recht haben. Nach dem Laborergebnis der Bioskopie ihres Rückenmarks werden wir mehr wissen.“Nachdem er gegangen war, erhob ich mich aus dem Bett und stellte mich mitsamt dem Galgen und dem Blutbeutel ans Fenster. Mein Zimmer befand sich im vierten Stock der Klinik und bot mir eine wunderbare Aussicht. Eine fahle Wintersonne beschien die geschwungene Hügellandschaft des Allgäus. In den Tälern waberten Nebelschwaden. Die Bergkuppen waren mit Schnee bedeckt. Am Horizont erstreckten sich die weißen Gipfel der Alpen, die viele Jahre mein Lebensmittelpunkt gewesen waren (siehe mein Buch „Limit up – Sieben Jahre schwerelos“). Die Nebelschwaden aus den Tälern stiegen langsam an den Hängen empor und verschmolzen mit den Wolken, die ein starker Wind über den Himmel jagte. Er trieb sie spielerisch vor sich her, wirbelte sie durcheinander und zerfetzte sie. Der Anblick erinnerte mich an meine erste Reise in die Südsee, bei der ich die Geschichte einer leidenschaftlichen Liebe kennen lernte.
Kapitel 3: Hölle im Paradies
Kurz nach meinem dreißigsten Geburtstag flog ich von Paris nach Tahiti. Seit ich als kleiner Junge „Die Meuterei auf der Bounty“ mit Marlon Brando in einem Kino meiner Heimatstadt gesehen hatte, war es mein Traum gewesen, die atemberaubend schönen Drehorte des Films in der Südsee zu besuchen. Wie immer bei meinen Reisen hatte ich nichts gebucht. Bei meiner Ankunft auf Tahitis Flughafen Faa´a sagte ich dem Taxifahrer, er sollte mich zum besten Hotel der Insel bringen. Als wir durch Papeete fuhren, war ich maßlos enttäuscht. Links und rechts der Straße standen zweigeschossige Holzhäuser, von deren Fassaden die Farbe abblätterte. Auf den Bürgersteigen lungerten Gruppen von dunkelhäutigen, dicklichen Männern in Shorts und bunten T-Shirts herum, die Bierdosen in den Händen hielten und offensichtlich betrunken waren. Rundliche Frauen mit säulenartigen Beinen schlurften mit Plastiktüten in der Hand über die Bürgersteige. Einige standen zu Zweit oder in kleinen Gruppen schwatzend vor lieblos dekorierten, mit Waren aller Art vollgestopften Schaufenstern. Sie alle hatten sich farbige Tücher um ihre aufgeschwemmten Körper gewickelt, die ihre Fettpolster nur unzureichend verbargen. Die salzige Luft der Inselhauptstadt war geschwängert mit Benzindüften, die die unzähligen Mopeds verbreiteten, auf denen Jugendliche durch die schmalen Gassen knatterten. Die Straßen waren verstopft von rostigen alten Autos, die in Deutschland niemals eine Zulassung erhalten hätten. Die Fahrer der Wracks hatten sich „La Cucaracha“ und ähnlich schrille Melodien als Signaltöne eingebaut. Sie waren offensichtlich sehr stolz auf ihre Musik. Pausenlos betätigten sie ihre Hupen und erzeugten ein Ohren betäubendes Creszendo. Ich litt Höllenqualen, weil wir nur im Schritttempo vorwärts kamen und ich dieser akustischen Hölle schutzlos ausgeliefert war. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis wir endlich das Ortsende erreichten und nach ein paar Kilometern in die Hoteleinfahrt des Tahara-Hilton einbogen. Ich ließ mir ein freies Zimmer zeigen. Es gefiel mir und ich checkte ein. Wenig später saß ich mit einem Cocktail in der Hand auf der großen Veranda und war wieder versöhnt. Unterhalb des terrassenartig an einen Berghang gebauten Hotelkomplexes fiel ein Wald von Kokospalmen steil zu der Lagune hinunter. In der Abendsonne schimmerte ihre spiegelglatte Wasseroberfläche wie flüssiges Gold, dann leuchtete sie in allen Farben der Koralle braun, weiß, lila, rot und rosa. An der Mündung eines kleinen Flusses, die ein paar Kilometer entfernt war, erkannte ich ein Dorf mit Pfahlbauten. Vor dem Korallenriff, das die Lagune gegen das offene Meer abschirmte, veranstalteten Insulaner eine Regatta mit ihren Auslegekanus. Hinter dem Riff erstreckte sich die weite Ruhe des Pazifiks, auf dem ein paar Meilen entfernt Moorea zu erkennen waren. Wie das Geschöpf der Phantasie eines Dichters schwebte diese unvorstellbar schöne Insel in einem feinen Dunst zwischen Ozean und Himmel. Sie schien nicht von dieser Welt zu sein. Ich freute mich sehr darauf, sie am nächsten Tag kennen zu lernen.Früh am Morgen bestieg ich eine viersitzige, einmotorige Propellermaschine, die als Shuttleservice stündlich zwischen den beiden Inseln hin und her flog. Ich war der einzige Passagier. Der Anflug auf Moorea ließ mich den Atem anhalten. Im klaren Morgenlicht war der Anblick der Insel noch spektakulärer als gestern kurz vor Sonnenuntergang. Am hinteren Rand seiner türkisfarbenen, spiegelglatten Lagune erstreckten sich sanft geschwungene, schneeweiße Sandstrände, die in der Sonne glitzerten als bestünden sie aus lauter winzigen Diamanten. Sie waren umsäumt von dichten Wäldern aus Kokospalmen, die sich zärtlich an die steil ansteigenden Hänge der beiden hoch aufragenden Berge schmiegten, deren pittoreske Silhouetten der Insel ihren einzigartigen Charakter verliehen. Nach einem Flug von weniger als zehn Minuten landeten wir auf einem kleinen Flugplatz, der nur aus einer kurzen Landebahn und einer Holzhütte bestand. Der Pilot parkte seine Maschine direkt neben dem kleinen Gebäude. Zwei junge Insulaner schoben einen Holzwagen an das Gepäckabteil des Flugzeugs, um mein Gepäck zu holen. Als sie meine beiden schweren Lederkoffer und die unförmige Tasche für meine Videoausrüstung sahen, lachten sie schallend. „Was wollen Sie mit dem ganzen Gepäck? Auf Moorea brauchen Sie eine Badehose, eine Shorts und ein T-Shirt für den Tag und einen Pareo für die Nacht. Das reicht völlig. Alles andere ist überflüssig.“Sie hatten Recht. Ihre treffende Bemerkung war der Grund, dass ich den Rest meines Lebens nur noch mit einem klug gepackten Handgepäck reiste und nur das Wenige mitnahm, was ich wirklich benötigte. In dem Holzhaus gab es zu meinem Erstaunen eine Autovermietung. Ich mietete mir einen offenen Jeep. Die beiden Jungs luden mein Gepäck ein und ich fuhr los. Kurz hinter dem Flughafen begann ein Wald aus Kokospalmen. Die Luft war erfüllt von den schrillen Schreien der farbenprächtigen Papageien, die überall in den Wipfeln saßen. Blauschimmernde Kolibris schwirrten stehend in der Luft und beäugten mich neugierig. Durch die Stämme hindurch leuchtete die blaue Lagune im Sonnenglanz. Ich hatte das Gefühl, das Paradies gefunden zu haben. Wie glücklich müssen die Menschen sein, die hier leben dürfen, dachte ich.Die schmale Straße stieg leicht an. Hinter dem Wäldchen erblickte ich unter mir eine weit geschwungene Bucht, neben deren Sandstrand sich ein kleines Bungalowdorf mit einigen Pfahlbauten erstreckte. Sie waren in die Lagune hinein gebaut und durch Holzstege miteinander verbunden. An einer kleinen Abzweigung vor mir tauchte ein Schild mit der Inschrift „Hotel Kia Ora“ auf. Kurz entschlossen bog ich ab und fuhr hinunter zu der Anlage. Die hübsche Rezeptionistin hatte eine lustige Afrofrisur. Ihre Haut war von der Sonne getönt und bildete einen faszinierenden Kontrast zu ihren blauen Augen, die wie Saphire funkelten. Sie begrüßte mich überaus freundlich. Auf meinen Wunsch zeigte sie mir einen der Over-Water-Bungalows. Er bestand aus einem großen Schlaf-Wohn-Raum und einem angrenzenden Bad. Der Hauptraum war mit einem Kingsize-Bett, einer Kommode, einem Schrank, einem Schreibtisch, einem Stuhl, zwei Sesseln und einer Couch im Rattanstil möbliert. Die Einrichtung sah elegant und gemütlich aus. Das Bad hatte eine geräumige Dusche, ein Waschbecken, eine Toilette und zwei Schränke. Es war groß, hell und luftig. Von jedem Winkel des Bungalows hatte ich einen freien Blick über die Lagune, deren Wasser unter mir gegen seine Pfähle plätscherte. Es war das einzige Geräusch, das zu hören war. Ich war restlos begeistert. Meine Begleiterin nannte mir einen stolzen Preis für die Übernachtung und sah mich erwartungsvoll an. Die utopische Summe war mir egal. Es war schon immer etwas teurer, einen exquisiten Geschmack zu haben. „Der Bungalow gefällt mir sehr gut. Ich nehme ihn für eine Woche .“ Sie lächelte zufrieden. Wir gingen zur Rezeption zurück, um die Formalitäten zu erledigen. Unterwegs erzählte sie mir, dass sie aus Montreal kam. Da sie zweisprachig war und hier viele Franzosen und Amerikaner Urlaub machten, hatte sie den Job bekommen. Ich wäre der erste Deutsche, der bisher hier gewesen war. Ihre liebenswürdige Art gefiel mir. Spontan fragte ich sie, ob ich sie zum Abendessen einladen dürfte, damit sie mir mehr über die Insel erzählen konnte. Sie sah mich kurz an, lächelte und sagte ja. Sie hieß Loni. Wir verabredeten uns für 18.30 Uhr, das war kurz nach Sonnenuntergang. Nach dem Ausfüllen des Anmeldeformulars setzte ich mich an die Hotelbar und bestellte mir einen Cocktail. Ein Mann in Shorts und einem weißen Hemd betrat die Bar und ließ sich neben mir nieder. Er war nicht mehr ganz jung, hatte einen kleinen, graugesprenkelten Bart und ein schmales, von der Sonne dunkelbraun gefärbtes Gesicht. Der Barkeeper begrüßte ihn wie einen alten Bekannten. Er bestellte sich einen Scotch. Während wir auf unsere Drinks warteten, kamen wir ins Gespräch. Er war Holländer und freute sich, mit mir Deutsch reden zu können. Wie er mir erzählte, lebte er mehr als dreißig Jahre auf Moorea. Als er hierher kam, war er lungenkrank. Das Klima hatte ihn in ein paar Tagen komplett geheilt. Er verliebte sich in die Insel und blieb. „Ich bin genauso begeistert von Moorea wie du, aber enttäuscht von Tahiti“, sagte ich. „Auf allen Bürgersteigen von Papeete lungern betrunkene Männer herum. Vom Taxi aus habe ich in die Geschäfte geblickt und zu meinem Erstaunen gesehen, dass die Regale mit französischem Wein und Käse, Erbsendosen, Maggi und Krabbenkonserven aus Dänemark gefüllt waren. Nirgendwo waren einheimische Produkte zu sehen.“„Ja, es ist schockierend“, antwortete er. „Das Baguette ist jetzt Hauptnahrungsmittel und statt tropischer Früchte werden französische Äpfel gegessen. Im gleichen Maße wie die traditionelle Ernährung sind auch die einheimischen Kleidungsstücke, Sitten und Gebräuche verschwunden. Für diese Zustände sind nur die Atomversuche der Franzosen auf der Mururoa Koralleninsel verantwortlich. Über den eigens gebauten modernen Flughafen in Faa’a überschwemmten ab Mitte der sechziger Jahre zwischen 15.000 und 20.000 französische Militärangehörige und Techniker Tahiti - mit damals 50.000 Einwohnern - und weitere Inseln des französischen Übersee-Territoriums. Kinos, Clubs und Bars wurden gebaut, später auch Videoshops. Um die Probleme mit dem neuentstandenen Männerüberschuss zu lösen, wurde sogar diskutiert, Bordelle mit Prostituierten aus Asien einzurichten. Der Alltag der Polynesier, die zuvor nicht einmal mit einem Flughafen an die Welt angeschlossen waren, änderte sich rapide. Trotz verbreiteten Unwissens kam es zu vielfältigen Protesten gegen die Atomtests auf Tahiti, die aber jahrelang genauso wenig Beachtung fanden wie die auf den Tausende von Kilometern entfernten Inseln von Samoa und Fidschi, obwohl dort radioaktiver Niederschlag gemessen wurde. Schließlich wurde das Fischen im Südpazifik verboten. An den durch die Atomexplosionen zerstörten Korallenriffen siedelt sich eine besondere Algenart an, auf der giftproduzierende Geißeltierchen gedeihen. Den Fischen, die mit den Algen das Gift aufnehmen, scheint es wenig auszumachen, im Gegensatz zu den Menschen am Ende der Nahrungskette. Bei ihnen führt die Fischvergiftung Ciguatera zu schweren neurologischen Störungen, mit Lähmungen und Magen-Darm-Beschwerden, die monatelang anhalten und sogar zum Tode führen können. Während bei diesen Fischvergiftungen die Kausalitätskette heute unbestritten ist, bleiben alle weiteren schweren Erkrankungen geheimnisvoll, an denen viele Polynesier litten und leiden, die auf Mururoa gearbeitet haben. Die möglichen Folgen radioaktiver Bestrahlung sind unter Wissenschaftlern wenig umstritten: bestimmte Krebserkrankungen, Fehlgeburten, Missbildungen bei Neugeborenen, Schädigungen des Immunsystems. Es kann nur sehr schwer nachgewiesen werden, dass Krebs bei einer Einzelperson auf Radioaktivität zurückgeht und nicht auf andere Faktoren. Vermutungen lassen sich am ehesten bestätigen, wenn in einer Bevölkerungsgruppe ein überdurchschnittlich hoher Prozentsatz an bestimmten Krankheiten leidet. Seit Ende 1963 wurden keine polynesischen Krankheitsstatistiken mehr veröffentlicht. Wann immer ein Arbeiter erkrankte, wurde er gleich in ein französisches Militärhospital auf Tahiti gebracht und in schweren Fällen nach Paris ausgeflogen. Zugang zu ihren Krankenakten haben die Polynesier bis heute nicht. Viele Leidensgeschichten gleichen den Krankheitsfällen in anderen radioaktiv verseuchten Gegenden der Erde. Bei einem kurzen Besuch der französischen Ärzteorganisation Médecins du Mondein Tahiti haben die Ärzte sehr seltene Krebsarten entdeckt und waren allgemein über die Art der medizinischen Betreuung entsetzt. Deshalb beschlossen sie, eine größere Untersuchung zu starten, die nicht nur die ehemaligen Mururoa-Arbeiter und ihre Familien einschließen soll, sondern auch die Nachbarinseln der Atombombentests.Die traditionell als Fischer arbeitenden Polynesier haben wegen des Fangverbotes ihre Jobs verloren. Diejenigen, die nicht in den Atomtestgebieten der Franzosen arbeiten wollen, erhalten eine monatliche Entschädigung aus Paris. Da sie keine andere Arbeit finden, setzen sie das Geld in Alkohol um und trinken den ganzen Tag mit ihren ehemaligen Kollegen. Sie lungern mit Sixpacks von Bierdosen und billigem Fusel auf den Bürgersteigen Papeetes herum, weil sie nicht genug Moneten für teure Drinks in Bars haben. Du siehst, das ehemalige Paradies auf Erden wurde massiv vergiftet und das Leben der Insulaner auf den Kopf gestellt. Heute müssen die Bewohner des einst fischreichsten Gewässers des Planeten ihre Fische aus Paris importieren. Die gesundheitlichen Folgen der Nuklearversuche lassen sich nicht mehr ungeschehen machen. Aber die Menschen könnten etwas von ihrer Würde zurückerhalten, wenn ihre Regierung sie ernst nähme - auch wenn sie weit weg von ihrem ´Mutterland` leben, in einer dünn besiedelten Weltgegend, die gerade deshalb für die krankmachenden Atomtests auserkoren wurde.“Ich war fassungslos. Die Ausmaße der Folgen dieser Umweltkatastrophe waren mir nicht bekannt gewesen. Es schockte mich, dass der gewissenlose Mensch in seiner Profitgier und Kriegslüsternheit auch vor diesem Paradies nicht zurückgeschreckt war und es massiv beschädigt und verseucht hatte. Als ich etwas sagen wollte, kam Loni herein, um mit dem Barkeeper zu sprechen. Sie sah uns und begrüßte den Holländer sehr herzlich. Offensichtlich kannte sie ihn gut. Dann verschwand sie wieder. Aber nicht, ohne mir kurz zuzublinzeln. Mein aufmerksamer neuer Bekannter hatte es bemerkt. „Sie ist ein sehr nettes Mädchen. Aber sei vorsichtig. Liebe kann verheerend sein.“ Ich sah ihn erstaunt an. Er wechselte das Thema und erzählte mir, dass er Maler wäre. Fast alle Briefmarken von Französisch Polynesien waren von ihm entworfen worden. Spontan lud er mich zum Abendessen zu sich nach Hause ein. Ich sagte ihm, dass ich bereits verabredet wäre. „Wenn deine Verabredung Loni heißt, dann bring sie mit. Ich mag sie sehr gerne.“„Ich kann es nicht versprechen, aber ich werde es ihr vorschlagen“, antwortete ich.„Oh, sie wird einverstanden sein. Sie war schon ein paar Mal zum Essen bei mir. Sie mag mein Haus. Nein, keine Sorge, ich bin verheiratet, da war nie etwas zwischen uns“, sagte er, als er meine hoch gezogene Braue bemerkte. „Ihr müsst euch nicht anmelden, ich bin heute Abend zuhause. Kommt einfach vorbei.“Am Abend holte ich Loni an der Rezeption ab. Als sie überlegte, in welches Restaurant wir gehen könnten, erzählte ich ihr von seiner Einladung. Sie war sofort einverstanden. Wir stiegen in meinen Leihwagen und sie dirigierte mich zu seinem Anwesen. Sein Haus lag auf der anderen Seite eines Baches, den ich mit meinem Jeep nicht durchqueren konnte. Eine schmale Brücke aus zwei nebeneinender gelegten Stämmen von Kokosnusspalmen führte hinüber. Es gab kein Geländer und wir hielten uns an den Händen fest, um die Balance zu halten. Am anderen Ufer des Baches zog ich sie an mich und wir küssten uns. Wir blieben eine Weile Arm in Arm stehen, um die Schönheit dieses paradiesischen Ortes auf uns wirken zu lassen. Der sehr solide aussehende Bungalow des Holländers lag inmitten von blühenden Büschen, die bis zum Dach hinaufwuchsen und es fast verdeckten. Ihr schwerer süßlicher Duft lag wie ein Parfum in der Luft und benebelte mir die Sinne. Sie grenzten an einen Palmenwald, der dicht hinter dem Haus begann und wie ein natürlicher Schutzwall wirkte. An der Vorderseite befand sich eine überdachte Veranda, von der man einen traumhaften Blick auf eine kleine Bucht unterhalb des Hauses und über die Lagune hatte. Bezaubert liefen wir Hand in Hand zu dem Bungalow. Seine Tür war offen und wir traten ein. Der Holländer stand mit einem Glas Whisky in der Hand in der Tür einer geräumigen, mit einem amerikanischen Kühlschrank und allen notwendigen Geräten ausgestatteten Küche. Er schaute einer dicken Insulanerin zu, die vor einem Gasherd stand und mit einem großen Löffel in einem Topf herumrührte. Sie trug einen Pareo und ein buntes Kopftuch, unter dem ihre grauen langen Haare hervorquollen. Nichts unterschied sie von den Frauen, die ich bei meiner Ankunft in Papeete gesehen hatte. Ich dachte, sie wäre seine Köchin. Er freute sich, als er uns erblickte und begrüßte uns herzlich. Zu meiner Überraschung stellte er uns die Köchin als seine Frau vor. Sie nickte uns gelangweilt zu und widmete sich wieder ihrem Topf. Er führte uns in ein großes Wohnzimmer. Verblüfft blieb ich stehen. In einer Ecke des Raumes stand ein kleines Piano mit einem aufgeschlagenen Notenbuch. Alle vier Wände waren von der Decke bis zum Boden mit Regalen bedeckt, in denen Rücken an Rücken unzählige Bücher standen. Es mussten mehrere Tausend sein. Noch nie hatte ich so viele in einem Privathaus gesehen.„Hast du die alle gelesen?“ fragte ich ihn.„Die meisten“, antwortete er kurz. Beeindruckt sah ich ihn an. Immer weniger verstand ich, dass ein so intelligenter, kultivierter und belesener Mann mit so einer unförmigen, unfreundlichen und vermutlich nicht besonders gebildeten Matrone zusammen lebte. Er fragte uns, was wir zu trinken haben wollten. Loni wollte eine Cola und ich einen Scotch. Er ließ uns allein, um das Gewünschte zu holen. „Die Beiden sind ein seltsames Paar. Sie passen überhaupt nicht zusammen. Oder siehst du das anders?“ fragte ich Loni. „Oh, sie haben gerade ihren dreißigsten Hochzeitstag gefeiert. Aber ihre Ehe ist eine tragische Geschichte. Frag ihn, vielleicht erzählt er sie dir.“Das Essen war vorzüglich. Es gab eine köstliche Gemüsesuppe, einen nach thailändischer Art zubereiteten Loup de Mer und als Nachspeise frische Ananas und Mangos mit Eis. Dazu kredenzte er uns einen gut gekühlten, trockenen Chablis. Wir aßen mit gutem Appetit und unterhielten uns angeregt mit dem Hausherrn. Er war ein geistreicher Erzähler, der nicht nur über die Lage im Südpazifik, sondern auch über das Geschehen in Europa und dem Rest der Welt bestens informiert war. Wir diskutierten über die verlogene, einseitige Berichterstattung in den Medien und die Leichtgläubigkeit der Masse. Er zitierte Shakespeare und sprach vom „fickleness of the mob“. Loni beeindruckte mich mit ihren klugen und durchdachten Äußerungen. Trotz der ernsten Themen lachten wir viel und waren bester Laune. Nur seine Frau blieb teilnahmslos und einsilbig. Sie antwortete nur sehr widerwillig und unfreundlich, als ich sie höflich nach der Rezeptur ihrer Suppe fragte. Sie schien froh zu sein, wenn sie zwischen den Gängen wieder in ihrer Küche arbeiten konnte. Nachdem wir unseren Nachtisch gegessen hatten, servierte unser Gastgeber einen grünen Chartreuse, meinen Lieblingsdigestif. Er hatte wirklich Format und war nicht nur ein Connaisseur was Essen und Trinken betraf. Immer weniger verstand ich diese Ehe. Seine Frau stand auf und räumte das Geschirr ab. Wir hörten, wie sie in der Küche hantierte und abspülte. Ich fand, dass der Zeitpunkt günstig war, um ihm auf den Zahn zu fühlen. „Was hat deine Frau? Ist sie sauer, dass wir unangemeldet vorbei gekommen sind?“ fragte ich betont harmlos.Sofort wurde er ernst. „Nein, das hat mit euch nichts zu tun. Sie ist immer so. Sie hat mir viele Jahre das Leben zur Hölle gemacht.“Tränen traten in seine Augen. Er nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Glas Chartreuse und gab sich einen Ruck. „Also gut, ich erzähle dir unsere Geschichte. An der Stelle, wo jetzt mein Haus steht, lebte als junges Mädchen meine Frau. Damals war es eine einfache Bambushütte mit einem Dach aus Palmblättern. Sie stand leer, weil der ehemalige Besitzer gestorben war und keine Erben hatte. Da war sie einfach eingezogen. Es war schon damals ein kleines Paradies. Um ihre Hütte herum wuchsen Büsche und Blumen, die auch heute noch stehen. Ich habe nur den Weg zum Haus frei geschnitten. Als ich den idyllischen Platz von der Brücke aus das erste Mal erblickte, hielt ich ihn für den schönsten, den ich jemals gesehen hatte. Es lag ein besonderer Zauber über diesen Ort. Bald fand ich heraus, dass es ihre Liebe war, die sich hier ausgebreitet hatte wie die vom Wind in einer Wiese verteilten zarten Blütengebilde der Pusteblume. Ich habe den Eindruck, dass Orte, an denen Menschen geliebt oder gelitten haben, immer ein schwaches Aroma von ihren Gefühlen haben, das niemals ganz verschwindet. Als ob diese Plätze eine spirituelle Dimension erhalten haben, die mysteriöser weise alle berührt, die vorbei kommen.“Ich sah ihn verwundert an. Er bemerkte meine Verwirrung, zuckte mit den Schultern und fuhr ohne darauf einzugehen fort. „Sie lebte hier zurückgezogen und allein, bis eines Tages Beau in der Bucht neben der Mündung des kleinen Flusses landete. Er war ein amerikanischer Seemann und von einem Kriegsschiff desertiert, das in Papeete vor Anker lag. Ein paar von ihm bestochene Fischer hatten ihn mit einem kleinen Boot hier herüber gesegelt und in der Bucht neben der Mündung des Flusses abgesetzt. Beau wurde so genannt, weil er wahrscheinlich der schönste Mann war, den man je gesehen hat. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die ihn kennen gelernt haben. Sie stimmten alle darin überein, dass seine Schönheit jedem, der ihn das erste Mal sah, den Atem raubte. Er war ungefähr 1,90 groß und hatte schulterlange schwarze Haare, die im Sonnenlicht glänzten als hätte er einen Heiligenschein. Er war gebaut wie ein griechischer Gott, breite Schultern und schmale Hüften. Seine Haut war weiß und wie Satin. Es war die Haut einer Frau. Als er in der Bucht stand und die beglückende Atmosphäre des Platzes auf sich wirken ließ, beobachtete sie ihn durch die Spalten zwischen den Bambusstangen. Sie trat aus der Hütte, winkte ihm zu und lud ihn ein, zu ihr zu kommen. Er verstand kein Wort ihrer Maohi-Sprache. Aber er begriff, was ihre Gesten und ihr Lächeln bedeuteten und kam zu ihr. Er setzte sich auf eine Matte und sie fütterte ihn mit Stückchen von Ananas. Ich kenne Beau nur vom Hörensagen, aber ich traf sie drei Jahre nach ihm. Damals war sie neunzehn Jahre. Ihre Schönheit war atemberaubend. Sie war ziemlich groß, schlank und besaß die schönen ebenmäßigen Züge ihrer Rasse. Mit großen, warmen Augen, die auf mich still und tief wie ein See unter Palmen wirkten. Ihre schwarzen lockigen Haare fielen ihren Rücken herunter und sie duftete nach allen Blumen der Insel. Ich kann sie nicht wirklich beschreiben. Sie war zu schön, um wahr zu sein.“Er machte eine Pause. Sein Blick schweifte über seine vollgestopften Bücherregale. Die Erinnerung an ihre ehemalige Schönheit hatte ihn erschüttert. Gebannt wartete ich auf die Fortsetzung seiner Geschichte.„Diese beiden jungen Menschen, sie war sechzehn und er zwanzig, verliebten sich auf den ersten Blick. Es war die wahre Liebe. Sie hatte nichts zu tun mit der Vernunftmäßigen, die aus Sympathie, gemeinsamen Interessen oder intellektuellen Gemeinsamkeiten entsteht. Dies war Liebe, rein und einfach. Es war die Liebe, die Adam für Eva empfand, als er sie das erste Mal im Garten Eden erblickte. Die Art von Liebe, die Tiere und Götter zueinander zieht und die die Welt und das Leben zu einem Wunder werden lässt. Manche sagen, dass es bei zwei Liebenden immer einen gibt, der liebt, und einen anderen, der sich lieben lässt. Aber ab und zu gibt es zwei, die lieben und sich lieben lassen. Dann bleibt die Sonne stehen, um ihnen zuzusehen.“Er schenkte sich Chartreuse nach. Ich dachte an den Erpel, der sich aus Liebe geopfert hatte, und verstand genau, was er meinte.„Sogar heute noch, nach all den Jahren, versetzt es mir einen Stich, wenn ich an diese beiden einfachen, glücklichen Menschen und ihre Liebe denke. Genauso wie es mir geht, wenn ich in bestimmten Nächten den Vollmond an einem wolkenlosen Himmel die Lagune bescheinen sehe. Sie war gut, süß und freundlich. Ich weiß nichts von ihm. Aber ich stelle mir vor, dass sein Herz genauso schön war wie sein Körper. Man sagt, dass glückliche Menschen keine Geschichte und keine Zukunft haben. Die Beiden lebten nur im Hier und Jetzt. Sie machten den ganzen Tag nichts und trotzdem schienen die Tage ihnen viel zu kurz zu sein. Er lernte ihre einfache Sprache. Stundenlang lag er auf der Matte, während sie fröhlich schwätzte und ihm belanglose Geschichten von dem Leben auf der Insel erzählte. Er war ein ruhiger, phlegmatischer Zeitgenosse und sein Verstand etwas träge. Tiefgründigkeit war ihm fremd. Seine Hauptbeschäftigung war es, ununterbrochen die Zigaretten zu rauchen, die sie ihm den ganzen Tag ohne zu ermüden aus Pandanus Blättern drehte. Manchmal kamen Frauen aus dem Nachbardorf vorbei und erzählten ihm Geschichten von alten Zeiten, in denen die verschiedenen Stämme der Insel wild gegeneinander kämpften. Manchmal ruderte er in einem Auslegekanu zum Riff und brachte einen Korb voll bunter Fische mit nach Hause. In einigen Nächten ging er mit einer Laterne zum Hummerfischen. Sie wusste, wie man einfache, aber köstliche Mahlzeiten aus den Schalentieren, Kokosnussbrei und den Früchten des Brotfruchtbaumes zubereitete. Einmal tötete er ein kleines Schwein und sie brieten es auf einem heißen Stein. Es war ein Festtag für sie. Tagsüber badeten sie zusammen in dem kleinen Fluss und am Abend paddelten sie mit ihrem Auslegerkanu hinaus in die Lagune, die ihre Farben während des Sonnenuntergangs ständig veränderte. Sie war wie ein Zaubergarten und die um ihr Boot herum fliegenden Fische waren wie Schmetterlinge. So verging Tag um Tag. Die Wochen wurden zu Monaten und ein Jahr war vergangen. Sie liebten sich leidenschaftlich. Ich möchte das Wort eigentlich nicht benutzen, denn es hat immer einen Schatten der Trauer, ein wenig Bitterkeit oder Zorn. Besser ist aus vollem Herzen. Sie liebten sich so einfach und natürlich wie an dem ersten Tag, an dem sie erkannten, dass in ihnen ein Gott wohnte. Beide dachten, dass ihre Liebe niemals schwächer werden könnte. Ein essenzielles Element der Liebe ist der Glaube an die eigene Unsterblichkeit. Und doch gab es in Beau bereits ein winziges Saatkorn, von ihm selbst nicht erkannt und unbemerkt von ihr, das zur gegebenen Zeit zur Langeweile und Gleichgültigkeit heranwachsen würde. Manchmal träumte er von seiner Arbeit als Matrose, von geschäftigen Hafenstädten und der unendlichen Weite des Ozeans.Eines Tages berichtete ihm ein Junge aus dem Nachbardorf, dass in der Bucht ein englisches Walfangschiff vor Anker lag. Die Zigaretten aus Pandanus-Blättern waren ausreichend, um sein Bedürfnis zu Rauchen zu befriedigen. Aber er sehnte sich nach echtem Tabak. Ihm lief das Wasser im Munde zusammen, wenn er an eine gut gestopfte Pfeife dachte. „Ich werde versuchen, ein bisschen Tabak gegen Früchte einzutauschen. Hilfst du mir, welche zu pflücken?“ fragte er sie.Sie gingen zusammen mit dem Jungen auf einen Hügel, sammelten einen großen Korb mit Kokosnüssen, wild wachsenden Orangen und Bananen und trugen ihn zu der Bucht. Beau und der Junge luden den Korb in ein Auslegerkanu und paddelten zu dem ankernden Walfänger. Er winkte ihr zu, bevor er und der Junge mit dem Korb das Fallreep an der Bordwand hinauf kletterten. Es war das letzte Mal, dass sie ihn sah.Am nächsten Morgen kam der Junge alleine zu ihr. Unter Tränen erzählte er ihr, wie sie an Bord geklettert waren und ein weißer Mann sie freundlich empfangen hatte. Beau und er redeten miteinander und wurden sich einig. Der Mann war der Kapitän des Schiffes. Er ließ den Obstkorb von zwei seiner Männer unter Deck bringen. Ein Matrose brachte Beau eine Pfeife und einige Päckchen Tabak. Beau riss sofort eins auf, stopfte die Pfeife und zündete sie an. Er sog den Rauch ein und schloss genießerisch die Augen. Der Kapitän sagte etwas zu ihm und sie gingen in eine Kabine. Der Junge beobachtete durch ein Fenster, wie der Kapitän eine Flasche auf den Tisch stellte. Beau trank und rauchte. Der Junge hatte das Interesse verloren. Er rollte sich an der Kabinenwand zusammen und schlief ein. Durch einen harten Tritt wurde er brutal geweckt. Erschrocken sprang er auf und bemerkte, dass das Schiff langsam aus der Lagune segelte. Durch das Fenster der Kabine sah er, wie Beau mit dem Kopf auf dem Arm vor der leeren Flasche am Tisch saß und fest schlief. Er wollte zu ihm laufen und ihn wecken. Aber eine harte Hand ergriff seinen Arm und hielt ihn fest. Jemand hob ihn hoch und warf ihn über Bord. Er schwamm zu dem Kanu und paddelte schluchzend ans Ufer. Der Kapitän brauchte Leute und hatte Beau einfach geschanghait. Sie war außer sich vor Kummer. Sie weinte und schrie drei Monate lang. Niemand konnte sie trösten. Sie aß nichts. Völlig erschöpft versank sie in einer dumpfen Apathie. Tagaus tagein saß sie in der Bucht und beobachtete den Horizont. Stunde um Stunde lag sie auf dem weißen Sand und die Tränen liefen ihr unaufhörlich über die Wangen. Vier Monate später brachte sie ein Kind zur Welt, das aber bei der Geburt starb. Alle Lebensfreude war aus ihr verschwunden. Nie gab sie ihre feste Überzeugung auf, dass Beau eines Tages wieder kommen würde.“Er machte eine Pause und genehmigte sich wieder einen großen Schluck seines Chartreuse. Dann sah er mich mit geröteten Augen verzweifelt an. „Als ich sie das erste Mal in der Bucht sitzen sah, verliebte ich mich Hals über Kopf in sie. Es war diese Melancholie in ihren Augen, die mich magisch anzog. Ich meinte, die Aura ihrer tiefgründigen Seele zu sehen. Sie verzauberte mich. Ich war ihr vom ersten Augenblick an verfallen. Als ich mich im Dorf nach ihr erkundigte, erfuhr ich ihre Geschichte. Ich konnte es kaum glauben, dass es unter den Inselbewohnern, deren Gefühle zwar heftig, aber schnell vergänglich sind, eine Frau gab, die so lange so leidenschaftlich liebte. Ihretwegen lernte ich die Sprache der Einheimischen. Als ich sie einigermaßen beherrschte, ging ich zu ihr und stellte mich ihr vor. Ihre erste Frage war, ob ich bei meiner Anreise Beau getroffen hätte. Sie beschrieb ihn mir mit leuchtenden Augen. Ich sagte nein und sie wandte sich enttäuscht von mir ab. Sie hatte komplett das Interesse an mir verloren. Aber ich gab nicht auf. Ich lauerte ihr auf und lief ihr immer wieder absichtlich über den Weg. Jedes Mal grüßte ich sie betont freundlich, aber sie ignorierte mich und würdigte mich keines Blickes. Eines Tages fasste ich mir ein Herz. Ich ging zu ihr und fragte sie, ob sie mit mir zusammenleben wollte. Sie sah mich mit einem eisigen Blick an und sagte nein. Ich hatte das erwartet, aber ich gab nicht auf. Also erzählte ich ihrer alten Tante, die wie ich heraus gefunden hatte ihre einzige Verwandte war, und ihren Nachbarn von meinem Vorhaben. Alle fanden es gut. Sie waren fröhliche Menschen und sie ging ihnen auf die Nerven mit ihrem ewigen Kummer. Ihre Tante und die Nachbarn fingen an, auf sie einzureden, mein Angebot anzunehmen. Nach den Standards der Insel war ich ein reicher Mann. Sie weigerte sich. Aber ihr Widerstand fachte meine Liebe noch stärker an. Von nun an belagerte ich sie täglich. Schließlich sah sie ein, dass Beau nie zurückkommen würde. Ermüdet von allen Einflüsterungen und meiner Hartnäckigkeit gab sie schließlich nach und sagte ja. Als ich sie am nächsten Tag außer mir vor Freude besuchte, hatte sie ihre Hütte nieder gebrannt, in der sie mit Beau gehaust hatte. Sie wollte auf keinen Fall auch mit mir in ihr leben. Es machte mir nichts aus. Ich baute den Bungalow, in dem wir gerade sitzen.Sie willigte ein, meine Frau zu werden. Bei unserer Hochzeit nach den Traditionen ihres Stammes war ich überglücklich. Aber schon nach den ersten Tagen unserer Ehe war mir klar, dass sie nichts für mich empfand. Sie erfüllte ihre ehelichen Pflichten ohne jede Anteilnahme. Hilflos musste ich akzeptieren, dass sie Beau immer noch liebte. Sie würde mich auf sein kleinstes Zeichen sofort verlassen, wenn er zurückkäme. Trotz dieses Wissens beschloss ich, um ihr Herz zu kämpfen. Ich versuchte, es mit Freundlichkeit und meiner liebevollen Art zu gewinnen. Aber meine Bemühungen interessierten sie nicht. Sie zeigte keinerlei Reaktion und blieb kühl. Also täuschte ich vor, sie zu ignorieren. Es war ihr nicht nur egal, sondern sogar angenehm. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Aus Verzweiflung schrie ich sie wegen jeder Kleinigkeit an. Schließlich verprügelte ich sie wie einen widerspenstigen Esel. Ohne einen Laut von sich zu geben, ertrug sie meine Schläge. Sie lächelte nur kalt und sah mich verächtlich an. Meine Liebe zu ihr wurde zu meinem Gefängnis, aus dem ich vergeblich immer wieder auszubrechen versuchte. Ich reiste zu anderen Inseln und hatte Affären. Aber die verstärkten meine Liebe zu ihr nur noch. Ich hatte nicht die Kraft, sie zu verlassen und wurde immer niedergeschlagener wegen ihrer Teilnahmslosigkeit. Es war eine jahrelange Folter, sie tagtäglich so gleichgültig und abweisend zu erleben. Erst nach vielen Jahren wurden meine Gefühle für sie taub und hoffnungslos. Am Ende hatte sich mein Feuer selbst verbrannt. Wenn ich sah, wie sie am Abend auf der Veranda saß und immer noch sehnsüchtig auf die Lagune starrte, empfand ich nicht mehr Wut und Verzweiflung, sondern Mitleid. Über dreißig Jahre leben wir jetzt zusammen, gebunden von Gewohnheit, Kompromissen und Bequemlichkeit. Heute blicke ich mit einem bitteren Lächeln zurück auf meine ehemalige Leidenschaft. Ich liebe sie nicht mehr, sondern toleriere sie und akzeptiere ihre Gegenwart. Die Tragödie der Liebe ist nicht ein Tod oder eine Trennung. Die Tragödie der Liebe ist die Gleichgültigkeit. Heute bin ich glücklich mit meinem Piano und meinen Büchern.“ Er schwieg. Auch ich war sprachlos. Vergeblich versuchte ich mir die ehemalige Schönheit und die Anziehungskraft des dicken, unfreundlichen Weibes in der Küche vorzustellen. Ich malte mir aus, wie sehr er unter den Phantomen seiner Ehe gelitten haben musste. Auf einmal fühlte ich mich sehr unwohl in dem Haus, das so viel Qual und Leid gesehen hatte. Ich wollte gehen und entschuldigte mich mit meiner Müdigkeit. Wir tranken aus und er verabschiedete uns mit einem sanften Händedruck. Seine Frau nickte uns nur kurz zu, als wir an ihrer Küche vorbei gingen. Loni und ich liefen händchenhaltend über die Brücke. Am anderen Ende blieben wir stehen und blickten zurück zu dem Bungalow. Der sternenklare Tropenhimmel beschien das idyllische Terrain. Es war unbegreiflich für mich, dass sie diesen paradiesischen Platz in eine Hölle auf Erden verwandelt hatten.Er hatte das Licht gelöscht und das Haus war dunkel. Auf der Veranda saß in einem Lehnstuhl seine Frau. Ich konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Aber ich war sicher, dass sie auf die Lagune hinaus blickte.
Wir fuhren schweigend nach Hause. Im Hotel fragte ich Loni, ob sie noch mit zu mir kommen wollte, um unter dem Sternenzelt noch etwas zu trinken. Ich wollte ungern allein sein. Zu sehr hatte mich die Geschichte des holländischen Malers berührt und aufgewühlt.
„Gerne“, sagte sie. Kurz darauf saßen wir mit einer Flasche Chablis aus der Minibar nur ein paar Zentimeter oberhalb der Wasseroberfläche der Lagune auf der Terrasse meines Bungalows. Ich ergriff ihre Hand. Angesichts der unendlichen Zahl von Sternen über uns fragte ich sie, welche Bedeutung so eine menschliche Tragödie für das Universum haben könnte.