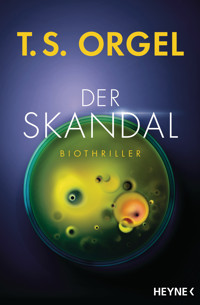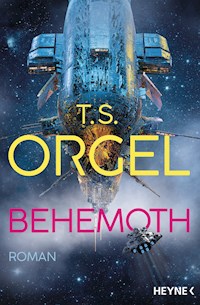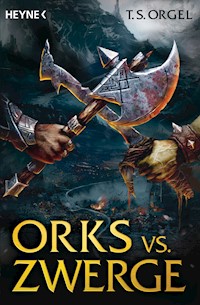7,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Frankfurt am Main, im Jahr 1830. Während eines rauschenden Fastnachtsballs wird Millicent Wohl, eine junge und wissbegierige Frau, plötzlich Zeugin eines brutalen Raubüberfalls in einem Museum. Eine schwarze Gestalt eilt an ihr vorüber – und verschwindet im Nichts. Milli versucht den Diebstahl aufzuklären, doch niemand glaubt ihren Hinweisen. Da erhält sie Hilfe von unerwarteter Seite: der alte Goethe ist inkognito in Frankfurt, und der Dichterfürst hat ein großes Interesse an der Wiederbeschaffung des Diebesguts. Eine atemlose Jagd auf finstere Mächte und Sagengestalten beginnt …
- Der Hörspielerfolg vom SPIEGEL-Bestseller-Autorenduo T. S. Orgel – jetzt auch als Roman
- Frankfurt, 1830: Im Keller eines Museums verschwindet ein Schädel, und die Spur führt eine junge Frau ins finstre Herz alter Mythen und Legenden
- Ein historischer Mystery-Krimi für alle Fans von Markus Heitz’ »Die Meisterin« und Brigitte Riebes »Die Pestmagd«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Frankfurt am Main, im Jahr 1830. Während eines rauschenden Fastnachtsballs wird Millicent Wohl, eine junge und wissbegierige Frau, plötzlich Zeugin eines brutalen Raubüberfalls in einem Museum. Eine schwarze Gestalt eilt an ihr vorüber – und verschwindet im Nichts. Milli versucht den Diebstahl aufzuklären, doch niemand glaubt ihren Hinweisen. Da erhält sie Hilfe von unerwarteter Seite: der alte Goethe ist inkognito in Frankfurt, und der Dichterfürst hat ein großes Interesse an der Wiederbeschaffung des Diebesguts. Eine atemlose Jagd auf finstere Mächte und Sagengestalten beginnt …
T. S. Orgels »Die Schattensammlerin« kann auch als aufwendig inszeniertes Hörspiel erlebt sowie als E-Book gelesen werden.
Die Autoren
Hinter dem Pseudonym T. S. Orgel stehen die beiden Brüder Tom und Stephan Orgel. In einem anderen Leben sind sie als Grafikdesigner und Werbetexter beziehungsweise Verlagskaufmann beschäftigt, doch wenn beide zur Feder greifen, geht es in fantastische Welten. Ihr erster gemeinsamer Roman »Orks vs. Zwerge« wurde mit dem Deutschen Phantastik Preis für das beste deutschsprachige Debüt ausgezeichnet. Seitdem haben sie mit »Die Blausteinkriege«, »Terra« und »Die Schattensammlerin« noch viele weitere Welten erkundet.
Mehr über Tom und Stephan Orgel und ihr Werk finden Sie auf:
www.ts-orgel.de
T. S. ORGEL
DICHTER und DÄMONEN
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 6/2022
Copyright © 2022 by Thomas und Stephan Orgel
Copyright © 2022 dieser Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung und -illustration:DASILLUSTRAT, München,unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-28410-7V001
www.heyne.de
Inhalt
1. Der Diebstahl
2. Der Geheimrat
3. Spurensuche
4. Fenstersturz
5. Der Zirkus
6. Eine Reise nach Offenbach
7. Schillers Worte
8. Main, Mythen und Legenden
9. Von Wolzogens Vermächtnis
10. Die Senckenberg-Akten
Verzeichnis handelnder Personen
1.
Der Diebstahl
Ein wilder Zug aus maskierten Gestalten schob sich mit Trommeln, Fackeln und Trompeten durch die Altstadt der freien Stadt Frankfurt, um mit vereinten Kräften den Römer zu erobern. Man schrieb das Jahr 1830.
Napoleons Kriege hatten tiefe Wunden in der Seele der hessischen Handelsmetropole hinterlassen, und die Menschen konnten sich noch viel zu genau an das »Jahr ohne Sommer« erinnern. Jene schrecklichen Monate, in denen die Sonne nicht mehr scheinen wollte und schwere Unwetter und Überschwemmungen das Korn auf den Feldern hatten verfaulen lassen. Die Menschen wussten, was Unheil und Elend bedeuteten, doch in der Fastnacht, die in jenem Jahr auf den dreiundzwanzigsten Februar fiel, waren die tief verschneiten Gassen Frankfurts bis zum Bersten mit bunten Gewändern gefüllt. Das Geschrei und der Lärm der Narren waren bis weit hinauf zum Rand des Taunus zu hören, den der Winter noch immer in seinem eisigen Griff gefangen hielt.
Die Fastnacht war ein seltsames Relikt aus uralten, heidnischen Zeiten. Ein Brauch, um die bösen Geister und Dämonen zu vertreiben: üble Gesellen, die sich bevorzugt im Schutz der dunklen Jahreszeit aus ihren Löchern in der Höhe hervorwagten und bis tief in die Niederungen der Mainebene vordrangen, um die Menschen dort unten mit Unheil und Elend zu überziehen. Doch an den Fastnachtstagen gewannen die Frankfurter seit jeher die Oberhand über ihre Dämonen zurück. Überall in der Stadt wurde getanzt und gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Und die Geister und Dämonen kauerten sich furchtsam in ihren finsteren Löchern zusammen und warteten ab, bis die Gefahr an ihnen vorübergezogen war.
Jedenfalls die meisten von ihnen …
An diesem verschneiten dreiundzwanzigsten Februar veranstaltete zur gleichen Zeit auch das neu gegründete Senckenberg Museum ein rauschendes Fest. Die höchsten Würdenträger der Stadt waren der Einladung zum Maskenball gefolgt, denn es hatte sich herumgesprochen, dass die einflussreiche Komtess Natalja Scheremetewna Interesse an der reichen naturwissenschaftlichen Sammlung zeigte, die das junge Museum auszeichnete. So eine seltene Gelegenheit ließ sich natürlich niemand entgehen, der in der Stadt Rang und Namen hatte und sich darüber hinaus auch noch gute Geschäfte mit dem Zarenreich versprach. Und so quollen die ehrwürdigen Räumlichkeiten im Schatten des Eschenheimer Turms beinahe über vor unzähligen Adligen, Gelehrten und Mitgliedern des gehobenen Bürgertums.
Unter all den hochgestellten Persönlichkeiten fühlte sich Milli unglaublich fehl am Platz. Die junge Frau, die erst vor wenigen Wochen aus der Provinz in die hessische Handelsmetropole gezogen war, hätte weit lieber draußen in den Gassen mit den einfachen Bürgern gefeiert. Doch als frischgebackene Mitarbeiterin im Senckenberg hatte sie keine Möglichkeit, sich vor diesem bedeutenden Anlass zu drücken. Ihre Tante Anni hatte eigens eines ihrer liebsten Kostüme für sie umgenäht. Ein entsetzlich albernes Etwas mit lindgrünen Puffärmeln und fühlerartigen Auswüchsen, in dem sich Milli vorkam wie eine grauenvolle Mixtur aus Raupe und übergroßer Socke. Ihre Tante hatte beim letztjährigen Ball der Wohltätigen Bürgerwitwen den zweiten Preis damit eingeheimst, und Milli konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wer auf dem dritten Platz gelandet war.
Nun fand sie sich also derart verunstaltet inmitten dieser feinen Herrschaften wieder und musste zu allem Überfluss auch noch feststellen, dass ein Maskenball in Frankfurt eine hochoffizielle Veranstaltung darstellte, zu der sich die Damen und Herren in todschicke Gewänder nach venezianischem Vorbild hüllten. Bei den einzig wirklichen Verkleidungen handelte es sich um bunt bemalte Masken, die an dünnen Stäben elegant vor die Gesichter gehalten wurden. Wenn sich Milli in größeren Gesellschaften sonst schon nicht besonders heimisch fühlte, so wäre sie an diesem Abend am liebsten ganz tief im Erdboden versunken.
Der Festsaal lag im Erdgeschoss des weitläufigen Gebäudes, dort, wo an normalen Tagen die Skelette gewichtiger Ungetüme aus der Urzeit ausgestellt waren. Jetzt quoll er über vor gewichtigen Persönlichkeiten der Neuzeit, die sich mit gewichtigen Mienen und den dazugehörigen gewichtigen Bäuchen über die angebotenen Häppchen hermachten.
Am Umfang des Bauches konnte man in diesen Zeiten recht gut den Status eines Menschen ablesen. Bei Milli zu Hause waren die Bauern eher klein und zäh gewesen. Nur der Wirt und der Amtsvogt hatten dort mächtige Bäuche zur Schau getragen. Die übrigen Dorfbewohner hatten überhaupt keine Gelegenheit gehabt, dick zu werden. Vor allem nicht, wenn die Ernte mal wieder durch Hagelstürme und Regenbäche vernichtet worden war und gerade genug übrig blieb, um den nächsten harten Winter zu überstehen.
In Frankfurt dagegen herrschte beinahe schon ein Überfluss an Bäuchen, deren Umfang Milli in den ersten Wochen immerhin geholfen hatte, sich in der komplizierten Hierarchie der Museumsangestellten zurechtzufinden.
Der Bauch von Kurator Anton Hollweg war zum Beispiel nur mittelprächtig ausgeprägt. Er wäre sicherlich gern mächtiger gewesen, doch im Verlauf seiner Karriere hatte er es nie so recht zu voller Blüte geschafft. Obwohl er es wirklich nach besten Kräften versuchte, wie man an der Art erkennen konnte, auf die er sich über die köstlichen Happen hermachte, die von der Dienerschaft auf silbernen Tabletts durch den Saal getragen wurden. Die Küchlein und Würstchen und Pasteten verschwanden so rasch in seinem Magen, dass man fürchten musste, er wäre auf der Flucht vor den Franzosen.
»Ah«, rief er zwischen jedem Happen immer wieder begeistert aus. »Ah! Hmmm. Köstlich. Ein Gedicht!«
Die Küchenhilfen hatten Milli einmal hinter vorgehaltener Hand verraten, dass Kurator Hollweg im eigenen Haushalt am untersten Ende der Bäuche-Hierarchie stand. Selbst die zwei hässlichen Schoßhündchen seiner Gattin bekamen gerüchtehalber mehr zu futtern als er. Den Frust über diese Ungerechtigkeiten des Lebens ließ er deshalb oft und gern an seinen eigenen Untergebenen aus. In Gegenwart seiner hochgestellten Gäste allerdings, die das Gemetzel auf dem Silbertablett mit ehrfürchtigen Blicken verfolgten, war er wesentlich umgänglicher. In Gegenwart leckerer Häppchen schien er beinahe sogar ein glücklicher Mensch zu sein. »Lerchenpastete auf indischen Vogelnestern, Butterstollen, Entenleber, kalekutischer Kapaun! Und das nur zum Vorwärmen des Magens, meine Liebe!«
Einige der Anwesenden kannte Milli schon vom Sehen. Da war natürlich Johann Georg Neuburg, der erste Direktor des Senckenberg Museums und gleichzeitig Schwippschwager des berühmten Ministerialrats und Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Der Dichter selbst hatte seine Wahlheimat Thüringen seit etlichen Jahren nicht mehr verlassen, da es um seine Gesundheit schon längst nicht mehr zum Besten bestellt war. Dafür war anlässlich des Maskenballs sein Adlatus Abaris angereist. Die beiden hochgestellten Herrschaften waren in eine hitzige Diskussion vertieft, und so oblag es Herrn Hollweg, ihren russischen Ehrengast standesgemäß zu unterhalten.
Als gute Freundin des Hauses von Anstett galt Komtess Natalja Scheremetewna quasi als inoffizielle Vertreterin des Russischen Zarenhauses im Deutschen Bund. Eine außergewöhnlich gebildete und gut aussehende Dame mittleren Alters, die das aufdringliche Wesen ihres Gastgebers mit einem charmanten Lächeln ertrug. »Eine ordentliche Auswahl, werter Herr Kurator«, lobte sie freundlich.
»Ordentlich? Na, warten Sie erst mal das Bankett ab. Sie werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Das wird ein Festmahl wie im venezianischen Dogenpalast: eine originalgetreue Nachbildung des römischen Trevi-Brunnens. Er besteht aus reinstem Zucker und liegt in einem Bett aus Seesternen, Krabben und Langustenhäppchen. Winzige edelsteingeschmückte Fischlein recken keck ihre Köpfchen aus den salzigen Fluten, und als Überraschung springt zum Schluss sogar ein Zwerg mit einem Dreizack daraus hervor.«
»Ein Zwerg mit einem Dreizack?«
»Sie werden begeistert sein!«
Die Augenbraue der Komtess hob sich in einem eleganten Bogen. »Ist das nicht ein wenig … nun, barbarisch?«
»Er trägt natürlich einen Lendenschurz«, beteuerte Herr Hollweg, während er sich gierig dem nächsten Tablett in den Weg warf. »Oh, sehen Sie mal, meine Liebe: Kaviar! Der Rogen des Störs. Im Deutschen bezeichnen wir ihn nicht umsonst als Speise der Götter, denn er ist eine echte Köstlichkeit. Kennen Sie in Russland eigentlich Kaviar?«
Das war leider das zweite Problem mit Kurator Hollweg: Er war als Vorgesetzter nicht nur ein echter Kotzbrocken, sondern darüber hinaus auch nicht mehr zu bremsen, wenn er sich ein bisschen zu viel hinter die Binde gegossen hatte. Milli war sich vollkommen sicher, dass er im Grunde nur durch familiäre Verbindungen an seinen Posten gekommen sein konnte.
»Ich habe tatsächlich schon einmal von Kaviar gehört«, entgegnete die Komtess mit ihrem charmanten russischen Akzent. »Ob Sie es glauben oder nicht: Wir fahren in unserem Land sogar Kutsche.«
»Am besten trinkt man zu Kaviar Schaumwein«, erklärte Herr Hollweg, dem die kleine Spitze seines erlauchten Gastes völlig entgangen zu sein schien. »Warten Sie, ich zeige Ihnen den besten Schaumwein der Welt. Der wird Sie unter Garantie – ja, wo ist denn hier ein Diener, wenn man ihn mal braucht? Wissen Sie, die Franzosen haben zwar eine Menge Unheil über dieses Land gebracht, aber von Schaumwein verstehen sie etwas. Wobei das kein Wunder ist, denn sie haben uns ja die besten Kellermeister aus dem Rheingau weggeschnappt.«
»Entschuldigen Sie mal!«, unterbrach ihn ein distinguiert wirkender Herr aus der Gästeschar, der im Auftrag des Hauses Mumm für die Getränkeversorgung zuständig war.
»Na, haben Sie denn etwa das Rüttelverfahren erfunden?«, entgegnete Hollweg geringschätzig.
»Das Rüttelverfahren?« Der Vertreter des Hauses Mumm runzelte die Stirn und strich sich nervös den Schnurrbart. »Nun, es ist nicht ganz so einfach, wie Sie …«
»Ja was ist denn so schwierig daran, einen klaren Wein zu produzieren? Ein bisschen rütteln und kräftig Blasen dazugeben.«
»Blasen?«
»Wissen Sie denn nicht, was Blasen sind? Kein Wunder, dass Sie nicht in Frankreich arbeiten dürfen.«
Der Vertreter des Hauses Mumm wurde knallrot im Gesicht und schnappte heftig nach Luft, doch Kurator Hollweg hatte sich bereits wieder seiner russischen Gesprächspartnerin zugewandt. »Wissen Sie, Komtess, das Rüttelverfahren wurde ja eigentlich auch von uns erfunden – also eigentlich von einem Schwaben. Aber dafür kann er ja nichts.« Er lachte künstlich und störte sich nicht im Geringsten daran, dass keiner mitlachte. »Jedenfalls hat das Rüttelverfahren den Veuve Clicquot zum vielleicht besten Schaumwein der Welt gemacht. Zu einem Savoir-vivre, wie der Franzose so schön sagt. Sie da! Fräulein Wohl!« Abrupt richtete sich sein Zeigefinger auf Milli, die bis zu diesem Augenblick sehr zufrieden damit gewesen war, von den Anwesenden höflich übergangen zu werden. Als ihr nun aber bewusst wurde, dass sich sämtliche Blicke auf sie zu richten begannen, wurde sie beinahe ebenso knallrot im Gesicht wie kurz zuvor der Vertreter des Hauses Mumm.
»Ich?«, gelang es ihr schließlich, weitgehend ohne zu stottern zu antworten.
»Sehen Sie hier noch jemand anderen, der auf den Namen Millicent Wohl hört?«
»Nein, aber ich …«
»Keine Widerworte! Schwingen sie Ihren Hintern in die Küche, und – was ist das eigentlich für ein lächerliches Kostüm, das Sie da tragen?«
Milli errötete noch ein klein wenig mehr. »Saturnia pavonia«, murmelte sie mit gesenktem Kopf.
»Wie bitte?«
»Das Kleine Nachtpfauenauge – das ist eine Raupe.«
»Eine Raupe? Sieht das hier etwa aus wie eine Fastnachtsveranstaltung?«
Milli wollte schon zu einer passenden Entgegnung ansetzen, doch Herr Hollweg kam ihr harsch zuvor: »Keine Widerworte. Schwingen Sie Ihre Larve umgehend in die Küche, Fräulein Wohl, und besorgen Sie uns eine Flasche von dem Veuve Clicquot, den ich für die Komtess zurückgelegt habe. Husch, husch!« Er strich sich mit der Hand über das schüttere Haar und schüttelte seufzend den Kopf. »Wie heißt es im Deutschen so schön? Gutes Personal ist schwer zu finden.«
»Meinen Sie: ›Toter Fisch stinkt vom Kopf her‹?«, fragte die Komtess.
Herr Hollweg schüttelte lachend den Kopf. »Nein, nein, liebe Komtess. Das hat eine völlig andere Bedeutung in unserer Sprache.«
»Ich verstehe«, sagte die Komtess lächelnd.
Das Getümmel in der Küche ähnelte einem ganz eigenen Maskenball – oder bei genauerer Betrachtung noch eher einer blutigen Schlacht. Napoleon hatte mit Sicherheit kaum schlimmer auf dem europäischen Kontinent gewütet als diese Armee zu allem entschlossener Küchenschergen, die sich fluchend und brüllend durch die engen Gassen und Räume schob, die ohnehin schon mit einem bunten Durcheinander an Gerätschaften angefüllt waren. Gewaltige Kupferkessel, so groß wie Weinfässer; Töpfe und Pfannen und riesige Spülbecken, in denen sich Berge von schmutzigen Tellern stapelten. Bis zum Bersten mit Gewürzen in allen nur erdenklichen Farben und Geschmacksrichtungen gefüllte Schränke und Säcke voller Mehl und Zucker und anderer Zutaten, die in immer größeren Mengen von den Bediensteten herangekarrt wurden, um den schier unersättlichen Hunger der illustren Gästeschar zu stillen. Hundertschaften von Köchen und Kellnern drängten sich an den Arbeitstischen, schleppten Vorräte heran und verschwanden wieder mit Tabletts, die sich unter Bergen frisch gekochter Leckereien bogen.
»Hey, pass doch auf!«
»Aus dem Weg!«
»Blumenkohl! Ich sagte Blumenkohl!«
Nur mit Mühe gelang es Milli, den zahlreichen Angriffen aus Suppenschüsseln, Töpfen und Pfannen auszuweichen und sich durch die Reihen der gegnerischen Truppen hindurchzuschlagen, bis sie schließlich vor ihrer Generalin stand – um im allerletzten Augenblick doch noch mit einem vorbeieilenden Küchenjungen zusammenzustoßen, der ein mit schmutzigen Tellern überladenes Tablett vor sich hertrug. Scheppernd und krachend zerschellte das Geschirr auf dem Boden.
»He da!« Eine massige Hand packte Milli am Kragen und zerrte sie in die Höhe.
Die Generalin der Armee war eine furchterregende Kriegerin, deren Statur einem Ochsen zur Ehre gereicht hätte. Als Rüstung trug sie eine fettverschmierte Lederschürze, und ihr Marschallstab war eine kupferne Suppenkelle, die sie nun drohend in Millis Richtung schwang. Wenn es neben dem berühmten Siegfried aus der Nibelungensage jemals ein anderer Krieger mit einem Drachen hätte aufnehmen können, dann wäre es die Küchenvorsteherin des Senckenbergs gewesen. Wahrscheinlich hätte sie ihn im Anschluss auch gleich noch gebraten und sein Skelett der Museumssammlung vermacht.
»Gnade«, winselte Milli mit eingezogenem Kopf. »Ich kann alles erklären.«
»Erklär es meinem Kochlöffel!«, donnerte die Küchenvorsteherin in einem Bass, der mühelos die Mauern von Troja zum Einsturz gebracht hätte. »Du da, Bursche!«, wandte sie sich an den belämmert dreinblickenden Küchenjungen. »Steh nicht so dumm im Weg. Fürs Maulaffenfeilhalten wirst du nicht bezahlt. Kehr die Scherben auf und sieh zu, dass der Zwerg endlich in den Trevi-Brunnen steigt!«
»Der Zwerg ist in den Streik getreten«, murmelte der Küchenjunge kläglich. »Er weigert sich, einen Lendenschurz anzuziehen.«
»Ja, soll er denn etwa nackt aus dem Brunnen springen?«
»Er will gar nicht springen. Er hat gesagt, dass das so nicht vereinbart war. Das wäre unter seiner Würde oder so.«
»Unter seiner Würde? Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder dahergelaufene Hesse plötzlich seine Würde entdeckt?« Irritiert kratzte sich die Küchenvorsteherin mit der Kelle am Hinterkopf und richtete sie dann auf ihr Gegenüber. »Dann pass mal auf, Junge. Dann kletterst eben du in den Brunnen. Aber wasch dir vorher gefälligst die Füße!« Mit diesen Worten wandte sie sich um, um sich auf ihre nächsten Gegner zu stürzen.
»Champagner!«, rief Milli ihr verzweifelt hinterher. »Wo finde ich den Champagner?«
Die Generalin machte sich kaum die Mühe, sich umzudrehen. »Herr Hollweg schon wieder? Dieser Saufkopf soll beim Äppler bleiben. Für etwas Besseres fehlt ihm der Verstand.«
»Nicht für ihn. Er ist für die Komtess!« Als die Generalin stirnrunzelnd innehielt, nutzte Milli schnell die entstandene Lücke in ihrer Deckung, um nachzustoßen. »Natalja Scheremetewna, meine ich.«
»Oha!« Die Suppenkelle der Generalin fuhr herum. »Sag das doch gleich, Mädchen. Komtess Scheremetewna ist ein ganz anderes Kaliber als dieser Hanswurst. Die hat Geschmack. Die kann ein Bœuf Bourguignon noch von einem Coq au Vin unterscheiden.«
»Ein was von einem was?«
»Sie ist ein echter Gourmet, wie der Franzose sagt. Aber davon verstehst du nichts, du Klappergerüst.«
»Warten Sie! Ich weiß nur, dass Herr Hollweg mir das Leben zur Hölle macht, wenn ich nicht mit einem Champagner für die Komtess zurückkomme.«
Die Küchenvorsteherin nickte. »Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Er war schon immer recht aufbrausend. Ich habe gehört, dass er sogar einmal …«
»Was ist denn nun mit dem Champagner?«, unterbrach sie Milli schnell. »Wo finde ich den?«
»Na, im Kühlhaus, Mädchen. Wo denn sonst?«
»Seit wann haben wir ein Kühlhaus?«
»Den Leichenkeller meine ich. Woanders war kein Platz mehr.«
Beim Leichenkeller handelte es sich um den mit Abstand gruseligsten Bereich des gesamten Senckenberg Museums. Der Abstieg in die Tiefen war steil und düster, und das flackernde Licht von Millis Laterne warf unheimliche Schattenbilder auf die schmalen, glatt geschliffenen Treppenstufen. Sie musste wirklich höllisch aufpassen, um nicht auszurutschen und sich bei einem Sturz in die Tiefe alle Knochen zu brechen. Schon nach wenigen Metern war der Küchenlärm beinahe vollständig von den meterdicken Wänden verschluckt, und bald hörte sie nur noch ihre eigenen Schritte und ihren keuchenden Atem.
Im Herbst war sie zwanzig Jahre alt geworden und hielt sich im Grunde für eine aufgeklärte junge Frau, die nichts für Aberglauben und Geistergeschichten übrighatte. Doch jedes Mal, wenn sie diese steilen Stufen hinuntersteigen musste, verwandelte sie sich in ein kleines Mädchen zurück, das immer noch an all die unheimlichen Dinge glaubte, die ihr die Alten am Kamin erzählten. An die Geschichten von Werwölfen und weißen Frauen und von den Geistern der Toten, die keine Ruhe fanden, weil ihnen eine ordentliche Beerdigung verwehrt geblieben war – und Tote gab es leider zuhauf in den verwinkelten Kellergewölben, die nun vor ihr lagen. Unten angekommen, atmete sie erst einmal tief durch und nahm dann ihren ganzen Mut zusammen, um weiterzulaufen.
Ein langer Gang tat sich vor ihr auf, von dessen kahlen Wänden rechts und links zahlreiche Türen abgingen. Hinter den meisten befanden sich Lagerräume und Labors. Hier eine Sammlung seltener Federn und dort ein ganzer Raum voll mit aufgespießten Schmetterlingen. Ein Raum war vollgestopft mit nicht identifizierbaren Knochen, in einem anderen lagerten Hunderte von Steinen in allen erdenklichen Formen und Größen. Ein Übelkeit erregender Gestank nach Bohnerwachs und Knoblauch lag in der Luft. Der Knoblauchgestank rührte von dem Arsen her, das zur Präparation der Exponate verwendet wurde. Es brannte sich regelrecht in die Nasenscheidewände hinein und war so giftig, dass bereits eine kleine Dosis genügen konnte, um einen erwachsenen Menschen innerhalb von wenigen Stunden qualvoll umzubringen.
Der Gang führte in eine Reihe düsterer Gewölbekeller hinein, die mit unzähligen Regalen vollgestellt waren. Hier lagerten all die Skelette, Plastiken und in Alkohol eingelegten Exponate, die es nicht nach oben in die Ausstellungen geschafft hatten: Regalreihe um Regalreihe voller Fossilien, in Bernstein eingeschlossener Insekten und Schädeln bizarrer Tiefseekreaturen. Hier ein Glas mit einem missgestalteten Fötus, dort der gewaltige Hüftknochen eines Urzeitwesens. Gleich mehrere Regale waren mit ausgestopften Tieren belegt, die zum Teil auf so grauenvolle Art zusammengestückelt waren, dass sie aussahen wie bizarre Karikaturen oder Kreaturen, die den schlimmsten Albträumen entsprungen waren.
Beim Lieblingsexponat des leitenden Präparators Josef Buchner handelte es sich um eine ganz besonders abscheuliche Kreatur aus den bayerischen Alpen: Ein Mischwesen aus einer gehörnten Eule mit dem Körper eines Fuchses und den Flügeln einer Fledermaus. Als Milli gleich an ihrem ersten Arbeitstag dieses Ding erblicken musste, war sie beinahe zu Tode erschrocken gewesen. Josef hatte ihr später erklärt, dass es sich beim Wolpertinger nicht um ein echtes Tier, sondern nur um eine Fantasiegestalt handelte, um damit Reisende in den Alpen zu erschrecken. Das im Senckenberg gelagerte Exemplar hatte er als junger Bursche irgendwann einmal selbst zusammengenäht und nach Frankfurt mitgebracht. Es war damals sozusagen sein Gesellenstück gewesen.
»Glaub net olles, was du siagst«, hatte er in seinem unverwechselbaren bayerischen Dialekt gebrummelt, während er Milli an den Regalen entlanggeführt und nach und nach den Schrecken aus den Kellerräumen vertrieben hatte. »Die Monster auf den Jahrmärkten sind nur Hokuspokus. Hast du die Fidschi-Meerjungfrau, die sie in Bornheim zur Schau stellen, gesehen? Die hat einfach nur den Oberkörper einer Katz’n, auf den die Schwanzfloss’n von am Fisch genäht wurde. Eine grauenvolle Arbeit, sog i dir. I’ bin mir sicher, dass sie keinen Monat übersteht, dann müssen’s so an neues armes Tier von der Straß’n wegfangen.« Unwirsch hatte er den Kopf geschüttelt und auf das nächste Exponat gedeutet, das entfernte Ähnlichkeit mit einem Wischmopp besaß. »Des, was du da drüben siehst, soll irgendwann amoal a Hirsch aus der sibirischen Taiga gewesen sein. Und des hier – i’ hob ehrlich g’sagt ka Ahnung, was des is. Es siagt aus wia a Elefant, aber es is winzig klein. Vielleicht so eine Art Schrumpfefant. Frag den Herrn Kurator, der hat sich den Mist andrehen lassen.«
Ganz am hintersten Ende des hintersten Gewölbes, dort, wo es so eisig kalt war, dass einen bereits der Gedanke daran frösteln ließ, befand sich schließlich der Leichenkeller. Hier lagerten die zahlreichen, frischen Tierkadaver, die auf ihre Bearbeitung durch die Präparatoren warteten. Das Labor, in dem dieses Handwerk verrichtet wurde, lag gleich daneben. Hinter der Tür am Ende des Ganges brannte noch Licht, was ungewöhnlich war, denn sämtliche Angestellten hatten die strikte Weisung erhalten, sich auf dem Maskenball einzufinden.
Normalerweise hätte die Anwesenheit eines anderen Menschen an diesem ungemütlichen Ort etwas Beruhigendes gehabt, doch an diesem Abend war das aus irgendeinem Grund anders. Milli konnte es nicht in Worte fassen, doch sie hatte das untrügliche Gefühl, auf der Hut sein zu müssen.
»Hallo?« Ihre Worte hallten so unnatürlich laut von den Wänden wider, dass sie erschrocken zusammenfuhr. Als sie die Laterne hob, hatte sie den Eindruck, von den ausgestopften Tieren auf den Regalbrettern vorwurfsvoll angestarrt zu werden. Sie räusperte sich. »Ist da jemand? Josef?« Unschlüssig blickte sie den Gang hinunter auf den erleuchteten Türrahmen. Hatte sie da irgendwo ein Geräusch gehört? Ein Klappern oder ein metallisches Kratzen? Oder bildete sie sich das alles nur ein? Sie schüttelte den Kopf über ihre ängstlichen Gedanken. Wahrscheinlich hatte einfach nur ein schusseliger Angestellter vergessen, die Lampen zu löschen.
Die Kiste mit dem französischen Schaumwein befand sich zum Glück gleich ganz in der Nähe. Milli stellte ihre Lampe auf einem leeren Regalbrett ab und stemmte ächzend den Deckel auf. Im Innern fand sie, fein säuberlich aufgereiht, ein halbes Dutzend bauchiger Flaschen vor, von denen eine schöner und edler aussah als die nächste. Behutsam hob sie eine davon aus ihrem weichen Bett aus Holzwolle und hielt sie bewundernd gegen das Licht. Sie war ein wenig staubig, doch soweit Milli es durch das grünliche Glas erkennen konnte, war der Champagner tatsächlich so klar wie ein Gebirgsbach. Mit Sicherheit würde er auch so besonders schmecken, wie er aussah. Sonst hätte Kurator Hollweg ihn mit Sicherheit nicht seinem Gast angeboten.
Als Milli gerade das edel gestaltete Etikett zu entziffern versuchte, ertönte hinter der Tür am Ende des Ganges urplötzlich ein Klirren, so als wäre ein Glas aus einem der Regale gefallen und am Boden zerschellt. Erschrocken fuhr sie herum. »Wer ist da?« Mit angehaltenem Atem lauschte sie in die Dunkelheit.
»Wahrscheinlich nur eine Maus«, murmelte sie, um ihre Nerven zu beruhigen. Das Senckenberg hatte schon länger Probleme mit diesen kleinen Nagern, die mit Vorliebe an den Präparaten herumkauten und sich durch das für Mäusezungen unwiderstehlich schmeckende Füllmaterial wühlten. Der Direktor hatte sogar eigens eine Katze anschaffen lassen, um diesem Problem Herr zu werden. Dummerweise wurde das Tier so ausgiebig vom Küchenpersonal gemästet, dass es gar keine Lust mehr verspürte, den gemütlichen Platz auf der Ofenbank zu verlassen, um seinen lästigen Pflichten nachzukommen.
Als es ein weiteres Mal laut und bedrohlich polterte, war Milli sicher, dass es sich nicht um eine Maus handeln konnte – allerhöchstens um eine sehr, sehr große. Sie stand jetzt mitten im Gang und starrte auf das erleuchtete Viereck der Labortür, hinter der sie dunkle Schatten zu erkennen glaubte. Wieder polterte und schepperte es laut und vernehmlich, und schließlich klang es beinahe sogar so, als würden zwei Menschen miteinander ringen.
Jetzt war es eindeutig: Im Labor musste etwas ganz gewaltig faul sein. Angesichts der vielen toten Tiere dort drinnen ging für einen Augenblick die Fantasie mit Milli durch. Die Kehle schnürte sich ihr zu, und ihre Beine fingen an zu schlottern. Alle Instinkte rieten ihr, das Heil besser in der Flucht zu suchen, doch sie wollte auch unbedingt wissen, was da los war. Beinahe von allein setzten sich ihre Füße in Bewegung.
Sie hatte die Tür schon fast erreicht, als das Gepolter seinen Höhepunkt erreichte und durch einen wütenden Fluch untermalt wurde. Ein heftiger Hieb war zu vernehmen, dann schlug etwas schwer am Boden auf. Im nächsten Augenblick wurde die Tür aufgestoßen und schlug krachend gegen die Wand. Ein dunkler Schatten füllte den Türrahmen aus, und noch ehe Milli reagieren konnte, wurde sie von einer massigen Gestalt über den Haufen gerannt.
Mit rudernden Armen stürzte sie auf ihr Hinterteil, dabei entglitt die wertvolle Champagnerflasche ihren Händen und ging auf den steinernen Fliesen klirrend zu Bruch. Ein Schauer aus Glasscherben und sündhaft teurem, perlendem Schaumwein ergoss sich über ihr Raupenkostüm und durchnässte sie von Kopf bis zu den Füßen.
»Wie soll ich das bloß Tante Anni erklären?«, war der erste Gedanke, der ihr durch den Kopf schoss. Doch als sie aufblickte, blieb ihr das Herz stehen. Denn sie starrte direkt in die Augen des Mannes, der sie über den Haufen gerannt hatte, und das Gefühl, das sie dabei überkam, war beinahe so, als würde sie in einen tiefen Abgrund stürzen.
Entsetzt riss sie den Mund auf und schnappte nach Luft. Sie wollte schreien, nach Hilfe rufen oder fortlaufen, doch die Panik schnürte ihr die Kehle zu. Nur unter Aufbietung all ihrer Kräfte gelang es ihr, den Kopf zur Seite zu drehen. Der Mann sagte ein Wort in einer fremden Sprache, das beinahe missbilligend klang. Seine Stimme war ein tiefer, voller Bass, der in ihrem Magen vibrierte. Langsam streckte er die Hand nach ihrem Gesicht aus, umfasste ihr Kinn und drehte es sanft zurück in seine Richtung. In diesem Moment wurde ihr schlagartig bewusst, dass sie leibhaftig in einen Abgrund stürzen würde, wenn sie noch einmal in diese schrecklichen Augen blicken musste.
»Zu Huilf!«, rief da eine klägliche Stimme aus dem Labor und brach den Bann. »Polizey!«
Der Kopf des Fremden fuhr herum. Er stieß ein weiteres fremdländisches Wort aus, das diesmal ganz sicher wie ein Fluch klang. Einen Augenblick lang verharrte er regungslos und schien zu überlegen. Schließlich gab er sich einen Ruck und ließ von Milli ab. Er richtete sich auf, warf einen letzten Blick zurück über die Schulter und humpelte dann, ohne sich noch einmal umzusehen, den Gang hinunter.
Milli starrte ihm sprachlos hinterher, bis seine massige Gestalt von der Dunkelheit verschluckt worden war. Erst als sie ganz sicher war, dass er nicht mehr zurückkehren würde, rappelte sie sich auf und rannte ins Labor, wo sie den Präparator Josef fand. Er lag auf dem Boden. Schnell stürzte sie zu ihm hin. »Josef! Du blutest!«
»I hoab koa Zeit zum Blut’n net.« Mühsam hob der alte Mann die Hand und fuhr sich über den Kopf. Im nächsten Moment ließ er sie wieder fallen und schaute sich erschrocken um. »Ja, wo is er hin? Wo ist der Schädel?«
»Der sitzt zum Glück noch auf deinen Schultern.«
»Schmarrn! Nicht der. Der vom Schiller!«
»Von wem?«
Josef stieß ein entnervtes Schnaufen aus und räusperte sich geräuschvoll:
»Im ernsten Beinhaus wars, wo ich beschaute,
Wie Schädel Schädeln angeordnet paßten;
Die alte Zeit gedacht ich, die ergraute.
Sie stehn in Reih geklemmt, die sonst sich haßten …«
»Oje.« Besorgt presste Milli ihm die Handfläche gegen die Stirn. »Ich glaube, es ist schlimmer als gedacht. Leg dich besser wieder hin.«
»Naa!« Unwirsch schlug Josef ihre Hand beiseite. »Jetzt hör mir doch endlich amoal zu, Madl! Er hot den Schädel von Schiller gestohlen, du musst ihn aufhalt’n!«
»Du meinst den Mann, der mich umgerannt hat?«
»Du bist ja eine ganz eine Aufgeweckte. Wo is er hin?«
»Den Gang hinunter.«
»Ja worauf woartest du dann noch? Lauf ihm hinterher!«
»In dem Kleid? Mit den Schuhen?«
»Ist mir egal, und wennst fliegen lernst!«
»Aber du bist verletzt. Ich kann dich doch nicht einfach hier liegen lassen.«
»Schmarrn, mir geht’s gut. Mei Hirn hot scho schlimmere Stürz’ überstanden.«
»Bist du sicher?«
»Kruzifixnochamoal, du musst den Schädel finden! Lauf!«
Also hastete Milli, so schnell es ihr möglich war, zurück durch die Gewölbekeller. Vorbei an dem winzigen Schrumpfefant, dem sibirischen Wischmopp und dem bayerischen Wolpertinger, dann durch den Lagerraum für die Skelette und in den Keller mit den kleineren Präparaten hinein: Gliederfüßer, Arachniden, Insekten und … »Aua!« Ihre Laterne schlug klirrend gegen ein Regalbrett, und auf einen Schlag wurde es pechschwarze Nacht.
Milli stieß einen tiefen Seufzer aus. »Na großartig.«
Dem unheimlichen Dieb ganz allein durch diese dunklen Kellerräume hinterherzujagen, war die mit Abstand dümmste Idee ihres Lebens gewesen. Was hätte sie denn getan, wenn sie ihn eingeholt hätte? Und was sollte sie nun ohne eine Lichtquelle tun? Wenn sie jetzt einfach weiterrannte, bog sie vielleicht irgendwo falsch ab und verirrte sich in dem weit verzweigten Labyrinth aus vergessenen Nebengängen. Wer wusste denn schon so genau, welche unbekannten Gefahren hier unten noch auf sie lauerten?
Sie atmete tief durch und versuchte, sich zu beruhigen. »Verlier jetzt bloß nicht die Nerven, Milli.« Sie konnte doch eigentlich gar nicht falsch abgebogen sein. Sie war einfach nur geradeaus gelaufen. Sie musste lediglich herausfinden, in welchem Lagerraum sie sich gerade befand. War sie nicht eben noch an den Tausendfüßlern vorbeigerannt?
Vorsichtig streckte sie die Hände aus, bis sie gegen das Regal stießen. Ihre tastenden Finger fanden ein Glas und strichen über eine chitinartige Oberfläche hinweg. Dann ertasteten sie eine hornartige Struktur, und als sie schließlich etwas Weiches, Haariges berührten, verzog Milli angewidert das Gesicht. »Uhh …« Ihre Fantasie malte sich die absurdesten Kreaturen aus: Ledrige Flügel, gebleckte Zähne, dornige Auswüchse am gesamten Körper. Dämonenhafte Wesen, die in der Dunkelheit zu neuem Leben erwachten – angetrieben von einem unstillbaren Hunger auf junge Museumsangestellte, die so dumm gewesen waren, allein in den Keller hinabzusteigen. Sie musste sich sehr zusammenreißen, um nicht schon wieder in Panik zu verfallen. Was hatte sie von Josef gelernt? Es gab keine Monster – nur schlecht gemachte Präparate.
»Natürlich!«, rief sie schließlich erleichtert aus. »Du bist ein Hase.« Sie musste direkt vor der Sammlung heimischer Säugetierarten stehen, nur eine Regalreihe von den Spinnentieren entfernt. Wenn sie einfach nur geradeaus weiterlief, stieß sie als Nächstes auf die afrikanische Trophäensammlung, und von dort war es nicht mehr weit bis zur Treppe.
Als Milli endlich schnaufend zurück in der Küche war, wurde sie von dem Lärm und der Hitze beinahe erschlagen. Von einem Augenblick auf den nächsten wurde ihr schwindelig, und sie musste sich an der Wand festhalten, um nicht zu Boden zu stürzen. Sie hielt einen Augenblick inne und schnappte nach Luft. Als sie sich wieder gefangen hatte, bahnte sie sich eilig ihren Weg durch das Heer der Küchenkräfte hindurch, stieß die schwere doppelflügelige Schwingtür zum Ballsaal auf und stürzte mit einem erleichterten Keuchen hinaus. Hastig schob sie sich zwischen den feiernden Gästen hindurch und erklomm schließlich kurz entschlossen einen Tisch, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Schon nach rascher Suche hatte sie den Dieb wiedergefunden. Er schien überhaupt nicht in Eile zu sein. Ganz gemächlich spazierte er durch die Menge hindurch und fand sogar noch die Zeit, sich im Vorbeigehen von einem Tablett einen leckeren Happen zu stibitzen. Trotzdem war er nur noch wenige Schritte vom Ausgang entfernt, und wenn er nicht aufgehalten wurde, würde er in wenigen Minuten uneinholbar verschwunden sein.
»Ah, da ist sie ja endlich!«, rief da die unverkennbar nervige Stimme von Herrn Hollweg. »Hast du ihn?«
Hektisch deutete Milli über die Köpfe der Feiernden hinweg. »Dort! Dort vorn ist er«, keuchte sie. »Sie müssen ihn aufhalten!«
»Den Champagner?«
»Den … was? Nein, den Dieb meine ich!«
»Um Himmels willen, der Champagner wurde gestohlen?«
»Der Schädel!«, fauchte sie den Kurator ungehalten an.
»Der … bitte was?« Herrn Hollweg klappte der Kiefer nach unten, und er starrte sie verdattert an.
»Ach, verdammt«, stöhnte Milli und sprang vom Tisch. Als sie losrannte, hörte sie in ihrem Rücken noch seine entgeisterte Stimme: »Völlig hysterisch, das Mädchen. Ich wusste zwar, dass das eines Tages passieren würde – aber so schnell?«
Draußen auf der Straße schepperte und lärmte und kreischte es, als wären Napoleon und die Preußen gleichzeitig in die Stadt eingefallen. Ganze Hundertschaften bunt verkleideter Menschen zogen mit Sack und Pack die Große Eschenheimer Gasse hinunter, um sich unten auf der Zeil dem noch viel gewaltigeren Heerzug anzuschließen, der sich wie jedes Jahr anschickte, mit gemeinsamen Kräften den Römer zu erobern. Der Schnee stand meterhoch an den Straßenrändern, und die Luft war so frostig kalt, dass der Atem der Feiernden in dicken Dampfwolken in den sternenklaren Himmel hinaufstieg.
Nur mit Mühe gelang es Milli, sich zwischen den dicht gedrängt Feiernden hindurchzuschlängeln, ohne dabei den Anschluss an den Dieb zu verlieren. Immer wieder wurde sie geschubst und angerempelt und herumgestoßen. Ein schwerer Stiefel trat hinten auf den Saum ihres Kostüms, irgendwer kippte ihr sein halbes Bier in den Kragen und in Höhe der Apotheke kam sie beinahe überhaupt nicht mehr voran, weil dort der Verrückte, der an normalen Tagen völlig unbeachtet von den vorbeieilenden Passanten seine Reden schwang, an diesem Abend endlich ein dankbares Publikum gefunden hatte. Seine wirren, von »Das Ende ist nah!« unterbrochenen Predigten wurden mit Johlen und begeistertem Applaus aufgenommen, und sein hageres Gesicht glänzte voller Aufregung, während er den betrunkenen Narren mit ausladenden Gesten die Schrecken der Verdammnis ausmalte.
Nach einem kurzen Augenblick der Panik, in der Milli schon befürchtete, den Flüchtenden endgültig aus den Augen verloren zu haben, entdeckte sie ihn in der Zuschauermenge auf der anderen Straßenseite wieder. Eine Weile folgte sie ihm parallel auf ihrer Straßenseite die Gasse hinab und hielt verzweifelt Ausschau nach einer Lücke im Umzugsgedränge, durch die sie auf seine Seite gelangen konnte. Doch wie sehr sie auch Ausschau hielt, an dieser Stelle war nirgendwo ein Durchkommen.
Schließlich wurde sie sogar so heftig angerempelt, dass sie zu Boden gestürzt wäre, wenn nicht ein halbes Dutzend Hände gleichzeitig nach ihr gegriffen und sie grob auf einen der Umzugswagen hinaufgezerrt hätten. Milli schrie und strampelte und schlug um sich. »He! Nein! Lasst mich los!«
»Nur wenn du den Wegezoll zahlst!«, rief ein Mann mit einer böse grinsenden Fuchsmaske auf dem Kopf.
»Wegezoll! Wegezoll!«, grölten seine Kameraden im Chor über den Lärm der Menge hinweg.
Angewidert stieß Milli den Fuchskopf von sich und drehte sich suchend im Kreis. Sie entdeckte den Dieb auf der Straße zum Roßmarkt wieder, wo er sich gerade anschickte, in die Katharinenpforte einzubiegen.
»Was ist denn jetzt mit meinem Wegezoll«, rief der Fuchskopf und machte vielsagende Kussgeräusche. »Komm, jetzt zier dich halt nicht so.« Dabei rückte er ihr wieder so dicht auf die Pelle, dass sein biersaurer Atem Würgereize verursachte. Milli war in diesem Augenblick schon mehr als geladen, aber das brachte das Fass nun endgültig zum Überlaufen. Beinahe von allein schoss ihr Knie in die Höhe, direkt zwischen seine Beine.
»Uh«, sagte der Fuchskopf und sackte langsam in sich zusammen.
»Uh«, wiederholten seine Kameraden im Chor.
»Das gehört sich aber nicht«, sagte ein grässlich bemalter Ziegenkopf empört.
Milli deutete einen Knicks an – »Bitte vielmals um Entschuldigung, edler Herr« – und trat einen raschen Schritt auf den Ziegenkopf zu, der einen erschrockenen Satz rückwärts machte und ihr dadurch den Weg zur Flucht freigab. Schnell sprang sie vom Wagen herunter, landete platschend mit beiden Füßen in einer tiefen Pfütze und rannte los. Auf der anderen Straßenseite angekommen, drängte sie sich rücksichtslos durch die Zuschauermenge hindurch, schlug wenige Schritte weiter einen Bogen um den hoch aufragenden Kirchturm der Katharinenkirche und bog keuchend in die dahinter liegende Gasse ein.
»Stehen bleiben!«
Obwohl der Dieb sie auf diese Entfernung und bei all dem ohrenbetäubende Lärm unmöglich hören konnte, blieb er unvermittelt stehen und wandte sich mit einer ruckartigen Bewegung um. Als sich ihre Blicke begegneten fuhr ein eisiger Schauer über Millis Rücken hinweg. Beinahe hatte sie das Gefühl, dass alles an ihm falsch war. »Wie ein Scherenschnitt«, schoss es ihr durch den Kopf. Und schlagartig war der Fastnachtslärm weit fort, und sie schien ganz plötzlich in der Menge völlig allein mit ihm zu sein. Sie bildete sich sogar ein, seinen Atem hören zu können – frostig wie eine Raunacht in den Wäldern des Hochtaunus. Sie erinnerte sich an die Sage vom Kopflosen Reiter, der dort draußen in der Höhe sein Unwesen treiben sollte. Der war schließlich auch auf der Jagd nach Schädeln – nur dass ihr Dieb hier ganz offensichtlich selbst noch einen besaß. Was hatte ihn also zu dieser Tat angetrieben? »Wer … wer bist du?«, fragte sie atemlos in die Stille hinein. Ihre Worte klangen seltsam hohl und leer.
Er antwortet nicht, sondern starrte sie einfach nur wortlos an. Alles in ihr schrie danach, auf dem Absatz kehrtzumachen und zu fliehen. Zurück nach Hause zu Tante Annie, wo sie sich in ihrem Zimmer unter der Bettdecke verkriechen konnte. Wie ein kleines Mädchen, das Angst vor den Monstern in seinem Kleiderschrank hatte. Stattdessen nahm sie all ihren Mut zusammen und machte einen zaghaften Schritt auf ihn zu. Der Schnee knirschte überlaut unter ihren Füßen, und das Geräusch schien auf magische Art den Bann zu brechen. Plötzlich kehrte der Fastnachtstrubel zurück, fegte lautstark über sie hinweg und warf sie beinahe noch zu Boden.
Der Dieb wandte sich nach kurzem Zögern um und rannte weiter. Ohne nachzudenken, nahm Milli erneut die Verfolgung auf. Da er das linke Bein nachzog, war sie ihm bereits dicht auf den Fersen, als er urplötzlich einen Haken schlug, in eine schmale Seitengasse einbog und dabei einen dicken Jungen über den Haufen rannte, der ihm den Weg versperrte.
»Heee!«, kreischte der Junge und drehte eine Pirouette, nur um im nächsten Augenblick heftig mit Milli zusammenzuprallen und rücklings im Schnee zu landen.
»Entschuldige!«, rief Milli, während sie schon wieder beschleunigte, um dem Dieb in die Gasse hinein zu folgen. Nach nur wenigen Schritten blieb sie irritiert stehen. Der Dieb war verschwunden. Einfach fort. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Unschlüssig blickte sie sich um.
Obwohl die Mondsichel hell am Himmel stand, brauchte sie eine ganze Weile, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten und sie die Gestalt entdeckte, die zwischen Müllbergen an der Hauswand kauerte. Sie holte tief Luft und sprach sie an. »Hallo, du da. Ich sehe dich.«
Als die Gestalt nicht reagierte, trat sie vorsichtig näher. Im Mondlicht konnte sie seine Züge nicht besonders gut erkennen, nur einen struppigen Vollbart unter hohen Wangenknochen. Der Mann war groß gewachsen und dürr wie ein an Schwindsucht Erkrankter. Er hatte sich in eine ausgefranste Lumpendecke gehüllt und stank ganz gottserbärmlich nach Alkohol und Erbrochenem. Neben ihm lag eine leere Weinflasche im Schnee. Für einen Augenblick glaubte Milli schon, dass er tot war, doch dann sah sie die Dampfwolke seines Atems über ihm aufsteigen und stieß erleichtert die Luft aus. Zum Teil, weil sie froh war, dass der Mann noch am Leben war, und ganz unbewusst auch deshalb, weil es sich bei ihm nicht um den Dieb handelte.
Zögerlich stapfte sie tiefer in die Gasse hinein, bis sie feststellte, dass sie an ihrem Ende angekommen war. Nirgendwo fand sie eine Spur von dem Dieb. »Wo bist du hin, verdammt noch mal? Du kannst dich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Kannst du fliegen?« Sie blickte nach oben und sah, wie der Mond gerade hinter eine Wolke verschwand. Eine Schneeflocke landete auf ihrer Nasenspitze. Erst jetzt spürte sie die eisige Kälte, die durch ihre nasse Kleidung kroch und ihre Füße langsam zu Eiszapfen gefrieren ließ. Sie kam sich plötzlich ganz albern vor, in ihrem ruinierten Raupenkostüm, auf der Jagd nach einem mörderischen Dieb, dessen Augen so tief wie Abgründe waren. Irgendwie war es wie ein böser Traum. Sie stieß einen erschöpften Seufzer aus und machte kehrt.
Am Eingang zur Gasse sah sie den Jungen, den sie auf ihrer Jagd umgerannt hatte. »He, Kleiner!«, rief sie ihm zu. »Entschuldige, dass ich dich umgerannt habe.« Sie runzelte die Stirn und sah genauer hin. Der Kleine hatte überhaupt nicht das Gesicht eines Kindes, sondern das eines erwachsenen Mannes. Außerdem wuchs ihm ein kräftiger Schnurrbart. Sie erschrak, um sich im nächsten Augenblick selbst dafür zu schelten. Der Junge war kein Kind, sondern ein Zwerg. »Entschuldige«, stotterte sie. »Ich meine, entschuldigen Sie. Ich habe nicht erkannt, dass Sie … also, ich wollte …« Sie stellte fest, dass sie unsinniges Zeug brabbelte, und brach schließlich ab. Der Zwerg starrte sie nur wortlos an. Den Ausdruck auf seinem Gesicht konnte sie beim besten Willen nicht deuten. Sie räusperte sich und wies über die Schulter. »Der Mann, den ich da verfolgt habe – er hat etwas aus dem Senckenberg gestohlen. Er ist ein Dieb. Haben Sie zufällig gesehen, wohin er verschwunden ist?«
Der Blick des Zwergs folgte ihrem Zeigefinger in die Gasse hinein. Irgendetwas flackerte kurz in seinen Augen auf. War das etwa Angst? Er sah zurück zu Milli und schien einen Augenblick mit sich zu hadern. Dann wandte er sich jäh um und rannte davon. Als Milli die Straßenecke erreichte, war er bereits in der Menge der Feiernden untergetaucht.
Kurator Hollweg
Milli saß steif auf der unbequemen Holzbank und starrte in Gedanken versunken in die Vitrine an der gegenüberliegenden Wand des Ganges. Eine Familie ausgestopfter Neuweltaffen starrte mit gläsernen Augen zurück. Abwesend bemerkte sie die kahlen Stellen im Pelz der Tiere. Am anderen Ende des Ganges wischte ein Bediensteter den beinahe makellosen Steinboden. Das Klappern seines Eimers war das einzige Geräusch im Raum. Der Schnee, der jetzt draußen wieder in dichten, großen Flocken fiel, verschluckte die Geräusche der Straße, und die Eisblumen an den hohen Fenstern hinter Millis Rücken ließen das Februarlicht trüb und weich hereinfallen. Es sah nicht danach aus, als würde der Tag noch heller werden. Milli zog ihr Schultertuch enger. Es war so kalt, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte, doch dummerweise hatte sie ihren Mantel am Kleiderhaken im Archiv hängen lassen, als man sie ins Büro von Kurator Hollweg zitierte. Was überaus eilig geklungen hatte, zog sich jetzt umso länger hin. Hollweg ließ seine Mitarbeiter gern warten. Vermutlich gab ihm das ein Gefühl von Wichtigkeit. Aber dies hier war selbst für ihn ungewöhnlich unhöflich. Milli biss die Zähne zusammen, damit sie nicht klapperten. Angestrengt bemühte sie sich, ihre Gedanken abzulenken, doch immer wieder glitten sie unweigerlich zurück zur vergangenen Nacht.
Das Öffnen der hohen Tür riss sie aus ihren Grübeleien. »Fräulein Wohl, kommen Sie doch bitte herein.« Hollwegs Stimme klang herablassend wie immer.
Hastig erhob sie sich, straffte die Schultern und betrat das Büro des Kurators. Wohlige Wärme schlug ihr entgegen: Im großen Kamin auf der anderen Seite des Raums prasselte ein ansehnliches Feuer, heiß genug, um die Eisblumen an den großen Fenstern schmelzen zu lassen. Ein dicker Teppich verschluckte ihre Schritte. Die Wände waren vollgestellt mit Bücherregalen und Schaukästen mit wunderlichen Kuriositäten und naturwissenschaftlichen Fundstücken aus aller Welt. In einer Ecke stand hoch aufgerichtet ein amerikanischer Grizzly, und über dem Kamin hing der präparierte Schädel eines Bisons. Hollweg liebte es, mit den Exponaten des Museums anzugeben, so viel war sicher.
Die Mitte des Raumes dominierte ein gewaltiger Schreibtisch auf Löwenfüßen, dessen lederbezogene Platte mit akkurat geschichteten Papierstapeln vollgestellt war. Hollweg thronte dahinter auf einem schweren Ledersessel, und Milli war sich fast sicher, dass der auf einem Podest stand, um den Kurator eine Winzigkeit größer wirken zu lassen. Demselben Zweck dienten wohl auch die zwei ebenfalls ledernen Sessel direkt vor dem Tisch. In einem von ihnen war ein Mann in einer Polizeiuniform versunken. Er trug einen beeindruckenden Backenbart und war gerade dabei, sich aus den Polstern zu kämpfen, als Milli den Raum betrat.
Hollweg machte sich nicht die Mühe, sie freundlicher als unbedingt angemessen vorzustellen. »Hauptmann Waldschmidt, das hier ist Millicent Wohl. Fräulein Wohl, der Polizeihauptmann hat einige Fragen zum Tathergang des gestrigen Abends, und ich erwarte, dass Sie umfassend und zur vollen Zufriedenheit der Polizei antworten.«
»Selbstverständlich.« Milli grüßte den Hauptmann, dem es mit Mühe gelang, sich aus dem tiefen Sessel zu befreien, mit einem leichten Knicks.
Schnaufend erwiderte der Polizist ihren Gruß und zog einen Notizblock samt Bleistift hervor. Mit etwas verkniffenem Blick musterte er seine bisherigen Notizen und räusperte sich. »Millicent Wohl, 21 Jahre, ledig, wohnhaft in der Großen Bockenheimer Gasse 46 hier in Frankfurt bei ihrer Tante Anna Wohl, verwitwet«, las er in breitem Frankfurterisch vor und blickte dann auf. »Ist das korrekt?«
Milli warf Kurator Hollweg einen Blick zu, den dieser teilnahmslos erwiderte. Es wirkte nicht, als wollte er ihr einen Platz anbieten, also straffte sie die Schultern und wandte sich vollends dem Hauptmann zu. »Das ist richtig, ja. Aber wofür …«
»Nur für die Akten, Fräulein«, unterbrach sie Waldschmidt knapp. »Vollständigkeit und Gründlichkeit sind die Grundpfeiler guter Ermittlungsarbeit.« Er kritzelte etwas in seinen Block. »Und Sie haben also am fraglichen Abend …«
»Gestern Abend«, warf Milli ein.
»… am fraglichen gestrigen Abend den Diebstahl gesehen?«
»Ich habe«, sie stockte kurz und warf Hollweg erneut einen Blick zu.
Der wedelte jedoch nur mit der Hand. »Antworten Sie. Wir haben der Polizei unsere volle Kooperation zugesichert.«
»Ich habe gesehen, wie der Mann …«
»Der Täter!«
»Wie der Täter Herrn Josef …«
»Josef Buchner«, unterbrach Hollweg erneut dienstbeflissen. »Herr Buchner arbeitet bereits seit mehr als zehn Jahren stets gewissenhaft für unser Haus.«
Der Polizist räusperte sich. »Wenn Sie mich meine Arbeit machen lassen würden, Herr Hollweg, dann würde das hier alles ein wenig schneller gehen. Das ist nicht das einzige Verbrechen, das heute in unserer Stadt aufzuklären ist.«
»Und das ist meine Schuld?«
Der Polizist ging nicht darauf ein. »Also, Fräulein Wohl«, setzte er erneut etwas lauter an. »Sie haben gesehen, wie der Täter Herrn Josef Buchner niedergeschlagen hat?«
Milli zögerte. »Nicht direkt, nein. Aber ich habe gehört …«
»Aha.« Waldschmidt kritzelte etwas in seinen Block. »Hörensagen also. Weiter.«
Sein Einwurf verunsicherte Milli noch mehr. »Aber zuerst hat er ihn bedroht. Er hat die Herausgabe eines Schädels gefordert, aber Josef, Herr Buchner, verweigerte …«
»Moment«, unterbrach sie der Polizist erneut. »Das Subjekt wollte einen … Schädel?«
»Das hat Herr Buchner gesagt.«
Der Polizist schaute von ihr zum Kurator. »Bei dem gestohlenen Gegenstand handelt es sich um einen Schädel, Herr Hollweg? Welcher Art?«
»Na ja, gewissermaßen. Es ist … ein Ausstellungsstück von gewissem Wert.«
»Einer dieser Schrumpfköpfe, von denen in der Stadt die Rede ist?«
»Nun …«
»Es handelt sich um einen menschlichen Schädel«, sagte Milli. »Einen – ich zitiere Herrn Buchner – männlichen Schädel jüngeren Datums von mitteleuropäischem Typus.«
»Ach.«
»Das ist nichts Ungewöhnliches«, warf Hollweg eilig ein. »Wir verwahren eine ganze Reihe von Schädeln hier. Verbrecher, ungewöhnliche Krankheiten, die Knochen von Menschen, die ihre Überreste der Wissenschaft …
»Davon habe ich gehört.« Der Polizist sah ihn scharf an. »Aber man hat auch gehört, dass es in gewissen Kreisen üblich ist, nachts Tote aus ihren Särgen zu stehlen …«
»Lebende geht ja schlecht«, sagte Hollweg und kicherte eine Spur zu nervös. Er räusperte sich. »Das wurde vielleicht früher gemacht. Kommt heute aber fast nicht mehr vor. Also gar nicht mehr. Meines Wissens. Es gibt genug Menschen, die ihre sterblichen Überreste der Wissenschaft und hier insbesondere unserem Labor …«
»Also ist der Kopf da gestohlen?«
»Also ich denke nicht, dass …« Hollweg unterbrach sich selbst. »Ach so. Ja. Bei dem gestohlenen Artefakt handelt es sich um einen Schädel. Einen wertvollen Schädel. Er …«
»War er aus Kristall?«
Der Kurator sah den Polizisten verwirrt an. »Das wäre höchst ungewöhnlich. Normalerweise besteht das menschliche Skelett aus Knochen.«
»Man fragt ja nur«, sagte Waldschmidt und klang dabei fast ein bisschen enttäuscht. »Man liest ja die seltsamsten Dinge.« Er kritzelte etwas in seinen Block. »Also wertvoll war er?«
»Herr Buchner sagte, dass es sich um ein außergewöhnliches Stück handelt. Möglicherweise einer der interessantesten Köpfe unserer Zeit. Er …«
»Josef sagte, es wäre der Schädel von Schiller«, sagte Milli.
»Was?« Waldschmidt sah auf.
Kurator Hollweg warf Milli einen beinahe tödlichen Blick zu. »Der Herr Buchner hat ein ausgesprochen inniges Verhältnis zu alten Knochen, und … er gibt ihnen blumige Namen. Schiller, Aristoteles, Nero …«
»Er zitierte ein Gedicht dazu …«
»Wie ich schon sagte«, unterbrach Hollweg sie schnell. Er machte mit dem Zeigefinger eine kreisende Bewegung vor der Stirn. »Aber was soll man tun? Buchner ist einer der besten Präparatoren in Hessen, und Direktor Neuburg hält große Stücke auf ihn. Da darf er wohl ein wenig exzentrisch sein.« Er seufzte theatralisch. »Aber der Wert des Schädels liegt für unser Museum vor allem darin, dass er eine Leihgabe eines unserer wichtigsten Gönner ist. Wenn herauskommt, dass er hier gestohlen wurde, quasi unter meinen eigenen zwei Augen – der Schaden für unseren Ruf wäre enorm.«
»Der Schaden für Ihren Ruf?«
»Na ja, wissen Sie, eine ganze Reihe unserer Exponate sind Leihgaben wohlhabender Bürger. Und wenn die der Meinung wären, dass ihre wertvollen Sammlerstücke bei uns nicht sicher sind … Sie müssen den Kerl finden, verstehen Sie?«
»Schon weil er Josef niedergeschlagen hat«, sagte Milli.
Der Kurator sah sie einen Moment lang irritiert an. »Das auch«, sagte er dann abwesend. »Das auch. Er ist immerhin ein ziemlich guter Präparator.«
Der Polizist räusperte sich. »Also, Fräulein … Wohl. Zurück zum Tathergang. Erzählen sie mir doch mal genau, was in der frag… in der gestrigen Nacht passiert ist. Von Anfang an, wenn’s Ihnen nichts ausmacht.«
»Ich hab’s Ihnen doch schon gesagt«, sagte Hollweg, doch dieses Mal ließ sich der Polizist nicht das Wort nehmen.
»Lassen Sie mich, Herr Kurator! Man macht seine Arbeit. Gründlich – oder gar nicht. Hat meine Mutter immer gesagt. Also fangen Sie an, Fräulein. Wir haben nicht den ganzen Tag.«
Milli riss sich zusammen. »Von Anfang … also, es fing an, dass ich von Herrn Hollweg hier hinunter in den Keller geschickt wurde, um aus dem Leichenraum von Herrn Buchners Labor den Schaumwein zu holen.«
»Französischen Schaumwein«, warf Hollweg hörbar stolz und selbstzufrieden ein. »Direkt aus der Champagne. Kostet ein Vermögen – aber er ist es wert. Haben Sie schon mal Champagner getrunken, Herr Waldschmidt?«
»Ich kann mich nicht daran erinnern«, entgegnete der Polizist irritiert.
»Ein Genuss, sag ich Ihnen! So gern ich patriotisch wäre, beim Schaumwein bin ich Anhänger des französischen …«
»Sie sollten also den Schaumwein holen«, unterbrach Waldschmidt seinen Redeschwall und wandte sich wieder Milli zu. Dann stutzte er, und das Kratzen seines Bleistifts hörte auf. »Sie lagern den Schaumwein in einem Leichenhaus?«
Hollweg zuckte nur mit den Schultern. »Wo sollte man ihn denn sonst lagern? Schaumwein muss kühl liegen.«
»Josef sagt, dass das im Sommer der kühlste Ort ist«, erklärte Milli. »Und nebenbei gibt es neben ihm nicht viele Menschen, die den Schlüssel haben. Wertvolle und verderbliche Ware wird deshalb oft dort unten gelagert. Tote Tiere, interessante Proben von krankem Gewebe, die uns das Bürgerhospital liefert, der Wein, Eis für die Getränke …«
»Sie lagern Eis für die Getränke neben Toten?«
Hollweg winkte ab. »Die stören sich nicht daran, wenn’s etwas kälter wird. Im Gegenteil.«
»Ah«, machte Waldschmidt trocken. »Und was passierte dann?«
»Ich kam hinunter und fand die Tür nur angelehnt vor«, fuhr Milli fort. »Das ist aber nichts Seltsames an solchen Tagen. Ich bin sicher nicht die einzige Dienstbotin, die gestern Nacht geschickt wurde, um Getränke zu holen. Das ist auch der Grund, warum Herr Buchner den Abend unten verbracht hat. Er wollte ein wenig darauf achten, dass dort niemand etwas anfasst, das ihn nichts angeht.«
»Und weiter?«
»Ich bin in den Kühlraum gegangen und habe die Flaschen gesucht, wegen denen ich beauftragt worden war. Für den Empfang war ziemlich viel eingelagert, und es hat eine Weile gedauert, ihn zu finden. Dann habe ich Geräusche gehört. Irgendwas ging zu Bruch, es klang wie ein Kampf und Streit. Zwei Stimmen. Herrn Buchners und die eines mir unbekannten Mannes. Beide schienen sich wegen etwas zu streiten, doch von dort, wo ich stand, habe ich sie nicht sehen können. Was mir aber sofort aufgefallen ist, war der Akzent.«
»Buchner kommt aus Niederbayern«, warf Hollweg ein. »Aus Passau, glaube ich.«
Milli stockte. »Nein, ich meine nicht Herrn Buchners Akzent. Der fremde Mann klang … ich weiß nicht. Wie jemand, der eigentlich nicht Deutsch spricht.«
Der Polizist horchte auf. »Ein Franzose?«
»Würde denen ähnlich sehen«, pflichtete Hollweg bei. »Die haben hier ja schon immer gern geplün…«
»Kein Franzose«, sagte Milli rasch.
»Nicht?«, fragte Waldschmidt.
»Nein, ich glaube, der kam eher aus dem Osten.«
»Ah, ein Tscheche!« Wieder begann Waldschmidt auf sein Papier zu kritzeln.
»Oder ein Österreicher«, sagte Hollweg. »Denen traue ich ja alles zu.«
Milli seufzte. »Nein, kein Österreicher. Und ehe Sie fragen: Es war auch kein Preuße. Mein Bruder ist in Berlin stationiert. Ich weiß, wie Preußen klingen.«
Die beiden Männer schienen für einen Moment etwas ratlos zu sein. »Dann … ein Fahrender?«, erkundigte sich Waldschmidt schließlich. »Es ist Fastnacht, da sind eine Menge Schausteller und Fahrende in der Stadt.«
»Aber was sollte ein Fahrender im … Moment.« Hollweg zögerte, als ihm eine Idee zu kommen schien. »Was, wenn der Buchner versucht hat, Geld zu machen, indem er Ausstellungsstücke an die Fahrenden verkauft?«
»Es war kein friedlicher Austausch!«, widersprach Milli heftig. Sie stützte die Hände in die Hüften. »Ich sagte doch: Sie haben gekämpft!«
»Ja, vielleicht war er ja nur mit dem Preis nicht zufrieden.« Hollweg klang jetzt etwas sicherer. »Und einen Menschenschädel kaufen, das klingt doch ganz nach diesem Gesindel!«
»Nein! Sie haben gestritten, und ich habe gehört, wie der Mann Josef … Herrn Buchner niederschlug! Und dann wurde die Tür aufgerissen, und der Fremde stieß mich über den Haufen.«
»Ja, so kann man natürlich Geld sparen. Herr Hauptmann, ich denke, Sie sollten dringend den Buchner danach befragen, was er mit Fahrenden zu schaffen hat.«
»Und ich denke, Sie sollten die Polizeiarbeit schon mir überlassen.« Waldschmidt seufzte. »Fräulein Wohl, haben Sie den Mann nun gesehen?«
»Ja.« Milli konnte eine gewisse Schärfe nicht aus ihrer Stimme heraushalten. »Und er sah definitiv nicht nach einem Fahrenden aus. Er …« Sie stockte kurz. »Er war … seltsam.«
»Ja, wie sah er denn nun aus?«
»Na ja, er war mittelgroß, untersetzt. Vielleicht so wie der Herr Kurator, nur ohne den Bauch. Sehr kräftig. Kurzes, helles Haar und ein Schnauzbart. Dunkle Augen, soweit ich das im Halbdunkel erkennen konnte. Definitiv dunkle Augen! Er trug dunkle Hosen, Weste, einen Gehrock mit Stickereien – ich habe ihn oben noch mal gesehen: sehr modisch geschnitten, und einen weiten, dunklen Mantel darüber. Oh, und er hat gehinkt!«
»Ein Bart, hm?« Der Polizist klang düster. »Ein Sozialist. Ein hinkender Sozialist.«
»Ich dachte mir schon, dass der Buchner mit Sozialisten zu schaffen hat«, sagte Hollweg, doch der Polizist beachtete ihn nicht.
»Könnten Sie den Mann wiedererkennen? Oder eine Beschreibung von ihm anfertigen?«
»Wiedererkennen auf jeden Fall«, sagte Milli bestimmt. »Ich vergesse nie ein Gesicht. Es ist eine Gabe. Oder ein Fluch, bei manchen Gesichtern, aber … ja.«
»Gut, dann benötige ich eine genaue Beschreibung. Weiter – was ist nach dem Streit geschehen?«
»Wie ich schon sagte: Der Fremde schlug Herrn Buchner nieder.«
»Dieser Buchner scheint mir der Beschreibung nach allerdings ein kräftiger Kerl zu sein«, sagte Waldschmidt nachdenklich. »Es ist nicht einfach, einen Mann niederzuschlagen, wenn er darauf gefasst ist.«
»Der Schlag war sehr heftig«, bekräftigte Milli. »Dann ließ der Mann den gestürzten Herrn Buchner zurück und verließ den Raum.«
»Und Sie sind sich sicher, dass er sonst nichts an sich nahm?« Der Polizist blätterte kurz in seinem Block. »Ich habe mir hier notiert, dass außerdem drei goldene Becher und eine Schatulle mit Schmuck entwendet wurden.«
»Das glaube ich kaum. Er hat sich nicht damit aufgehalten, irgendetwas zu suchen. Er verließ den Raum fast sofort nach dem Kampf.«
Hollweg räusperte sich. »Vermutlich hat er diese anderen Dinge schon zuvor gestohlen. Es spielt allerdings keine Rolle«, fügte er schnell hinzu. »Der Schädel ist das mit Abstand wertvollste Stück Diebesgut.«
»Hm«, machte Waldschmidt und schrieb erneut etwas auf. »Ich verstehe. Weiter. Ich habe gehört, dass Sie daraufhin ebenfalls das Gebäude verlassen haben, Fräulein Wohl. Fluchtartig.«
»Ja. Nein, nicht fluchtartig. Ich bin dem Dieb gefolgt! Als der Mann den Keller verließ, habe ich nach Herrn Buchner gesehen. Er hat am Kopf geblutet, war jedoch bei Sinnen, und es schien ihm in Anbetracht der Dinge gut zu gehen. Er schickte mich hinter dem Dieb her. Also habe ich ihn auf sein Drängen hin sitzen lassen und bin dem Täter nachgeeilt.«
»Um ihn aufzuhalten? Sie? Ha!«, machte Hollweg. »Das ist nicht besonders glaubwürdig, Fräulein Wohl. Am Ende stecken Sie mit dem Täter noch unter einer Decke!«
Milli schnappte nach Luft und protestierte: »Natürlich nicht! Und natürlich wollte ich ihn nicht aufhalten!«
»Sehen Sie, Hauptmann? Sie gibt es sogar zu!«, rief Hollweg triumphierend.
»Nichts dergleichen tue ich! Ich bin ihm gefolgt, um jemanden auf ihn aufmerksam zu machen. Bedienstete, Gäste, vielleicht einige der Offiziere unter ihnen, oder einen der Wachleute, die das Museum für den Anlass bestellt hatte.«
»Und … haben Sie?«, fragte Waldschmidt misstrauisch.
»Nein! Wie konnte ich? Der Kerl hatte einigen Vorsprung, und er bewegte sich ganz unauffällig durch die Gäste! Niemand hat auf mein Rufen gehört; die Leute haben lieber gegafft oder mich gleich ganz übersehen! Ich glaube, irgendjemand hat mich sogar hysterisch genannt.«
»Nun«, sagte Hollweg. »Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Hysterie bei Frauen häufig …«
»Also haben Sie ihn nicht aufgehalten«, folgerte Waldschmidt messerscharf, was Milli einen entnervten Seufzer entlockte.
»Nein, habe ich nicht. Als niemand reagiert hat, bin ich ihm auf die Straße gefolgt. Ich habe ihn eine Weile verfolgt. Er hatte mich nicht bemerkt, glaube ich, denn er hatte es nicht eilig.«
»Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie in solchen Dingen ausgebildet?« Waldschmidt klang ein wenig herablassend, was Milli seltsamerweise wütender machte als die unnötigen Zwischenrufe des Kurators.
»Nun fürs Erste: Er ist nicht gerannt. Er hat sich auch nicht umgesehen, sondern sich möglichst unauffällig durch die Menge geschoben. Es war viel los, und er kam nicht sonderlich schnell voran. Ich allerdings auch nicht. Nicht, ohne seine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen – und vor allem nicht in meinem Kostüm.«
»Das Fräulein hatte sich als Raupe verkleidet«, warf Hollweg spöttisch ein. »Ist das zu fassen?«
Milli beachtete ihn dieses Mal nicht. »Es war wirklich nicht leicht, ihm zu folgen, aber mir ist es gelungen. Für eine Weile zumindest. Bis er mich bemerkt hat. Als er mich sah, ist er durch die Menge davongerannt. Durch das Hinken nicht allzu schnell, aber ich konnte ihn auch nicht einholen. Er ist durch die Katharinenpforte gelaufen und kurz darauf in eine Seitengasse. Und als ich die erreicht hatte, war er verschwunden.«
»Verschwunden«, echote Waldschmidt.
»Spurlos!«, bestätigte Milli. »Das ist nur eine enge Sackgasse. Sie hat nur einen Ausgang. Und sie war leer. Ich meine, abgesehen vom Schnee und altem Gerümpel, aber ich habe nachgesehen, und er hat sich nirgendwo dort versteckt.«
»Frauen!« Hollweg warf theatralisch die Hände in die Luft. »Es geht nie gut, wenn sie versuchen, die Aufgaben eines Mannes zu übernehmen.«
»Aber immerhin arbeitet sie für Sie«, sagte Waldschmidt.
Der Kurator murrte. »Nicht auf mein Anraten, so viel ist sicher. Direktor Neuburg hat sich für ihre Anstellung eingesetzt. Aber ich bin mir sicher, dass sich seine Ansicht nach diesem Vorfall ändern wird.«
»Ach?«, fragte Milli. »Sie meinen die ungenügenden Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen wurden, um die Ausstellungsstücke zu schützen und einen Angriff auf das Museumspersonal zu verhindern, Herr Hollweg?«
Der Kurator fuhr in seinem Sitz auf, sein Bauch bebte, und seine Stimme überschlug sich beinahe: »Wie können Sie es wagen!«