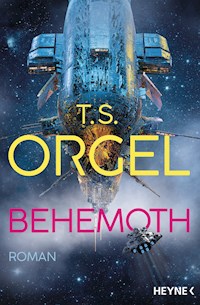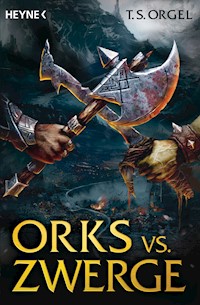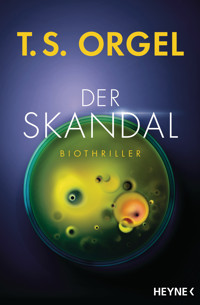
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Unternehmer Dan Light wird als Held der grünen Ernährung gefeiert. Seine Firma Light Foods produziert Laborfleisch, für das keine Tiere sterben müssen, und macht Milliardenumsätze damit. Doch der Ausbruch einer weltweiten Krankheit wirft einen Verdacht auf: Geht bei Light Foods wirklich alles mit rechten Dingen zu? Als Dan Light nachforscht, stößt er in seinem eigenen Unternehmen auf ein Netz aus Korruption, Intrigen und Sabotage – und wird auf einmal selbst zum Gejagten. Ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Es klingt beinahe zu gut, um wahr zu sein. Im Deutschland der nahen Zukunft hat der Konzern Light Foods nicht nur das erste marktfähige Fleisch aus dem Labor entwickelt, sondern auch eine ressourcenschonende Produktionsweise dafür. Ist das die Lösung für die Umweltprobleme und Welternährungssorgen? Das versprechen zumindest die großspurigen Werbebotschaften des charismatischen Firmengründers Dan Light, der sich gekonnt als Steve Jobs der New-Food-Industrie inszeniert. Dazu kommt, dass überall auf der Welt eine neuartige und tödliche Lebensmittelkrankheit um sich greift. Fleisch aus Massentierhaltung wird als Ursache angenommen – und die Aktien von Light Foods steigen. Doch dann schöpft ein kleines Team von Aktivisten Verdacht. Wie kann die Firma weltweit Milliarden Tonnen Fleisch produzieren, und das auch noch völlig klimaneutral? Peter, der Kopf der Aktivistengruppe, schleust sich in die PR-Abteilung des Konzerns ein und hackt sich in die Systeme. Als er brisantes Datenmaterial findet, will er Light Foods auffliegen lassen – und fällt einem Unfall zum Opfer. Jetzt liegt Peter im Koma auf der Intensivstation, und seine Schwester Anna muss sich entscheiden, was sie mit Peters Entdeckung und den Plänen der Gruppe anfangen will. Eine tödliche Jagd nach der Wahrheit hinter Light Foods beginnt …
Die Autoren
Hinter dem Pseudonym T. S. ORGEL stehen die beiden Brüder Tom und Stephan Orgel. In einem anderen Leben sind sie als Grafikdesigner und Werbetexter beziehungsweise Verlagskaufmann beschäftigt, doch wenn beide zur Feder greifen, geht es in fantastische Welten. Ihr erster gemeinsamer Roman Orks vs. Zwerge wurde mit dem Deutschen Phantastik Preis für das beste deutschsprachige Debüt ausgezeichnet. Seitdem haben sie mit Die Blausteinkriege, Terra und Die Schattensammlerin noch viele weitere Welten erkundet.
Mehr zu den Autoren und ihrem Werk finden Sie auf www.ts-orgel.de und www.diezukunft.de
T.S. ORGEL
DER SKANDAL
BIOTHRILLER
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 6/2023
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2023 by Thomas und Stephan Orgel
Copyright © 2023 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,
unter Verwendung eines Motivs von Elymas/Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28941-6V001
diezukunft.de
»Poor men seek meat for their stomachs, rich men stomachs for their meat.«
Benjamin Franklin, Poor Richard’s Almanack, 1735
PROLOG
Gebannt starrte Peter auf den Bildschirm seines Laptops. Ihm wurde gleichzeitig heiß und kalt. Ganz langsam dämmerte ihm die Bedeutung der Informationen, die er gerade gefunden hatte, versteckt in einem unzureichend gesicherten Back-up-File. Er schluckte, zögerte einen winzigen Moment und tippte dann einen Befehl ein. Gehorsam startete sein Rechner den Download. Es war viel. Hunderte Dokumente, fein säuberlich in Unterordnern verpackt, von denen das Back-up die meisten in weitere komprimierte Dateien verpackt hatte. Spielte keine Rolle. Es war mehr als genug Zeit, das alles gründlich zu sichten. Das wenige, was er bis jetzt geöffnet hatte, war mehr als genug, um ein deutliches Bild zu zeichnen. Dieses Verzeichnis enthielt Daten, die wie die Schockwelle eines Erdbebens um die ganze Welt gehen würden.
Er lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück und atmete langsam, beinahe zögerlich aus. Von diesem Augenblick hatte er geträumt, immer und immer wieder, während er sich über Monate immer tiefer in die Bürokratie dieses sterbenslangweilig hippen Großraumbüros gegraben hatte. Diesen Moment des Triumphs, der die Krönung seiner jungen Journalistenkarriere werden sollte. Bilder von Ehrungen schossen ihm durch den Kopf. Hände, die geschüttelt wurden, Auszeichnungen, die man verlieh, und unzählige Liveberichte und TV-Interviews, die er mit einem geduldigen Lächeln über sich ergehen lassen würde. Er, der Mann, der dem Bösen eigenhändig die Maske vom Gesicht gerissen hatte.
Im nächsten Augenblick zuckte allerdings schon ein Funken Schuldbewusstsein durch seinen Kopf. Fuck, es ging hier doch nicht um ihn. Das Ding hier war größer als ein paar Ehrungen. Es ging um Menschenleben! Hatte er denn nichts von Lisa gelernt?
Instinktiv sah er sich um und runzelte noch in der Bewegung die Stirn. Natürlich war er allein. Es war seine Wohnung. Klein, kahl, schon viel zu lange temporär. Das würde sich auch ändern, wenn das hier endlich einmal vorbei war. Er seufzte, beugte sich nach vorn und griff nach seinem Handy, das neben dem Rechner auf der Tischplatte lag. Mit dem Daumen entsperrte er das Display und klickte auf das Symbol, das den abgesicherten Messenger öffnete. Gleich an erster Stelle stand Lisas Kennung und daneben als Profilbild ein winziges Anarchiesymbol. Mit zitternden Fingern tippte er eine Nachricht ein. »Ich habe das File gefunden. Es ist alles da. Wir haben die Schweine!«
Keine zehn Sekunden später kam schon die Antwort. Ein Emoji, das große Augen machte. Dann die Worte: »Bin gleich da!«
Schnell flogen seine Finger über das Display: »Bleib! Ich komm zu dir.«
Lisa antwortete prompt mit einem erhobenen Daumen und einer stilisierten Explosion.
»Boom!«, murmelte Peter. »Das kannst du laut sagen.« Schnell klappte er den Laptop zu, steckte ihn in seine Umhängetasche und warf sie sich über die Schulter. Während er die Treppen hinunterstürmte, kam er sich vor wie Jason Bourne mit einer Atombombe in der Tasche, die jeden Augenblick hochgehen konnte. Die alte Frau Nowak aus dem zweiten Stock sah ihm missbilligend hinterher. Ihr Dackel stieß ein kurzes Bellen aus, als er an ihnen vorbeistürmte, immer zwei Treppenstufen auf einmal nehmend. Er warf den beiden ein triumphierendes Grinsen zu. Frau Nowak schüttelte stumm den Kopf.
Peter rannte die Straße hinunter zur S-Bahn-Station. Vorbei an Fast-Food-Restaurants, kleinen Lebensmittelgeschäften und unzähligen Modeläden, in denen sich die Menschen der Leichtigkeit ihres Daseins hingaben, ohne dabei auch nur einen Gedanken an den Preis zu verschwenden, den sie für ihr bisschen Luxus bezahlten. Nicht der offizielle Preis, dachte Peter, der auf dem Preisschild aufgedruckt war, sondern die wirklichen Kosten, die vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen blieben. Den weit höheren. Die Kinderarbeit in den Kobaltminen Afrikas, die menschenunwürdigen Lebensverhältnisse in kambodschanischen Nähereien und die tiefen Wunden, die all dieser sinnlose Konsum an jedem Tag aufs Neue in ihre Umwelt schlug. Sein Blick blieb an der vor wenigen Tagen neu eröffneten Filiale von »Light Foods BestBurgers« hängen, vor deren goldfarbenen Türen sich bereits eine lange Schlange gebildet hatte. Hirnlose Zombies, die mit leeren Blicken auf ihre iPhones starrten, während sie geduldig auf einen Platz im angesagtesten Fresstempel der Stadt warteten. Insgeheim freute er sich schon auf ihre entsetzten Blicke, wenn die Bombe endlich hochgehen würde. »Boom!«
Er musste lachen, weil er plötzlich feststellte, dass er sich nun schon selbst wie Lisa anhörte. Aber das war nun mal ihre Art – ihre eigene Art von Magie, mit der sie die Menschen für eine Sache entzünden konnte, die ihr am Herzen lag. Er stürmte die Treppe zur S-Bahn-Station hinunter. In der Zwischenebene ging es wesentlich ruhiger zu als oben auf der Straße, allerdings war es hier auch nicht unbedingt einladend. Schmutzig, schlecht beleuchtet und über allem der allgegenwärtige Gestank von altem Essen und Urin. Einige Jugendliche musterten ihn interessiert, als wollten sie abschätzen, ob sie ihn als Opfer oder als Täter einsortieren sollten. Unbewusst zog er die Kapuze seines Hoodies über den Kopf und beschleunigte erneut seine Schritte. Hinter der nächsten Ecke stand ein Anzugträger und sprach in sein Handy. Als Peter an ihm vorüberhastete, unterbrach er das Gespräch und wandte sich von ihm ab. Wieder dachte Peter daran, dass er eine Atombombe über der Schulter trug. War er denn von allen guten Geistern verlassen?
In der Gleisebene drückte er sich schnell an eine Säule und sah sich unauffällig um. Ganz in der Nähe stand eine Gruppe Handwerker in Arbeitskleidung, etwas weiter entfernt ein Rentnerpärchen mit Rollkoffern. Am Ende des Bahnsteigs durchwühlte ein Obdachloser systematisch die Mülleimer nach Pfandflaschen, und ganz in der Nähe tauchte erneut der Anzugträger mit dem Handy am Ohr auf. Irritiert fragte sich Peter, wie der Mann so schnell dort hingekommen war. Als sich ihre Blicke kreuzten, wandte sich der Anzugträger erneut von ihm ab. Peter musterte ihn misstrauisch. Auf den ersten Blick machte die Kleidung einen geschäftsmäßigen und gepflegten Eindruck. Bei genauerem Hinsehen schien sie allerdings von der Stange zu sein. Außerdem war sie mindestens eine Nummer zu groß. Auch die dunkelbraunen Lederschuhe schienen schon bessere Tage gesehen zu haben. Peter sah zur Anzeige hoch, die jetzt eine neue Zeit anzeigte. Der Zug verspätete sich um fünf Minuten. Er stieß einen stillen Fluch aus und warf einen nervösen Blick auf sein Handy. Der Anzugträger hatte in der Zwischenzeit seinen Platz verlassen und war hinter den Fahrplan getreten. Nur noch seine Hosenbeine und die abgewetzten Lederschuhe waren zu sehen. Der Bahnsteig füllte sich langsam. Der Obdachlose arbeitete sich langsam bis zu Peter heran und starrte ihn mit blutunterlaufenen Augen an.
»Haste ma’ Wechselgeld? Zum Telefonieren?«
Peters Hand fuhr ganz automatisch zur Hosentasche, in der er seinen Geldbeutel aufbewahrte. Er öffnete ihn und fand zu seiner Enttäuschung nur einen Fünfzigeuroschein. Entschuldigend schüttelte er den Kopf.
»Ick nehm auch ’n Fuffziger«, sagte der Obdachlose ohne eine Spur Humor im Blick.
»Sorry.«
»Arschloch«, murmelte der Obdachlose und schlurfte weiter zum nächsten Mülleimer.
Peter fühlte sich trotzdem ein bisschen schuldig. Als er aufsah, stellte er fest, dass der Anzugträger ihn vom anderen Ende des Bahnsteigs her finster taxierte. Er zog die Kapuze tiefer ins Gesicht und ging erneut hinter der Säule in Deckung.
Die S-Bahn war fast voll und furchtbar stickig. Der herbe Geruch zahlreicher müder Menschen hing in der Luft. Nur noch ein, zwei Plätze waren frei. Der Anzugträger stieg ebenfalls ein und presste das Handy wieder ans Ohr. Die Jugendlichen aus der Zwischenebene folgten ihm. Sie blieben an den Türen stehen und begannen, sich gegenseitig herumzuschubsen. Einige Passagiere schauten verärgert, aber niemand brachte den Mut auf, sie zurechtzuweisen. Ein paar Stationen weiter stiegen sie glücklicherweise aus.
Der Zug leerte sich zusehends. Der Anzugträger saß noch immer auf seinem Platz. Jetzt war sich Peter beinahe sicher, dass er ihn verfolgte. An der nächsten Station wartete er bis zum allerletzten Augenblick, um dann kurz vor dem Schließen der Türen aufzuspringen und mit einem Satz nach draußen zu treten, während sich die Türen mit einem düsteren Zischen hinter ihm schlossen. Als der Zug anfuhr, warf er einen Blick über die Schulter. Der Anzugträger erwiderte ihn finster, überrascht und verärgert.
Eilig strebte Peter auf die Treppen zum Ausgang zu. Sein Atem ging stoßweise. Seine Hände zitterten. Draußen hatte es zu regnen begonnen. Menschen hasteten mit eingezogenen Köpfen an ihm vorüber. Scheinwerfer zuckten über Hauswände und Schaufenster hinweg. Er zwang sich, nicht zu rennen. Er lief die Straße hinunter und nahm die Fußgängerbrücke zur anderen Seite des Flusses. Ein Polizeiauto raste mit eingeschaltetem Blaulicht an ihm vorüber. Er wartete, bis es zwischen den Häuserreihen verschwunden war, ehe er die Straßenseite wechselte und auf den Wohnblock zuhielt, in dem Lisa zu Hause war. In ihrer Wohnung im dritten Stock brannte Licht. Erst jetzt wagte er, erleichtert aufzuatmen. Mit immer noch zitternden Händen zog er den Haustürschlüssel aus der Hosentasche. Hinter ihm bog ein Auto in die Straße ein, seine Scheinwerfer streiften ihn kurz und erloschen. Zu spät bemerkte er, dass es nicht angehalten hatte, sondern mit ausgeschaltetem Licht weiter direkt auf ihn zuhielt.
Den Aufprall spürte er seltsamerweise gar nicht. Nur dass er herumgeschleudert wurde und so hart gegen irgendetwas prallte, dass er glaubte, irgendwas zerbrechen zu hören. Glas splitterte, und er flog erneut durch die Luft und landete auf dem Asphalt. Er wartete auf den Schmerz, doch nichts geschah. Er spürte überhaupt nichts, nur einen leichten Druck in der Magengegend. Ihm wurde kurz schwarz vor Augen, doch gleich darauf wurde die Welt in grelles Licht getaucht. Benommen blinzelte er. Jemand beugte sich über ihn, dann wurde es erneut dunkel. Danach wechselten sich die Lichter in schneller Folge ab. Erst weiß, dann rot, dann blau. Eine engelhafte Gestalt beugte sich über ihn. Sie schien etwas zu sagen, allerdings kam kein einziger Laut über ihre Lippen. Dunkelheit kroch von allen Seiten auf die Gestalt zu und hüllte alles ein, bis nur noch ein winziger Fleck übrig blieb, das Blitzen in einem Auge. Dann flackerte es auf und verlosch.
EINS
Gegen Mitternacht erreichte Anna das Krankenhaus im Westen Berlins. Sie war sich nicht sicher, was sie erwartet hatte, aber Menschenleere war es nicht gewesen. Abgesehen von einer übermüdeten Nachtschicht im gläsernen Verschlag des Empfangs schien das Gebäude beinahe verlassen. Der leicht säuerlich-scharfe Geruch nach Desinfektionsmitteln, Krankenhausessen und warm gehaltenem Pfefferminztee hing in der stickigen Luft. Für einige lange Minuten fühlte sie sich an einen schlechten Horrorfilm erinnert, und während die Nachtschicht quälend langsam ihre Daten in ein Besucherformular tippte, erwartete sie beinahe, den ersten Untoten um die ferne Gangbiegung schlurfen zu sehen. Endlich schob ihr die Nachtschicht einen ganzen Stapel Papiere zur Unterzeichnung durch ein Ausgabefach und wies ihr anschließend die Richtung zum nächsten Aufzug, der sie unter leisem Quietschen und Rumpeln bis zu der Station brachte, auf der ihr Bruder lag. Die Stille hier oben wurde durch ferne Pinggeräusche irgendwelcher Überwachungsmonitore hinter geschlossenen Türen unterstrichen. Irgendwo keuchte rhythmisch ein Beatmungsgerät, eine der Leuchtröhren über ihr summte hörbar, und vom anderen Ende des nur schummrig beleuchteten Gangs kam das unablässige, monotone Stöhnen eines Patienten, das ihr schon nach wenigen Augenblicken auf die Nerven ging. Leere Betten standen abgedeckt auf dem Gang, dessen dicker, zerkratzter Linoleumboden die Geräusche ihrer Schritte aufzusaugen schien. Noch bevor sie das Pflegedienstzimmer am anderen Ende des Gangs erreicht hatte, piepte in einem der Zimmer ein Alarm. Wenige Augenblicke später hastete eine Pflegerin mit tiefen Rändern unter den Augen an ihr vorüber, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Im Glaskasten am Ende des Gangs saß lediglich eine weitere Person, und Anna hoffte im Stillen, dass dies nicht die gesamte Belegschaft während dieser Nachtschicht war. Nach allem, was sie über den Zustand der Berliner Krankenhäuser gehört hatte, konnte das allerdings gut sein.
Sie parkte ihr Gepäck auf einem Stuhl neben dem Teekocher, ließ sich etwas Wasser aus dem Spender in einen Plastikbecher ein und wartete, bis die Pflegerin schließlich die Zeit fand, sie zu Peters Zimmer zu weisen. Das gequälte Stöhnen des Patienten war hier deutlicher zu hören. Ihre Erleichterung war nicht gering, als sie feststellte, dass es nicht aus Peters Zimmer, sondern aus einem der angrenzenden Räume kam.
Leise, zögerlich öffnete sie die Tür. Der Raum lag in tiefem Halbdunkel. Nur eine Nachtbeleuchtung über dem Bett brannte und ließ Peters Gesicht hager, eingefallen und entsetzlich fahl wirken. Oder vielleicht war es das tatsächlich. Schläuche waren auf die Wangen geklebt, schienen in seiner Nase zu verschwinden oder zusammen mit einem Gewirr aus bunten Kabeln unter seinem gepunkteten Krankenhaushemd zu verschwinden. Pflaster und Verbände bedeckten viel von dem, was übrig blieb, und machten es schwer, ihn überhaupt zu erkennen. Eine halb leer gelaufene Infusion verschwand in einer leise piependen Maschine, von der wiederum Schläuche in die Wand und in seinen Arm zu führen schienen, und auf einem Monitor neben dem Kopfende seines Betts flackerten arrhythmisch wechselnde Zahlen. Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung oder was immer hier überwacht wurde. Immerhin bedeuteten sie wohl, dass irgendwo noch Leben in dieser wächsernen Gestalt war. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie seit dem Betreten des Zimmers die Luft angehalten hatte, und sie atmete tief durch. Die schale Luft in ihrer Mischung aus Medikamentengerüchen, Seife und Urin schnürte ihr sofort die Kehle zu und ließ sie husten.
Ein leises Geräusch ließ sie zusammenfahren. In einem Sessel am Fenster rührte sich mit einem verschlafenen Seufzen eine zierliche Gestalt.
Lisa musste geschlafen haben, aber sie sah nicht aus, als sei es besonders erholsam gewesen. Ihre Augen waren rot unterlaufen und von so tiefen Schatten umgeben, dass sie selbst auf ihrer dunkelbraunen Haut deutlich zu sehen waren. Eigentlich sah sie aus, als hätte sie seit Tagen gar nicht mehr geschlafen, und ihre zu Rastas geflochtenen Haare klebten in wirren Strängen am Kopf.
Die perfekte Lisa. Aus irgendeinem Grund war es ihr Anblick, nicht der ihres Bruders, der Anna die gesamte Tragweite des Unglücks mit einem Schlag bewusst machte. Plötzlich schwankte sie, als hätte sie einen Tritt in den Magen bekommen. Sie griff nach dem Fußende des Betts, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und versuchte verzweifelt, Luft zu bekommen.
Lisa richtete sich auf. »Anna! Alles in Or…« Sie sprach das Wort nicht fertig, so als wäre ihr im selben Augenblick selbst klar geworden, wie höhnisch es klang. Nichts war in Ordnung.
Stattdessen stemmte sie sich aus ihrem Sessel und manövrierte Anna hinein. Dann holte sie aus der kleinen Nasszelle des Zimmers ein Glas Wasser und drückte es Anna in die zitternde Hand.
Anna stürzte es gierig hinunter.
»Besser?«
Sie nickte, stellte das Glas ab und wischte sich mit der Hand über das Gesicht. »Wie lange bist du schon hier?«, fragte sie dann leise.
Lisa zog sich einen der zwei Krankenhausstühle heran und setzte sich neben sie, wobei sie Peters fahles Gesicht nicht aus den Augen ließ. »Seit sie ihn eingeliefert haben.«
»Seit vorgestern Abend schon?«
Lisa zuckte mit den Schultern. »Ich mein, ich war kurz zu Hause, duschen und frische Klamotten und so, aber …« Sie wiederholte das Schulterzucken, als wüsste sie nicht, was sie sonst tun sollte. »Sie haben gesagt, ich soll nach Hause gehen. Er liegt im Koma, und es sieht nicht so aus, als würde er in den nächsten Stunden aufwachen. Oder Tagen. Oder …«, sie schluckte und ließ den Kopf hängen. »Jedenfalls«, sagte sie dann leiser, »kann es dauern, bis die Schwellung in seinem Kopf und den Nerven zurückgegangen ist, erst dann können sie irgendwas sagen. Aber … aber es ist mir einfach nicht richtig vorgekommen, ihn ganz allein hier liegen zu lassen. Was, wenn er doch aufwacht?«
Anna sah sie an und rieb sich dann über das Gesicht. Das Schwindelgefühl war verschwunden und mit ihm die Enge in ihrer Brust. Lisa war der Inbegriff einer Powerfrau. Die kleine schwarze Frau mit den unglaublich vielen Haaren war geradezu unverschämt sportlich, konnte klettern und surfen und fuhr Snowboard wie eine junge Göttin. Anna hatte das Paar vor einigen Jahren einmal zu einem Skiwochenende begleitet. Während sie selbst damit zu kämpfen hatte, ihre Skier einigermaßen parallel zu halten, war Lisa allen anderen aus der Gruppe davongefahren und hatte sich schließlich ein Rennen mit den einheimischen Skilehrern geliefert. Anna hatte sie dafür gehasst. Damals und auch danach hatte sich immer alles nur um Lisa gedreht. Die schöne Lisa, die herzensgute Lisa, die talentierte, die perfekte Lisa, die selbstlose … Die Frau machte Peter glücklich, soff mit Skilehrern um die Wette, sammelte Sportpokale wie Anna Strafzettel und brachte ihre eigene Mutter dazu, ihr zu sagen, sie solle sich ein Beispiel an Lisa nehmen. Es war der letzte gemeinsame Ausflug gewesen. Ab dann hatte Anna Begegnungen, soweit es ging, vermieden. Mit Ach und Krach hatte sie sich durch ihren Bachelor gekämpft und sich bei jedem Besuch zu Hause anhören dürfen, wie erfolgreich Peter doch geworden war, was für ein bezauberndes Paar die beiden doch seien, in welchen Vereinigungen und Gremien Lisa inzwischen schon wieder saß und wie nobel es doch von ihr war, dass sie sich so der Rettung der Umwelt verschrieben habe, wo sie es doch selbst schon aufgrund ihrer Hautfarbe – wir sehen das ja gar nicht mehr, aber du weißt, wie die Leute sind – so viel schwerer habe als Anna.
Kurz: In Lisas Gegenwart fühlte sich Anna immer ein bisschen minderwertig. Und selbst jetzt schien Lisa stärker zu sein als sie.
Für einen Moment wallte Zorn in ihr auf und trieb ihr Tränen in die Augen. Wieso lag ihr Bruder hier, und seine perfekte …?
In diesem Moment sank Lisa in sich zusammen, nahm einen tiefen, bebenden Atemzug, und plötzlich hatte auch sie Tränen in den Augen. Gleich darauf zog sie Anna an sich und schlang die Arme um ihren Hals, wie eine Ertrinkende, die sich an einem Stück Holz festklammerte. Für eine Weile hielt sie sich an Anna fest, und ihre Schultern bebten in leisem Schluchzen. Anna tätschelte ihr unbeholfen den Rücken und kam sich schäbig vor. Konnte sie nicht einmal jetzt das mit der Eifersucht sein lassen?
Nach einer Weile beruhigte sich Lisa wieder. Sie schniefte und löste sich mit einem schüchternen Lächeln von Anna. »Entschuldige. Du musst dich selbst beschissen genug fühlen, und ich heule dich hier so voll …«
Anna wischte sich mit dem Handballen über die Augen. »Schon okay. Es ist«, sie rang um Worte, »halt beschissen.«
»Was, wenn er nicht mehr aufwacht?« Lisa starrte sie mit blutunterlaufenen Augen an, und Anna kam sich schlagartig um Jahre gealtert vor.
Zögernd zuckte Anna mit den Schultern. »Darüber dürfen wir nicht nachdenken. Was haben die«, sie nickte in Richtung Tür, »gesagt?«
Lisa zuckte müde mit den Schultern und ließ sich in ihrem Stuhl zurücksinken. »Eigentlich gar nichts. Es ist noch zu früh. Er hat Glück gehabt, war die Aussage.« Sie schnaubte abfällig. »Ein gebrochenes Bein, drei Brüche im linken Arm, zwei im rechten und in der Hand, Haarrisse in der Hüfte, ein paar Rippen«, sie deutete auf die Halskrause, die Peters Kopf fixierte, »drei angebrochene Wirbel und eine Schädelfraktur. Aber angeblich keine lebensbedrohlichen Verletzungen oder innere Blutungen. Ob seine Nerven …« Sie schluckte und beugte sich dann nach vorn, um Peter liebevoll eine Haarsträhne aus dem Gesicht zu streichen. Ihre Hand zitterte. Sie schniefte leise und brachte den Anflug eines Lächelns zustande, das wohl tapfer sein sollte. »Sie wissen es nicht. Es ist noch zu früh«, wiederholte sie. »Aber ich weiß, dass er es schafft.«
Immer noch die gleiche, unverbesserliche Optimistin. Im Gegensatz zu mir. Anna starrte auf Lisas schmale Hand, auf Peters geschwollenes und gleichzeitig eingefallenes Gesicht und auf die Monitore, die mit steigender und fallender Frequenz vor sich hin piepten.
Glück? Wie sollte irgendjemand denn so einen Unfall überleben? Es war doch quasi kein Knochen in Peters Körper heil geblieben. Und dann die Sache mit der Flüssigkeit im Kopf … Sie hatten ihn ins künstliche Koma versetzen müssen und dann seinen Schädel aufgebohrt. Anna spürte, wie sich allein bei dem Gedanken ihr Magen zusammenzog. Unbeholfen legte sie ihre Hand auf die ihres Bruders. Sie fühlte sich eiskalt, leblos an. »Das will ich ihm geraten haben«, sagte sie leise, nach einer Pause, die ihr viel zu lang vorkam. »Sonst kriegt er Prügel von mir.«
Lisa sah auf, und ein unwillkürliches, verstörtes Auflachen entrang sich ihrer Kehle. Anna zuckte mit den Schultern.
Eine Zeit lang saßen sie schweigend nebeneinander und lauschten den gleichmäßigen Geräuschen der Geräte. Irgendwann betrat eine Krankenschwester das Zimmer, überprüfte die Funktionen, notierte irgendwelche Werte und tauschte eine Infusionsflasche aus.
»Sollen wir uns was zu trinken holen?«, fragte Lisa.
Anna nickte dankbar.
Im Erdgeschoss fanden sie eine Cafeteria, die um diese Nachtzeit natürlich geschlossen war, in einer Ecke davor jedoch einen Automaten, der nicht nur Patientenkarten, sondern auch Kleingeld annahm. Lisa zog sich einen Tee und Anna einen Becher Kaffee. Der Kaffee schmeckte wässrig, gleichzeitig angebrannt, fade und mit einem Nachhall von Brühwürfelsuppe, die der Automat wohl ebenfalls ausspucken konnte. Anna verzog das Gesicht, schluckte den Kaffee jedoch tapfer hinunter. Im Grunde war es ihr egal. Immerhin war er heiß und würde mit viel Glück genügend Koffein enthalten, um ihre Lebensgeister wieder ein bisschen auf Trab zu bringen.
Sie traten vor die Tür, und Anna sog gierig die klare, eisige Nachtluft ein. Lisa ging ein paar Schritte aus dem Eingangsbereich in den Schatten einer Nebentür, holte eine Dose mit selbst gedrehten Zigaretten aus ihrer Hosentasche und zündete sich eine an. Anna konnte hier im Dunkeln kaum das schwarze Gesicht der anderen sehen. Der Geruch ließ erahnen, dass die Zigarette mehr als nur Tabak enthielt. Nach zwei tiefen Zügen hielt sie das Teil Anna hin, doch die lehnte dankend ab.
»Wissen sie eigentlich schon, wer der Fahrer war?«, fragte sie stattdessen.
»Bislang nicht.«
Anna schlang die Arme um sich. »Ich frage mich … ich meine, warum ist der nicht stehen geblieben? Wie kann man da weiterfahren? So, als wäre nichts …« Sie brach ab und schüttelte erneut den Kopf. »Ich könnte nicht mit der Gewissheit leben, dass ich einen Menschen …« Ihre Stimme versagte erneut.
Lisa blies heftig den Rauch aus. Eine süßliche Graswolke hüllte Anna für einen Moment ein und stieg dann in den Nachthimmel hinauf. »Das war kein Unfall«, stieß sie ungehalten hervor.
Anna warf ihr einen verwirrten Blick zu. »Aber die Polizei sagt …«
»Ach, die Bullen. Die haben doch keine Ahnung.« Wütend drückte Lisa die Zigarette gegen die Hauswand, immer und immer wieder, bis alle Glut erloschen war. Dann schob sie den Stummel in ihre Jackentasche, wandte sich abrupt um und stiefelte zurück ins Foyer.
Anna sah ihr sprachlos hinterher. Was zum Teufel war das gerade gewesen?
Da sie nicht wusste, wie sie sich verhalten sollte, entschied sie, Lisa erst mal in Ruhe zu lassen. Sie zog sich noch einen weiteren Brühwürfel-Kaffee aus dem Automaten und setzte sich vor der Cafeteria auf eine Bank. Auch um diese Nachtzeit herrschte in diesem Teil des Krankenhauses, in der Nähe der Notaufnahme, übermüdete Betriebsamkeit. Sie beobachtete die unterschiedlichen Menschen, die durch die Gänge wanderten, und lauschte ihren manchmal bizarren Unterhaltungen. Sie war froh über die Ablenkung, die ihr gestattete, sich für eine Weile nicht mit Peters Schicksal auseinandersetzen zu müssen. Die meisten Gäste hier waren Angehörige von Leuten in der Notaufnahme, mit bangen, müden Gesichtern und Furcht in den Augen, die blicklos in ihre Kaffees starrten oder fieberhaft auf Smartphones herumtippten. Vermutlich, um irgendwem da draußen in der Nacht Neuigkeiten zum Zustand eines Patienten zu übermitteln – oder eben, dass es nichts Neues zu berichten gab. Eine Handvoll Leute aus Rettungswagenbesatzungen holten sich einen Kaffee oder ließen eine Flasche Cola aus dem Automaten poltern, oder ein abgepacktes Sandwich, das sie auf dem Weg nach draußen hastig und mit viel zu großen Bissen hinunterschlangen. Hier und da saßen an den Tischen aber auch Patienten, manche mit fahrbaren Infusionsständern neben sich und Schlaflosigkeit im Blick. Am Nebentisch leerte ein alter Mann mit stoischer Methodik einen Beutel Gummibären nach dem anderen und futterte sie auf, nachdem er sie, sorgfältig nach Farben sortiert, vor sich auf dem Tisch aufgereiht hatte.
Gegen halb drei ging Anna wieder hinauf zur Intensivstation, um nach Peter zu sehen. Lisa lag, vom Schlaf übermannt, zusammengefaltet auf dem Sessel, und ein anwesender Pfleger wechselte gerade die Infusionen und überprüfte irgendwelche Werte. Anna wartete geduldig und kam sich dabei von Minute zu Minute nutzloser vor. Also wandte sie sich schließlich wieder ab und trottete zurück in die Cafeteria.
Der Raum war jetzt beinahe vollständig verlassen. Am Kaffeeautomaten stand ein junger Mann mit schwarzen Haaren und einem kurzen, gepflegten Vollbart. Die Maschine akzeptierte offenbar weder seine Münzen noch seine Geldkarte, also spendierte sie ihm einen Kaffee und holte sich selbst einen dritten. Der Brühwürfelgeschmack war noch immer nicht verschwunden. Vielleicht sollte das Zeug ja auch so schmecken.
Der junge Mann warf ihr einen seltsamen Seitenblick zu, nahm dann einen Schluck von seinem eigenen Getränk und verzog das Gesicht. »Lecker!«, sagte er mit gespielter Begeisterung. »Bohnensuppe. Genau das habe ich jetzt gebraucht.«
»Entschuldigung«, Anna lächelte schmal. »Ich hätte wohl vorwarnen sollen.«
»Ihr Gesichtsausdruck hätte Warnung genug sein sollen«, erwiderte der Mann und nippte erneut an seinem Becher. »Ist mal was anderes.«
»Ich fürchte nur, dass wir um diese Zeit nicht großartig die Wahl haben.«
Er betrachtete den Inhalt seines Bechers, runzelte die Stirn und stellte ihn dann betont vorsichtig auf dem nächsten Tisch ab. »Ich denke eventuell schon. Haben Sie Hunger?«
Anna sah ihn fragend an.
»Auf der anderen Seite der Cafeteria«, er deutete dorthin, wo auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Platzes mit den Tischen ein Gang zu einer anderen Station abzweigte, »gibt es einen nagelneuen Automaten. Kaffee hat der leider keinen, dafür aber ganz anständiges, echtes Essen. Ich glaube, ich brauche etwas Nahrhafteres als das hier, und die Cafeteria macht erst morgen um halb neun wieder auf. Außer am Sonntag.«
Anna sah ihn befremdet an. »Sonntag? Da dürften doch aber die meisten Verwandten …«
Er zuckte mit den Schultern. »Hat mir vorhin ein Arzt erzählt. Ist wohl schon einige Jahre so. Deswegen gibt’s dort wohl auch den neuen Automaten. Also, was ist, kommen Sie? Oh, ich bin übrigens Georg. Eigentlich Georgo, aber die meisten Leute machen dann George draus. Englisch. Und … Egal. Georg, jedenfalls.«
Anna schnaubte belustigt. »Also gut, Georg jedenfalls, eigentlich Georgo, definitiv nicht George.« Sie stellte ihren Becher neben seinen. »Anna. Und jetzt bitte keine ›Aus dem Schoße der Kolchose‹-Sprüche.«
Georg sah sie verwirrt an, und nach einem Moment winkte sie ein wenig peinlich berührt ab. »Ich dachte … Sie sehen alt genug aus, um sich an das Lied zu erinnern.«
Georg zuckte mit den Schultern. »Ich bin in Griechenland aufgewachsen. Deswegen auch der Name.«
Jetzt lachte Anna tatsächlich leise. »Gut, das hätte ein Hinweis sein können, ja. Okay, wo ist dieser Wunderautomat?«
Georg lächelte ebenfalls. »Gleich dort hinten, wenn der Herr Doktor mir keinen Unsinn erzählt hat.«
»Also gut. Sie gehen vor.«
»Du. Wenn wir schon bei Geschichten zu unseren Vornamen sind, okay?«
»In Ordnung.«
Tatsächlich stand auf der anderen Seite der Eingangshalle ein geschmackvoll beleuchteter, brandneuer Automat ein wenig hinter einer etwas kränklich aussehenden Topfpalme. Ein großer Bildschirm nahm fast die ganze Vorderseite ein und zeigte eine Auswahl an erstaunlich reichhaltig und verdächtig appetitlich aussehenden heißen Menüs, die eher wie aus einem New-Food-Restaurant aussahen. Ein Navigationsmenü darunter informierte sie über den Bestellvorgang und die diversen Zahlungsmöglichkeiten, wobei diese anscheinend allesamt über eine Handy-App abgewickelt wurden, die sie sich per QR-Code auf ihr Smartphone laden sollten. Ganz unten schließlich gab es einen futuristisch wirkenden Ausgabeschacht, an dem dezent der Name des Herstellers stand: Light Foods.
Anna erstarrte.
»Alles in Ordnung?«
Sie schluckte und riss den Blick los. »Nein. Eigentlich nicht.« Sie lächelte schief. »Das ist so absurd. Dieser Automat. Peter arbeitet in diesem Konzern. Er, der immer gegen Fertigmahlzeiten gewettert hat. Und jetzt liegt er hier in diesem Krankenhaus, und hier steht dieses … Ding.«
»Peter?«
»Mein Bruder.«
»Oh. Was ist passiert?«
»Autounfall. Er ist operiert worden und liegt im Koma, und …«
Georg schnaubte mitfühlend. »Okay, Moment. Was hältst du davon, dass wir uns jetzt etwas zu essen nehmen? Auch wenn’s nur aus diesem Ding ist. Schlimmer als die Brühe aus dem anderen Automaten kann es nicht sein. Und dann erzählst du. Wenn du magst.«
»Ich …« Anna stockte und riss sich schließlich zusammen, »Ich weiß nicht, entschuldige. Ich sollte dich nicht damit belästigen. Du wirst deine eigenen Sorgen haben.«
»Habe ich. Meine Großmutter liegt in der Notaufnahme. Sie ist dement und ist heute Nacht gestürzt, als sie aufs Klo wollte. Sie hat sich wohl irgendwas gebrochen. Dauert eine Weile, bis sie sie untersucht haben, und so lange bleibe ich hier. Ich glaube nicht, dass sie weiß, was ihr passiert ist. Sie wollen jemanden schicken, sobald sie mich brauchen. Und deshalb werde ich jetzt was essen. Weil sie mich brauchen wird. Und vermutlich wirst du auch noch gebraucht, also suchst du dir jetzt was aus. Ich lade dich ein.«
»Das kann ich nicht annehmen.«
Georg grinste. »O doch. Die Revanche für diesen Kaffee bist du mir schuldig.«
»Okay. Das ist fair.« Wider Willen musste auch Anna grinsen. Erneut musterte sie den Automaten. »Das ist schon seltsam. Peter ist überzeugter Vegetarier, aber sein Arbeitgeber verkauft hier haufenweise Fleischgerichte.«
Georg scrollte sich durch die appetitanregenden Bilder der verfügbaren Gerichte. »Das ist gar nicht so seltsam. Soweit ich weiß, verkauft Light Foods nur Produkte mit Fleisch, das im Labor gezüchtet wurde. Ist ihr Wahlspruch oder so. Also dass kein Tier für sie stirbt.«
»Labor? Ist das nicht eine eklige Vorstellung?«
Georg zuckte mit den Schultern. »Nicht ekliger als aus dem Großschlachthof. Isst du Fleisch?«
»Schon, aber …«
Er tippte auf das Display, auf dem jetzt eine Box mit gebackenen Kartoffelhälften, grünen Bohnen, Miniaturkarotten und einem Stück Fleisch zu sehen war. »Dann probier das hier. Hühnchen. Das hatte ich schon mal. Wenn es auch nur ansatzweise so gut ist wie in den Restaurants, dann wirst du es nicht bereuen. Nicht mehr als den Kaffee vorhin zumindest.«
»Ist ja gut. Wie lange willst du darauf noch herumhacken?«
Georg grinste. »Die Nacht ist noch jung.«
Anna verdrehte die Augen und seufzte ergeben. Sie hatte tatsächlich das letzte Mal irgendwann im Bordbistro des Zugs gegessen, aber das war auch schon wieder acht Stunden her, und sie spürte plötzlich, wie ihr Magen knurrte. »Na gut. Was soll schon schiefgehen?«
»Und wenn, dann sind wir hier wenigstens in einem Krankenhaus.« Georg ließ zwei der Hühnchenboxen ausgeben, dazu zwei Colas, und wenige Minuten später setzten sie sich mit ihren dampfenden Mahlzeiten an einen freien Tisch. Zu Annas Verblüffung sah der Inhalt fast so appetitlich aus, wie die Abbildungen versprochen hatten, und der Duft war mit dem fettigen Mief üblicher Fast-Food-Produkte nicht zu vergleichen. Als sie gegessen hatten, fühlte sich Anna tatsächlich etwas besser, und als schließlich jemand kam und Georg zu seiner Großmutter bat, stellte Anna fest, dass sie seit bestimmt einer halben Stunde nicht mehr an Peter oder den Unfall gedacht hatte.
Kurz darauf tauchte Lisa mit ihrem Gepäck auf. »Man hat mich rausgeworfen«, sagte sie tonlos. Bleierne Müdigkeit schien sich über sie gelegt zu haben und jegliche Emotion zu ersticken. »Ich soll mich ausschlafen gehen und morgen wiederkommen. Er wird überwacht, und«, sie zuckte hilflos mit den Schultern, »ich kann ohnehin nichts tun, außer denen im Weg rumzusitzen. Komm, ich fahr dich nach Hause.« Sie drückte Anna ihr Gepäck in die Hand.
ZWEI
Lisa hatte sie vor dem Mietshaus abgesetzt, in dem Peter seine Wohnung hatte, ihr Peters Schlüssel in die Hand gedrückt und war schweigend davongefahren. Eigentlich hatte sie die ganze Fahrt geschwiegen und es Anna damit leicht gemacht, sich in Peters Wohnung absetzen zu lassen. Lisa hatte ohnehin keinen Platz, und Peter hatte diese Wohnung hier eigentlich nur genutzt, wenn er in Ruhe arbeiten wollte. Im Grunde hatte er sowieso die meiste Zeit bei Lisa verbracht, und so hatte Lisa ihr angeboten, die Wohnung vorübergehend als Unterkunft zu nutzen. Sich um Peters Zimmerpflanzen zu kümmern und so. Anna hatte das Angebot nur zu gern angenommen. Die Vorstellung, in der perfekten Wohnung der perfekten Lisa Gast sein zu müssen, dort, wo Peter tatsächlich wohnte, war beinahe zu viel für sie gewesen. Also hatte sie den Schlüssel angenommen und ihr Gepäck durch das sparsam beleuchtete, knarzende Treppenhaus nach oben getragen.
Peters Wohnung war finster und roch abgestanden. Irgendwie unbewohnt. Licht von der Straße fiel durch ein paar Fenster herein, und bis Anna einen funktionierenden Lichtschalter gefunden hatte, wirkten die dunklen, kleinen und geradezu totenstillen Zimmer eher wie ein Mausoleum. Schließlich fand sie den Schalter. Peters Wohnung bestand aus drei kleinen Zimmern und einem geradezu winzigen Bad und war gerade mal mit dem Nötigsten ausgestattet. Ein paar Schränke, Kommoden und ein Haufen Regale von einem schwedischen Möbelhaus. In der kleinen Küche stand ein Esstisch für zwei vor einem altmodischen gusseisernen Rippenheizkörper, der viel zu viel Platz einnahm, und außerdem die winzigste Küchenzeile, die Anna je gesehen hatte. Im eigentlichen Wohnraum stand ein altes Sofa, das Peter vor Jahren ihrer Großmutter abgeschwatzt hatte, vor einem einsamen Smart-TV an der sonst kahlen Wand, und ein aus Sägeböcken und einer Sperrholzplatte zusammengebauter Schreibtisch brach unter Stapeln von Büchern und Ordnern beinahe zusammen. Teppiche gab es überhaupt nirgendwo, die schmucklosen Vorhänge schienen lediglich dazu da zu sein, neugierige Blicke aus dem Haus gegenüber zu verhindern, und die Dielen in den Räumen knarrten bei jedem zweiten Schritt. Pflanzen konnte sie in keinem der Räume entdecken.
Für eine endlos erscheinende Weile stand Anna schließlich im Wohnzimmer, das nur vom Straßenlicht erhellt wurde, das von unten durch die Fenster fiel. Fahrzeuggeräusche drangen dumpf von draußen herein, ein monotones Rauschen, in dem nur ab und an das Beschleunigen eines Fahrzeugs und einmal das Quietschen einer S-Bahn zu erkennen war, doch diese Geräusche untermalten nur die Stille der Wohnung und ließen sie in Annas Ohren dröhnen.
Irgendwann öffnete sie die Hand, ließ Peters Schlüsselbund auf den Couchtisch fallen und sank auf dem alten Sofa zusammen. Und während draußen die ersten Berliner zu ihrer täglichen Arbeit aufbrachen, glitt sie langsam in einen unruhigen Schlaf.
»Ist er …« Tot? Anna wagte es nicht, das Wort auszusprechen, vielleicht aus Angst, dass es allein dadurch Wirklichkeit würde. Sie drückte das Handy so fest gegen ihr Ohr, dass es schmerzte. »Ja. Ich … ich verstehe. Wo …?« Wieder lauschte sie angestrengt den Worten auf der anderen Seite der Leitung. Das Herz schlug ihr bis in den Hals. Sie hatte Mühe, alles zu verstehen; zu viele Informationen prasselten auf sie ein. »Nein, das ist schon in Ordnung. Ich … ich komme sofort. Also, so schnell wie möglich. Rufen Sie bitte sofort an, wenn sich etwas ändern sollte.«
Sie hatte kaum aufgelegt, als sie schon in ihr Schlafzimmer stürzte und die Schränke aufriss. Kleidung fiel ihr geradezu entgegen und verschwand in Rucksack und Reisetasche, als wüsste sie, dass Anna keine Minute Zeit zu verlieren hatte, und im nächsten Augenblick schob sie sich schon durch einen überfüllten ICE, der seltsamerweise ratterte und quietschte wie eine alte S-Bahn oder einer der Regionalzüge aus ihrer Kindheit, als Sitze noch mit Kunstleder bezogen waren.
Sie war kein Mensch, der sich lange an einem Ort aufhielt. Es fiel ihr nicht besonders schwer, sich schnell auf die Reise zu begeben. Und trotzdem hatte sie diesmal das Gefühl, nicht schnell genug zu sein. Der Zug schien geradezu in die hereinbrechende Nacht zu kriechen, das Licht war seltsam gedämpft, und Anna verbrachte eine Ewigkeit damit, sich von Abteil zu Abteil zu schieben, ohne ihren reservierten Sitzplatz zu finden. Aus irgendeinem Grund schien es allen im Zug so zu gehen, und so war die Menge der Fahrgäste pausenlos in anscheinend zielloser Bewegung. Unruhig bewegte sich Anna mit dem Strom der Leute durch den Waggon, von einem Abteil ins nächste und wieder zurück, dabei immer ein Auge auf ihr Gepäck gerichtet und das andere auf das Display ihres Handys, das sie fest umklammert hielt. Bei jedem Signalton, der das Eintreffen einer neuen Nachricht verkündete, zuckte sie zusammen, doch jedes Mal war es eine andere Nachricht als die befürchtete. Es war erstaunlich, über wie viele belanglose Dinge man jeden Tag informiert wurde, ohne sie richtig wahrzunehmen. Zumindest, bis sie lästig wurden.
Irgendwann übermannte sie schließlich die Müdigkeit. Sie ließ sich auf ihren Platz fallen und schloss die Augen. Sie träumte von einer gemeinsamen Bootsfahrt mit ihrer Familie und von einem Sturm, der sie allesamt in die Tiefe riss. Wäre da nicht die ausgestreckte Hand eines Fremden gewesen, die sie im letzten Augenblick an die Wasseroberfläche hinaufgezerrt hatte, wäre sie mit Sicherheit ertrunken. Als sie von einem weiteren Signalton ihres Handys aus dem unruhigen Halbschlaf gerissen wurde, versuchte sie, sich an das Gesicht des Fremden zu erinnern. Es gelang ihr nicht. Genauso wenig, wie es ihr gelang, die Gesichter der Menschen um sie herum zu erkennen, als sie die Augen wieder aufschlug. Vielleicht hatte sie vor Müdigkeit die Fähigkeit verloren, Details zu erkennen, doch die meisten von ihnen schienen Peter zu ähneln, oder Lisa, ihrer Mutter oder diesem Mann aus der Krankenhaus-Cafeteria.
Auf halber Strecke, mitten im nächtlichen Nirgendwo, mussten sie umsteigen, weil der Zug ein Problem mit der Klimaanlage hatte. Anna hatte den Eindruck, dass ausgerechnet ihr solche Dinge jedes Mal passierten, wenn sie mit der Bahn fuhr. Das war genau einer dieser Gründe, warum sie das Zugfahren mied, auch wenn ihr das schon mehr als einen spitzen Kommentar ihres umweltbewussten Bruders eingebracht hatte.
Der neue Zug war trotz der späten Stunde ziemlich gut gefüllt, überheizt und roch streng nach klammer Kleidung, Staub, Krankenhausfluren, gebratenem Fleisch und Menschen, die den ganzen Tag gearbeitet hatten. Die meisten Fahrgäste schienen Pendler zu sein, und ausnahmslos alle wirkten so müde, wie sie sich fühlte. Irgendwie gelang es dem Bahnpersonal, auch noch die Reisenden aus ihrem Zug unterzubringen, obwohl jetzt an einen Sitzplatz nicht mehr zu denken war. Also stand sie, ihr Gepäck zwischen die Beine geklemmt, neben einer der gläsernen Türen an der Wand und döste. Eine korpulente Dame saß neben ihr auf einem Rollkoffer und sah eine Nachrichtensendung auf ihrem Handy. Sie trug Kopfhörer, weshalb Anna den Ton nicht hören konnte, doch gelegentliche Untertitel verrieten Anna, dass es um irgendeine Krankheit namens TASE in Großbritannien ging. Cutszenen zeigten etwas Unappetitliches mit Mäusegehirnen. Mit einem »Nee, nee. Was die sich wohl als Nächstes ausdenken«, wechselte die Frau den Film auf die Zusammenfassung einer Datingshow, bei der es wohl darum ging, auf einem seeuntüchtig vor Afrika treibenden Wrack seine große Liebe zu finden. Zufrieden grunzte die Frau und wickelte einen großen Klumpen frisches Mett aus, den sie mit den Fingern in sich hineinzuschaufeln begann, ohne die Augen von ihrem Handydisplay zu nehmen.
Sie sah aus dem nächtlichen Fenster, das sich irgendwann, als sie nicht hingesehen hatte, in einen Monitor verwandelt hatte. Dort lief ein Film über Peter und sie selbst, aus der Zeit, als sie noch Kinder waren und man sie ständig für Zwillinge gehalten hatte, weil Peter nur knapp ein Jahr älter war als sie. Doch als sie dort auf dem Monitor älter wurden, wurden die Unterschiede zwischen ihnen größer und deutlicher, als sie das noch als Kinder empfunden hatten. Im Film gaben sie sich, irgendwann nach dem Tod der Eltern, das letzte Mal die Hand. Das war an dem Tag gewesen, als Anna die letzten Kisten mit ihren Sachen aus Peters Garage geholt hatte. Umzugskartons standen dort, an die sich Anna nicht erinnern konnte. Hatte Peter damals schon für seinen Umzug nach Berlin gepackt, und sie hatte es nur nicht mitbekommen? Sie selbst hatte die Kiste drei Tage später im Müllcontainer vor ihrem Haus entsorgt, ohne auch nur noch einmal hineinzusehen. Vier Stunden später hatte sie ihre Schlüssel in den Briefkasten der Hausverwaltung geworfen und war in ein Uber zum Flughafen gestiegen, um nach Lima zu fliegen. Die nächsten Jahre waren ein zerhacktes Kaleidoskop aus Momentaufnahmen, ziellos, willkürlich. Anna starrte auf den Monitor, während neben ihr Leute missbilligend zu tuscheln begannen. Der Trip durch Chile und Argentinien, fast ein Jahr Burma, eineinhalb in Australien, davor Au-pair in Vancouver und irgendwann eine Saison als Erntehelferin in Südspanien.
Einer der anderen Fahrgäste sagte etwas, das sie nicht verstehen konnte, und Anna brauchte eine Weile, bis ihr klar wurde, dass er ihr eine Frage stellte. Anna sah sich um und entdeckte ihn drei Sitzreihen weiter. Seine Statur und die Lederjacke waren ihr so bekannt, dass es unwichtig war, dass sie sein Gesicht aus irgendeinem Grund nicht erkennen konnte: Kagisho, der Typ, den sie vor einem Dreivierteljahr in Südafrika kennengelernt hatte. Wieder sagte er etwas. Eindringlich und erneut vollkommen unverständlich. Was es auch war – es war unwichtig. Sie hatte mit diesem Kapitel abgeschlossen. Deshalb war sie gerade erst zurückgekommen. Und noch immer wusste sie nicht, was sie eigentlich von ihrem Leben erwartete.
Sie drängte sich zwischen den Leuten hindurch, weg von Kagisho und den Bildern aus ihrem Leben, ins nächste Abteil, in dem auf allen Monitoren Nachrichten liefen. Nachrichten über Krankenhäuser und sterbende Menschen, Autounfälle und dazwischen seltsamerweise immer wieder Peter. Peter als Journalist, der irgendwelche Leute befragte, Peter, der Kinder rettete, und Tiere aus einem brennenden Tiertransporter, Peter, der eine Präsentation zu einem riesigen Klumpen Hackfleisch hielt, Peter, der sich furchtlos einem Lastwagen aus »Soylent Green« entgegenstellte. Nichts davon verwunderte Anna. Peter passte in jedes der Bilder. Peter hatte schon von frühester Kindheit an genau gewusst, was er wollte, nämlich etwas bewegen und die Welt verbessern. Er hatte Journalismus studiert und bei einigen der besten Verlagshäuser volontiert. Kurzzeitig hatte er bei einer Umweltschutzorganisation gearbeitet, und die Stelle in der PR-Abteilung des gigantischen Herstellers für kultiviertes Fleisch passte zu ihm. Dort wurde die Welt von morgen gemacht. Das hatte er gesagt, als sie das letzte Mal telefoniert hatten. Eine Welt ohne Hunger. Eine Welt … auf jedem der Bildschirme wurde Peter in diesem Moment gleichzeitig von einem lautlosen Elektrofahrzeug überfahren. Anna fuhr zusammen und schrie auf, und alle Gesichter in diesem vollgestopften Zug wandten sich ihr zu. Und jedes gehörte einem Toten. Mit ruckartigen, unkontrolliert wirkenden Bewegungen, Marionetten gleich, drehten sich die Passagiere um und starrten sie aus blicklosen Augen an, bevor sie ihre Münder öffneten und ein schrilles, rhythmisches Hupen …
Anna schreckte auf, fiel beinahe von der Couch und starrte panisch im abgedunkelten Zimmer umher, während irgendwo draußen auf der Straße ein Fahrzeugalarm misstönend vor sich hin plärrte. Sie sog gierig die kühle Luft in sich hinein und stieß einen halblauten Fluch aus. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie ihr Herz nicht mehr im Hals schlagen fühlte, und noch länger, bis sie die Kraft fand, sich zu bewegen. Quälend umständlich streifte sie die Straßenschuhe von den Füßen, schälte sich aus ihrer Jacke und ließ sich wieder auf das Sofa zurücksinken. Das Wiedersehen mit ihrem Bruder hatte sie sich völlig anders vorgestellt. Aber manchmal kamen die Dinge eben nicht so, wie man hoffte. Wobei – taten sie das jemals?
Gegen Mittag saß sie immer noch zusammengekauert auf dem Sofa und starrte mit verquollenen Augen auf das eingerahmte Foto, das vor ihr auf dem Wohnzimmertisch stand. Es zeigte die Familie vor fünfzehn oder sechzehn Jahren beim letzten gemeinsamen Italienurlaub. Damals war ihr Vater noch am Leben gewesen, und Mutter hatte diesen fröhlichen Gesichtsausdruck, der ihr nach seinem Tod von einem Tag auf den anderen abhandengekommen war. Peter war auf dem Bild noch dünn wie eine Spargelstange und hielt einen großen Einkaufsbeutel umklammert, in dem er den ganzen Tag über den Plastikmüll vom Strand eingesammelt hatte. Anna hatte in diesem Alter lieber Eis gegessen oder zusammen mit ihrem Vater Sandburgen gebaut. Ihr Bruder musste an diesem Tag dagegen schon beschlossen haben, Meeresbiologe oder Umweltingenieur oder vielleicht auch Recyclingverpackungsdesigner zu werden. Und wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, war er nicht mehr so leicht davon abzubringen.
Das war überhaupt schon immer der Unterschied zwischen ihnen gewesen. Anna hatte immer stundenlang über den Dingen gegrübelt und an sich selbst gezweifelt, während Peter einfach die Ärmel hochgekrempelt hatte und zur Tat übergegangen war.
»Verdammt«, sagte Anna und schüttelte den Kopf. »Ich denke über ihn schon, als sei er tot.« Schwerfällig stemmte sie sich vom Sofa hoch und riss das Fenster auf. Eisige Luft strömte ihr entgegen, und sie atmete tief durch, doch selbst das konnte die lähmende Erschöpfung nicht vollständig vertreiben. Also tappte sie in die winzige Küche, öffnete nacheinander alle Schränke und fand schließlich eine Stempelkanne und eine halbe Packung Kaffeepulver.
Sie schaltete das kleine Küchenradio ein und begann, Kaffee in die Stempelkanne zu löffeln. Ein ausgesprochen anstrengend gut gelaunter Moderator wurde von einer Nachrichtensendung abgelöst. Dürre irgendwo, Überschwemmung woanders, Auffahrunfall auf einer Autobahn in Brandenburg, Neues vom Krieg, sie bekam nicht mit, von welchem, ein Kommentar zu den sich häufenden TASE-Fällen, ein Hollywood-Beziehungsdrama, Fußball, das Wetter. Endlich wieder Sonnenschein. Wieder der Moderator, der einen bemühten Zombie-Witz im Zusammenhang mit der Berliner Landespolitik riss. Sie schaltete das Radio wieder aus, füllte den Wasserkocher und ging mit einer angebrochenen Schachtel Zwieback erneut durch die Wohnung. Auch bei Tageslicht betrachtet, war sie nicht wesentlich gemütlicher.
Die Bücherregale im Wohnzimmer waren überladen mit Fachbüchern zu allen möglichen Themen, von Politik über Marketing bis hin zu Abhandlungen über die Herstellung von künstlichen Fleischprodukten. Dazwischen standen ein paar verlorene Fantasyromane und eine Handvoll Krimis. Einen der Krimis hatte Anna ihrem Bruder vor ein paar Jahren mal zu Weihnachten geschenkt. Er handelte von einer Frau, die nach einem Autounfall im Wachkoma lag und hilflos erfahren musste, dass ihr eigener Ehemann geplant hatte, sie umzubringen. Anna schauderte. Sie dachte an Lisa und deren Worte vor dem Krankenhaus. Ob sie wohl imstande ist, jemanden zu überfahren? Eigentlich unvorstellbar, aber unter den richtigen Umständen konnte wohl jeder Mensch einen Mord begehen. Gleich darauf schnaubte sie schuldbewusst. Das ist jetzt einfach nur paranoid.
Apropos paranoid. Sie blieb vor Peters improvisiertem Schreibtisch stehen und runzelte die Stirn. Ihr Bruder schien sich wirklich viel Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Oder arbeitete er im Homeoffice? Der Schreibtisch war voll mit Stapeln von Papier, auf dem irgendwelche Diagramme abgedruckt waren, Bücher mit Seitenmarkierungen stapelten sich auf der einen Seite, auf der anderen lag eine aufgeschlagene Zeitschrift mit einem Bericht über Shiok Meats, einem Hersteller von künstlichen Meeresfrüchten. Dazwischen stand eine halb ausgetrunkene Teetasse. An der Wand über dem Tisch waren weitere Ausdrucke mit Heftzwecken befestigt, dazwischen Haftnotizzettel, auf denen einzelne Wörter oder Zahlengruppen standen. Das war an sich für Peter nicht ungewöhnlich. Das war schon immer seine Art gewesen, sich Notizen zu machen, selbst als er noch zur Schule ging. Er hatte seine Familie damit wahnsinnig gemacht, da das Zeug außer ihm niemand entziffern konnte. Anna versuchte, aus einigen der Zettel schlau zu werden, doch es gelang ihr nicht. Ja, hat sich nicht viel geändert. Eigentlich fehlten nur noch rote Fäden, die sich von Heftzwecke zu Heftzwecke spannten, um das Ganze ein wenig irrsinnig wirken zu lassen. Anna nahm ein Blatt von einem der Stapel und überflog es. Lieferkettenstatistiken. Wahnsinnig interessant. Eigentlich dachte ich, dein Job wäre irgendwie glamouröser, Brüderchen. Sie legte den Bogen zurück, sammelte die Tasse ein und ging zurück in die Küche, wo inzwischen der Wasserkocher vor sich hin brodelte.
Als ihr Handy klingelte, zuckte sie zusammen. Auf dem Display leuchtete Lisas Name auf.
»Hi. Gibt es etwas Neues?«
»Ich war gerade dort und habe die Morgenvisite abgepasst«, sagte Lisa, und Anna überkam sofort ihr schlechtes Gewissen. Hier saß sie, tat sich selbst leid und überlegte, ob Lisa fähig war, ihren Freund zu überfahren, während die stets perfekte Lisa bereits im Krankenhaus gewesen war und mit den Ärzten gesprochen hatte. Was eigentlich ihre Aufgabe als nächste Verwandte gewesen wäre. Lisa hatte inzwischen weitergesprochen, und Anna musste sie wohl oder übel unterbrechen.
»Ich sagte, die Ärztin klang vorsichtig zuversichtlich. Seine Werte sind gut, sie können bislang keine Infektionen feststellen, und es scheint keine verborgenen Blutungen zu geben, die ihn akut bedrohen.«
Anna schloss erleichtert die Augen und nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. »Das klingt … gut, oder?«
»Das ist erst mal die beste Nachricht, auf die wir im Moment hoffen konnten«, sagte Lisa. »Wie geht es dir gerade?«
»Jetzt? Erleichtert. Kaputt, aber das muss ich dir ja nicht erzählen, oder?«
»Nicht wirklich. Du sollst heute im Laufe des Tages noch mal ins Krankenhaus kommen. Du musst einiges an Dokumenten unterzeichnen. Du bist seine Schwester. Ich reiche ihnen da nicht. Soll ich dich abholen?«
Anna gähnte und hörte, wie sie Lisa damit ansteckte. »Lass gut sein. Ich nehme mir ein Uber. Musst du nicht arbeiten? Und … was ist mit Peters Arbeitgeber?«
»Ich hab mir freigenommen.« Lisa schnaubte. »Und Light Foods weiß schon Bescheid. Nicht dass sich dort jemand bedauernd geäußert hätte. Ich glaube, wir können froh sein, dass sie nicht gleich gefragt haben, wann er wieder arbeiten kann.«
»Autsch.«
»Hmhm. Pass auf, ich muss heute trotzdem noch ein paar Sachen erledigen …«
»Kein Problem«, fiel Anna ihr ins Wort. »Ich bleibe bei Peter. Und ich gebe dir Bescheid, wenn sich doch irgendwas Neues ergibt. Du solltest dich vermutlich mal ausschlafen. Es bringt niemandem was, wenn du zusammenklappst.«
Lisa gähnte erneut. »Vermutlich hast du recht. Falls ich schlafen kann, heißt das.«
Dir fällt schon was ein. Anna musste an die Zigarette in der vergangenen Nacht denken, und Lisas seltsames Verhalten kam ihr wieder in den Sinn. Allerdings schien diese nicht vorzuhaben, irgendein Wort darüber zu verlieren, also beließ Anna es dabei.
»Hör mal«, sagte Lisa stattdessen, »was hältst du davon, wenn wir uns morgen vielleicht zum Frühstück treffen. Dann gehe ich danach zu Peter.«
»Klingt großartig. Und wo?«
»Ich denk mir was aus. Um zehn?«
»Zehn klingt gut, bis dann.«
Sie legten auf, und Anna starrte noch eine Weile gedankenverloren auf das dunkle Display, ehe sie aufstand und erneut in der Küche nach etwas Essbarem suchte.
Das ganze Gerede über Frühstück hatte sie darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Magen schon seit einigen Stunden schmerzhaft knurrte. Abgesehen von Kaffee, der angebrochenen Packung Hafermilch, drei Päckchen Teebeutel und dem letzten Zwieback, gab es allerdings keinerlei verwertbare Lebensmittel mehr. Nachdenklich starrte sie in den fast leeren Schrank. Schon seltsam. Peter war derjenige von ihnen beiden, der großen Wert auf Essen legte. Oder zumindest gelegt hatte. Er war ein leidenschaftlicher Koch. Das war er schon immer gewesen. Während sie sich nach der Schule Nudeln mit Ketchup gemacht hatte, hatte Peter mit endloser Geduld und bewaffnet mit Kochbüchern schon mit zwölf Jahren ganze Menüs zubereitet. Eine Zeit lang hatten alle gedacht, er würde irgendwann Koch werden, aber selbst als das nicht eingetreten war, blieb das Kochen eine von Peters großen Leidenschaften. Es war Lisa gewesen, die ihm die Augen für die Probleme der Tierhaltung und für fleischlose Alternativen geöffnet hatte. Und das meiste davon war ausgesprochen schmackhaft. Jedenfalls soweit Anna das beurteilen konnte, als jemand, die sich bis heute für Wochen von Ramen, Burgern, Ketchup-Nudeln oder Currywurst ernähren konnte. Kaffee war vermutlich das Einzige, was sie wirklich einschätzen konnte. Jedenfalls sah diese Küche nicht so aus, als würde sie Peter gehören. Oder als würde er sich auch nur lange hier aufhalten. Es gab, abgesehen von einem Flughafen-Salzstreuer, nicht mal Gewürze hier. Das hieß wohl, dass Peter hier nicht wohnte. Wohnte er bei Lisa? Vermutlich. Aber warum hatte sie nichts davon gesagt?
Anna starrte den Tee an. Dann nahm sie den letzten Zwieback, zog sich ihre Jacke über und verließ die Wohnung, um ein paar Einkäufe zu erledigen, bevor sie sich um das Uber kümmerte.
Im zweiten Stock stand eine der Wohnungstüren einen Spalt offen. Ein leichter Geruch von kochenden Kartoffeln, Sauerkraut und Tosca strömte ins Treppenhaus.
Auf Fußhöhe streckte ihr ein grauhaariger Rauhaardackel schnüffelnd die Nase entgegen, ein kleines Stück darüber lugte das faltige Gesicht einer älteren Frau hervor. Anna schätzte sie auf Anfang bis Mitte siebzig, doch so genau konnte man das nicht sagen. Auf dem Klingelschild stand der Name Nowak.
»Gehören Sie zu dem Herrn Heigen im dritten Stock?«
»Ich bin seine Schwester.«
Frau Nowak musterte sie einen Augenblick lang mit misstrauisch zusammengezogenen Brauen. »Das ist ein sehr hellhöriges Haus«, sagte sie schließlich in vorwurfsvollem Ton. »Man kann jeden Schritt auf dem Parkett hören.«
Anna nickte müde. »Ich werde mir Mühe geben.«
»Wissen Sie, es ist ja nicht meinetwegen, aber Herr Petracek braucht seinen Schlaf.«
»Ich verstehe. Er muss vermutlich früh raus.«
»Allerdings. Er ist nicht mehr der Jüngste. Manchmal kommt er nicht einmal mehr rechtzeitig bis zu seinem Lieblingsbaum, dann kann es schon mal passieren, dass er mitten in den Hausflur pinkelt.«
Anna sah sie irritiert an. Dann fiel ihr Blick auf den grauhaarigen Dackel, der gerade damit begonnen hatte, konzentriert ihren Schuh abzulecken. Die Augen der alten Frau folgten ihrem Blick. Ächzend beugte sie sich nach unten und zerrte das widerstrebende Tier zurück in ihre Wohnung.
»Herr Petracek ist sehr zurückhaltend. Fremde jagen ihm Angst ein. Schlechte Erfahrungen, wissen Sie?« Sie sah Anna herausfordernd an, so als wartete sie den ganzen Tag schon darauf, endlich von den schlechten Erfahrungen ihres Dackels berichten zu können.
»Ich verstehe«, sagte Anna nur. Sie verspürte eigentlich keine große Lust auf eine längere Unterhaltung.
Frau Nowak schien das nicht aufzufallen, denn sie begann, ungefragt zu berichten. Es waren eine ganze Menge Dinge, die ihrem Dackel im Verlauf seines Lebens widerfahren waren. Das arme Tier konnte einem richtiggehend leidtun. Frau Nowak redete schnell, so als hätte sie Angst, unterbrochen zu werden. Als sie fertig war, wirkte sie beinahe ein bisschen erschöpft.
Anna hatte mehrfach versucht, eine Lücke in ihrem Redeschwall zu finden, und stellte fest, dass sie wohl für eine ganze Weile den Atem angehalten haben musste. »Puh«, sagte sie jetzt schnell und möglichst mitfühlend, »das ist ja wirklich faszinierend. Ich meine, bedauerlich. Faszinierend und bedauerlich. Ich würde liebend gern«, sie bremste sich gerade noch, bevor sie »mehr hören« sagen konnte, »noch bleiben, aber ich muss jetzt wirklich los, wissen Sie? Ich muss dringend ins Krankenhaus, zu Peter. Irgendwelche Berichte lesen. Oder unterzeichnen.«
»Schlimme Sache, das mit Ihrem Bruder«, beeilte sich Frau Nowak zu sagen. »Schlimmer Unfall. Es war schrecklich!«
Anna sah sie verwirrt an. »Der Unfall war doch gar nicht hier, oder?«
»Nein, nein!«, beeilte sich die Alte. »und wir sind da sehr froh. Stellen Sie sich das nur mal vor: all die Sirenen und Blinklichter! Herr Petracek hätte vermutlich einen Herzinfarkt bekommen! Da haben wir Glück im Unglück … Ich meine – wie steht es denn um Herrn Heigen? Er ist ja ein wirklich netter Nachbar, ganz im Gegensatz zu Leuten wie …«
»Ich weiß es noch nicht, Frau Nowak. Auch deswegen muss ich jetzt wirklich los. Um nach ihm zu sehen.«
»Ja, natürlich, aber …«
»Bis später, Frau Nowak.« Anna lächelte und ergriff hastig die Flucht.
Erst draußen stellte sie fest, dass sie keine Ahnung hatte, wo sich in der Nähe brauchbare Einkaufsmöglichkeiten befanden. Also betrat sie den erstbesten kleinen asiatischen Supermarkt einige Hundert Meter die Straße hinunter und warf relativ wahllos Nudelsuppen und anderes Fertigessen in ihren Einkaufskorb. Sie ertappte sich dabei, wie sie sich Peters vorwurfsvolle Blicke ausmalte, während er die lange Liste von Konservierungsmitteln und ungesunden Zusatzstoffen vorlas, die in den Speisen enthalten waren. Allein die Art, mit der er das pulverisierte Enten- oder Rindfleisch in den Ramen stumm kritisieren würde, würde anklagend im Raum stehen und versuchen, ihr den Appetit zu verderben.
Die alte Frau hinter der Kasse starrte mit finsterer Miene auf den Bildschirm eines winzigen Röhrenfernsehers, der sich neben der Eingangstür zwischen Kühltruhen und Gewürzregalen versteckte. Eine Nachrichtensprecherin erklärte auf Chinesisch die neuesten Zahlen der TASE-Erkrankungen. Das Bild wechselte zu einem Viehmarkt, auf dem ein Reporter wahllos Passanten sein Mikrofon unter die Nase hielt. Die Kassiererin murmelte etwas, das wie ein Fluch klang, und kassierte dann wortlos ab. Sie benutzte einen alten Taschenrechner und schrieb die Zahlen akkurat mit einem Bleistift auf einen Abreißblock. Als sie mit ihrer umständlichen Abrechnung fertig war, wickelte sie jedes Produkt sorgfältig in Plastiktüten ein und packte alles zusammen in eine weitere Plastiktüte. Anna musste lächeln – wie hätte Peter wohl darauf reagiert? Als die Kassiererin ihren Gesichtsausdruck bemerkte, begann sie ebenfalls zu lächeln und stopfte spontan noch eine Handvoll Bonbons dazu.
Anna wünschte ihr einen schönen Tag und beschloss dann, sich im direkt gegenüberliegenden, offenbar gerade neu eröffneten »Light Foods BestBurgers« ein schnelles Mittagessen zu gönnen. Eins musste man Peters Arbeitgeber lassen: Auch dieser Hähnchenburger aus künstlichem Fleisch war erstaunlich lecker. Um Längen besser als das, was andere Ketten aus echten Hühnern machten. Seufzend rief sie sich ein Uber und machte sich auf den Weg zum Krankenhaus.
Der nächste Tag begann mit dem Anruf einer Großtante, die sich mit tränenerstickter Stimme nach Peters Zustand erkundigte. Anna beruhigte sie mit einer Handvoll freundlicher Lügen, erfuhr nebenbei noch ein paar Neuigkeiten über ihren krebskranken Onkel und versprach, sich wieder zu melden, sobald es Neues zu berichten gab. Sie duschte, zog sich an und googelte nach der Adresse des Cafés, das Lisa ihr als Treffpunkt genannt hatte.
Das Café befand sich in der Nähe des Zoologischen Gartens direkt am Ufer der Spree. Es bot eine schöne Aussicht über den Fluss und war offenbar ein beliebter Treffpunkt für Studenten und Universitätsmitarbeiter der nahen TU. Um diese Uhrzeit war es schon erstaunlich gut besucht. Lisa erwartete sie bereits und winkte sie zu sich heran. Sie hatte einen Fensterplatz ergattern können und bereits eine Tasse Tee vor sich auf dem Tisch stehen. Dieses Mal hatte sie ihre Rastas zu einem Pferdeschwanz gebunden, dicker als Annas Oberarm. Anna entschied sich für einen Kaffee und den Frühstücksteller mit Rührei.
»Es ist irgendwie seltsam«, sagte Lisa, während sie gedankenverloren aus dem Fenster sah. Anna war ein wenig erschrocken, wie fahlgrau ihre sonst tiefbraune Haut wirkte. Sie sah noch immer völlig übernächtigt aus, und ihre Augen waren leicht verquollen und gerötet, so als hätte sie die ganze Nacht geweint. »Die ganzen banalen Dinge wie spazieren gehen, einkaufen und gemeinsam frühstücken. Man weiß sie erst dann richtig zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat.«
»Immer noch nicht besser?«
»Irgendwie ’ne blöde Frage, oder?«, fragte Lisa nur, und dann schwiegen sie eine ganze Weile. Die Kellnerin kam und brachte Kaffee und Frühstück. Lustlos stocherte Anna in ihrem Rührei herum.
»Sie haben ihn heute Morgen noch mal operiert. Sie mussten seinen Kopf aufbohren«, sagte Lisa mit einem undefinierbaren Blick auf Annas Teller, »um die Flüssigkeit abzulassen. Sie wissen nicht, ob er dauerhafte Schäden davongetragen hat. Selbst wenn … falls er …« Ihre Stimme brach.