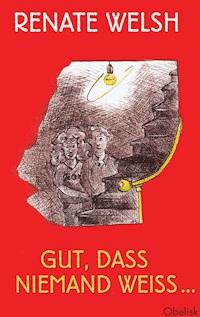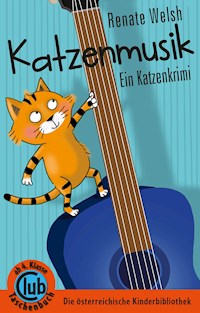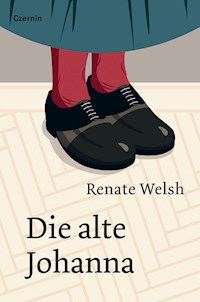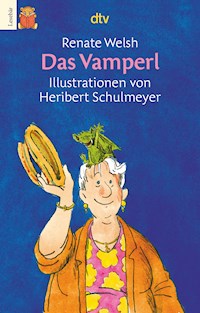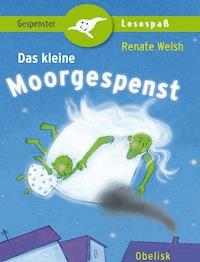6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rosa ist ein unerwünschtes Kind, Kälte umgibt sie von Geburt an, aber dankbar soll sie stets sein. Auch für ihre Lehrstelle als Weißnäherin - obwohl sie lieber Schneiderin geworden wäre. Immerhin wird ihre Lehrmeisterin eine Art Vertraute für sie. Doch diese Frau ist Jüdin und übersiedelt 1938 nach Prag, kurz nachdem Rosa ihren ersten Freund durch einen tragischen Unfall verloren hat. Rosa versteht die Welt nicht mehr und am wenigsten ihre Eltern, in deren Wiener Gasthaus nationalsozialistisches Denken mehr und mehr um sich greift. Es ist ein qualvolles Leben, aus dem Rosa in die Ehe mit einem älteren Witwer flieht, der es gut mit ihr meint - und mit den Menschen, für die er sich einsetzt und durch die er in die Fänge der Gestapo gerät. Wie sehr sie diesen Mann geliebt hat, wird ihr erst nach seinem Tod bewußt. Und auch, daß sie gern ein Kind gehabt hätte ... Renate Welsh greift ein sogenanntes »einfaches« Frauenleben auf, das von Entbehrungen geprägt ist, was diese »Trümmerfrau« zwar nach außen stark erscheinen läßt, an ihrer Seele aber nicht spurlos vorübergeht. Daß es für die Romanfigur ein reales Vorbild gibt, macht die autobiographische Rahmengeschichte deutlich. Doch »wir haben nur geglaubt, sie zu kennen«, schreibt Renate Welsh.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Renate Welsh
Die schöne Aussicht
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
OriginalausgabeDeutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München© 2005 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40166-1 (epub) ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-24494-7
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher sowie Themen, die Sie interessieren, finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhalt
Rosa ...
An diesem Abend ...
Wie sehr er ...
Plötzlich war der ...
Kurz bevor Lottes ...
Nachtrag
Rosa hockte an Barrys Grab unter den Fliederbüschen am Hintereingang zum Gasthaus, zupfte verwelkte Blüten von den Kapuzinerkressen, nicht daß sie gerade an den Bernhardiner dachte, es war nur der Platz geworden, an den ihre Füße gingen, ohne besondere Aufforderung. Auch wenn die Büsche längst kahl waren, wenn es von den Zweigen tropfte und ihre Schuhe in der nassen Erde einsanken, hockte sie hier, mit gespreizten Beinen, manchmal stützte sie die Hände auf und vergaß, daß sie es getan hatte, dann schimpfte die Mutter über den verkrusteten Matsch auf dem Mantel. Rosa mußte den Fleck ausbürsten, bis nichts mehr davon zu sehen war. Ansonsten schüttelte die Mutter zwar immer wieder den Kopf über die Tochter, doch wunderte sie sich nicht mehr. Ein altes Ei und alter Samen, sagte sie, was konnte man da erwarten? Sie sagte es auch, wenn Rosa in Hörweite war. Mich dürfte es eigentlich nicht geben, dachte Rosa oft. Die Mutter war fünfzig, als sie geboren wurde, ihre älteste Schwester dreißig.
Die Prüfung in Geschichte war nicht gut ausgegangen, unter dem Blick der Lehrerin wurde Rosas Kopf leer, sie hatte gelernt, gestern wußte sie, wann der Siebenjährige Krieg begann, jetzt wußte sie es wieder, 1756, natürlich 1756, nur in der Klasse stand sie blöd und stumm, und die anderen kicherten, und Hanna stupste Bärbel mit dem Ellbogen an und verzog das Gesicht. Hanna mit den dicken braunen Zöpfen, Hanna mit den großen dunklen Augen, Hanna mit der zarten Nase, Hanna mit den schmalen Fingern und den ovalen rosaroten Nägeln, kein einziger abgebissen oder eingerissen. Hanna, die so gut roch, die radschlagen konnte und immer eine Antwort wußte. Wenn die Lehrerin Hanna aufrief, um ein Gedicht vorzutragen oder ein Lied zu singen, sträubten sich die Härchen auf Rosas Armen und sie spürte etwas wie einen sanften Wind im Nacken. Alle Mädchen wollten neben Hanna sitzen, alle wollten ihre Hand halten, wenn sie sich in Zweierreihen aufstellen mußten. Hanna lächelte dann gleichmütig in die Runde. Auch die Erwachsenen lächelten, wenn sie Hanna ansahen, sogar die strenge Handarbeitslehrerin und der finstere Schulwart. Ein einziges Mal war es Rosa gelungen, als erste neben Hanna zu stehen, da merkte sie, wie schweißnaß ihre Hände waren, und trat schnell zur Seite. Rosa wußte, daß sie kein schönes Kind war. Ihre Nase war zu klobig, ihr Gesicht zu breit, ihr ganzer Körper zu gedrungen, ihre Füße und Hände zu groß, die Haare zu strähnig. Die riecht doch immer nach Wirtshaus, hatte Marianne gesagt, laut genug, daß Rosa es am anderen Ende des Turnsaals hören konnte. An dem Abend zog sie die Tuchent über den Kopf, zuerst merkte sie nichts, aber dann roch sie es: schales Bier, Tabak, Zwiebeln und brutzelndes Schmalz. Von da an hatte sie den fettigen Dunst in der Nase, sobald sie die Haustür öffnete, der ließ sich auch nicht hinausschneuzen, selbst wenn sie Wasser hochzog und wieder ausprustete. Die Mutter verbot ihr, öfter als einmal in vierzehn Tagen den Kopf zu waschen, davon würden die Haare dünn, sagte sie, und fielen aus. Rosas Haare waren ohnehin dünn.
Rosa zog eine Brennessel aus dem Boden, wunderte sich, wie lang und wie gelb die Wurzel war, zerkrümelte Erde zwischen den Fingern. Kühl fühlte sie sich an.
Die Mutter steckte den Kopf aus der Hintertür, rief Rosa. Semmeln solle sie holen. Zum Bäcker ging sie gern, zum Fleischhauer nicht, von dem Geruch nach Blut wurde ihr übel. Als sie zurückkam, saß die alte Frau Wiesner am Tisch in der Fensternische und schlürfte schmatzend Gulyassuppe. Rings um ihren Mund glänzte der rote Saft. Sie grabschte eine frische Semmel aus Rosas Korb, putzte den Teller aus, schob ihn mit einer ungeduldigen Bewegung bis an die Tischkante, so daß Marianne herlief, um ihn vor dem Fallen zu retten. Die Wiesner verlangte Kaffee mit viel heißer Milch, ohne Haut, und einen kleinen Cognac. Während sie darauf wartete, nahm sie ihr Strickzeug zur Hand und begann mit klappernden Nadeln an einem grünen Socken zu stricken. Rosa schauderte es. Sie hatte gehört, wie die Schwester mit ihren Freundinnen flüsterte, die Wiesner mache noch ganz andere Dinge mit ihren Stricknadeln. Die jungen Frauen scheuchten Rosa weg, bevor sie Genaueres erfuhr, aber aus ihren fahrigen Gesten, den geröteten Wangen, den gesenkten Stimmen wußte sie, daß es sich um Da-unten handeln mußte, um das unaussprechliche Geheimnis, um Männer und Frauen und die schrecklichen Dinge, die sie miteinander anstellten. Früher hatte Rosa manchmal Geräusche aus dem Zimmer der Eltern gehört, vor denen sie sich unter der Decke verkrochen hatte, seit langem schon hörte sie nur mehr Vaters schwere Schuhe auf den Boden plumpsen, aber als die Eltern am Ruhetag im Kino waren, hörte sie noch beängstigendere Geräusche aus dem Zimmer, das sie mit der Schwester teilte. Sie riß die Tür auf; noch bevor sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten und sie mehr sah als den hellen Fleck des Bettes, drohte eine Männerstimme mit Prügeln, wenn sie nicht sofort verschwände. Rosa blieb auf halber Höhe der Treppe sitzen, döste irgendwann ein und wachte erst auf, als der Mann über sie hinwegstieg, sich umdrehte, sie unters Kinn faßte und dabei laut und gurgelnd lachte. Später steckte ihr Marianne eine Kokoskuppel zu und legte den Finger an den Mund.
Die Wiesner verlangte eine Kokoskuppel. Rosa erschrak. Konnte die Frau Gedanken lesen? Die Wiesner setzte ein Grinsen auf, vor dem Rosa heiß und kalt wurde, und zeigte mit der Stricknadel auf sie. Rosa solle die Kokoskuppel bringen, sie habe jüngere Beine, sagte die Wiesner. Mit abgewandtem Gesicht stellte Rosa den Teller auf den Tisch, die Wiesner ließ die Stricknadeln fallen, packte Rosas Kinn, betrachtete sie und schüttelte den Kopf. Rosa schämte sich, sie wußte nicht recht wofür, sie fühlte, wie sie rot wurde, häßliche rote Flecke bekam sie im Gesicht und am Hals, vor ein paar Tagen hatte sie sich im Spiegel erblickt, als sie genau diese Hitze spürte, und war erschrocken, weglaufen wollte sie und konnte nicht, blieb stehen vor diesem bösen, anklagenden Spiegel, bis Marianne ärgerlich nach ihr rief und sie aus der Erstarrung löste.
Die Wiesner lachte. In ihrer linken Mundecke bildeten sich Bläschen, in einem davon war ein Kokosschnipsel, eins glitzerte bräunlich-rosa von der Kakaocreme. Die dicken weichen Finger der Wiesner hielten immer noch Rosas Kinn, sie mußte dableiben und die Bläschen anstarren, als sie den Kopf zur Seite drehte und die Mutter hilfesuchend anschaute, ließ die Wiesner los und sagte zur Mutter, es werde nimmer lang dauern. Die Mutter strich sich die Haare aus der Stirn und von den Wangen, verschränkte die Hände über dem Bauch und senkte den Kopf. Der Nagel am Mittelfinger ihrer rechten Hand war eingerissen. Wie rot ihre Hände waren, wie dick die blauen Venen an den Handrücken. Hannas Mutter hatte ganz schmale Hände und lange rosarote Fingernägel.
Im Fliederbusch hatte Rosa ein Vogelnest entdeckt, darin lagen drei kleine türkisfarbene braun gesprenkelte Eier. Die Vogelmutter störte es nicht mehr, wenn Rosa still unter dem Busch hockte, sie starrte mit ihren schwarzen Stecknadelaugen vor sich hin und flog nur ab und zu kurz weg, um einen Regenwurm aus der feucht glänzenden Erde zu picken. Solange die Vogelmutter weg war, hielt Rosa sprungbereit Wache.
Gestern erst hatte der Nachbarkater seinen großen Kopf unterm Zaun durchgesteckt und wäre sicher durchgeschlüpft, wenn Rosa ihn nicht mit Schreien und Händeklatschen vertrieben hätte. Er fauchte und zischte, funkelte sie aus gelben Augen an. Sie starrte zurück, es war schwer, nicht zu blinzeln. Aug in Auge mit einer Katze durfte man nicht blinzeln, sonst hatte man verloren, unweigerlich. Wer hatte das gesagt? Rosa verstand nicht, warum die Vogelmutter ihr Nest ausgerechnet im Fliederbusch gebaut hatte, so nahe am Boden, aber da war es nun einmal, und sie mußte um halb acht in die Schule gehen und konnte erst um halb zwei zurückkommen, auch wenn sie rannte, bis sie Seitenstechen bekam. Sie schleppte ein langes Brett aus dem Schuppen zum Zaun, grub eine Rille und stellte das Brett hochkant vor den Spalt zwischen Erde und Zaun. Wenn der Zaun nur höher wäre. War er aber nicht.
Rosa spürte etwas auf dem Kopf, griff hinauf, hielt eine halbe Eierschale in der Hand. Wie zart die war. Rosa setzte sie auf ihren Mittelfinger, drehte sie hin und her. An der Bruchstelle war die Schale klebrig. Aus dem Nest piepste es hoch und leise. Rosa wollte aufspringen und schauen, hielt sich gerade noch rechtzeitig zurück, horchte nur mit ganzer Aufmerksamkeit. Pecken hörte sie, Piepsen und ein trockenes Rascheln, das mußte die Vogelmutter sein, die ihre Flügel bewegte. Rosa hielt den Atem an.
Als die Vogelmutter knapp über ihren Kopf flog, zuckte Rosa zusammen. Sehr langsam stand sie auf, ging nicht zu nahe ans Nest, machte die Augen schmal, um besser zu sehen. Die Vögelchen waren zerstrubbelt, die Federn verklebt, eigentlich nichts als drei weit offene gelbe Schnäbel. Irgendwie ekelig, und trotzdem wollte Rosa sie in die Hand nehmen, warm halten und die Federn glattstreichen und zurechtpusten. Sie hockte sich wieder hin, hielt sich an ihren eigenen Armen fest, wiegte sich hin und her, atmete ganz flach. Als die Vogelmutter zurückkam und das Piepsen laut anschwoll, erschrak Rosa vor dem Geräusch, mit dem die Luft aus ihrem Mund strömte. Erst als die Mutter zum dritten Mal rief, ging Rosa widerwillig ins Haus. Viel lieber wäre sie draußen geblieben, um auf die Vogelkinder aufzupassen, doch davon wollte die Mutter nichts hören, richtig ärgerlich wurde sie, schrie zuletzt die Tochter an. Rosa wollte die Mutter bestrafen und nichts essen, aber dann stieg ihr der Geruch der berühmten Gulyassuppe verlockend in die Nase. Es gab Leute, die nur ihretwegen ins Gasthaus kamen. Rosa löffelte den Teller aus, putzte ihn noch mit einer Schnitte Brot sauber.
Selbst nachts ließen ihr die Vögel keine Ruhe. Die Kirchturmuhr schlug gerade zwei Mal, als Rosa aufwachte. Sie schlich aus dem Zimmer, nur nicht auf die knarzende Treppenstufe treten, vorsichtig drehte sie den Schlüssel in der Hintertür um, trat hinaus in den Hof. Langsam gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit, etwas raschelte im Gras, sie spürte einen Lufthauch. Sehr langsam setzte sie Schritt um Schritt, der Kies knirschte trotzdem unter ihren Füßen, immer wieder blieb sie stehen. Der Fliederbusch lag tief im Schatten, als der Mond hinter einer Wolke hervorkam, konnte sie die Umrisse des Nests ausmachen und darauf die Silhouette der Vogelmutter. Sie stand völlig still, bis die Kälte in ihren Fußsohlen die Kopfhaut erreichte, dann schlich sie ins Haus zurück. Ein scharfer Schmerz durchzuckte sie, als sie die eisigen Füße warm zu reiben versuchte. Barry, paß auf die Kleinen auf, murmelte sie im Einschlafen.
Der Kater tauchte auf, als die Vogelkinder ihre ersten unbeholfenen Flüge machten. Sie warf mit Steinen nach ihm, ein einziges Mal streifte sie seinen Rücken, da rannte er laut miauend davon. Die Schule war eine Qual. Was machte sie hier, wo sie doch weit Wichtigeres zu tun hatte? Es berührte sie nicht einmal, wenn Hanna und Bärbel sie musterten und dabei tuschelten. Auch als Hanna nach einigen Tagen plötzlich anfing, hin und wieder ein Wort an sie zu richten, war es ihr egal, sie antwortete höchstens einsilbig und wartete auf das Klingelzeichen. Erst als Hanna ihre Hände packte, merkte sie, daß Hanna ausgerechnet sie als Partnerin für die gymnastischen Übungen ausgesucht hatte. Sie hatte nicht einmal Zeit, nasse Hände zu bekommen.
Was war das für ein Geschrei im Hof? Rosa stürzte hinaus, sah den Kater in einem ungeheuren Satz hochschnellen. Schon hatte er ein Vogelkind im Maul, es zuckte noch, dann hing es leblos baumelnd herab. Rosa wollte schreien, brachte keinen Ton heraus. Der Kater legte sich mitten in den Grasfleck. Das Vögelchen war nur ein kleiner Happen für ihn. Blutstropfen standen in seinem weißen Bart. Rosa rannte zu ihm hin, er lief nicht weg, fauchte nur, sie drosch auf ihn ein, er war so überrascht, daß er nicht gleich reagierte, nach dem zweiten oder dritten Schlag fuhr er seine Krallen aus und zerkratzte ihre Wange, dann drehte er sich um, stolzierte zum Zaun und sprang mühelos darüber.
Die Mutter kam aus dem Haus gelaufen, packte Rosa, wusch ihr Gesicht, betupfte die Kratzer mit Jod, das Brennen jagte ihr Tränen in die Augen. Heul gefälligst nicht, selber schuld, hast ja noch Glück gehabt, das hätte leicht ein Auge kosten können. Wann würde sie endlich vernünftig werden, so ein Kind sei wahrlich eine Strafe Gottes, und womit habe sie das verdient. Katzen fingen eben Vögel, das habe der Herrgott so eingerichtet, das könne sie nicht ändern und auch sonst niemand. Als sie fertig war, strich sie Rosa über den Kopf und reichte ihr eine Essiggurke aus dem Glas auf der Theke. Am Abend wusch sie die Kratzer mit einem in Kamillentee getauchten Lappen, Kamillentee war immer gut, wegen der paar Kratzer könne man nicht gleich zum Doktor laufen, danach kam wieder Jod, für alle Fälle, wer wisse denn, wo der Kater seine Pfoten reingesteckt habe, und hoffentlich würde es ihr eine Lehre sein.
Hanna bedauerte Rosa ausführlich, so verunstaltet, wie sie jetzt war, würde sie keinen Mann bekommen, außer natürlich einen Blinden, den würde es nicht stören. Bärbel konnte sich gar nicht einkriegen vor Lachen und mußte aufs Klo rennen.
Die Wunden heilten nur langsam, der Schorf juckte sehr, Rosa kratzte immer wieder daran, bis Blut kam. Du wirst Narben behalten, sagte die Mutter, hör endlich auf damit, sonst wirst du ganz entstellt. Würde sich die Mutter eben noch mehr genieren müssen mit ihr. Rosa wußte schon lange, wie verlegen Mutter und Schwestern wurden, wenn sie in die Gaststube kam. Die Mutter drohte, ihr die Hände abends an den Bettrahmen zu binden, und wickelte ihr Gesicht in Leinenstreifen, aber die lockerten sich nach kurzer Zeit. Fast jede Nacht träumte Rosa von dem Kater, der fauchte und die spitzen Zähne zeigte, oft war er ganz verschmiert von Blut.
Rosa kam nach Hause, ging hinauf in ihr Zimmer, um das Schulkleid auszuziehen, das geschont werden mußte. Marianne lag stöhnend im Bett, sie zitterte so sehr, daß die Messingbeine gegen den Boden ratterten. »Ist dir kalt?« fragte Rosa. Als die Schwester nickte, legte sie ihr die eigene Tuchent über die Decke. »Willst du ein Glas heiße Milch?« Die Mutter dürfe nichts erfahren, flüsterte die Schwester, sie könne sich doch verlassen auf Rosa, dann würde sie ihr auch den grünen Schal schenken mit dem weißen Muster.
Als die Mutter einkaufen ging, stellte Rosa einen kleinen Topf auf den Herd, während sie wartete, bis die Milch heiß wurde, schaute sie nach den Vögeln. Die zwei saßen nebeneinander im Fliederbusch und zwitscherten. Rosa atmete tief ein. Inzwischen war die Milch übergegangen. Rosa goß den Rest in einen Becher, gab Zucker hinein und trug ihn hinauf. Die Stimme, mit der sich die Schwester bedankte, war tonlos und schwach. Rosa lief zurück in die Küche, während sie den Lappen ausspülte, kam die Mutter mit zwei vollen Taschen in die Gaststube. Sie ließ sich auf einen Hocker fallen, wischte über ihre Stirn, fächelte sich Luft zu. Vor Erleichterung, daß sie nicht merkte, wie sehr es nach angebrannter Milch roch, packte Rosa die Taschen aus, verstaute die Lebensmittel. Die Mutter tätschelte ihr die Wange, dann begann sie Zwiebeln zu hacken für ihre ewige Gulyassuppe, die ihr ganzer Stolz war. Wenn sie kochte, war sie blind und taub für alles, was nicht kleingeschnitten und angebraten in ihre Töpfe paßte.
Marianne zitterte nicht mehr, stöhnte nicht mehr, lag einfach da mit schweißnassem Gesicht, verklebten Haaren, weit geöffneten Nasenlöchern, gab keine Antwort, als Rosa fragte, wie es ihr gehe. Im Zimmer hing ein süßlicher Geruch, der Brechreiz erzeugte. »Was ist denn, was hast du, bitte, sag doch was.« Rosa lief aus dem Zimmer, rief schon auf der Treppe nach der Mutter, jetzt war es egal, ob sie versprochen hatte, nichts zu sagen. Die Mutter hastete keuchend hinter ihr die Treppe hinauf, warf einen Blick auf das Bett, schrie Rosa an, worauf sie denn noch warte, sie müsse den Doktor holen, und zwar schnell. Rosa rannte, rannte, wie sie noch nie gerannt war, konnte kaum sprechen, als der alte Arzt in Hemdsärmeln und mit hängenden Hosenträgern die Tür öffnete. Er fragte nicht lange, packte seine Tasche, fuhr im Gehen in den Mantel und folgte ihr. Der Vater war nicht da, die Mutter schickte Rosa in die Gaststube, um die Zeit kamen sowieso nicht viele Gäste. Als sie Bier zapfte, lief der Schaum über die halbe Theke. Der Vysola riß den Mund auf und lachte, seine dicke rote Zunge schlängelte sich zwischen den zahnlosen Kiefern. Sie wischte das Glas außen ab, stellte es vor ihn hin, da tatschte er auf ihren Popo. Er lachte noch lauter, als sie zurückzuckte. Hinter der Theke fühlte sie sich sicherer, sie putzte die Spüle, bis auch der letzte matte Fleck silbern glänzte, polierte die Gläser auf der Abtropftasse. Ein großer Wagen fuhr vor das Haus, verdunkelte die Fenster der Gaststube, schnelle Schritte auf der Treppe, dann oben in der Wohnung, jeden einzelnen Schritt spürte sie als Schlag auf den Kopf, die Stimme der Mutter, hoch und schrill, das beruhigende Murmeln des Arztes, ganz als wäre die dunkle Holzdecke der Gaststube durchlässig geworden. Nur der Vysola schien nichts zu merken, nuckelte an seinem Bier und grinste vor sich hin. Jetzt kamen die Schritte die Treppe herunter, schwerer als zuvor, auch viel langsamer, die Haustür wurde aufgestoßen, knallte gegen die Wand, metallisches Klirren, der satte Ton einer Autotür, die zugeworfen wurde, Motorengeräusch, quietschende Reifen. Im Vorhaus die Stimme der Mutter, die den Arzt dringend einlud, doch ein Bier, einen Kaffee, einen Schnaps, ein Glas Wein zu trinken, er habe leider keine Zeit, sagte er, und die Mutter betete noch einmal alles herunter, was sie an Trinkbarem anzubieten hatte, wollte ihn um jeden Preis zurückhalten, aber er ging, die Mutter blieb unendlich lang im Vorhaus stehen, bevor sie in die Gaststube trat und gleich im Vorratsraum verschwand. Dumpfe Geräusche, es dauerte lange, bis Rosa klarwurde, daß sie Erdäpfel- und Zwiebelsäcke über den Boden schleifte, dann kehrte sie anscheinend auf, rammte bei jedem Besenstrich an die Wand. Der alte Vysola verlangte einen Schnaps, als Rosa fragte, welchen er wolle, schüttelte er sich vor Lachen, bis er schwankend aufstand und zum Pissoir ging. Kaum war er zurück, kam ein neuer Gast, den kannte Rosa nicht, aber sie war froh, daß er da war. »Welchen Schnaps ich will, hat sie gefragt«, sagte der Vysola immer wieder, »welchen Schnaps ich will. Gut, nicht? Welchen Schnaps!«
Rosa zapfte Bier für den neuen Gast, diesmal schäumte es nicht so wild, sie ließ den Hebel rechtzeitig los, wartete einen Moment, goß nach. Der Gast nannte Rosa ein tüchtiges Mädel, das hätte die Mutter hören sollen, aber die werkte immer noch in der Vorratskammer herum und machte dabei mehr Lärm als je zuvor. Als sie endlich herauskam und Rosa nach Marianne fragte, wurde die Mutter zornig. Ihre Augen waren rot und verquollen. Rosa soll sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, hat sie überhaupt die Hausaufgabe gemacht, und wann hat sie zuletzt Schuhe geputzt? Auch den Vater schrie sie an, als der nach Hause kam, und er verschwand im Keller. Rosa ging die Treppe hinauf, plötzlich war die Mutter hinter ihr, schob sie zur Seite, stieg mit einer Geschwindigkeit, die niemand je an ihr gesehen hatte, hinauf, ging ins Zimmer der Töchter, machte Rosa die Tür vor der Nase zu, kam mit einem Packen Bettwäsche heraus und ging hinunter. Ein blutverschmiertes Leintuch hatte sich aus dem Bündel gelöst und schleifte hinter ihr her.
Der junge Mann, den Rosa einmal auf der Treppe getroffen hatte, betrat die Gaststube, die Mutter schoß hinter der Theke hervor, holte aus und gab ihm zwei klatschende Ohrfeigen. Er ließ sich einfach schlagen, flüsterte irgend etwas, alle Tische waren besetzt, die Gäste hoben die Köpfe und drehten sich zu den beiden, die Mutter wischte die Hände an der Schürze ab, der junge Mann stand immer noch da, worauf wartete der, schließlich ging er, von hinten sah es aus, als wäre er geköpft worden. Am nächsten Morgen kam er aus der Bäckerei gerannt, als Rosa vorbeiging, erkundigte sich nach der Schwester, aber Rosa konnte ihm nichts sagen, sie wußte selbst nichts, jedenfalls nichts Genaues, mit ihr redete die Mutter nicht, sie sprach auch nicht so viel mit den Gästen wie sonst, verschwand immer wieder in der Vorratskammer, die längst aufgeräumt war, alle Einsiedegläser hatte sie abgestaubt und die Kartoffeln in der Ecke selbst aussortiert, was doch sonst Rosas Arbeit war. Es hatte mit Da-unten zu tun, soviel hatte sie verstanden, mit Da-unten, wo man nicht hingreifen durfte, der Pfarrer nannte das Unkeuschheit und es war die schlimmste Sünde und die Engel weinten und der Schutzengel legte sich die Flügel übers Gesicht, damit er es nicht sehen mußte. Wenn die Mutter mit der Nachbarin sprach, steckten die beiden die Köpfe zusammen und man verstand kein Wort, auch wenn man sich noch so sehr bemühte. Der junge Mann lief bis zur Schule neben Rosa her, aber sie konnte ihm nicht helfen, wie denn.
Bärbel und Hanna schoben Rosa in der Pause in eine Ecke des Schulhofs. Mit schief gelegtem Kopf und weit aufgerissenen Augen sagte Hanna: »Du weißt eh, daß deine Schwester in die Hölle kommt, wenn sie jetzt stirbt.« – »Und daß sie kein christliches Begräbnis bekommt«, fügte Bärbel hinzu, »nicht einmal auf dem Friedhof wird sie begraben werden, verscharrt wird sie auf der Simmeringer Heide, auf dem Galgenberg.« Was wußten die beiden? Rosa biß sich auf die Lippen, bis sie bluteten. Sie fragte nicht. Sie nicht.
Das Zimmer war so fremd. Auf dem Bett der Schwester standen die drei Matratzen, eine an die andere gelehnt, die Tuchent war weg, der Polster lag quer über zwei Matratzen. Nie hatte Rosa allein geschlafen, sie wachte immer wieder auf, weil keine Atemzüge aus dem Nebenbett kamen, unter Mariannes Bett hockte die Angst, schwappte über den Boden, sammelte sich in allen Winkeln, legte sich auf Rosas Mund und Nase wie eine klebrige Masse. Als sie am Morgen in die Gaststube kam, schaute die Mutter sie entsetzt an, stellte dann einen großen Becher Kakao vor sie hin, nicht Malzkaffee wie sonst, obwohl doch Freitag war und nicht Sonntag. Die Tür öffnete sich, die Wiesner stand da und sagte irgend etwas, da packte die Mutter den Besen, schwang ihn drohend und ging auf die Wiesner los, die rannte kreischend davon, eine Stricknadel fiel aus ihrer Tasche und klapperte über den Boden. Rosa hob die Nadel auf und reichte sie der Mutter, da bekam die Mutter einen roten Kopf, packte die Stricknadel mit beiden Händen, verbog sie, wie der starke Heinrich im Prater die Eisenstangen verbogen hatte, und warf sie in den Mistkübel.
Die Tür zur Gaststube ließ sich nicht öffnen. Rosa rüttelte an der Klinke, erst dann sah sie den Zettel Wegen Krankheit geschlossen. Krank? Wer war jetzt wieder krank? Die Schwester konnte nicht gemeint sein, die war schon so lange im Spital. Nun sah Rosa auch, daß die Vorhänge in der Gaststube zugezogen waren. Sie rannte ums Haus zur Wohnungstür. Die war offen. Im Vorhaus hörte sie Stimmen aus der Gaststube. Da saß Marianne und schaute sich gar nicht mehr ähnlich, aber sie war es doch, hundert Jahre älter geworden, teigig blaß hielt sie sich am Tisch fest, es sah aus, als würde sie umkippen wie eine Stoffpuppe, wenn sie die Hände höbe. Rosa blieb mitten in der Stube stehen, die Schwester schaute sie an, als warte sie auf etwas, senkte dann den Kopf. Die Mutter trug Hühnersuppe auf, die gibt es sonst nie, und verfolgte mit den Augen jeden Löffel auf dem Weg vom Teller in Mariannes Mund. Essen muß sie, was auch geschehen ist, jetzt muß sie erst einmal essen, und dann wird man weitersehen. »Vielleicht geh ich nach Amerika«, sagte die Schwester, dort kenne sie niemand, dort werde sie niemand anstarren. Der Vater fragte, wer die Überfahrt bezahlen solle, er bestimmt nicht, das sei einmal sicher. Die Mutter verzog den Mund, bis er so schief in ihrem Gesicht stand wie der des Nachbarn nach dem Schlaganfall. Nach dem Essen schickte die Mutter Marianne ins Bett. Rosa ging hinter ihr die Treppe hinauf, eine Stufe nach der anderen. Ob sie die Schwester auffangen könnte, wußte sie nicht, die war zwar so mager geworden, daß das Kleid an ihr hing wie an einer Vogelscheuche, aber sie war doch ziemlich groß. Einmal stolperte sie, hielt sich kurz am Geländer fest. Im Zimmer strich sie mit der Hand über Polster und Decke, die Mutter hatte sie mit dem schönen weißen Bettzeug überzogen. Später am Abend, als auch Rosa im Bett lag, fragte sie, ob er dagewesen sei. Rosa nickte, das konnte die Schwester im Dunkeln nicht sehen und mußte die Frage wiederholen. »Ja«, sagte Rosa laut, als wäre die Schwester nun auch schwerhörig, »ja, er paßt mich immer auf dem Schulweg ab, aber ich hab ja nichts gewußt.« – »Sei froh«, sagte Marianne, »sei froh. Und wenn er wiederkommt, grüß ihn. Und ich trag ihm nichts nach, hörst du?« Rosa fragte, ob er auch einen Namen habe, da wurde die Schwester ärgerlich, das gehe Rosa gar nichts an, erklärte sie, und sie solle lieber auf sich aufpassen.
Zwei Monate später war Marianne nicht mehr da, als Rosa aus der Schule kam, hatte keinen Zettel hinterlassen, nur ihr grünes Tuch lag unter Rosas Kopfkissen, Rosa traute sich nicht, es umzunehmen, auf die Frage nach der Schwester schüttelte die Mutter nur den Kopf und erwähnte ihren Namen nie mehr. Rosa stellte sich vor, daß die Schwester mit dem jungen Mann nach Amerika gegangen war und eines Tages kommen und sie abholen würde. Sie suchte Bücher über Amerika in der Leihbibliothek, las sie unter der Decke im Bett, die Mutter sollte nichts davon erfahren. Rosa zeichnete eine Karte von Amerika; wenn im Kino an der großen Kreuzung ein Film aus Amerika lief, stand sie lange vor den Bildern im Schaufenster, überlegte, ob Marianne jetzt auch so lachte wie die amerikanischen Schauspielerinnen auf den Fotos. Sie probierte dieses Lachen vor dem Spiegel aus, aber es gelang ihr nicht. Wahrscheinlich hatte sie den falschen Mund dafür.
Die Seife auf dem Waschtisch hatte der Schwester gehört, Rosa verwendete sie nur ganz selten, bei besonderen Anlässen, meist roch sie nur daran und wusch sich mit Hirschseife. Die Mutter schnitt immer ein Stück in drei Teile, einen für die Theke, einen für sich und den Vater, einen für die Töchter. Ob die duftende Seife ein Geschenk von dem jungen Mann war?
Einmal auf dem Heimweg von der Schule meinte Rosa die Schwester auf der Straße zu sehen, sie rannte hinter ihr her, dreimal kam gerade im falschen Augenblick ein Auto dahergebraust und sie konnte die Straße nicht rechtzeitig überqueren, jetzt müßte Barry da sein, der würde die Spur gleich finden, ein Glück nur, daß Marianne einen leuchtendgrünen Hut trug, wo konnte sie den herhaben, er machte es leichter, ihr zu folgen, Rosa hätte natürlich rufen können, aber sie wollte die Schwester überraschen, einfach vor sie hintreten und sagen, was sagen, es würde ihr schon einfallen, wenn sie erst vor ihr stand, und wenn nicht, würde sie Marianne einfach umarmen. Ein großer Bierwagen versperrte die ganze Gasse, Rosa duckte sich, schlich unter den Pferden durch, vor Pferden hatte sie keine Angst, aber der Kutscher kam heraus und schrie, ob sie denn nicht wisse, wie gefährlich das war, ein Schlag mit den riesigen Hufen, und dann sollte womöglich wieder er schuld sein. Rosa hatte wertvolle Zeit verloren, als sie die Kreuzung erreichte, war der grüne Hut nirgends zu sehen, sie rannte in die linke Seitengasse, kehrte um, lief geradeaus, dann die rechte Straße entlang, blieb stehen, wurde angerempelt, irgend jemand sagte etwas zu ihr, klang freundlich, aber sie brachte den Mund nicht auf. Die Tür des Galanteriewarenladens auf der anderen Straßenseite ging auf, der grüne Hut leuchtete über den Lederflecken auf den Schultern der Eismänner, die ihr gerade in diesem Moment die Sicht verstellten, sie rannte hinüber und blickte in ein völlig fremdes Gesicht. Erst am Abend im Bett heulte sie.
Wenn der Herr Kaplan über Unkeuschheit redete, und das tat er ziemlich oft, drehten sich Hanna und Bärbel nach Rosa um und blickten einander bedeutungsvoll an, dabei zitterten ihre Nasen wie die von Kaninchen. Natürlich hatten das die anderen längst gemerkt, alle vermieden es, an Rosa anzustreifen, im Turnunterricht blieb sie immer als letzte übrig, und wenn einmal ein Mädchen fehlte und deshalb eine übrigblieb und mit Rosa turnen müßte, lief sie hinaus und erklärte, ihr sei schlecht. »Ist mir doch egal«, sagte Rosa jeden Tag beim Aufstehen, auf dem Schulweg, auf der Treppe hinauf zu ihrer Klasse im ersten Stock. »Ist mir doch egal.« Leider konnte sie sich selbst nicht glauben.
Wenn der Vater fragte, ob sein weißes Hemd endlich gebügelt sei, oder die Mutter sagte, das Bierfaß unter der Theke sei fast leer, hatten sie an diesem Tag schon viel mehr gesprochen als sonst. Beim Essen stützte der Vater die Ellbogen auf, beugte sich tief über den Teller und schaufelte Bissen um Bissen in seinen Mund. Zum Kauen konnte da keine Zeit bleiben. Es sah aus, als hätte er mit seinem Rücken, mit seinen Armen einen Käfig um sich selbst gebaut. Die Mutter schaute nie in seine Richtung, nur auf ihren eigenen Teller.
Am Morgen kam jetzt immer eine grauhaarige Frau, die der Mutter beim Putzen half, sie trug einen grauen Kittel, ihre Schuhe waren wohl einmal schwarz gewesen, jetzt waren sie grau, sogar ihre Hände, ihre Wangen waren grau. Sie und die Mutter führten einen Krieg darüber, wie viele Kübel Wasser notwendig waren, um die Gaststube aufzuwaschen. Die Mutter erklärte, sie würde sich nicht nachsagen lassen, es sei schmutzig bei ihr, dann seufzte die Frau und wendete den Blick zum Himmel. Wenn das alles ist, was man einem Menschen nachsagen kann, dann muß er ohnehin von Glück reden und unserem Herrgott danken. Anschließend schlug sie ein Kreuz über ihrer Kittelschürze. Amen.
In den Schulferien mußte Rosa der Frau helfen beim Gründlichmachen. Es war nicht die Arbeit, die sie störte, sondern die Art, wie die Frau sie ansah, dieses Lauern im Blick. Wenn irgend jemand etwas Freundliches über ein junges Mädchen sagte, wiegte sie den Kopf hin und her und murmelte, man würde schon sehen. Der Vater wich ihr aus, das Bier wird sauer, sagte er, wenn sie den Zapfhahn putzt. Rosa war ausnahmsweise einer Meinung mit ihm.
Die Leibchen mit den Strapsen für die kratzenden Strümpfe waren Rosa zu eng geworden. Am Abend im Bett legte sie beide Hände auf die Brust, die so seltsam weich geworden war und manchmal spannte. Wenn sie dabei die Brustwarzen berührte, zog es im Bauch und Daunten. Wahrscheinlich hatten alle recht, die sagten, daß sie schlecht war. Wenn die ganze Klasse am Aschermittwoch in Zweierreihen in die Kirche marschierte, würde sie es beichten müssen. Ob die Mutter das meinte, wenn sie manchmal so fragend schaute und fragte, ob Rosa ihr etwas sagen müsse?
Eines Morgens sah Rosa den Fleck auf dem Leintuch. Beim Aufstehen spürte sie es feucht und klebrig über ihre Schenkel rinnen. Sie riß das Leintuch vom Bett, lief damit hinunter in die Waschküche und begann zu schrubben. Der Fleck wurde blasser, weg ging er nicht. Plötzlich stand die Mutter hinter ihr, nahm ihr das Leintuch aus der Hand und strich ihr über die Stirn, über die Haare. »Mein armes Kind. Jetzt bist du eine Frau. Bleibt dir auch nicht erspart.« Die Mutter schimpfte nicht, sie legte den Arm um Rosas Schultern, das tat sie sonst nie, nahm ihn auch nicht weg, als sie auf der schmalen Stiege ganz eng nebeneinander gehen mußten. Rosa bekam eine Art Etui aus weich gewaschenem Leinen, gefüllt mit zerschlissenen Resten von Bettbezügen, und einen Gürtel, an dem sie es festmachen konnte. Auf dem Weg in die Schule spürte sie den Polster zwischen den Beinen, die Ränder rieben an den Schenkeln beim Gehen, sie setzte die Füße anders als sonst und hatte das Gefühl, daß alle Leute auf der Straße sie anstarrten und die Mädchen in der Klasse auch. »Bitte Frau Fachlehrerin, ich kann nicht turnen«, sollte sie der Lehrerin sagen, leise, es müßten nicht alle hören, hatte ihr die Mutter eingeschärft.
Für die Abschlußfeier der Schule hatte Anna, die älteste Schwester, Mutters dunkelblaues Hochzeitskleid enger gemacht und gekürzt. Der Stoff fühlte sich sehr weich an. Rosa hatte das Kleid sofort hinauf in ihr Zimmer getragen, das durfte nicht nach Wirtsstube riechen. Die neuen Schuhe mit kleinem Absatz und Riemchen über den Rist hatte sie dreimal eingecremt und blank poliert, angeblich schützte man so das Leder vor den Flecken, die Regentropfen machten. Am Tag vor der Zeugnisverteilung kam Hilde, die mittlere Schwester, und überreichte Rosa ein Päckchen, darin war ein weißer Spitzenkragen, der war so schön, den konnte man gar nicht anfassen. Die Schwester wusch ihr die Haare, zum ersten Mal mit Shampoo und nicht mit Seife. Abends im Bett schnupperte Rosa immer wieder an ihren Haaren.
Zum Frühstück ging sie in der alten Kittelschürze, es wäre schrecklich, das Kleid anzukleckern oder zu verdrücken. Als sie umgezogen die Treppe hinunterkam, schob gerade der Bierkutscher ein Faß durch den Vorraum. »Na, da schau ich aber«, sagte er und pfiff durch die Zähne. Sie stolperte und mußte sich am Geländer festhalten, er lachte laut.
Sogar Hanna sagte kopfschüttelnd, heute sehe Rosa ja fast wie ein Mensch aus. Rosa hätte sich gern darüber gefreut, aber sie merkte nur, wie ihre Befangenheit zunahm, rechter Fuß, linker Fuß, es war furchtbar wichtig, die richtige Reihenfolge einzuhalten. Es war auch wichtig, gerade zu gehen, Hilde hatte gesagt, wenn du nicht gerade gehst, sitzt das Kleid nicht. Plötzlich mußte sie kichern. Ein sitzendes Kleid! Wie kann etwas sitzen, das keinen Hintern hat? In dem Augenblick betrat der Herr Direktor den Zeichensaal und blickte sehr streng in ihre Richtung. Nein, der blickte nicht in ihre Richtung. Der schaute einfach nur so. Vielleicht war er deshalb Direktor geworden, weil jeder glaubte, dieser strenge Blick gelte ihm, und sofort ein schlechtes Gewissen bekam. Rosa wunderte sich über sich selbst. Solche Gedanken hatte sie sonst nie. »Das Denken soll man überhaupt den Pferden überlassen, die haben die größeren Köpfe«, sagte der Vater. »Und was soll denn dabei herauskommen, wenn ausgerechnet du zu denken anfängst«, hatte Hanna einmal gesagt. Aber eigentlich, stellte Rosa fest, machte das Denken Spaß. Mit geradem Rücken trat sie vor, wackelte nicht beim Knicksen. Der Direktor blickte über ihren Kopf hinweg, als er ihr alles Gute für ihren weiteren Lebensweg wünschte. Das Zeugnis in ihrer Hand fühlte sich glatt und fest an. Sie mußte es zweimal lesen, bevor sie glauben konnte, daß die Noten wirklich so viel besser waren, als sie erwartet hatte.
Die Eltern streiften das Zeugnis mit einem Blick, der Vater sagte, jetzt beginne der Ernst des Lebens, die Mutter schaute besorgt drein und schickte sie umziehen. Der große Tag war vorbei, und es war erst kurz nach elf. Sie hängte das Kleid auf einen Bügel, schnippte mit dem Finger dagegen, es schwang noch hin und her, als sie die Tür schloß.
Die Mutter hatte eine Stelle für Rosa bei einer Weißnäherin gefunden. Wenn Frau Michalek an ihrem Arbeitstisch saß, quoll ihr Hintern über die Sitzfläche des Stuhls mit der gebogenen Lehne und ihre Brüste lagen schwer auf dem Tisch, sie hatte Patschhändchen wie ein Baby, weiß, weich und mit Grübchen. Wie eine kuschelige Sommerwolke sah sie aus, solange man ihre hellen Augen nicht beachtete, denen nichts entging. Ein einziger Stich, der aus der Reihe tanzte, und Rosa mußte die Naht mit einer Stecknadel auftrennen und durfte erst nach Hause gehen, wenn die Arbeit zu Frau Michaleks Zufriedenheit erledigt war, die dabei ununterbrochen in einem halblauten Singsang schimpfte, wieviel es sie koste, wegen Rosas Ungeschicklichkeit und Unachtsamkeit länger Licht brennen zu müssen. Rosa haßte die Biesen und Hohlsäume, das Ajourieren und Monogrammsticken, haßte das ewige Weiß, die ewige Angst, das Leinen, das Halbleinen, den Damast oder Batist schmutzig zu machen. Wenn sie sich in den Finger stach, mußte sie ihn in den Mund stecken, bevor Blut den Stoff besudelte. Das gelang ihr nicht immer, dann mußte sie das Werkstück waschen und trockenbügeln. Schneiderin wäre sie gern geworden, aber es war niemand auf die Idee gekommen zu fragen, was sie wolle. Die Mutter sagte fast jeden Tag, sie müsse froh sein, überhaupt eine Arbeit zu haben, und der Vater brummte, es wäre besser gewesen, sie daheim zu behalten, dann müßten sie nicht fremde Hilfe bezahlen, obwohl, wenn er überlege, wie finster sie ständig dreinschaue, würde sowieso nie eine gute Kellnerin aus ihr. Am Samstagnachmittag und am Sonntag mußte sie in der Wirtsstube aushelfen. Dabei kam es immer öfter vor, daß einer von den Gästen sie in den Hintern kniff, dann rannte sie in die Vorratskammer und schämte sich, und das Lachen der Männer dröhnte sogar durch die geschlossene eisenbeschlagene Tür. »Hab dich nicht so, du wirst noch einmal froh sein, wenn dich überhaupt einer anschaut«, rief ihr einer nach. Noch schlimmer war, wenn die Männer sie musterten mit diesen Blicken, die dasselbe sagten, nur deutlicher. Dann schien es ihr sogar erstrebenswert, neben der Michalek sitzen zu können, deren argwöhnische Blicke nur den sauberen Stichen galten.
An einem Montagmorgen klopfte Rosa, bekam keine Antwort, klopfte noch einmal, öffnete schließlich die Tür. Auf dem Arbeitstisch stand ein Kasten, aus dem tönte Musik. Ob sie noch nie einen Radioapparat gesehen habe, schrie die Michalek. Rosa schüttelte den Kopf. Eigentlich, meinte die Michalek, dürfte sie Rosa gar nicht mehr bezahlen, eigentlich müßte sie dafür zahlen, daß sie hier Musik hören könne. »Aber womit sollst du zahlen? Und wenn du’s nicht hören kannst, kann ich’s auch nicht hören. Wie komm ich dazu, deinetwegen auf den Genuß zu verzichten?« So hörte Rosa jeden Tag die Opern- und Operettensendungen, und die Michalek gewöhnte sich an, ihr im Anschluß daran die Handlung zu erzählen und einzelne Arien vorzusingen, wobei sie die Tenorpartien mit besonderer Inbrunst schmetterte. Als Rosa Jahre später in die Volksoper ging, wartete sie in der ›Lustigen Witwe‹ vergeblich auf ›Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküßt‹ und auf das ›Vilja‹-Lied im ›Zigeunerbaron‹, aber sie wußte nicht, ob die Michalek oder sie selbst an der Verwirrung Schuld trug. Auf jeden Fall genoß sie diese Stunden und summte bald mit, wenn die alte Frau nach der Sendung ihre Lieblingsmelodien trällerte.