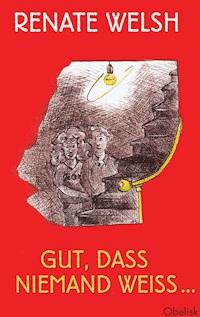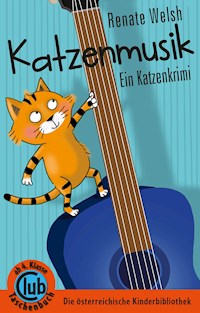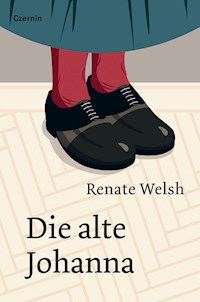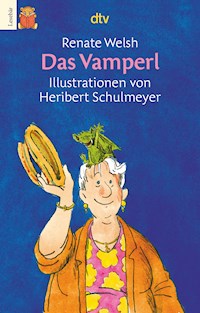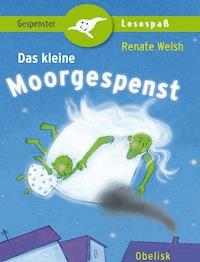14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn man an die eigenen Grenzen stößt? Wenn der Körper einen im Stich lässt, die Worte verschwinden? Mit gewaltiger Sprachkunst und Fingerspitzengefühl erzählt Renate Welsh von einem sehr persönlichen Ereignis: ihrem Schlaganfall, der Rehabilitation danach und vom harten Kampf zurück zu sich selbst. Mitten im Italienurlaub erleidet Renate Welsh einen Schlaganfall. Plötzlich ist sie nicht nur auf andere angewiesen, auch ihre Sprache ist verloren und die eigenen Gedanken scheinen mit einem Mal fremd zu sein. Ausgerechnet sie, eine Schriftstellerin, wird ihrer Worte beraubt. Diese zurückzuerhalten ist ein langer, harter und anstrengender Kampf, von dem Renate Welsh behutsam und feinfühlig berichtet. Und wie so oft geht das Erzählte bei ihr über das Einzelschicksal hinaus und zeigt, wie die eigenen körperlichen und psychischen Grenzen überwunden werden können. »Ich ohne Worte« ist die äußerst mutige und persönliche Geschichte über das Altern und den langen Weg zurück zur Sprache und in ein selbstbestimmtes Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Renate Welsh
ICH OHNE WORTE
Erzählung
Renate Welsh
ICH OHNE WORTE
Erzählung
Czernin Verlag, Wien
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Welsh, Renate: Ich ohne Worte / Renate Welsh
Wien: Czernin Verlag 2023
ISBN: 978-3-7076-0786-4
© 2023 Czernin Verlags GmbH, Wien
Autorinnenfoto: Christopher Mavrič
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
Druck: Findir
ISBN Print: 978-3-7076-0786-4
ISBN E-Book: 978-3-7076-0787-1
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
Inhalt
Ich ohne Worte
Danksagung
Als mich der Schlag traf, war ich nicht dabei.
Schon am Morgen war ich fremd neben mir gestanden, hatte gegen Wellen von Übelkeit gekämpft, mich beim Abendessen mühsam aufrecht gehalten. Wir mussten auf das Schiff warten, das uns zurück zum Hotel auf der Insel bringen würde.
Jetzt war die Matratze Treibsand, ständig in Bewegung, wieso ging das so steil bergauf? Der Griff nach dem Wasserglas war unendlich mühevoll, das Glas klirrte auf den Boden. Ich schleppte mich ins Badezimmer, wusste nicht, was ich da wollte, hielt mich am Waschbecken fest, ließ mich hinuntergleiten.
Licht flammte auf, mein Mann stand neben mir, versuchte mich hochzuziehen.
»Lass mich. Sitzen.«
Shiraz gab keine Ruhe, zog mich hoch, schob mich. Ein Schritt, noch ein Schritt, er schleppte mich zum Bett zurück, ich ließ mich darauf fallen.
»Drück meine Hand!«
»Wozu?«
»Streck die Zunge heraus!«
»Wa-warum?«
Dann war auch meine Schwägerin da. Dasselbe noch einmal: Drück meine Hand. Streck die Zunge heraus …
Ich war da und nicht da, es interessierte mich im Grunde nicht, dass es hell wurde, viel zu hell, dass Leute herumstanden. Ich schämte mich, weil ich kein Nachthemd anhatte. Es tat mir leid, dass ich Umstände machte, dass Shiraz Susanne aufgeweckt hatte, dass …
Die Fremden verkabelten mich. Sie machten also ein EKG, so viel verstand ich. »Sorry«, hörte ich mich sagen, immer wieder, das half auch nicht. Shiraz sah verstört aus, ein fremder Mann in orangefarbener Uniform scheuchte ihn weg.
Ich wurde auf einen Tragsessel geschnallt, über die Stiegen hinuntergetragen. Wieso hatte ich meinen Regenmantel an? Wer hatte ihn mir angezogen, Shiraz oder Susanne?
Nicht einmal verabschieden konnte ich mich, ich wurde über den Kiesweg geschleift, mein Hintern holperte über die Steine, mich fror.
Das Rettungsboot schaukelte heftig. Eine Frau legte mir einen Beutel auf den Bauch, sagte etwas, als ich nicht reagierte, verzog sie das Gesicht, hielt sich die Hand vor den Mund. Ich hatte wirklich nicht die Absicht, seekrank zu werden. Sobald wir am Steg angelegt hatten, nahm die Frau den unbenützten Beutel weg und gab mir einen neuen für die Fahrt im Rettungswagen. Ich hätte gern darüber gelacht, dass es eigene Speibsackerln für die Fahrt zu Wasser und für die Fahrt zu Land gab, aber das konnte ich nicht.
Nichts konnte ich.
Es war auch nicht wichtig.
Meine Trage wurde aus dem Wagen geschoben, ich wurde auf ein Bett gehoben. Plötzlich überfiel mich der Gedanke, dass niemand wusste, wo ich jetzt war. Fragen prasselten auf mich ein. Auch wenn ich sie verstanden hätte, hätte ich nicht antworten können. Meine Zunge war riesig, wurde immer noch größer, füllte bereits die Mundhöhle zur Gänze aus, da war kein Raum, in dem sie sich hätte bewegen können. Irgendetwas in mir fing an zu zittern, das Bett ratterte.
»Su nome?«
Nicht einmal meinen Namen konnte ich sagen, mein Hals wuchs von innen zu und wurde von außen zugeschnürt.
Meine Blase drohte jeden Augenblick zu platzen. Immer verzweifelter suchte ich das Wort Toilette.
Ein Träger trat zu meinem Bett. Ich weiß nicht, woran es lag, wahrscheinlich an seinem Gesichtsausdruck, ich war sicher, er würde mir helfen. Es gelang mir, das Mobiltelefon aus der Tasche meines Regenmantels zu ziehen und mit Aufbietung aller Kräfte Bernadettas Nummer in den Kontakten zu finden. Bernadetta würde Rat wissen und sie sprach natürlich Italienisch. Schweißgebadet zeigte ich auf das Telefon. Der junge Mann verstand, ich hörte ihn mit Bernadetta sprechen, hörte ihre Stimme. Das öffnete eine Tür, ich wusste nicht, wohin, in diesem Moment genügte, dass es überhaupt eine Tür geben könnte.
Eine Frau beugte sich über mich, strahlte Wärme aus. Als ich endlich erfasste, dass sie mich auf Deutsch ansprach, fing ich an zu weinen. »Maria Theresia« las ich auf ihrem Kittel. Bis zu meiner Abreise kümmerte sie sich um mich, dolmetschte, besorgte sogar Dinge, die ich brauchte. Solange sie in der Nähe war, gab es einen festen Punkt in diesem ständig pulsierenden Raum.
Mein Bett stand neben der Tür. Auf dem Gang klapperten, schlurften, schmatzten, klopften Schritte hin und her, eilig, hastig, manchmal auch zögerlich. Neben mir im Bett lag ein widerwärtiges, gallertartiges Etwas. Vergeblich versuchte ich es wegzuschieben. Ich wollte die Pflegerin, die mir eine Bettschüssel unter den Hintern schob, ersuchen, sie möge doch bitte dieses Ding entfernen, aber mein Hals war zugeschnürt, nicht einmal krächzen konnte ich. Die Pflegerin strich mir über die Stirn, das war schön, aber wieso sah sie nicht, dass etwas völlig Ungehöriges, Anstößiges neben mir im Bett lag? Ich versuchte darauf zu zeigen, sie steckte mir eine Tablette in den Mund.
In der Nacht kam mir der Gedanke, das Ding könnte schuld daran sein, dass ich nicht sprechen konnte, ich verdoppelte meine Anstrengungen, es aus dem Bett zu werfen. Endlich gab ich auf.
Am Morgen kamen zwei Frauen in orangefarbenen Kitteln, rollten mich zur Seite, rollten mich hin, rollten mich her, ich wurde gewaschen. Es tat gut, das Wasser zu spüren, es tat gut, alles geschehen zu lassen, nichts tun zu müssen. Eine Frau strich mir die Haare aus der Stirn, drückte mich an ihre weiche Brust.
»Cara«, murmelte sie. Hier wollte ich bleiben und gewiegt werden wie ein Kind. Ich fing an zu weinen und konnte nicht mehr aufhören. »Povera cara.«
Alles war gut, doch dann musste sie weiter, ließ mich als armes Waisenkind zurück.
Was war das? Meine rechte Hand zerrte die Linke vor meine Augen, öffnete die Finger mit Gewalt. Die Handfläche war gezeichnet von meinen Nägeln. Die Hand krampfte. Ich betrachtete sie angeekelt, sie fiel auf die Bettdecke. »Diese Hand da fällt«, schallte es in meinem Kopf. Als Schülerinnen mussten wir laut und deutlich »Hier!« sagen, wenn unsere Namen im Klassenbuch aufgerufen wurden. Ich war hier. Da war ich nicht. Anwesend, aber nicht vorhanden.
Noch einmal versuchte ich, das Ding neben mir aus dem Bett zu werfen. Natürlich gelang es mir nicht. Handelte es sich etwa doch um meine Hand? Um meine ehemalige Hand? Die war aber doch viel zu groß. Vielleicht siebenmal so groß wie meine rechtmäßige Hand. Und aus ganz und gar anderem Stoff gemacht. Nicht einmal zum Nasenbohren würde sie taugen.
Es war eine Herausforderung, mit den Fingern der rechten Hand die der linken aus dem Krampf zu lösen, in dem sie sich in die Handfläche gebohrt hatten. Meine Knie ratterten, mein Hals wurde immer enger. Ich versuchte zu rufen, brachte keinen Ton heraus, versuchte mich einzurollen. Auch das gelang nicht.
Ich war nicht nur allein, fremd, in einem Körper, der mir nicht gehörte, ganz außerhalb aller Koordinaten. Konnte nicht einmal wünschen, dass es anders wäre. Ich war dieses fremde Ding, gallertartig, widerwärtig.
»Was fehlt dir?«
»Nichts.«
»Hast du Schmerzen?«
»Nein.«
Nichts fehlte mir. Alles fehlte mir. Vor allem die Wörter.
Wenn jemand in den nächsten Tagen sagte: »Du klingst doch normal«, hätte ich schreien wollen. Sie logen. Ich würgte die Wörter heraus, die wenigen, die ich erwischen konnte, selten die, die ich suchte, und nie im richtigen Augenblick. Sie logen, und ich log aus Verzweiflung, weil ich die Hoffnung aufgegeben hatte, dass es vielleicht möglich sein könnte, in dem Mückenschwarm von Wörtern das richtige Wort zu finden. »Du klingst normal.« Ein Hohn war das.