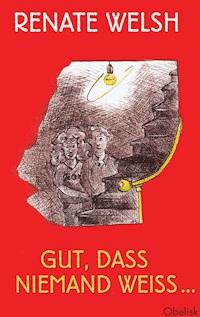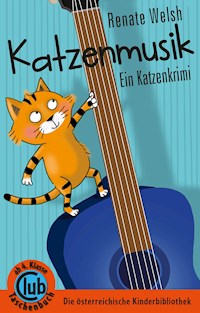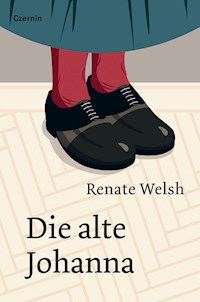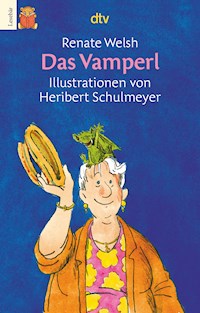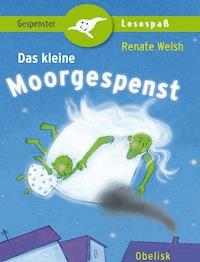19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"In einer Woche würde Johanna wegfahren. Dann würde keiner mehr fragen, ob sie ehelich oder unehelich geboren war. Dann würde sie nicht mehr Johanna, das Gemeindekind, sein, sondern Johanna, die Schneiderin. Oder Johanna, die Friseurin." "Das wäre ja noch schöner, wenn ledige Kinder schon was wollen dürften!", diesen Satz kann Johanna nicht vergessen. Denn eigentlich will sie eine Ausbildung machen und kommt dafür Anfang der 1930er-Jahre in ein kleines niederösterreichisches Dorf. Dort angekommen, muss sie jedoch als Magd auf einem Bauernhof arbeiten, unentgeltlich. Aber Johanna gibt nicht auf und kämpft für ihre Zukunft. Feinfühlig und ergreifend erzählt Renate Welsh Johannas Geschichte – und zugleich vom Schicksal einer ganzen Generation. Renate Welsh erzählt von den politisch turbulenten 1930er-Jahren in Österreich: Austrofaschismus, Antisemitismus und Nationalsozialismus beeinflussen das kleine Dorf immer stärker, in das Johanna voller Hoffnung auf eine Ausbildung kommt. Doch diese wird ihr verwehrt, stattdessen muss sie als Dienstmagd auf dem Bauernhof der Familie Lahnhofer arbeiten. Johanna teilt so das Schicksal vieler unehelich geborener Mädchen ihrer Zeit, doch trotz aller Umstände nimmt sie ihr Leben selbst in die Hand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Renate Welsh
JOHANNA
Roman
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Welsh, Renate: Johanna / Renate Welsh
Wien: Czernin Verlag 2021/1979
ISBN: 978-3-7076-0722-0
© 2021 Czernin Verlags GmbH, Wien
Autorinnenfoto: Christopher Mavrič
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
ISBN Print: 978-3-7076-0722-0
ISBN E-Book: 978-3-7076-0723-9
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
Für Johannas Enkelkinder
Inhalt
I. Teil
1931
Abschied
Eine wie du …
Die anderen
Totenwache
Der Brief
Weihnachten
II. Teil
1932
Maria
Die Mutter
St. Florian
Fragen
Hagel
Der Kater
Der Lohn
Heimweh
III. Teil
1933
Zirkus
Warten
IV. Teil
1934–1935
Zwischenspiel
Feuerwehrball
Peter
Reden
Krank
Veränderung
Johanna
Angst
V. Teil
1936
Anfang
I. Teil
1931
Abschied
Seit Johanna wusste, dass sie weggehen würde, sah alles anders aus.
Den ganzen langen Sommer über hatte sie jeden Morgen einen Strich in den Pfosten neben dem Schweinekoben geritzt. Es waren jetzt hundertundvier Striche. Eine Woche noch.
Sie striegelte den verklebten Dreck von den Flanken der drei Kühe, wusch die Euter mit dem Tuch, das immer säuerlich roch, auch wenn man es noch so oft ausspülte. Sie wich gerade noch rechtzeitig dem Kuhschwanz aus, als sie die Bless mit der Wurzelbürste bearbeitete.
Die Ziehschwester Maria kam über den Hof und nickte Johanna zu. Der Henkel des Eimers schepperte.
Johanna füllte Heu in die Futterkrippen. Ihre Stiefel schlurften auf dem Lehmboden. Es waren alte Stiefel des Ziehvaters, drei oder vier Nummern zu groß. Wenn Johanna schlaftrunken hineinfuhr, war das praktisch, aber beim Gehen hatte sie Mühe damit.
Der Milchstrahl zischte hell in den leeren Eimer. Später, sobald der Boden bedeckt war, wurde der Klang dumpfer. Als der erste Eimer voll war, nickte Maria; Johanna schob ihr einen leeren Eimer hin, schnippte zwei Strohhalme aus der schäumenden Milch und goss sie durch das Sieb. Sie schöpfte zwei Liter in die Kanne und trug sie ins Haus.
Johanna ging zum Brunnen, pumpte den Eimer voll, spülte ihn aus, pumpte noch einmal und hielt das Gesicht unter den scharfen Strahl. Sie schüttelte sich, dass die Tropfen von ihren Haaren flogen. Die weiße Katze erwischte einen Tropfen auf der Nase und sprang beleidigt zur Seite.
Wenn sie ihre Jungen bekommt, bin ich nicht mehr da, dachte Johanna.
Die Kaffeebecher standen auf dem Herdrand aufgereiht, jeder mit dem Namen des Besitzers in Goldbuchstaben.
Johanna fischte mit einem Stück Brot die Haut vom Kaffee.
Die Ziehschwester kam herein. »Die Bless hat was«, sagte sie.
»Ich frag den Hadinger«, sagte die Ziehmutter.
Maria machte eine geringschätzige Handbewegung. »Besser, der Tierarzt kommt.«
»Der kostet Geld.«
»Und wenn die Bless hin ist, kostet es erst recht Geld.«
Die Ziehmutter nickte. »So arg ist es? Also gut, wenn du meinst … Johanna, lauf hinüber, wenn du fertig bist mit dem Kaffee.«
Johanna zog die Stiefel aus und fuhr sich mit dem Kamm durch die Haare. Ein Zahn brach ab. Wenn das so weiterging, war der Kamm bald so zahnlos wie der Ziehvater. Aber der hatte die Zähne im Krieg verloren, lange bevor Johanna auf der Welt war. Sie war 13, fast 14.
»Die Zähne ist mir noch der Kaiser schuldig«, sagte der Ziehvater gelegentlich. Es war der einzige Witz, den Johanna je von ihm gehört hatte.
»Beeil dich! Und bring gleich ein Paket Malzkaffee mit und ein Kilo Zucker. Die Eier kannst du am Weg in der ›Traube‹ abgeben.«
Johanna ging barfuß. Sie hatte vor ein paar Tagen begonnen, jeden Abend schwarze Schuhcreme auf ihre Schuhe zu schmieren. Wenn sie bis zum nächsten Sonntag so weitermachte, sah man vielleicht die abgewetzten Stellen nicht mehr. Außerdem waren die Schuhe unbequem. Sie hatten dem Fräulein Olga gehört, die dem Herrn Pfarrer die Wirtschaft führte.
Der Tierarzt war nicht zu Hause. Seine Frau versprach, er würde noch am Vormittag vorbeikommen.
In der »Traube« saß der Viehhändler mit zwei Fremden, an einem anderen Tisch prostete sich der alte Josef mit seinem Schnapsglas selbst zu. Seine Krücke lehnte schräg gegen einen Stuhl, Johanna musste einen Bogen darum machen. Josef kicherte. »Kannst ruhig drüberspringen, sie tut dir nichts.«
Marianne brachte dem Viehhändler und seinen Gästen Wein.
Sie lehnte sich vor, als sie die Gläser auf den Tisch stellte, und die drei Männer glotzten in ihren Ausschnitt. Marianne trug ein Dirndl mit engem Mieder. Die Bluse sah ganz brav aus, wenn sie stand, aber wenn sie sich vorbeugte, fielen auch die Rüschen vor. Marianne war kaum älter als Johanna, bis zum Juni waren sie in dieselbe Klasse gegangen. Jetzt half Marianne ihren Eltern im Gasthaus und war kaum wiederzuerkennen.
»Ich bring die Eier«, sagte Johanna.
Sie hatte das Gefühl, dass Marianne sie geringschätzig musterte. Etwas juckte sie am Bein. Sie kratzte sich mit den Zehen des anderen Fußes. Marianne nahm den Eierkorb.
»Vierzig sind es.«
»Ist gut. Willst du das Geld gleich mitnehmen?«
»Ja, schon.«
Mariannes Rock flatterte, als sie sich zur Kasse drehte. Der Viehhändler spitzte die Lippen. Marianne zählte Johanna das Geld in die Hand. Ihre Mundwinkel kräuselten sich.
Sollte sie nur grinsen. In einer Woche würde Johanna wegfahren, nach Norden, über den Semmering. So weit war noch keine von ihren Schulkolleginnen gekommen. Sie würde in die Eisenbahn einsteigen und wegfahren, und sie würde etwas lernen. Nicht bloß daheim arbeiten wie Marianne. Sie würde richtig lernen. Schneiderin würde sie werden, und wenn das nicht ging, vielleicht Friseurin.
Dann würde keiner mehr fragen, ob sie ehelich oder unehelich geboren war. Dann würde sie keiner mehr mit diesem schiefen Blick ansehen, mit dieser Mischung aus Mitleid und Geringschätzung. Dann würde sie nicht mehr Johanna, das Gemeindekind, sein, sondern Johanna, die Schneiderin. Oder Johanna, die Friseurin. Vielleicht würde sie sich auch so ein Dirndl nähen, mit rotem Mieder und blauem Rock und schwarzer Schürze.
»Hast du mein Fahrrad schon gesehen?«, fragte Marianne.
»Komm, ich zeig’s dir.«
Sie führte Johanna in den Hof. In einem eigenen Verschlag neben dem Holzschuppen stand das Rad. Die Speichen blinkten. Auf dem schwarzen Rahmen glänzte ein blauer Streifen.
»Was sagst du dazu?«
»Schön.«
Marianne spielte mit der Klingel. »Vielleicht lass ich dich einmal fahren. Wenn du aufpasst.«
Johanna sagte, sie müsse heim.
Die Ziehmutter arbeitete im Küchengarten. Sie richtete sich auf, legte beide Hände an den Rücken. »Mach da weiter, ich geh kochen.« Johanna übernahm die Harke. Das Unkraut zwischen den Krautköpfen stand schon wieder hoch. Die Binderwurzeln bildeten ein dicht verfilztes Gewirr und reichten tief. Seit Johanna denken konnte, hatte sie Binderwurzeln ausgegraben, oft einen halben Meter lang, dick und dunkelgelb. Das Unkraut wurde trotzdem nicht weniger. Im nächsten Frühjahr würden Maria und die Ziehmutter allein damit fertigwerden müssen.
Im nächsten Frühjahr würde Johanna nicht mehr umstechen, nicht mehr Mist einarbeiten, nicht mehr säen, nicht mehr Unkraut jäten. Sie streifte eine Raupe von einem Kohlblatt.
Die Arbeit im Küchengarten hatte sie nie gemocht. Man kam so langsam weiter, und wenn man endlich fertig war, fand die Ziehmutter immer noch einen Löwenzahn oder einen Hühnerdarm oder gar eine Brennnessel. Sie legte großen Wert auf ihren Küchengarten. Fräulein Olga kaufte nur bei ihr Gemüse für das Pfarrhaus, und in der »Traube« schätzte man ihren grünen Salat und ihre Gurken, die nie bitter waren.
Johanna klaubte eine Handvoll Steine aus dem Erdbeerbeet. Ob sie dort auch Erdbeeren hatten, wo sie hinfahren würde?
Dann waren die Hühner zu füttern. Sie kamen breitbeinig angerannt, als Johanna rief, sogar die schwarze Henne, die immer über die Straße in den Nachbargarten lief.
Im nächsten Sommer würde Maria heiraten, sobald ihr Franz von den Dragonern zurückkam. Die Zieheltern würden ihnen den Hof übergeben und Maria würde hier Bäuerin sein und eigene Kinder haben.
»Vielleicht ist es ohnehin besser, du gehst jetzt«, hatte die Ziehmutter gesagt. »Hier im Dorf ist es nirgends so, dass du einheiraten könntest.«
Johanna hatte gefragt, warum sie denn heiraten müsse. »Ich bin doch erst dreizehn.«
»In zehn Jahren ist es auch nicht anders«, hatte die Ziehmutter gesagt. »Zum Heiraten gehört Geld. Das ist einmal das Wichtigste. Du siehst ja, wie es mit der Maria ist. Kommt nur der Franz infrage, die haben auch nicht mehr, oder höchstens noch der Gruber, aber der sauft.«
Die Ziehmutter redete manchmal mit Johanna wie mit einer Erwachsenen. Oder doch nicht wie mit einer Erwachsenen. Mit den Erwachsenen redete sie gar nicht so offen. »Es hat eben alles seinen Preis«, sagte sie. »Gott sei Dank ist der Franz ein ordentlicher Mensch. Man wird ja sehen.«
Johanna wusste, dass die Ziehmutter recht hatte, und wollte trotzdem nicht glauben, dass es so sein müsse. Obwohl sie schon in der Schule erlebt hatte, dass jeder seinen Preis hatte und seinen Wert im Dorf. Wenn einer vorbeiging, wussten alle, wie viele Joch Boden da gingen und wie viele Kühe. Genau wie jeder wusste, welche Mitgift ein Mädchen zu erwarten hatte.
Nur Johanna hatte keinen Preis.
Ihre Mutter hatte sie hergeschenkt, als sie zwei Monate alt war. Manchmal dachte sie: Ein Geschenk ist doch etwas Gutes. Verschenken ist nicht dasselbe wie Wegwerfen.
Immerhin hatte die Mutter gute Leute ausgesucht, als sie ihr Kind herschenkte. Die Ziehmutter war gut, auch wenn sie sehr streng war. Sie arbeitete selbst hart, den ganzen Tag lang, und sie verlangte harte Arbeit von allen im Haus, von Maria genauso wie von Johanna. Der Unterschied war nur, dass Maria hierher gehörte, und Johanna gehörte nicht hierher. Vielleicht lag es daran, dass ihr nichts gehörte. Wenn einem nichts gehörte, gehörte man auch nirgends hin.
Die Fürsorgerin hatte allerdings gesagt: »Dort, wo du hingehörst, kannst du auch etwas lernen. Dort, wohin du zuständig bist.« Vielleicht, dachte Johanna, ist etwas gelernt haben genauso gut wie etwas haben.
Darum wollte sie weggehen, obwohl sie Angst hatte.
Im Schulzimmer hing eine Landkarte an der Wand. Sie war bald nach dem Besuch der Fürsorgerin in die sommertote Schule gegangen, hatte den Schulwart gebeten, ihr die Klasse aufzusperren, und hatte den Ort gesucht, wo ihre Mutter »zuständig« war. Dunkelbraun war es dort, nicht hellgrün wie hier. Sie fuhr mit dem Finger die Straße entlang, wobei sie mehrmals den Weg verlor. Weit war es, sehr weit. Sie überlegte, wie sie überhaupt hinkommen würde. Die Eisenbahnlinie, die nach Reichenau führte, lag weit abseits von hier. Johanna hatte überhaupt noch nie einen Zug gesehen. Wenn sie an die kommende Woche dachte, spürte sie ein Flattern im Magen.
Sie füllte Wasser in die Hühnertränke, kehrte den Mist zusammen und leerte ihn in den Bottich. Die Ziehmutter mischte den Hühnermist mit Erde und düngte damit die Blumenbeete. Es waren nur vier Eier in den Nestern. Die schwarze Henne ließ ihre Eier sicher im Nachbargarten, und der Nachbar dachte gar nicht daran, sie herauszurücken.
Nach dem Abendessen wusch Johanna wie immer das Geschirr. Maria stopfte Strümpfe. Die Ziehmutter verschwand im Zimmer und kam mit einer neuen Schürze zurück, dunkelblau mit weißen Blümchen.
»Die ist für dich«, sagte sie zu Johanna. »Und jetzt näh ich dir das Fahrgeld in die Tasche. Ich hab mich erkundigt, was es kostet bis Reichenau. Wenn es arg ist dort, dann kannst du immer zurückkommen, verstehst du?«
Johanna schluckte. »Danke«, sagte sie. Die weißen Blümchen verschwammen vor ihren Augen.
»Die Pfanne ist noch zu waschen«, sagte die Ziehmutter.
Eine wie du …
Die Schuhe, die einmal Fräulein Olga gehört hatten, drückten mit jedem Kilometer mehr. Johanna bückte sich, um die Schnürbänder zu lockern.
»Was treibst du?« Frau Kürners Lippen wurden beim Sprechen noch schmäler, die Mundwinkel zuckten am Ende jedes Satzes nach unten.
Johanna setzte sich wieder aufrecht und faltete die Hände im Schoß.
Die Fürsorgerin blickte gerade vor sich hin.
Der Autobus ratterte und schwankte von einem Schlagloch ins nächste. Johanna stemmte die Füße auf den Boden, um in den Kurven nicht gegen Frau Kürner gedrückt zu werden. Dabei zwickten die Schuhe noch mehr. Johanna klammerte sich an den Haltegriff des Vordersitzes.
In den Obstgärten neben der Straße wurden Winteräpfel gepflückt. Eine Gänseherde watschelte über die Straße und zwang den Autobus, so plötzlich zu bremsen, dass selbst Frau Kürner von ihrem Sitz rutschte. Die Gänse reckten die Hälse und zischten den Autobus wütend an.
Die Straße beschrieb eine weite Linkskurve, einen Augenblick lang sah Johanna in der Ferne den Kirchturm ihres Dorfes. Sie fasste nach ihrer Tasche, befühlte die gerillten Ränder der eingenähten Münzen.
In der Reihe hinter Johanna und Frau Kürner saß eine alte Frau, die eine Kiste auf dem Schoß hielt. Sie bekreuzigte sich in jeder Kurve, dabei schlitterte die Kiste vor, stieß an den Vordersitz und traf Johanna jedes Mal in den Rücken. Die alte Frau erzählte ihrer Nachbarin, sie fahre mit ihrer Häsin zum Decken, die Wirtin im nächsten Dorf habe so schöne Angorahasen.
»Schadet’s ihr nicht, das Durchrütteln im Autobus?«, fragte die Nachbarin.
»Im Gegenteil. Sie hat eh zu wenig Auslauf, die Bewegung tut ihr gut.«
Frau Kürner presste die Lippen aufeinander.
Im Gasthaus in Güssing bekam Johanna das Bett einer Serviererin, die zum Begräbnis ihrer Großmutter gefahren war. Johanna saß auf dem Bett und kaute das Brot, das ihr die Ziehmutter eingepackt hatte. Zwischen den Schnitten lag ein Stück vom sonntäglichen Schweinebraten. Trotzdem würgte es Johanna beim Schlucken.
Die zweite Serviererin kam herauf.
»So weit wegfahren, das möcht ich nicht«, sagte sie.
»Ich will etwas lernen«, sagte Johanna.
Als sie vor sieben Uhr früh hinunterging, hörte sie Frau Kürner zur Wirtin sagen: »Wo die Mutter zuständig ist, da bringe ich sie hin. Eine Person muss das sein! Hat acht Kinder, jedes von einem anderen Mann. Die ist die älteste. War lange genug bei uns. Und so was brauchen wir nicht in unserer Gemeinde, erst recht nicht in der heutigen Zeit, und es ist ja auch nicht unsere Angelegenheit. Wenn sie was lernen will – bitte sehr. Aber nicht bei uns!« Johanna blieb vor der Tür zur Gaststube stehen.
Sie war also nicht einmal mehr »so eine«. Nur noch »so was«. Das tat weh. Aber sie würde es ihnen noch zeigen. Allen. Und ganz besonders dieser Kürner.
Im Autobus zur Bahn redete sie kein Wort.
»Mach nicht so ein grantiges Gesicht«, sagte Frau Kürner. Johanna klammerte sich an ihren Zorn. Sie rückte noch näher zum Fenster, um nicht an die Fürsorgerin anzustreifen.
Ich heule nicht, dachte sie. Ich heule dir nichts vor. Dir nicht.
Frau Kürner lutschte Pfefferminzbonbons.
Ich zeig’s euch noch, ich zeig’s euch allen, dachte Johanna vor sich hin, in einem endlosen Refrain, während vor den Fenstern Landschaft vorbeizog, Kühe weideten, Kirchtürme auftauchten und verschwanden, Fahrgäste zustiegen und ausstiegen.
Der Bahnhof war aufregend. Johanna spürte das ferne Dröhnen und Rattern des heranfahrenden Zuges bis in die Zehenspitzen. Sie beugte sich vor, um besser zu sehen. Frau Kürner riss sie zurück.
Die donnernden Räder, der zischende Dampf, das Wasser, das von den Achsen spritzte, gaben Johanna das Gefühl, dass die riesige Lokomotive nur widerwillig stehen blieb, wie ein Pferd zitterte und losrennen wollte – nur stärker, viel stärker. Ein Mann mit rußschwarzem Gesicht beugte sich aus der Lokomotive und lächelte Johanna zu.
Sie lächelte zurück.
Als sie dann auf einer hellen Holzbank saß, den schrillen Pfiff hörte, das Stampfen und Rattern und Beben spürte, als auf den Feldern Menschen aufblickten und winkten, war Johanna fast glücklich, obwohl Frau Kürner neben ihr saß. Sie hätte gern zurückgewinkt.
Der graue Himmel wurde tintenblau, auf den Berghängen leuchtete hier und dort ein Licht auf, in den Mulden strahlten ganze Lichterketten. In der nächsten Station wurde eine zweite Lokomotive vorgespannt.
Das Fahrgeräusch änderte sich. Fast so, wie ein Mensch beim Bergaufgehen ins Schnaufen kommt, dachte Johanna. Die hohen schwarzen Bäume rückten so nah, dass man meinte, sie anfassen zu können, wenn man nur die Hand ausstreckte.
In einer langen, fast halbkreisförmigen Kurve sah Johanna die Lokomotive, sah den Funkenregen im weißen Dampf und musste schlucken, um ihren Vorsatz zu halten und nicht doch zu sprechen. Diese hüpfenden Sterne! Dann, in der nächsten Kurve, spannten sich fünf weiße Bogen über eine tiefe Schlucht, über Baumwipfel und Felsstürze, dahinter ragte eine graue Masse, und über der grauen Masse glitzerte Schnee. Jetzt, im Oktober.
»Die Rax«, sagte Frau Kürner.
Der Berg, dachte Johanna. Sie brauchte keinen Namen für den Berg. Das war der Berg. Einfach so.
Frau Kürner räusperte sich, zog ihren Rock glatt.
Eine halbe Stunde später kamen sie in Gloggnitz an. Johanna sah sich noch einmal nach der Lokomotive um. Die Räder schienen zu glühen.
Frau Kürner ging voraus, Johanna zwei, drei Schritte hinter ihr.
Frau Kürner drehte sich immer wieder um, einmal sagte sie: »Trödel nicht, wir haben nicht ewig Zeit«, dann ging sie immer schneller über die Brücke und die dunkle Straße entlang. Vor einem großen Gebäude blieb sie stehen und drückte auf die Klingel neben dem Tor.
»Du bleibst hier über Nacht«, sagte sie. »Morgen Früh wirst du abgeholt. Und eines merke dir für deinen späteren Lebensweg: Es wird gut sein, wenn du beizeiten lernst, dich zu fügen. Sonst wird es ein schlimmes Ende nehmen mit dir.«
Hinter der Tür schlurften Schritte.
Johanna bemühte sich, ein abweisend-hochmütiges Gesicht zu machen, nicht zu zeigen, dass sie Angst hatte.
Ein Schlüsselbund klirrte.
Die Tür wurde einen Spaltbreit geöffnet.
»Da bringe ich sie«, sagte Frau Kürner. »Sie wird morgen Früh abgeholt.«
Die Tür ging auf, eine sehr alte Frau mit wirrem weißen Haar, die aussah, als sei sie eben aus dem Bett gekommen, fasste Johannas Hand. »Ist schon recht«, sagte sie.
Frau Kürner drehte sich auf dem Absatz um. »Auf Wiedersehen«, sagte sie schon im Gehen.
Die alte Frau sperrte die Tür wieder zu, wobei sie »Ja-ja-ja« sagte und mehrmals nickte. Sie führte Johanna in eine enge Kammer mit einem Schiebefenster zum Gang. »Du hast sicher Hunger. Ich habe etwas aufgehoben für dich.«
Sie goss Malzkaffee aus einer Thermosflasche in eine dickwandige weiße Tasse und holte aus einem Wandschrank ein Stück Kuchen. Der Kuchen roch merkwürdig, fast nach Mottenpulver, aber Johanna war hungrig und tunkte den bröckelnden, trockenen Kuchen in den übersüßen Malzkaffee. Die alte Frau sah ihr mit schief gelegtem Kopf zu, nickte und seufzte. Erst als sie das letzte Stück Kuchen gegessen hatte, wurde Johanna klar, dass das Nicken nichts bedeutete. Der Kopf nickte ganz von selbst auf dem mageren Hals.
»Zeit zum Schlafengehen«, sagte die alte Frau.
Sie führte Johanna durch einen langen, dunklen Gang, dann eine Treppe hinauf, suchte umständlich den richtigen Schlüssel an ihrem riesigen Schlüsselbund. Als die Tür knarrend aufging, sah Johanna einen Saal. In einer Ecke brannte eine schwache Glühbirne unter einem blauen Tuch.
In dem Saal standen zwanzig oder mehr Betten. Die alte Frau führte Johanna zu einem Bett an der Türwand.
Im Nebenbett lag eine Frau, der das Nachthemd bis unter die Brust hochgerutscht war. Ihre Beine waren mit offenen Wunden bedeckt.
In einem anderen Bett fuhr eine Frau hoch. Sie war fast kahl, mit ein paar langen grauen Strähnen zwischen bläulichrot glänzenden Flächen. Sie begann zu jammern: »Mama! Mama!« Aus einer anderen Ecke des Saals keifte eine tonlose Stimme: »Gib endlich Ruhe! Ruhe, hab ich gesagt!«
»Ich bleib nicht hier«, sagte Johanna.
Die alte Frau, die Johanna eingelassen hatte, nickte heftig. »Armes Ding. Ich hab kein anderes Bett für dich. Schlaf schön. Morgen wirst du abgeholt.«
»Nein!«, sagte Johanna. »Da bleib ich nicht. Bitte!«
»Ist nur für eine Nacht. Eine Nacht nur.«
»Kann ich nicht auf dem Gang bleiben?«, bat Johanna.
»Das ist verboten«, bedauerte die alte Frau unter heftigem Nicken.
Johanna klammerte sich an ihre Hand. »Bitte, lassen Sie mich nicht da! Ich kann da nicht schlafen, wirklich nicht!«
»Ruhe!«, keifte es aus der dunklen Ecke. »Ruhe!«
»Der Armenrat hat es befohlen«, sagte die alte Frau. »Es tut mir leid.«
Sie riss sich plötzlich los und hastete zur Tür. Johanna stolperte; bevor sie ihr nachlaufen konnte, knirschte schon der Schlüssel im Schloss. Johanna hämmerte mit den Fäusten an die Tür.
»Ruhe!«
»Nicht einmal schlafen …«
»Mama!«
Johanna ging zurück zu ihrem Bett, setzte sich auf die Decke, zog die Beine an und umklammerte die Knie mit beiden Händen.
Sie bemühte sich, das Zittern zu unterdrücken, das das Eisenbett rattern ließ.
»Nicht weinen, nicht weinen«, murmelte die alte Frau mit den geschwürigen Beinen. »Nicht weinen. Wird alles wieder gut. Alles wieder gut. Nicht weinen. Wenn man so jung ist, wird alles wieder gut.«
»Ich weine nicht«, flüsterte Johanna.
Sie weinte wirklich nicht. Sie hatte das Gefühl, brechen zu müssen. Sie hatte einen widerlichen Geschmack im Mund und ein Würgen in der Kehle, gegen die Tränen vielleicht angenehm gewesen wären. Aber ich weine nicht, dachte sie.
Die ganze Nacht über saß sie auf dem Bett. Im blauen Licht erschienen die Gestalten in den Betten wie Gespenster. Hin und wieder stand eine auf, dann hörte sie Wasser in Nachttöpfe zischen und der Brechreiz wurde ärger.
Als es endlich hell wurde und Johanna die Frauen im Saal richtig sehen konnte, erschrak sie noch einmal. Ihre Nachbarin war nicht die Einzige, deren Beine offene Wunden hatten. Manche scheuchten nicht einmal die Fliegen weg, die sich auf die Geschwüre setzten. Einige lagen abgedeckt da, mit weit aufgerissenen Augen. Viele jammerten vor sich hin in einem auf- und absteigenden Singsang.
Johanna hielt sich an ihren Knien fest.
Ihre Nachbarin stützte sich mühsam auf den Ellbogen. »Ist ja nicht so schlimm, ist nicht so schlimm.« Der Speichel lief ihr übers Kinn, ihr linker Mundwinkel sackte ab, das linke Augenlid hing schlaff herunter.
Auf dem Gang klirrte Metall, die Tür wurde aufgesperrt. Die Beschließerin rollte einen Wagen mit einer dampfenden Aluminiumkanne, einem Berg dick geschnittener Brote und drei Türmen aus dickwandigen weißen Tassen herein. Sie schenkte Kaffee ein und verteilte Brote.
Eine Frau verlangte schrill, die Beschließerin müsse zuerst von ihrem Kaffee trinken. »Die wollen mich vergiften«, flüsterte sie. Die Beschließerin nahm einen Schluck, als sei das jeden Morgen so, dann brockte die Frau ihr Brot in die Tasse und begann genießerisch zu schlürfen.
Johanna lehnte Kaffee und Brot ab.
»Ich hab meine Vorschriften«, sagte die Beschließerin.
Johanna stand auf und ging zum Waschbecken. Während sie sich wusch, spürte sie Blicke auf ihrem Rücken. Jemand kicherte. Johanna flocht ihre Zöpfe neu und setzte sich wieder auf ihr Bett. Eine alte Frau schlurfte zwischen den Betten hin und her, brachte einer Bettlägerigen einen feuchten Waschlappen, fütterte eine andere, kämmte eine dritte.
Johanna wartete.
Die Tür ging auf. Es war nur eine Frau mit Eimer und Besen, die eine scharf riechende Lauge über den Steinboden schüttete und hin und her wischte.
Gegen acht Uhr kam die Beschließerin wieder und führte Johanna in die Kammer neben dem Tor. Auf dem Weg über den hallenden Gang wiederholte sie: »Ich hab meine Vorschriften.«
In der Kammer saßen zwei Männer, beide die Ellbogen auf den Tisch gestützt, und unterhielten sich laut über ein neues Spritzenhaus für die Feuerwehr. Als die Beschließerin Johanna vor sich her über die Schwelle schob, unterbrachen sie das Gespräch.
»Da hast du deine neue Dirn«, sagte der eine.
Dirn? Hatte er Dirn gesagt?
Der Größere stand auf und trat neben Johanna. Sein Atem roch schal. Er packte ihren Oberarm.
»Mager, aber zäh«, sagte er zufrieden.
»Na, siehst du«, sagte der andere, als hätte er eine Leistung vollbracht. Sein Lächeln war schmierig.
Johanna holte tief Atem. »Ich will Schneiderin werden«, hörte sie sich sagen. »Das haben sie mir versprochen.«
Die beiden Männer wechselten Blicke. »Versprochen? Dir?«
»Ja. Darum bin ich hergekommen.«
Der Große machte eine ungeduldige Handbewegung und sagte zu dem Dicken, der sich kichernd die Hände rieb: »So weit kommt’s noch.« Er wandte sich an Johanna: »Du kommst zu mir als Dirn, damit du es nur weißt.«
»Nein!«
Der Dicke legte die Stirn in Kummerfalten. »Du hast hier nicht zu schreien, verstanden?«
Johanna gab sich einen Ruck. »Ich bleibe nicht da. Ich fahr heim. Die Mutter hat mir sowieso das Fahrgeld eingenäht.«
Die Beschließerin legte Johanna die Hand auf die Schulter und murmelte beschwörend: »Nicht, Mädel, nicht, du machst es dir nur noch schwerer.« Johanna schüttelte die Hand ab, hob den Kopf und sah dem Großen voll ins Gesicht.
Dem stieg unter dem Bartschatten die Röte über die Wangen. Er begann zu brüllen.
»Du wirst hier überhaupt nicht gefragt, verstanden? Du bist meine Dirn und sonst nichts!«
»Herr Armenrat …«, begann die Beschließerin, aber niemand beachtete sie.
Der Dicke verschränkte die Arme. »Das wäre ja noch schöner, wenn ledige Kinder schon was wollen dürften!« Plötzlich schoss seine runde rosarote Hand vor. Johanna wich zurück. »Merk dir eines: Du tust, was man dir sagt, verstanden? Eine wie du hat nicht frech zu sein, sonst …« Die Drohung blieb in der Luft hängen. Nach einer Weile fügte er hinzu: »Du weißt vielleicht gar nicht, wie viele froh wären, überhaupt eine Stellung zu finden. 300.000 und mehr! Und wenn du Ärger machst, nehmen wir dir das Geld weg, hast du gehört?«
Johanna klammerte beide Hände um die Schürzentasche.
»Zerdrückst die schöne Schürze«, murmelte die Beschließerin.
Der Große zog eine goldene Uhr aus der Tasche, ließ sie aufschnappen, runzelte die Stirn und reichte dem Dicken die Hand. »Also wir gehen. Und wegen dem Spritzenhaus reden wir noch.« Er steckte der Beschließerin eine Münze zu, die sich knicksend bedankte, packte Johanna am Arm und führte sie hinaus.
Die Sonne blendete Johanna, als das Tor aufging.
Vor dem Haus stand ein starker, glänzender Brauner vor einem Leiterwagen. Der, der das Pferd hielt, war sicher der Knecht. Er musterte Johanna grinsend.
»Ferdl«, sagte der Bauer, »die ist nichts für dich, die ist erst dreizehn und ich trag die Verantwortung. Merk dir’s.« Ferdl sprang auf den Wagen.
»Du wirst sehen«, sagte der Bauer während der Fahrt, »es ist zu deinem Besten. Es tut nie gut, wenn man sich überhebt über seinen Stand.«
Johanna antwortete nicht. Sie hätte kein Wort herausbringen können, selbst wenn sie gewollt hätte.
Als der Bauer sagte: »Wisch dich ab«, merkte sie, dass sie sich die Unterlippe blutig gebissen hatte.
Das Pferd bog unaufgefordert rechts in eine Seitenstraße ab, die durch den Wald bergauf führte. Ein Eichhörnchen rannte über den Weg. Eine Kastanie polterte auf die ratternden Bretter.
In einer Kehre sah Johanna plötzlich den Berg wieder.
Gleich darauf stand neben der Straße die Ortstafel.
Sie bogen links ab, fuhren an ein paar geduckten Häusern vorbei, Ferdl sprang vom Wagen, öffnete ein Tor.
»Da sind wir«, sagte der Bauer.
Ein großer, braun-weiß gefleckter Hund bellte, seine Kette rasselte, er versuchte, Johanna anzuspringen.
Ferdl lachte. »Der Rolfi tut dir nichts.«
Er spannte das Pferd aus und führte es in den Stall. Der Bauer ging auf das Haus zu; nach ein paar Schritten wandte er sich um und winkte Johanna, ihm zu folgen.
Die Küche war dunkel und sehr heiß. Die Bäuerin rührte in einem großen Topf. Johanna konnte ihr Gesicht nicht sehen. Der Bauer verlangte ein Glas Most.
Die Bäuerin seufzte, nahm einen Krug und sagte im Vorübergehen zu Johanna, sie käme gerade recht, sie solle gleich die Bohnen auslösen. Der Korb stünde auf der Bank.
Johanna stellte den Pappkarton mit ihren Sachen in die Ecke. Sie hatte bald die Hand voll Bohnen und wusste nicht, wohin damit. »Worauf wartest du?«, fragte die Bäuerin, die mit dem Most zurückkam.
»Wo ich sie reintun soll.«
Mehr zu sich selbst als zum Bauern oder zu Johanna murmelte die Bäuerin: »Es ist ein Jammer. Sie werden immer dümmer.« Sie nahm einen großen irdenen Topf vom Regal neben dem Herd. Johanna machte sich an die Arbeit.
Ich bleibe sowieso nicht. Ich bleibe nicht. So war es nicht ausgemacht. Ich bleibe nicht.
Daran klammerte sie sich, während sie die fleckigen Bohnen aus den Schoten löste. Der Bauer schnitt Brot und Selchfleisch, trank seinen Most und aß schweigend. Dann ging er.
Die Bäuerin schlug Knödelteig ab.
Eine Uhr tickte. Eine Fliege stieß gegen die Fensterscheibe, surrte durch die Küche, bis die Bäuerin ein Tuch nahm und sie erschlug. In der Nähe schlug eine Glocke an, hoch und schnell. Die Bäuerin warf die Knödel ins aufzischende Wasser. »Bist du noch immer nicht fertig? Hol eine Kanne Wasser.«
Johanna ging mit der hohen braunen Kanne über den Hof. Rolfi bellte wie verrückt. Man musste lange pumpen, bis Wasser kam. Johanna hatte Hunger. Sie war an regelmäßige Mahlzeiten gewöhnt und jetzt hatte sie seit zwei Tagen nicht mehr richtig warm gegessen. Sie ärgerte sich, weil sie eigentlich gar nicht vorgehabt hatte, hier etwas zu essen. Sie wollte nur weg. Aber ihr Magen krampfte vor Hunger.
Der Bohnenkorb war noch immer halb voll.
Auf dem Hof klapperten schnelle Schritte. Eine junge Frau kam herein, ging auf Johanna zu, gab ihr die Hand und begrüßte sie. »Ich bin die Tochter. Maria heiße ich. Du wirst bei mir in der Kammer schlafen. Nach dem Essen zeig ich dir, wo du deine Sachen hintun kannst.«
Kurz darauf kamen drei Buben, der älteste etwa in Johannas Alter. Sie warfen ihre Schultaschen in eine Ecke, setzten sich zum Tisch und klapperten mit den Löffeln gegen die Tischplatte.
Die Bäuerin scheuchte sie hinaus.
»Franz, wasch dir die Hände, die sind kohlschwarz. Josef, hol den Vater, er ist beim Birkenwald unten. Gustl, bring einen Korb Holz.«
Keiner von den dreien beachtete Johanna, die verbissen Bohnen auslöste. Sie war noch lange nicht fertig, als sie sich zum Essen setzten.
»Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen.« Mit dem Amen stieß der Bauer seine Gabel in einen Knödel. Die Bäuerin legte ein großes Stück Selchfleisch auf den Teller des Bauern und kleinere Stücke auf die Teller der Buben. Dann nahm sie sich selbst. Ferdl und Johanna bekamen nur Kraut und Knödel.
Nach dem Essen fuhren Johanna und Maria mit dem Bauern auf die Wiese, das letzte Heu wenden. Maria sah Johanna einige Male von der Seite an, als wollte sie etwas sagen, ließ es aber bleiben.
Der Rechen war schwerer als der Rechen daheim. Johanna spürte, wie die Müdigkeit in ihren Armen wuchs und dass diese Müdigkeit sogar an ihrer Wut zehrte.
Es dämmerte, als sie die letzte Reihe wendeten. Auf dem Heimweg wurde es völlig dunkel. Der Wald raschelte und knisterte. Ein Vogel flog auf, irgendwo im Graben heulte ein Hund, oder vielleicht war es ein Fuchs.
Suppe und Brot standen schon auf dem Tisch. Josef schlief, den Kopf auf die Arme gebettet. Johanna hatte Mühe, den Löffel zum Mund zu führen. Gearbeitet hatte sie immer, aber es hatte zwischendurch Pausen gegeben, die andere Maria, ihre Ziehschwester, hatte mit ihr geredet, sie hatten sich in den Schatten gesetzt. Es war einfach anders gewesen, ganz anders. Dort war sie daheim gewesen. Hier war sie die Dirn.
Maria führte sie in einen kellerartigen Verschlag hinter der Küche, in dem zwei Betten und ein Schrank standen. Der Schrank gehörte Maria. »Du kannst deine Sachen in den Kasten oben auf dem Speicher tun. Ich zeig dir morgen, wo.«
Johanna verhedderte sich beim Ausziehen, war plötzlich in den Ärmeln ihres Kleides gefangen. Fast hätte sie um Hilfe gerufen. Der Strohsack roch modrig. Das grobe Bettzeug kratzte.
Die anderen
Johanna lernte sehr schnell sich zurechtzufinden. Sie merkte sich, wo die Geräte aufbewahrt wurden – nicht so sehr aus Diensteifer, sondern weil sie es vermeiden wollte, jemanden direkt anzureden. In jeder Antwort, besonders in jeder Antwort der Bäuerin, schwang ein Vorwurf mit. Vor allem aber wollte Johanna noch immer nicht glauben, dass sie wirklich bleiben musste. Jeden Abend sagte sie sich: Morgen gehe ich. Morgen sage ich ihnen, dass ich nicht bleibe. So war es nicht ausgemacht. Das war eine Art Nachtgebet.
Sie redete eigentlich nur mit den Kühen, wenn sie sie vor dem Melken striegelte. Die Kühe hielten still, wenn man mit ihnen sprach. Sie lernte ihre Eigenheiten kennen. Es wunderte sie, dass es auch hier eine Bless gab, obwohl doch sonst alles so anders war als unten im Burgenland, und dass auch hier die Bless die Kuh war, bei der man am meisten aufpassen musste, wenn man nicht einen Kuhschwanz ins Gesicht bekommen wollte.
Das Dorf war noch kleiner als das, aus dem sie gekommen war. Es gab nicht einmal einen Laden, nur sieben geduckte Häuser, die mit einem Fenster zur Straße schielten und mit den anderen Fenstern ihre Innenhöfe bewachten, und es gab eine Kapelle aus Backstein mit vier Bänken auf der Frauenseite und vier Bänken auf der Männerseite. In dieser Kapelle wurde zweimal im Jahr Messe gelesen, zum Erntedank und zum Fest des Kirchenpatrons. Im Turm hing eine kleine Glocke, die reihum von den Dorfbewohnern geläutet wurde, in der Früh um sechs, zu Mittag und um sechs Uhr abends. Auf der Eisenkette vor der Kirchentür schaukelten die kleinen Kinder oder sie hockten unter der Kastanie neben der Kapelle, wenn sie miteinander tuschelten oder spielten. Es gab ein Wirtshaus am Ortseingang und an jedem Ende des Dorfes eine Villa. Die eine gehörte einem Oberstaatsanwalt aus Graz, die andere einem Postkartenfabrikanten aus Wien.
Wenn ein Bauer oder eine Bäuerin in die Küche trat, sagte die Bäuerin: »Das ist unsere neue Dirn.« Als ob Johanna keinen Namen hätte.
Ihr war es recht. Sie brauchte keinen Namen für diese Leute.
Am ersten Sonntag stellte sie fest, dass sie die Schuhe von Fräulein Olga nicht mehr anziehen konnte. Sie hatte eine Beule am linken Fuß, die zu eitern begann, und die Schuhe waren ohnehin längst zu klein gewesen. Johanna kam frisch gewaschen, aber barfuß zum Frühstück.
»So kannst du nicht in die Kirche gehen«, sagte die Bäuerin. »Man muss sich ja schämen mit dir. Schäl die Erdäpfel, wasch den Salat und begieß den Braten!«
Johanna war zum ersten Mal allein im Haus. Mehr noch als in Gegenwart der Bäuerin hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Als der Wind die Kammertür zuschlug, zitterte Johanna vor Angst. Es dauerte Minuten, bis sie weiterschälen konnte. Sie war erleichtert, als die Hausleute vom Kirchgang zurückkamen und das Knarren und Ächzen der alten Dielen übertönten.