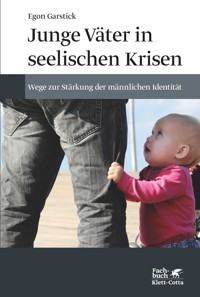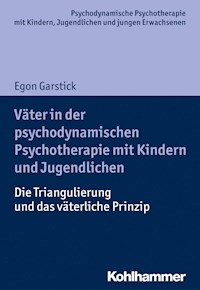33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dem Eltern-Burnout wirksam vorbeugen - Das erste Buch, dass das Phänomen »Schreibaby« aus Sicht eines Kinderarztes und eines Psychotherapeuten beschreibt - Der transdisziplinäre Ansatz als Schlüssel zur erfolgreichen Therapie - Ein besonders niedrigschwelliges Beratungsangebot für hilfesuchende Eltern Immer wieder kommt es zu Überforderungen in der frühen Entwicklung eines Kindes. Etwa 16–20 % aller Neugeborenen sind Schreibabys. Eltern werden durch das übermäßige Schreien und den andauernden Schlafentzug an den Rand ihrer Kapazitäten gebracht. Häufig sind die extremen Erschöpfungszustände der Eltern sowie ihre eigenen, noch unerkannten Vernachlässigungen und traumatischen Erfahrungen aus Kindheit und Jugend eine schwere Hypothek für ihre neue Lebensaufgabe. Für das flexible Auffangen dieser entgleisenden Beziehung braucht es eine engagierte und einfühlsame Zusammenarbeit von Kinderärzt:innen und Psychotherapeut:innen, damit in den frühkindlichen Entwicklungsströmenerfolgreiche und effiziente bio-psycho-soziale Lotsenarbeit möglich wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Egon Garstick/Raffael Guggenheim
Die Schreibaby-Sprechstunde
Eltern und ihre Kinder pädiatrisch-psychologisch begleiten
Mit einem Vorwort von Oskar Jenni
Klett-Cotta
Impressum
Besonderer Hinweis
Die Medizin unterliegt einem fortwährenden Entwicklungsprozess, sodass alle Angaben, insbesondere zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren, immer nur dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung des Buches entsprechen können. Hinsichtlich der angegebenen Empfehlungen zur Therapie und der Auswahl sowie Dosierung von Medikamenten wurde die größtmögliche Sorgfalt beachtet. Gleichwohl werden die Benutzer aufgefordert, die Beipackzettel und Fachinformationen der Hersteller zur Kontrolle heranzuziehen und im Zweifelsfall einen Spezialisten zu konsultieren. Fragliche Unstimmigkeiten sollten bitte im allgemeinen Interesse dem Verlag mitgeteilt werden. Der Benutzer selbst bleibt verantwortlich für jede diagnostische oder therapeutische Applikation, Medikation und Dosierung.
In diesem Buch sind eingetragene Warenzeichen (geschützte Warennamen) nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Die digitalen Zusatzmaterialen haben wir zum Download auf www.klett-cotta.de bereitgestellt. Geben Sie im Suchfeld auf unserer Homepage den folgenden Such-Code ein: OM98094
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von VRD / Adobe Stock
Zeichnungen: Dr. Kerstin Walter
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98094-3
E-Book ISBN 978-3-608-12216-9
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20634-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Einführung und Entstehungsgeschichte
1.1 Unsere Vorerfahrungen und Motivationen
Kapitel 2
Grundlagen für die Eltern-Kind-Arbeit
2.1 Heranreifung unseres Konzepts oder »Unser Reifungsprozess«
2.1.1 Therapeutisches Holding – Winnicott statt Wessel-Kriterien (Winnicott)
2.1.2 Intuitive Kompetenz, Feinfühligkeit und innere Haltung (Ainsworth, Cierpka, Brisch)
2.1.3 Mutter und Vater als Leihcontainer (Bion)
2.1.4 Intersubjektivität und das Bedürfnis nach Resonanz (Stern, Trevarthen, Rosa)
2.1.5 Das Spielbedürfnis als Resonanzerfahrung (Papoušek)
2.1.6 Bumerang und Gespenster im Kinderzimmer (Garstick, Fraiberg)
2.1.7 Therapeutischer Leihcontainer für Eltern als Basis für Triangulierung (Bion, Abelin, Grieser, Garstick)
2.1.8 Das imaginäre und das reale Kind – Der große Bruch! (Soulé, Garstick)
2.1.9 Zusammenfassung und therapeutische Bedeutung
2.2. Entwicklungspädiatrische Reflexion und somatische Ursachen für frühkindliches Schreien und Regulationsstörung
2.2.1 Das physiologisch unreife Nervensystem
2.2.2 Die neuronale Überreizung
2.2.3 Gastroösophagealer Reflux
2.2.4 »Dreimonatskoliken« und Milchunverträglichkeit
2.2.5 Geburtsverletzung als Ursache für vermehrtes Schreien: Claviculafraktur/Schädelhämatome und andere Frakturen
2.2.6 Neuromuskuläre Gründe
2.2.7 Schluckassoziierte Schmerzen
2.2.8 Chirurgische Gründe: Hernien, Invaginationen und Hair-Torniquet-Syndrom
2.2.9 Kardiologische Gründe
2.2.10 Hypersensibilisierte Kinder
2.2.11 Schütteltrauma
2.3 Konzeptuelle Grundlagen zur Regulationsstörung
2.3.1 Ernährung und Verhalten – »Am I a good animal?«
2.3.2 Bedeutung des unstillbaren Schreiens für Bezugspersonen
2.3.3 Fehlende Übergänge und der Begriff des »digitalen« Kindes
Kapitel 3
Die Sensibilität der Eltern – Der Weg vom Paar zur Familie
3.1 Das Elternwerden als Herausforderung für die Paarbeziehung
3.2 Entfremdung und Vereinsamung schon in der Schwangerschaft
Kapitel 4
Die therapeutische Anamneseerhebung
4.1 Der Begriff transdisziplinäre Arbeit
4.2 Gemeinsame Anamneseerhebung durch Arzt und Psychotherapeut – Einblick in die Praxis des transdisziplinären Settings
4.3 Kreatives Oszillieren – Die Umsetzung des Anspruchs auf transdisziplinäre Zusammenarbeit
4.4 Von der empathischen Wahrnehmung zum therapeutischen Holding
4.5 Auswahl bedeutsamer Themen
4.5.1 Paargeschichte und Kinderwunsch
4.5.2. Soziale Situation mit Fokus Migrationshintergrund
4.5.3. Verunsicherung und Stress in der Schwangerschaft
4.5.4 Gesundheitsprobleme der Eltern als Belastungsfaktor
4.5.5 Geburtsverlauf, postpartale Adaptation und Entwicklung der mütterlichen Identität
Kapitel 5
Die Arbeit des Psychotherapeuten
5.1 Ein Kompass für den Aufbau von sicherer Bindung
5.4 Migration und Einsamkeit als Gefahr für die Elternschaft
5.5 Die versteckte, verdrängte Depression der Eltern
Kapitel 6
Die pädiatrisch-therapeutische Untersuchung und der Maßnahmenplan
6.1 Die pädiatrisch-therapeutische Untersuchung
6.2 Die Zusammenfassung der Befunde
6.3 Konkrete medizinische Behandlungspläne
Kapitel 7
Behandlungsplan bei Einschlaf- und Durchschlafstörungen
7.1 Die Haltung der Eltern
7.2 Selbstregulationskompetenz
7.3 Das 24-Stunden-Protokoll
7.4 Schlafregeln und Gestaltung des »Sicheren Orts«
7.5 »Tag rettet die Nacht«-Regel
7.6 Regulation durch »Restaurantzeiten«
7.7 Entlastungsmöglichkeiten und Rettung des elterlichen Schlafes
7.8 Vorgehen bei Energielosigkeit, außerordentlicher psychischer Belastung und Indikation von Kinderschutzmaßnahmen
Kapitel 8
Die Grenzen der Kleinfamilie – Ist eine sichere Bindung in der Kleinfamilie möglich?
8.1 Fürsorgliches Verhalten der Eltern – Identifizierung mit Vorbildern
8.2 Narzissmus, Selbsterleben und Selbstwertgefühl
8.2.1 Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit
8.2.2 Der Wunsch nach Vollkommenheit
8.2.3 Verlorene Ideale oder Ersatz für Verluste
8.3 Der Weg vom Paar zur Familie
8.4 Selbstoptimierung
8.5 Verunsicherte Eltern in der individualisierten Gesellschaft
8.6 Verlorene Heimat und die Suche nach dem sicheren Ort
Kapitel 9
Grundwerte und »Philosophie« unseres Zürcher Modells
9.1 Gesellschaftskritische Überlegungen zu den Grundwerten unserer Schreibaby-Sprechstunde
9.2 Stress durch Beschleunigung und narzisstische Gier
9.3 Bindungsbeziehung – Krippenbetreuung – Schreien gegen den Stress
9.4 Leistungsgesellschaft – Die Anforderungen der modernen Gesellschaft als Angriff auf gesunde Bindungsbeziehungen
9.5 Kritische Bestandsaufnahme der Familienergänzenden Kinderbetreuung
9.6 Abschlussgedanken und Zusammenfassung
Kapitel 10
Ausblick – Was in Not geratene Babys und Eltern im Spital brauchen
Anhang
1 Beratungsstellen für Einschlafprobleme und den Umgang mit sog. »Schreibabys«
2 Das 24-Stundenprotokoll
3 Begriffe aus der Sprechstunde
Techniken
Instrumente
Wichtige Begriffe und Regeln aus der »Information therapy«
Metaphern
Therapeutische Maßnahmen, die wir unterstützen
Therapeutische Maßnahmen, von denen wir abraten
4 Leitfaden für das Anamnesegespräch von Eltern eines Kindes mit »Frühkindlicher Regulationsstörung«
5 Leitfaden für die Untersuchung und Therapie von Familien eines Kindes mit »Frühkindlicher Regulationsstörung«
Literatur
Vorwort
Mit diesem Buch legen Egon Garstick und Raffael Guggenheim ein Werk vor, das für die praktische Arbeit von Fachpersonen im Bereich der Frühen Kindheit sehr hilfreich ist. Die beiden Autoren widmen sich einem Thema, das in seiner Tragweite für betroffene Eltern oft unterschätzt wird, obwohl es viele Väter und Mütter an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit bringt: das Schreien von Säuglingen. Sie haben im Rahmen der Schreibaby-Sprechstunde am Zürcher Stadtspital Triemli ein Konzept entwickelt, das Eltern und Fachpersonen gleichermaßen unterstützt und eine wertvolle Orientierung bietet.
Säuglinge schreien – mal mehr, mal weniger. Schreien ist ihre erste Sprache, mit der sie ihre Bedürfnisse und Empfindungen kommunizieren. Doch was tun, wenn das Schreien exzessiv wird und sich Eltern ratlos fragen, wie sie ihrem Kind helfen können? Häufig wird die Herausforderung eines Schreibabys von Eltern, aber auch von Fachpersonen als isoliertes Problem betrachtet – ein medizinischer Befund hier, ein erzieherischer Rat dort. Das Buch zeigt jedoch, wie untrennbar die körperlichen, psychischen und sozialen Aspekte bei Kindern mit Regulationsstörungen verwoben sind. Mehr noch: Es ist ein Plädoyer für eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die nicht ausschließlich auf die Symptome fokussiert, sondern ebenso die zugrundeliegenden Ursachen erforscht und diese in den Kontext der gesamten Familiendynamik stellt.
Egon Garstick und Raffael Guggenheim greifen dabei auf bewährte Konzepte zurück – wie auf das »Holding« von Kinderarzt Donald Winnicott, die »Feinfühligkeit« der Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth und die »Resonanz« des Soziologen Hartmut Rosa – und erweitern diese mit eigenen Ansätzen. Besonders hervorzuheben ist, wie detailliert die beiden Autoren auf die Dynamiken zwischen Eltern und Kind eingehen und dabei praxisorientierte und alltagsnahe Lösungen aufzeigen. Von konkreten Tipps für die Untersuchung des Säuglings bis hin zu Leitfäden für die Anamnese und die Beratung – dieses Buch ist ein wertvolles Werkzeug für Fachpersonen wie Kinderärztinnen und -ärzte, Psychotherapeutinnen und -therapeuten im Frühbereich, Hebammen sowie Mütter- und Väterberaterinnen.
Das Buch knüpft an die frühen Arbeiten des amerikanischen Kinderarztes T. Berry Brazelton und des Genfer Kinder- und Jugendpsychiaters Bertrand Cramer an. Dabei zeigen Egon Garstick und Raffael Guggenheim in ihrem Buch, wie wichtig die transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pädiatrie und Psychotherapie in der Frühen Kindheit ist, um eine bestmögliche Passung zwischen den Eigenheiten und Bedürfnissen des Kindes und den Erwartungen und Ressourcen der Familien herzustellen. Die Autoren bezeichnen ihren Ansatz als »kreatives Oszillieren«: ein ständiges Pendeln zwischen pädiatrischen und psychotherapeutischen Aspekten, um die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie besser nachzuvollziehen und zu unterstützen. Garstick und Guggenheim betonen, wie zentral es dabei ist, die Perspektiven der jeweils anderen Disziplin nicht nur zu verstehen, sondern auch aktiv in die eigene Arbeit zu integrieren. Diese Haltung des Voneinander-Lernens und der gemeinsamen Reflexion macht das Buch zu einem Vorbild für gelingende interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Dieses Werk greift auch aktuelle gesellschaftliche Themen auf – insbesondere die Rolle der Eltern in der Kinderbetreuung und die damit verbundenen Herausforderungen der familienergänzenden Betreuung. Die beiden Autoren unterstreichen die hohe Bedeutsamkeit einer sicheren Bindung für die langfristige Gesundheit und Entwicklung eines Kindes. Sie weisen darauf hin, dass die ersten Lebensjahre eine einzigartige Phase darstellen, in der Urvertrauen und Bindungssicherheit aufgebaut werden. Diese wichtige Botschaft sollte uns als Gesellschaft wachrütteln und dazu anregen, den Bedürfnissen von Familien mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Ich wünsche diesem Buch eine weite Verbreitung und danke Egon Garstick und Raffael Guggenheim für ihren gelungenen Beitrag zu einem so zentralen Thema der Kindheit. Es ist ein Buch, das die Praxis bereichert, das Verständnis für die Bedürfnisse von Babys und Eltern vertieft und uns daran erinnert, wie entscheidend die ersten Lebensjahre für ein gesundes Aufwachsen sind.
Oskar Jenni, im Januar 2025
Kapitel 1
Einführung und Entstehungsgeschichte
»The Earliest Relationship – Parents, Infants and the Drama of Early Attachment«, so lautet der Originaltitel eines wunderbaren Buches, gemeinsam geschrieben vom nordamerikanischen Kinderarzt Thomas Berry Brazelton und dem Kinder- und Jugendpsychiater Bertrand Cramer aus Genf.1 Im Jahre 1991 gab Klett-Cotta eine deutsche Übersetzung dieses Werkes unter dem Titel »Die frühe Bindung« heraus. Der knappe deutsche Titel wird der differenzierten Aussage im längeren amerikanischen Titel nicht gerecht. Warum? Die beiden Autoren beschreiben sehr genau, wie ein Baby mit seinen angeborenen Reflexen durch entwicklungsfördernde Interaktionen zwischen ihm und seiner menschlichen Umwelt erste frühe Regulationskompetenz erleben kann oder auch nicht. Da passt der Titel »The Drama of Early Attachment« viel besser, weil mit ihm angedeutet wird, dass es tatsächlich dramatisch verlaufende Missverständnisse zwischen Neugeborenen und ihren Eltern geben kann, die in der Folge dann den Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung gefährden.
Der vor dreißig Jahren geleistete gemeinsame Blick vom Kinderarzt Brazelton und dem Psychotherapeuten Cramer auf die Komplexität der frühkindlichen Entwicklung und ihre möglichen Störungen bietet uns auch heute noch ein Grundlagenwissen. Vielleicht klingt es etwas anmaßend, wenn wir schreiben, dass wir das Erbe der zwei großen Wissenschaftler angetreten haben.
In der Kinderklinik des Zürcher Stadtspitals Triemli unter dem damaligen Chefarzt Dr. Ueli Bühlmann konnten wir nämlich den interdisziplinären Diskurs der beiden o. g. Autoren als Basis für eine transdisziplinäre Zusammenarbeit nutzen. Wir haben voneinander gelernt und unser jeweiliges Fachwissen durch das Wissen des Anderen erweitert und ein gemeinsames Vorgehen in der Arbeit mit den Familien entwickeln können.
Wie haben wir dieses Buch gemeinsam geschrieben?
Grundsätzlich haben wir alle Kapitel intensiv miteinander bearbeitet und uns gegenseitig in der finalen Erstellung unterstützt. Kapitel mit spezifisch pädiatrischen Themen, wie z. B. 6.1. Die pädiatrisch-therapeutische Untersuchung, sind von Raffael Guggenheim hauptverantwortlich erstellt worden und Kapitel wie z. B. 5 Die Arbeit des Psychotherapeuten von Egon Garstick.
An manchen Stellen im Text verwenden wir die Ich-Form, weil spezifische Erfahrungen mit Patienten, die einer von uns machen durfte, authentisch beschrieben werden sollen. Damit die Leser sich orientieren können, setzen wir am Anfang eines Kapitels bei der Verwendung der Ichform unsere Initialien RG und EG ein.
1.1 Unsere Vorerfahrungen und Motivationen
Schon als psychoanalytisch ausgebildeter Sozialpädagoge konnte ich – Egon Garstick – Erfahrungen in der sog. angewandten psychoanalytischen Arbeit mit Kindern und ihren Familien in verschiedenen Settings sammeln. Deshalb fiel und fällt es mir wohl leichter, als manch anderen psychotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen, mich auf eine therapeutische Arbeit einzulassen, die vom üblichen Setting in einer psychoanalytischen Praxis abweicht.
Sehr wohl bieten mir die differenzierten entwicklungstheoretischen Modelle der Psychoanalyse über die menschliche Entwicklung eine hervorragende Basis für das Verstehen-Können von gelingender und misslingender bio-psycho-sozialer Entwicklung.
Aber für die flexible therapeutische Arbeit mit Babys, Kleinkindern und ihren Eltern greife ich auf das Erlernte in meiner körperpsychotherapeutischen Weiterbildung, einer psychoanalytisch-systemische Fortbildung und in vielen beziehungsanalytisch orientierten Supervisionen zurück. Last but not least nenne ich die vielen Seminare bei meinem Freund und Kollegen Karl Heinz Brisch im Rahmen seiner bindungsorientierten Psychotherapiefortbildungen, die mir immer wieder sehr geholfen haben, einen kreativen Umgang mit dramatisch gefährdeten Bindungsbeziehungen bei den angetroffenen Schreibabys und ihren Eltern zu entwickeln.
Das oben erwähnte Buch von Brazelton und Cramer war für mich (E. G.) Ende der neunziger Jahre, als ich mich auf die therapeutische Arbeit mit Eltern und Babys zu fokussieren begann, eine wesentliche Orientierungshilfe beim Aufbau von verschiedenen therapeutischen Angeboten für Eltern mit ihren Babys und Kleinkindern. Psychoanalytiker, die mit Eltern und Babys arbeiten wollen, müssen sich in der Zusammenarbeit mit Entwicklungspädiatern, Hebammen und Pflegefachkräften ein genaues Wissen über das noch unreife psychophysiologische System des Säuglings aneignen, wenn sie Eltern helfen wollen, in entwicklungsfördernde Interaktionen mit ihrem Kind zu kommen. Hierzu passt die These von Brazelton und Cramer: »Im Augenblick der Geburt treffen die sensorischen und motorischen Anlagen des Neugeborenen und die intensiven Phantasien der Eltern aufeinander. Beide müssen nun in Übereinstimmung gebracht werden« (Brazelton & Cramer, 1991, S. 107).
Bevor ich als Psychotherapeut mit den Eltern über mögliche Projektionen auf das Kind nachdenke, ihre eventuellen Konflikte bearbeiten will, die sie mit der neuen Lebensphase haben, brauche ich den Austausch mit dem Entwicklungspädiater. Er kann den Eltern und mir die Entwicklungsbedürfnisse des psychophysiologischen Systems erklären und dafür sorgen, dass wir sie mit den Eltern gemeinsam erkennen und versuchen, ihnen gerecht zu werden. Der Kinderarzt Brazelton und der Psychoanalytiker Cramer können mit ihrer interdisziplinären Beschreibung der Herausforderungen, die Eltern und ihre Babys erleben, dazu motivieren, sich auf die Umsetzung und Anwendung solch eines ganzheitlichen Wissens über bio-psycho-soziale Entwicklung einzulassen. Raffael Guggenheim und ich nennen unsere Umsetzung dieses Wissens eine transdisziplinäre Arbeit. Darunter verstehen wir, dass wir uns gegenseitig in unserer Arbeit beeinflussen lassen, voneinander lernen und den Eltern auch die Sichtweise des Kollegen erklären können, wenn er manchmal nicht dabei sein kann, aber die Familie notfallmäßig von einem von uns aufgefangen werden muss. Unser Zürcher Modell dürfen wir als die Fortsetzung und Erweiterung der Arbeit von Brazelton und Cramer bezeichnen, weil wir konkret das wertvolle Wissen der beiden Autoren in gemeinsame, praktische Arbeit umsetzen.
In meiner Weiterbildung zum Kinderarzt hatte ich – Raffael Guggenheim – das große Glück, drei begnadete Lehrmeister gehabt zu haben: Remo Largo, Sepp Holtz und Ueli Bühlmann. Remo Largo ist wohl weit über den deutschsprachigen Raum hinaus einer der bekanntesten Exponenten der Entwicklungspädiatrie und allgemein bekannt durch seine populären Bücher über die kindliche Entwicklung, z. B. »Babyjahre« (Erstveröffentlichung 1993). Im Rahmen meiner Assistenzarztjahre konnte ich am Kinderspital Zürich in unzähligen Fortbildungen von seinem großen Wissen und seiner Erfahrung lernen. Von Sepp Holtz lernte ich die Umsetzung des entwicklungspädiatrischen Wissens in der täglichen Arbeit des Kinderarztes. Er arbeitete in der Abteilung für Entwicklungspädiatrie am Spital und in der eigenen Praxis. Ich durfte im Rahmen seines damaligen Pilotprojekts der pädiatrischen Praxisassistenz über ½ Jahr mit ihm in der Praxis zusammenarbeiten. Während ich von Remo Largo vieles über die die Bedeutung der Variabilität in der Entwicklung von Säuglingen und Kindern erfahren durfte, lernte ich von Sepp Holtz sensibel auf entwicklungsbezogene Themen einzugehen und diese mit den Familien stets mit etwas Humor und der kinderärztlichen »Magie«2 zu bearbeiten. In diesen Jahren war ich auch im regen Austausch mit meinem Onkel, dem Psychologen Prof. Reuven Feuerstein aus Israel, einem Schüler des Genfer Psychologen Jean Piaget, welcher stets dafür einstand, dass auch schwierige Kinder ein großes Potential haben, die Familien aber erst einmal unterstützt und die Kinder richtig gefördert werden müssen. So setzte ich mich immer mehr mit der Welt der Psychologie und Psychotherapie auseinander. Es war schließlich mein großes Glück mit Ueli Bühlmann, einen engagierten psychosomatisch orientierten Chefarzt gehabt zu haben, welcher selbst sein Leben lang in disziplinübergreifender Arbeit engagiert war. So ermöglichte er uns, das gewachsene Interesse an der Behandlung von Familien mit Schreibabys zusammen mit Egon Garstick, welcher damals bereits in der Adoleszentenmedizin engagiert war, zu einem Interventionskonzept für Schreibabys und ihre Familien (TIKSS) aufzubauen. Aus diesem ist die nun bestehende und hier beschriebene Sprechstunde für Regulationsstörungen entstanden.
Bereits im Vorfeld unserer Zusammenarbeit hat sich eine Gruppe von engagierten Pflegefachfrauen in der Kinderklinik des Zürcher Stadtspitals für die Entlastung von erschöpften Eltern eingesetzt. Das Drama der ungewollten Gewalt gegen Babys auf Grund totaler nervlicher Überforderung von Eltern war in der Schweizerischen Öffentlichkeit und in den Medien seit 2000 immer mehr ein Thema geworden und hatte flexible Auffangangebote in den Kinderkliniken entstehen lassen.
Mittlerweile können sich Familien in vielen Mütter- und Väterberatungsstellen und auch in spezifischen Schlafberatungsstellen gute Orientierungshilfen holen, was generell zu einer Abnahme von schweren Verläufen z. B. durch Schütteltrauma geführt hat. Allerdings legen wir bei der Empfehlung und Vermittlung großen Wert darauf, dass diese Fachkräfte eine bindungsorientierte Schlafberatung und kein dressurartiges Schlaftraining anbieten.
Mit Zufriedenheit stellen wir fest, dass sich doch eine große Anzahl von Hilfen für Eltern mit Babys heute auch in der Schweiz in einer breiten Beratungslandschaft finden lässt. (Siehe hierzu den Anhang).
Warum dann noch unsere Arbeit und dieses Buch darüber? Ermutigt dazu wurden und werden wir durch viele im Frühbereich arbeitende Fachkräfte und, last but not least, durch viele Eltern, die unsere ungewöhnliche, transparente, transdisziplinäre Arbeit mit ihnen und ihren Kindern erfahren haben. Sie haben einen Kinderarzt und einen Psychotherapeuten erlebt, die sich gemeinsam und transparent vor ihren Augen und Ohren für sie und ihre Babys engagieren.
Es gelang uns im weiteren Verlauf, ein Konzept zu entwickeln, das einerseits Entlastung für völlig erschöpfte Eltern anbot, andererseits auch uns darauf achten ließ, dass es nicht zu einer Gefährdung des Bindungsaufbaues zwischen Eltern und ihrem Baby kam. Wir ließen uns gemeinsam auf Fortbildungen zum Thema Frühe Beziehungen im Marie Meierhofer Institut (MMI)3 bei Anna von Ditfurth ein, fanden eine gemeinsame Sprache und entwickelten ein gemeinsames Verständnis für die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes, der Eltern und der ganzen Familie. Brazelton und Cramer sprachen vom »Drama of Early Attachment«. Wir kreierten den Begriff »Patient Bindung«! Damit ist gemeint, dass wir unser interdisziplinäres Wissen und eine flexible therapeutische Technik dafür einsetzen, dass Eltern und Babys zueinander finden und eine gesunde bio-psycho-soziale Entwicklung in der frühen Kindheit möglich wird.
Vielen Eltern mit ihren unruhigen Babys in der Schweiz kann aber auch im breit aufgestellten Feld der Mütter- und Väterberatungsstellen, in kinderärztlichen Praxen und durch erfahrene Hebammen geholfen werden. Wir verstehen unsere Sprechstunde als eine erweiterte Beratung, in die die Fachkräfte der primären Anlaufstellen hin überweisen können. In den Präsentationen unseres spezifischen Angebotes weisen wir aber stets darauf hin, was für wertvolle Hilfen gerade im Primären Sektor (also Väter-, Mütterberatung, Hebammen, und Kinderarzt) möglich sind. Andererseits bleibt unsere Sprechstunde ein niederschwelliges Angebot, d. h., Eltern können in ihrer Not von sich aus um einen Termin bitten.
Kapitel 2
Grundlagen für die Eltern-Kind-Arbeit
2.1 Heranreifung unseres Konzepts oder »Unser Reifungsprozess«
Die Erfahrungen mit dem ambulanten und stationären Schreibabyangebot an der Kinderklinik am Stadtspital Triemli (TIKSS)4 bilden die Basis dieses Buchs (→ Kapitel 1), welches aufzeigen möchte, wie eine transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Entwicklungspädiatrie und Psychodynamischer Psychotherapie entstehen und gelebt werden kann. Diese Zusammenarbeit braucht in erster Linie das gegenseitige Zuhören und Eingehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Eltern, Kind und Fachpersonen. Die Orientierung erfolgt durch die Einbindung bereits bewährter Konzepte, auf deren Grundlage das therapeutische Vorgehen basiert. In diesem Kapitel werden wir die Konzepte vorstellen, auf denen unsere praktische Arbeit aufbaut. Es ist aber nicht unser Ziel, sie vertieft vorzustellen, sondern wir beschränken uns auf die zentralen Ideen und zeigen deren Umsetzung im Rahmen dieses »Zürcher Modells« auf. Für eine vertiefte Auseinandersetzung findet der interessierte Leser die Grundlagenliteratur im Anhang.
Beim Planen des Angebotes für Schreibabys wurde aufgrund der offensichtlichen Not der Eltern insbesondere daran gedacht, wie eine schnelle und wirksame Entlastung für überforderte und völlig überreizte Eltern eingerichtet werden kann. Man war auf die somatischen und formalen Aspekte fokussiert und traute sich zu Recht zu, dass das Baby von einer erfahrenen Pflegefachfrau eine oder mehrere Nächte sogar im deregulierten Zustand gut betreut werden kann, während die überlasteten Eltern sich zu Hause erholen sollten. Nicht berücksichtigt wurden in diesem ersten Konzeptentwurf die Frage, ob diese »Entlastung« die Entwicklung der Eltern-Baby-Beziehung auch negativ beeinflussen kann. Man dachte nicht an mögliche Schuldgefühle der Eltern, die das »Allein Lassen« ihres Babys im Spital entstehen lassen können. Es wurde zu wenig überlegt, wie und wer die Mutter oder die Eltern begleitet, wenn das Baby sie am Folgetag wieder anschreit und dies erneut Scham, aber auch Wutgefühle auslöst. Ja, dass schließlich die gutgemeinte »Entlastung« zu einer noch größeren psychischen »Belastung« werden könnte. Die gemeinsame intensive interdisziplinäre Arbeit ergab dann ein Konzept, in welchem der bio-psycho-soziale Grundgedanke von allen mitgetragen werden konnte. Dabei wurden die somatischen und psychosozialen Themen, mit welchen sich Eltern und Fachleute in der Betreuung von Schreibabys auseinandersetzen, von Anfang an in die Behandlung integriert. Als Grundlage für das Verständnis unseres »Zürcher Modells« ist es daher unumgänglich, für uns essentielle Begriffe und Erkenntnisse der heute anerkannten Eltern-Baby-Therapie-Modelle zu kennen, welche wir als Basis für unsere Sprechstundenarbeit benutzen. Einige davon haben wir erweitert oder auch neu entwickelt. Wir werden in diesem Kapitel nun einige bedeutsame Konzepte und Begriffe anerkannter Spezialisten des Frühbereichs kurz vorstellen:
2.1.1. Therapeutisches Holding – Winnicott statt Wessel-Kriterien – Winnicott
2.1.2. Intuitive Kompetenz, Feinfühligkeit und innere Haltung – Ainsworth, Cierpka, Brisch
2.1.3. Mutter und Vater als Leihcontainer – Bion
2.1.4. Intersubjektivität und das Bedürfnis nach Resonanz – Stern, Trevarthen, Rosa
2.1.5. Spielbedürfnis als Resonanzerfahrung – Papoušek
2.1.6. Bumerang und Gespenster im Kinderzimmer – Garstick, Fraiberg
2.1.7. Therapeutischer Leihcontainer – Bion, Grieser
2.1.8. »Imaginäres Kind« und realer neugeborener Säugling – Der große Bruch – Soulé, Garstick
2.1.9. Zusammenfassung und therapeutische Bedeutung
2.1.1 Therapeutisches Holding – Winnicott statt Wessel-Kriterien (Winnicott)
Sowohl in der pädiatrischen Literatur als auch in der Laienpresse wird häufig zur Definition eines möglichen Schreibabys auf die Wessel-Kriterien verwiesen: Der nordamerikanische Kinderarzt Morris Wessel beschrieb 1954 diese Babys – aufgrund von elterlich geführten Schreiprotokollen – als Säuglinge, welche über einen Zeitraum von drei Wochen, jeweils mindestens an drei Tagen pro Woche mehr als drei Stunden pro Tag unstillbar und ohne erkenntlichen Grund schreien. (Wessel et al., 1954) Auf der Basis dieser formal-statistisch richtigen Feststellung beschrieb er dann die sogenannte »Dreier Regel«: Ein Baby, welches diese nicht erfüllt, ist folglich auch kein Schreibaby. Da hier nur die eigentliche Schreidauer beobachtet und beschrieben wird, führt diese Definition zu einer gefährlichen Vereinfachung: Es wird ganz außer Acht gelassen, was jegliches Schreien mit Eltern, Bezugspersonen und insbesondere dem Baby macht. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Leidensdruck der Eltern nicht erkannt oder nicht ernst genommen wird, wenn das Baby nach Auswertung eines Schreiprotokolls die Dreier Regel nicht erfüllt. Die Eltern selbst werden verunsichert und fühlen sich häufig im Stich gelassen, weil ihnen mehr oder weniger klar gesagt wird, dass sie gar kein Schreibaby hätten und sie daher auch keine besondere Hilfe benötigen. Das Schreien sei »im Rahmen der normalen Anpassung« (auch 3-Monats-Koliken genannt) und würde innerhalb weniger Wochen von selbst verschwinden. Somit werden die Eltern als nicht leidend oder »nicht leiden dürfend« angesehen.
Die heutige Kleinkindforschung geht aber stets davon aus, dass jegliches Schreien auch ohne Vorbelastung zu einer Überforderung der Eltern führen kann. Dies im Sinne einer Reizüberflutung der Eltern, vergleichbar mit der bekannten Reizüberflutung des Kinds. Die Belastungsgrenze ist aber für alle Eltern unterschiedlich: Für einige Eltern kann also bereits kurzzeitiges Weinen oder Unzufriedenheit des Kinds eine große Belastung darstellen, während andere sogar längere Schreiphasen ohne Probleme aushalten können.
Der erste wichtige Schritt in einem bio-psycho-sozialen Konzept ist: Die Eltern rausholen aus diesem Gefühl des Alleingelassen-Seins in ihrer chronischen Überreizung.
Sie brauchen die Erfahrung des Gehaltenwerden für das Wiedererlangen der fürsorglichen Elternrolle. Wir nennen es ein »Therapeutisches Holding« in Anlehnung an die von Winnicott beschriebene Funktion des Gehaltenwerdens (»Holding«) in der Mutter-Kind Beziehung, die der Säugling für seine Entwicklung braucht. (Winnicott, 1976).
Es ist dieses Momentum des Gehaltenwerdens, des Verstandenseins, des Mitfühlens, welches die Familien länger nicht mehr erleben durften. Unter anderem, weil sie aufgrund falsch verwendeter und/oder verstandener Definitionen, verzerrter Wahrnehmung, schlichter Ignoranz der Situation, oftmals aber auch aus Hilflosigkeit des Helfersystems, in ihrer Not nicht mehr wahrgenommen wurden. Wie ein solches therapeutisches Holding in der Praxis aussieht, werden wir in der Vorstellung des klinischen Vorgehens noch näher beschreiben. Wesentliche Voraussetzungen dafür sind die Feinfühligkeit des Therapeutenteams, damit die verschiedenen Bedürfnisse aller Beteiligter erfasst werden, und die Fähigkeit, auch emotional starke, heftige Gefühle »auszuhalten«.
2.1.2 Intuitive Kompetenz, Feinfühligkeit und innere Haltung (Ainsworth, Cierpka, Brisch)
In der modernen, u. a. von Piaget entwickelten Entwicklungspsychologie wird davon ausgegangen, dass ein gesunder Säugling fähig ist, seine soziale Umwelt wahrzunehmen, auf sie zu reagieren und sog. lesbare Signale zu senden. (Piaget & Inhelder, 1993) Dies ganz im Gegensatz zu diversen sehr etablierten Theorien Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts. Psychisch gesunde Eltern können in der Regel auf intuitive Kompetenzen für den Umgang mit ihren Kindern zurückgreifen, und so kommt es für beide Seiten zu befriedigenden Interaktionen. Zu diesen Kompetenzen gehört die Feinfühligkeit der Eltern, die Gefühle ihres Säuglings wahrzunehmen und adäquat zu beantworten. Dazu schreibt die Entwicklungsforscherin Marisa Benz:
Feinfühligkeit und intuitive Kompetenz
»Intuitive Kompetenz ist die angeborene, universell gültige Verhaltensbereitschaft von Menschen, Bedürfnislagen eines Säuglings zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. Diese intuitiven Kompetenzen versetzen Eltern in die Lage, den individuellen Eigenheiten ihres Kindes gerecht zu werden. Jedoch unterscheiden sich Erwachsene im Ausmaß ihrer Feinfühligkeit. Feinfühligkeit bedeutet, die Signale eines Kindes wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und entwicklungs- und situationsangemessen sowie prompt darauf zu reagieren (Ainsworth, 1977). Dies zeigt sich in alltäglichen Interaktionen, beispielweise wenn Eltern, durch Signale ihres Kindes geleitet, ihr Baby beruhigen, wenn es noch nicht in der Lage ist, sich selbst zu beruhigen, oder dessen Bedürfnisse nach Nähe und Rückversicherung feinfühlig erkennen und beantworten. Auf diese Weise kompensieren Eltern, was das Kind noch nicht allein schafft. Das Kind lernt, dass es sich auf die Unterstützung seiner Eltern verlassen kann und was mögliche Antworten auf innere Zustände sein können. Ein hohes Maß an Feinfühligkeit vonseiten der Bezugsperson führt zu emotionaler Sicherheit des Kindes.« (Benz & Scholtes, 2015, S. 4 ff).
Aufgrund dieser Feinfühligkeit können Eltern in der Regel also ihr Baby in einem Reizzustand durch einfühlsame Erklärungen und Handlungen beruhigen. Das Baby erfährt und entwickelt immer mehr die Gewissheit, dass richtig verstanden wird, wonach und warum es schreit. Es ist uns wichtig zu betonen, dass nicht die absolut entscheidende Ursache – die bei essentiellem Schreien häufig nicht offensichtlich ist – für das Schreien erkannt werden muss, sondern dass die Bezugsperson über eine innere Sicherheit verfügen sollte, die darin besteht, dass sie sich sicher ist, ihr Kind beruhigen zu können. Wir nennen es: Die innere Selbstsicherheit! (s. a. Metapher des Leuchtturms, erklärt im Anhang).
Sie muss wiedererweckt werden, was in der Regel bei nicht stärker psychisch vorbelasteten Eltern im niederschwelligen Setting möglich ist. Sie ist der grundlegende Baustein zum Wiederaufbau der intuitiven Kompetenzen, wenn diese durch verschiedene Verunsicherungen im Verlauf des Elternwerdens verloren gegangen sind.
Eltern mit innerer Selbstsicherheit greifen auf die o. g., angeborene, intuitive Kompetenz zurück, die sie feinfühlig auf das gestresste Kind eingehen lässt und es beruhigt. Die Anwendung der Feinfühligkeit führt dann zur Regulationskompetenz und lässt eine sichere Bindungsbeziehung wachsen. Dies wird vom Experten für bindungsbasierte Therapie Karl Heinz Brisch wie folgt erklärt:
»Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Eltern zur Kenntnis nehmen, dass der Säugling im ersten Lebensjahr noch kaum in der Lage ist, Stress selber zu regulieren, sondern diese Fähigkeit zur Selbstregulation stressvoller Erfahrungen erst durch das Erleben der Co-Regulation durch feinfühlige Bindungspersonen entwickelt. Da die Bindungsperson in der Regel auch noch über die Art der stressvollen Erfahrung spricht, den Stress mit Worten benennt, also zum Beispiel sagt: »Oh je, bist du so aufgeregt, hast du dich so erschreckt!«, oder: »Meine Güte, bist du so hungrig!«, »Hast du solche Angst, alleine zu sein?«, lernt der Säugling zusätzlich die richtigen Worte für seinen jeweiligen Stress.« (Brisch, 2014, S. 49)
2.1.3 Mutter und Vater als Leihcontainer (Bion)
Agathe Israel, eine psychoanalytische Kinderpsychotherapeutin aus Berlin, verbindet in diesem Zusammenhang Bions Beschreibung der sog. Container-contained-Beziehung mit Winnicotts Beschreibung der absoluten Abhängigkeit des Babys vom Gehalten-Werden durch die primäre Bezugsperson. Sie formuliert dies so: »Ein Baby ist, um überleben zu können, völlig auf aufmerksame Erwachsene angewiesen. Diese sorgen für Beruhigung, Sättigung, Wärme- und Reizregulierung, Pflege und psychische Resonanz. Winnicott fasst diese Aufgaben als »holding-function« zusammen und postuliert, dass es keinen Säugling ohne seine Mutter gibt, so wie es keine Mutter ohne Säugling gibt« (Israel, 2007, S. 21).
Mutter und Vater stellen sich, wenn es gut geht, als sog. Leihcontainer zur Verfügung. Sie nehmen die in der Mimik und im Weinen sicht- und hörbaren Aufregungen des Babys auf. Sie versuchen die Reize aus dem Körperinneren und diejenigen, die von außen auf das Baby einwirken und es erschüttern können, aufzufangen. Unbekannte und ungewohnte Sensationen wie Darmbewegungen oder verstärktes Aufstoßen, Schmerzen oder Hungerattacken lösen im Säugling Verunsicherung und existentielle Ängste aus. Er kann sich noch nicht allein beruhigen. Seine mögliche »Vernichtungsangst« muss von der Bezugsperson zunächst emotional verstanden und dann gewichtet werden. Eltern dürfen aber nicht wie das Kind von dem emotionalen Stress überwältigt werden.
Im Leihcontainer versucht das Baby, die unerträglichen affektiven Zustände, auch Emotionen genannt, loszuwerden. Aber im eigentlichen Container, also im psychischen und körperlichen Erleben der Mutter oder des Vaters, braucht es dann die Fähigkeit, die Aufregung in mitfühlende, auch beruhigende Worte zu fassen, die von passender fürsorglicher Behandlung begleitet werden. Zum Beispiel kann nach der Fütterung (oder nach dem Stillen) ein unangenehmer innerer Reiz durch die anstrengende Verdauungsarbeit entstehen, den das Baby noch nicht selber ein- oder zuordnen kann. Da braucht es dieses Auffangen der Angst oder des Ärgers und die empathische Antwort durch den Erwachsenen, der zusätzlich nach konkreten Handlungen sucht, wie dem Kind geholfen werden kann, den Reiz besser zu verkraften. Vielleicht durch eine leichte Massage oder durch Lageveränderungen. Hierbei ist aber wichtig, dass Mutter und Vater angstfrei, selbstbewusst und auf ruhige Art diese Beruhigung versuchen und nicht – durch die eigene Verunsicherung ausgelöst – in ein hektisches Suchen nach Lösungen verfallen.
Zusammengefasst: Das Baby braucht eine menschliche Umwelt, in dem es das Holding (Winnicott) und die Feinfühligkeit (Ainsworth) erlebt, seine Reaktionen gut gelesen und aufgenommen werden (Cierpka) und Menschen zu Verfügung stehen, die die wichtigen Rollen der Leihcontainer (Bion, Israel) und der Co-Regulatoren (Brisch) übernehmen.
Das Fazit für alle Fachkräfte im Frühbereich lautet: Bevor wir von mangelnder Selbstregulationskompetenz des Säuglings sprechen, müssen wir uns fragen: War und ist ein menschliches Umfeld vorhanden, das dem Säugling hilft, die Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit zu bewältigen? Ein Säugling kann nur gemeinsam mit den Eltern im Sinne einer Co-Regulation die Selbstregulation aufbauen. Diese Co-Regulation vollzieht sich im Alltag beim Beruhigen, Schlafen legen, Füttern, Spielen usw. Voraussetzung für die gemeinsame Regulation ist ein Gelingen der vorsprachlichen (präverbalen) Kommunikation. Die Abhängigkeit der kindlichen Selbstregulationskompetenz von einer guten Co-Regulation in der Umwelt kann gar nicht genug beachtet werden, weil uns immer wieder Eltern begegnen, die in ihrer Frustration unreflektiert dem Baby die Schuld für das Scheitern in dieser Entwicklungsaufgabe zuweisen. Auch manche Fachkräfte im Frühbereich denken nicht genug daran, dass ihre gut gemeinte Aufklärung über die »Regulationsstörung des Babys« von den Eltern missverstanden werden können und dann einer beziehungsorientierten Lösung im Wege stehen.
Fallbeispiel Roberto