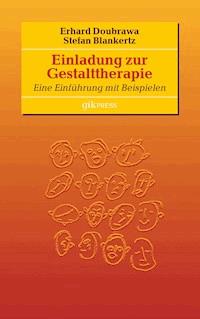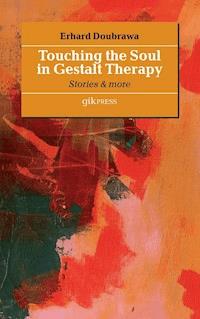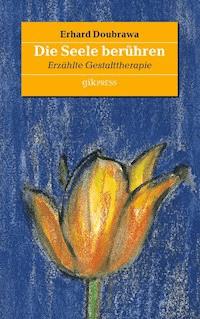
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erhard Doubrawa arbeitet seit vielen Jahren als Gestalttherapeut. Er ist Gründer und Leiter der Gestalt-Institute Köln und Kassel (GIK), wo er auch als Ausbilder tätig ist. In diesem Buch versammelt der Autor Geschichten, die er vielfach in seiner Arbeit erzählt hat - einzelnen Klientinnen und Klienten, in Workshops und Gruppen. Sie haben schon oft dazu beigetragen, dass Menschen sich wieder öffnen und so von anderen seelisch berühren lassen konnten. Ein Klassiker der Gestalttherapie in einer erheblich erweiterten Neuauflage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto Horstter Haar
Erhard Doubrawa, 1955, arbeitet seit vielen Jahren als Gestalttherapeut. Er ist Gründer und Leiter der »Gestalt-Institute Köln und Kassel (GIK)«, wo er auch als Ausbilder tätig ist (www.gestalt.de). Private Praxen in Köln und Kassel. Außerdem gibt er die Gestalttherapie-Zeitschrift »Gestaltkritik« heraus (www.gestaltkritik.de). Er ediert die Reihe gikPRESS zur Theorie und Praxis der Gestalttherapie (www.gikpress.de).
Eigene Buchveröffentlichungen u. a.: (gemeinsam mit Stefan Blankertz) »Einladung zur Gestalttherapie. Eine Einführung mit Beispielen« und »Lexikon der Gestalttherapie«.
therapeutenadressen service
Praxisadressen von Gestalttherapeutinnen u. -therapeuten. Infos siehe letzte Buchseite
INHALT
Leserstimmen
Weinen angesichts von Schönheit
Heilung und Erzählen – einleitende Gedanken
Was ist Gestalttherapie?
Die Arbeit der Klienten
Auch ich war einst Klient
Die Seele berühren
Zwei Paare
Aller lei zwischen Himmel und Erde
Die Mokassins meines Vaters
Die Arbeit der Therapeuten
Mein Erleben: Quelle meiner Arbeit
Der männliche Therapeut
Den Klienten schützen
Den Therapeuten schützen
Den richtigen Therapeuten finden
Autobiographische Skizzen
Wie ich Gestalt annahm
Spiritualität
Politische Gestalttherapie
Die Gestalt wird deutlich
Bonus Tracks
Sich berühren lassen
Vom Schutzschirm der Schüchternheit
Von Klienten-Therapeuten und Therapeuten-Klienten
Gestalttherapie und Achtsamkeit
Literaturempfehlungen
Dem Andenken an meinen Vater, in Dankbarkeit.
LESERSTIMMEN
»Nachdem ich angefangen hatte zu lesen, konnte ich nicht mehr aufhören. Du erklärst mir Gestalttherapie ›mit Fleisch und Blut‹, nicht nur als Skelett. Und so, dass ich sie verstehe.«
Herbert Greif, Nideggen
»Ich konnte schon während des Lesens spüren, wie die harte Kruste des ›diagnostisch-psychoanalytischen touches‹ in meiner Arbeit sich aufzulösen begann und ich wieder offen und unbefangen (mit Lachen und Weinen) auf meine Patienten zugehen kann.«
Elke Geser-Schellkopf, Gestalttherapeutin, Bayreuth
»Lieber Erhard, hab’ Dank für Dein wunderbares neues Buch. Es hat mich wahrhaftig tief erreicht. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen.«
Carina Gadebusch, Gestalttherapeutin, Remscheid
»Ich glaube, besser und verständlicher für den, der es nicht so mit den Fachbegriffen hat oder sich in der Materie besonders gut auskennt, kann man Gestalttherapie nicht mehr erklären.«
Gabriele Önal, Tübingen
»Die Erzählung von Deinem Vater hat auch mich wieder ermutigt, meine Mutter nochmal anders zu sehen oder ihr anders zu begegnen.«
Martina Feldmayer-Ott, Gestalttherapeutin, Köln
»Offenheit, Ehrlichkeit, Wärme, Zärtlichkeit, Freude und Tränen sind nur einige Begriffe, die mir zu diesem Buch spontan einfallen. Herr Doubrawa hat mit seinen Geschichten auch meine Seele berührt und mir das Herz geöffnet. Dieses Buch ist sowohl für Therapeuten als auch für Klienten eine große Hilfe.«
Karin Soukup,
Mal- und Gestaltungstherapeutin, Bad Ischl
»Dieses Buch berührte meine Seele und ich fühlte mich angesprochen und verstanden. Was da zu lesen steht, ist pure persönliche Erfahrung und teils von einer für mich verblüffenden Offenheit.«
Franziska Benz, Gestalttherapeutin, Oberkirch
WEINEN ANGESICHTS VON SCHÖNHEIT
Vor einigen Jahren haben meine Frau und ich unseren amerikanischen Kollegen John Reis und seine Frau Linda besucht. Zusammen mit ihren beiden Kindern, einer fünfjährigen Tochter und einem achtjährigen Sohn, saßen wir an jenem Sonntagvormittag beim Frühstück und redeten dies und das. Gemeinsam genossen wir den wunderbaren Ausblick aus ihrem Wohnzimmerfenster über die pazifische Küstenlinie nördlich von San Diego. Leichtigkeit prägte dieses Gespräch, besonders aufgrund der Unkompliziertheit und Herzlichkeit unserer Gastgeber.
Schließlich erzählte Linda, dass sie in der letzten Woche mit ihrer Tochter zum ersten Mal in der Oper gewesen sei. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher. Doch was ich erinnere, hat mich schon damals berührt – und es berührt mich immer wieder, wenn ich daran denke.
Linda liebt Musik und liebt die Oper. Sie wartete geduldig, bis ihre Tochter fünf Jahre alt wurde. Erst dann nahm sie sie mit zu einer Aufführung. Sie stellte sich vor, dass sie sich nun nicht mehr so arg langweilen oder unruhig werden würde. Was jedoch geschah, hatte sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt.
Ihre Tochter saß fast zweieinhalb Stunden ganz ruhig neben ihr und lauschte aufmerksam. Gebannt folgte sie dem Geschehen auf der Bühne. Danach sagte sie zu ihrer Mutter, während sie einige Tränen mit ihren Handrücken aus den Augen wischte und über ihr Gesicht verteilte:
»Mom, ich verstehe das nicht. Es war sooo schön, und ich habe trotzdem weinen müssen.«
Linda schloss ihr Töchterchen in die Arme und erklärte: »Das ist kein trauriges Weinen. Manchmal muss man auch weinen, wenn man etwas sehr, sehr Schönes erlebt, weil es einen so tief berührt hat.«
Das ist eine schöne und verständliche Erklärung von »Berührtsein«. Und vor allem eine, die mich selbst berührt hat.
HEILUNG DURCH ERZÄHLEN – EINFÜHRENDE GEDANKEN
Man bat einen Rabbi, dessen Großvater ein Schüler des Baalschem gewesen war, eine Geschichte zu erzählen. »Eine Geschichte«, sagte er, »soll man so erzählen, dass sie selber Hilfe sei.« Und er erzählte: »Mein Großvater war lahm. Einmal bat man ihn, eine Geschichte von seinem Lehrer zu erzählen. Da erzählte er, wie der heilige Baalschem beim Beten zu hüpfen und zu tanzen pflegte. Mein Großvater stand und erzählte, und die Erzählung riss ihn so hin, dass er hüpfend und tanzend zeigen musste, wie der Meister es gemacht hatte. Von der Stunde an war er geheilt. So soll man Geschichten erzählen.«
Martin Buber
In diesem Buch geht es mir darum, Gestalttherapie auf eine Weise vorzustellen, dass sie für Sie, liebe Leserinnen und Leser, erfahrbar wird. Am besten trifft das, was ich damit meine, die einleitend zitierte Anekdote, die ich bei Martin Buber im Vorspann zu seinen »Erzählungen der Chassidim « gefunden habe.
Ich habe sie zum ersten Mal gelesen, als ich Student der katholischen Theologie war. Damals beschäftigten wir uns mit der Frage, wie Glaubenserfahrungen zu vermitteln sind. Wir entdeckten, dass dies nur »narrativ« geschehen kann – erzählend also.
Ich freue mich, dass ich jetzt wieder an eine ähnliche Stelle komme. Heute frage ich mich, wie gestalttherapeutische Erfahrungen weitervermittelt werden können. Wieder entdecke ich, dass dies eigentlich nur erzählend möglich ist. So möchte ich nun damit beginnen, von meinen gestalttherapeutischen Erfahrungen zu erzählen: von meinen Erfahrungen als Klient, von meinen Erfahrungen in der gestalttherapeutischen Ausbildung, vor allem aber von meinen Erfahrungen, die ich als Gestalttherapeut und später als Lehrer der Gestalttherapie machen durfte.
Das Ziel der Gestalttherapie fasse ich gern als »sich wieder öffnen« zusammen: Wir mussten uns nämlich allzu oft verschließen. Aus Schutz und um zu überleben, haben wir uns abgeschirmt mit einer glatten, undurchsichtigen Oberfläche. Derart sind eingekapselte »Entzündungen« entstanden, Reste von früheren Verlusten und Verletzungen.
Gestalttherapie lädt uns ein, uns behutsam wieder zu öffnen, damit das, was der Heilung bedarf, an die Oberfläche treten und endlich abgeschlossen werden kann. Auf diese Weise können wir uns wieder für das Zwischenmenschliche öffnen, für den anderen, für das Du. Und so können schließlich wieder Begegnungen und Berührungen geschehen und Beziehungen und Bindungen eingegangen werden.
Lassen Sie sich also von mir mitnehmen, wenn ich »meine« Geschichten erzähle, Geschichten, die die Seele berühren:
Geschichten von Klienten, die zuerst einmal meine Seele, die Seele des Therapeuten, berührt haben.
Geschichten von Klienten, die sich in der therapeutischen Arbeit geöffnet haben und sich von mir, dem Therapeuten, seelisch berühren ließen.
Geschichten schließlich, die hoffentlich auch Sie in Ihrer Seele berühren werden, denn das ist die beste Voraussetzung, damit Heilung geschehen kann.
Es sind Geschichten, die ich vielfach in der therapeutischen Praxis erzählt habe – einzelnen Klienten, in Therapiegruppen und auch bei Ausbildungen. Sie haben schon oft dazu beigetragen, dass Menschen die Verhärtungen ihrer Seele überwanden und sich für andere wieder erreichbar machten.
Lassen Sie beim Lesen Ihrer Seele freien Lauf. Nur sie kennt den Weg. Vertrauen Sie ihr. Und (bitte!) versuchen Sie nicht, gleich »alles« verstehen zu wollen. Der erste Schritt ist nämlich immer die Erfahrung. Verstehen ist erst ein zweiter, auf seine Weise genauso wichtiger, aber eben erst der folgende Schritt.
Den Ort, den ich mit meinen Geschichten erreichen möchte, ist Ihre Seele. Lauschen Sie, gehen Sie mit, fühlen Sie mit, geben Sie sich Raum. Verstandesmäßig nachvollziehen können Sie Ihre Erfahrungen dann gut in einem nächsten Schritt. Zwischendurch gibt es zwar immer wieder mal etwas Erklärendes, werde ich Gedanken »aus meinem Zettelkasten« einfügen, aber vor allem möchte ich versuchen, Ihnen beim Lesen erfahrbar zu machen, wie Gestalttherapie »funktioniert«.
Ihnen wird sicher auffallen, dass in diesem Buch häufig davon die Rede ist, dass die Klienten weinen, dass den Gruppenteilnehmern Tränen in den Augen stehen und dass es mir als Therapeuten genauso geht.
Muss Gestalttherapie also unbedingt mit Weinen zu tun haben? Muss nicht. Hat aber häufig. Das hängt damit zusammen, dass Weinen einfach geschieht, wenn wir die Starre verlassen und wieder in Bewegung und in Fluss kommen.
Weinen gehört erfahrungsgemäß dazu, wenn wir »existentielle Augenblicke« erleben – Begegnungen stattfinden, die erfüllt sind vom Licht dessen, was der jüdische Religionsphilosoph (und indirekt ein wichtiger geistiger Vater der Gestalttherapie) Martin Buber, »Ich-Du-Momente« genannt hat, Momente der Begegnung, in denen wir uns in unserem Wesen angesprochen und gemeint wissen.
Der Begriff »existentieller Augenblick« stammt von dem amerikanischen Psychotherapeuten Len Bergantino. Er bezeichnet damit diesen lebensstiftenden Moment, der echtes Leben, nicht einfach nur »Überleben« bedeutet. Bergantino beschreibt den »existentiellen Augenblick« als eine Begegnung von Wesen zu Wesen, als zeitweise Überwindung der Rollen, als heilende Berührung, die tiefe Gefühle auslöst – und zwar sowohl beim Klienten, als auch beim Therapeuten. Häufig ist das mit Tränen verbunden und nicht selten übrigens auch mit einer gleichsam existentiellen Scham, die zeigt, wie nah wir unserem Wesen sind, unserer Mitte, unserer Seele.
Len Bergantino weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diesen »existentiellen Augenblicken « eine spirituelle Dimension eigen ist. Der humanistische Psychologe Abraham H. Maslow stellte ähnliches fest, als er sich mit seelisch »besonders gesunden« Menschen beschäftigte. Diese Menschen, die sich oft gar nicht als religiös verstanden, wussten um die Erfahrung spiritueller Momente der Aufhebung des Getrenntseins: Gipfelerlebnisse – Momente der Verbundenheit, des Dazugehörens. Momente des Heilseins, des Ganzseins (Abraham H. Maslow, Jeder Mensch ist ein Mystiker, hrsg. von Erhard Doubrawa, Wuppertal 2014).
In allen geschilderten Fällen wurden die Namen und biographischen Informationen zum Schutz der Klienten verändert. Meine Therapeuten und Lehrer, meine Kollegen und Freunde, die ich in Dankbarkeit erwähne, haben natürlich ihre richtigen Namen behalten.
Wegen der leichteren Schreib- und Lesbarkeit verwende ich in diesem Buch die grammatikalisch männliche Form gleichermaßen für Männer und Frauen.
WAS IST GESTALTTHERAPIE?
Gestalttherapie, oder einfach nur »Gestalt«, ist eine Lebenseinstellung, die praktische Konsequenzen hat. Es geht um dich und mich und um unsere Erfahrung hier und jetzt. Gestalt versucht, angepasste Menschen, die in ihrem Joch nicht zufrieden sind, wieder auf eigene, freie Füße zu stellen.
Bruno Paul de Roeck
Begriff
Gestalttherapie trägt ihren Namen nach der Gestaltpsychologie, die sich damit beschäftigt, wie wir beim Wahrnehmen die Wirklichkeit herstellen. Die Gestaltpsychologie geht von dem ganzheitlichen Ansatz aus, dass wir Wahrgenommenes auf eine für uns sinnvolle Weise organisieren und strukturieren. Die Gestalttherapie beschäftigt sich mit Problemen der Wahrnehmung, ihr geht es um die Wahrnehmungsfähigkeit und deren Verbesserung. Probleme der Wahrnehmung können beispielsweise auftreten, wenn das aktuell Wahrzunehmende von vorher gemachten Erfahrungen überlagert wird. Dann wird nämlich nicht mehr wahrgenommen, was da ist, sondern eher, was wir hoffen oder was wir befürchten. Das in der Vergangenheit Erfahrene oder das »Gelernte« wird auf das Gegenwärtige projiziert.
Zwei einfache Beispiele für solche Projektionen:
Jemand hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit einem Vorgesetzten gemacht und ist jetzt wieder mit einem Vorgesetzten konfrontiert. Er wird nun alle Befürchtungen gegenüber Vorgesetzten bestätigt finden.
Jemand hat einmal schlechte Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht. Ihm wird es dann schwerfallen, die Besonderheit eines neuen Menschen, dem er gerade begegnet, im Blick zu behalten. Die Gefahr besteht, dass er überflutet wird von all den aus der vergangenen Erfahrung stammenden Befürchtungen.
Geschichte
Die ersten Ansätze, die später in die Gestalttherapie eingeflossen sind, wurden in den 1930er und 1940er Jahren von zwei deutschen Psychoanalytikern während des Nationalsozialismus im südafrikanischen Exil entwickelt: Lore und Fritz Perls. Sie haben den »sicheren« Platz der Psychoanalytiker hinter der Couch aufgegeben und sich vor den Klienten gesetzt. Damit symbolisierten sie, dass sie die Macht über den Klienten (die der Therapeut in der Psychoanalyse durch den nicht hinterfragbaren Deutungsanspruch erhält) ablehnten und den Klienten als Gleichberechtigten begegnen wollten. Ende der 1940er Jahre siedelten sie sich in New York an, wo sie dem amerikanischen Schriftsteller und politischen Aktivisten Paul Goodman begegneten. Gemeinsam mit ihm bauten sie ihren Ansatz weiter aus und gaben ihm den Namen »Gestalttherapie«.
Bekannt wurde die Gestalttherapie Ende der 1960er Jahre – bedingt durch ihre Nähe zur »Human-Potential-Bewegung«, der psychologisch-spirituell-politischen Aufbruchbewegung junger Amerikaner in jener Zeit. Fritz Perls lebte und lehrte im Zentrum dieser Bewegung: in Esalen/Big Sur an der phantastischen kalifornischen Westküste, etwa 200 km südlich von San Francisco.
Therapie
Gestalttherapie heilt durch Würdigung: Der Klient kommt zur Therapeutin, weil er mit einem Lebensproblem meint, nicht mehr allein fertig werden zu können. Vorsichtig lässt ihn die Therapeutin erleben, dass er selbst in Wirklichkeit über außerordentliche Kräfte verfügt, die ihm das Überleben ermöglichen. Durch die Würdigung dieser Kräfte kommt der Klient in Kontakt mit seiner Fähigkeit, Lösungen seines Problems für sich zu finden. Dieser Kontakt macht es ihm möglich, sich selbst, seine Mitmenschen und seine Umgebung so wahrzunehmen, dass er die Unterstützung spürt, die er daraus ziehen kann. Häufig sind die heutigen Probleme das Ergebnis von früheren Problemlösungsversuchen. Sie waren damals sinnvoll. Doch heute schränken sie eher ein. Das ist wie mit Kinderschuhen. Vor einem Jahr passten sie wie angegossen. Heute sind sie viel zu klein.
»Würdigung« heißt also, die Kraft zu spüren – eben: zu würdigen –, die in genau dem Verhalten liegt, das der Klient als »Problem« sieht. Durch diese Haltung der Würdigung kommt der Klient in Kontakt mit seiner Fähigkeit, Problemlösungen für sich selbst zu finden.
In der Gestalttherapie geht es vor allem um die therapeutische Haltung, mit der die Gestalttherapeuten die Klienten dabei unterstützen, ihre eigene »organismische Selbstregulation« wieder in Gang zu bringen. Damit ist die bei jedem vorhandene Fähigkeit gemeint, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und die notwendigen Schritte einzuleiten, diese Bedürfnisse zu befriedigen.
Wenn die Bedürfnisbefriedigung klappt, schenken wir der organismischen Selbstregulation keine weitere Beachtung, vielmehr nur, wenn sie nicht klappt. Das geschieht leider relativ häufig. Denn in unserer Kultur haben wir nicht gelernt, auf unsere eigentlichen Bedürfnisse zu achten, sondern eher, sie nicht wahrzunehmen. Und bei dem, was wir tun, orientieren wir uns allzuoft nicht an dem, was wir selbst wollen, sondern daran, was andere von außen an uns herantragen.
Mit einer gewissen Wehmut betrachte ich gelegentlich spielende Kinder. Sie folgen bei ihrem Spiel einfach ihrem Interesse, ihrer Neugier, ihrer Lust. Voll Begeisterung zeigen sie dann den Erwachsenen, was sie herausgefunden haben. Wenn die Erwachsenen sie dann loben – »Das hast du aber fein gemacht!« – beginnt die Deformierung. Nicht die Begeisterung wird geteilt und dadurch ermutigt. Sondern das Lob für das Produkt tritt an die Stelle der Lust am Prozess. Das Kind beginnt dann, etwas zu tun, zu erforschen, zu lernen, weil es ihm Lob einbringt. Auf diese Weise entsteht die Fremd- oder Außensteuerung.
Gestalttherapie will Klienten wieder zur »Selbststeuerung« ermutigen und damit Subjektsein wieder erlebbar machen.
Die Selbststeuerung lässt sich nur wiederherstellen, wenn der Therapeut seine Klienten auf dem Weg dorthin bereits als mündige Subjekte ansieht. In der Pädagogik spricht man vom Paradox der »vorgeschossenen Mündigkeit«. Ich finde diesen Begriff sehr passend auch für das, was Stefan Blankertz ein »therapeutisches Paradox« nennt: Der Therapeut behandelt auch jene Klienten als mündig, die ihre eigene Mündigkeit noch nicht fest in ihren Besitz genommen haben.
So betrachtet bin ich als Gestalttherapeut nicht der Quell von Wissen und Weisheit. Nicht ich kenne die Lösungen und müsste sie meinen Klienten nur noch nahe bringen. Nein, meine Klienten müssen ihre Lösungen selbst suchen und finden. Ich kann ihnen dabei nur meine Unterstützung anbieten – der Therapeut ist eben nur ein »Steigbügelhalter«: Die Klienten können nur selbst das Pferd besteigen und reiten. Ich habe das Vertrauen (und die Erfahrung!), dass meine Klienten ihre bisher verschüttete Mündigkeit schnell wieder in Besitz nehmen werden, wenn die »selbstgesteuerte« Lösungssuche einmal begonnen hat. Dabei wird der Gestalttherapeut eine Vielzahl von Methoden so anwenden, wie es der Persönlichkeit der Klienten und seiner eigenen Persönlichkeit entspricht – therapeutische Gespräche, Gewahrseinsübungen, Arbeit mit inneren Dialogen, Rollenspiele, Dialoge mit abwesenden Personen, körperorientierte Interventionen und kreative Ausdrucksmittel wie Ton, Papier und Farbe etc.
Kosten
Gestalttherapie wird nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Über die Wirksamkeit dieses psychotherapeutischen Ansatzes sagt das jedoch nichts aus. So hat die Gestalttherapie zum Beispiel gleich nach ihrer Entstehung einen festen Platz in Bereichen gefunden, in denen man sehr viel davon versteht, ob eine Methode effektiv ist oder nicht – nämlich in der Organisationsentwicklung, im Managementtraining und im beruflichen Coaching.
Dieser Artikel ist zuerst erschienen in der Zeitschrift »Psychologische Lebenshilfe«. Er erscheint hier in leicht überarbeiteter und erweiterter Form.
DIE ARBEIT DER KLIENTEN
AUCH ICH WAR EINST KLIENT
Das Konzept des existentiellen Augenblicks umfasst rührende und bewegende Erfahrungen, die einen heilenden Einfluss ausüben. Ein interpersonaler existentieller Augenblick ist gekennzeichnet durch gegenseitige Achtung und eine Qualität des Kontakts, die auch spirituelle Züge besitzt. Er vereinigt Komplexität und eine naive Schlichtheit, die ihm seine Schönheit verleiht. Solche Augenblicke besitzen eine ganz besondere und heilende Qualität.
Len Bergantino
Erst beim letzten Workshop im ersten Jahr meiner gestalttherapeutischen Ausbildung bin ich »richtig« ans Arbeiten gekommen. Ich war mit einer großen Verzweiflung in mir in Kontakt gekommen. Ich weiß eigentlich nicht, wie es geschah, jedenfalls fand »es« statt, als wir einen Workshop mit einer Gastlehrtrainerin hatten. Auf einmal war meine große Verzweiflung spürbar. Ich musste weinen.
Ich erinnerte mich an meine Kindheit in Schweden, daran, wie es sich anfühlte, als »deutsches Nazi-Kind« geschmäht zu werden. Weil die schwedischen Kinder nicht mit mir »Nazi-Kind« spielen durften, musste ich meist allein spielen. Ronni, den ich über alles liebte, spielte trotzdem mit mir. Seine Mutter bekam das einmal mit und lief schreiend auf uns zu. Ronni stieß mich unter einen Strauch, um mich vor den Augen seiner Mutter zu verbergen. Natürlich hatte sie mich schon längst erblickt. Sie strafte ihn mit vielen harten Schlägen direkt vor dem Strauch, unter dem ich mich versteckt hielt. Ich sah ihn. Ich hörte ihn – zuerst laut schreien, später nur noch leise wimmern. Trotzdem haben Ronni und ich uns auch weiterhin getroffen. Heimlich…
…dies erzählte ich damals heftig weinend meiner Ausbildungsgruppe. Das Zeitgefühl hatte ich dabei völlig verloren. Ich war erschüttert, als ich nach der Arbeit feststellte, dass sie mehr als eineinhalb Stunden gedauert hatte. Ich entsinne mich heute gar nicht mehr an weitere Inhalte. Nur noch an meinen Schmerz, an meine Verzweiflung. Nach der Arbeit war ich so erschöpft, dass die anderen Teilnehmer des Workshops mich in Decken hüllten und mir heißen Tee zu trinken brachten. Aber ich war gleichzeitig auch erleichtert, und alles um mich herum erschien mir heller.
Nach diesem Erlebnis habe ich mich entschieden, mit meiner Lehrtherapie zu beginnen. Mein damaliger Ausbilder, Willy Berns, schickte mich dafür zu Manfred Ley. Bei ihm versuchte ich, an meine Erfahrung von diesem Wochenendworkshop anzuknüpfen, was zuerst nicht gelingen wollte. Mindestens ein halbes Jahr lang konnte ich mir das Wort »Verzweiflung« nicht mehr ins Gedächtnis rufen. Als es mir jedoch wieder ins Bewusstsein trat, kam auch die große Traurigkeit wieder. Für mich begann eine tränenreiche Zeit. Das war am Anfang auch noch ganz in Ordnung für mich. Mit der Zeit fing ich aber an, mich für meine Tränen zu schämen.
Ich schämte mich meiner Tränen, die in dieser Zeit oft »zu laufen anfingen« – nicht nur in der Therapiesitzung, sondern auch im Alltag … Und so ging ich wieder einmal zu Manfred Ley. Ihm hatte ich noch nichts von der Scham über meine Tränen gesagt. Dafür schämte ich mich obendrein. Ich setzte mich bei ihm auf die Couch und erwähnte noch nichts, sondern dachte nur an meine Scham wegen des häufigen Weinens. Plötzlich begann er, von sich selbst zu erzählen.
Er berichtete völlig unerwartet davon, dass er am letzten Samstag auf einmal heftig habe weinen müssen. Ich war wie vom Blitz getroffen. Er habe seinen beiden Söhnen beim Spielen zugeschaut und sei davon so tief berührt gewesen, dass ihm die Tränen gekommen wären. Seine beiden kleinen Söhne wären erschrocken, wären zu ihm gekommen und hätten ihn getröstet. Er hätte ihnen – so fuhr er dann fort – versichert, dass es für ihn ganz in Ordnung sei zu weinen. Sie bräuchten sich keine Sorgen um ihn zu machen. Das hätte die beiden tatsächlich beruhigt, und sie hätten dann einfach ihr Spiel fortgesetzt. Er habe ihnen weiter zugesehen und weiter geweint. Sie hätten gespielt und ihn hin und wieder liebevoll angeschaut. Damit endete sein Bericht – und zugleich meine Scham wegen meiner eigenen Tränen.
Wärme breitete sich in mir aus, Vertrauen zu meinem Lehrtherapeuten. Ich habe in der Folgezeit begonnen, mich ihm gegenüber zu öffnen, also ihm mein Inneres schamfrei – oder zumindest schamfreier – mitzuteilen. Und ich habe meine Seele von ihm berühren lassen.
DIE SEELE BERÜHREN
Existentielle Augenblicke müssen nicht zwangsläufig zu Tränen führen, aber bei mir war das einige Male der Fall. Diese Augenblicke waren deshalb zu bewegend, weil ich damals mit tiefen Gefühlserlebnissen Schwierigkeiten hatte und nicht leicht zum Weinen zu bringen war. Viele Menschen, besonders Männer, isolieren sich emotionell und halten diese Isolation fälschlich für Freiheit. Sie sublimieren ihre Gefühle und versperren sich ihren emotionalen Bedürfnissen, bis sie schließlich an Herzinfarkten, Schlaganfällen oder anderen Krankheiten sterben.
Len Bergantino
Ralf, der Roboter
Ralf, ein Mittdreißiger, erschien an einem Sommertag vor vielen Jahren zum Vorgespräch in meiner Praxis. Eine frühere Teilnehmerin meiner Gruppen hatte ihm meine Telefonnummer gegeben. Auf meine Frage, wie ich ihm weiterhelfen könnte, schwieg er zunächst. Dann sagte er: »Ich weiß nicht, was ich will.« Auf Nachfrage beschrieb er, dass er überhaupt nicht wisse, was er gern esse. Dass er auch nicht wisse, mit wem und wie er seine Wochenenden verbringen wolle. Seine Frau sei für die Organisation seiner sozialen Kontakte zuständig. Er lebe fast ausschließlich für seine Arbeit. Er habe als Jurist eine Führungsposition in der Wirtschaft inne. Seine Stimme war monoton, während er berichtete. Langweilig. Leise. Die räumliche Entfernung zwischen uns schien riesig. Unser Kontakt war von der Sachlichkeit unseres Gespräches bestimmt. Keine Gefühlsäußerungen. Ich fragte ihn nach seinen augenblicklichen Empfindungen. Dass er nichts spüre, antwortete er. Ich jedoch wurde traurig. Spürte Schmerz und meine eigenen Tränen hinter meinen Lidern.
Eine sehr zähe und spröde Zeit folgte dem Vorgespräch. Nur kurz, ein einziges Mal in etwa zwölf Monaten, zeigte er Gefühle. Es war Rührung, die ihn überkam, als er von der Geburt seiner dritten Tochter vor zwei Jahren erzählte, bei der er dabei gewesen war. Er weinte in meiner Anwesenheit. Kurz. Unmittelbar darauf folgten Scham und Rückzug. Scham ist mir inzwischen eine vertraute Begleiterin in meinen Therapiesitzungen. Blitzschnell taucht sie auf, wenn wir – Klient und Therapeut – Neuland betreten. Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden dieses Phänomen kennen: Wenn Sie beispielsweise zum ersten Mal in einem neuen Urlaubsland essen gehen und noch nicht mit den dort herrschenden Sitten und Umgangsformen vertraut sind und deshalb schüchtern in der Hoffnung um sich blicken, durch Beobachtung Sicherheit zu bekommen. Ralf also hatte Neuland betreten. Für einen Augenblick spürte er Rührung, und in mir stieg Wärme für ihn auf.
Gut erinnere ich mich noch an den Druck, den ich als Therapeut empfand, wenn Ralf – unzufrieden über die kaum merklichen Veränderungen – den »Therapieerfolg« zu quantifizieren versuchte. Stichworte auf seinem Schreibblock notierend, wollte er »Fortschritt« erzwingen. Oft befürchtete ich, dass seine Ungeduld (wieder ein Gefühl!) die Oberhand gewinnen könnte, und er die Therapie abbrechen würde. Doch alles änderte sich, als er sich entschied, an einem meiner Workshops auf Kreta teilzunehmen.
Ich sehe das Bild noch klar und lebendig vor mir: Aufgeregt, ja aufgelöst erschien Ralf zur dritten Gruppensitzung. Es war am Vormittag. Er hatte in der Nacht kein Auge zugetan. Viel geweint. Weinte immer noch. Jung sah er dabei aus, wie ein Jugendlicher. Er habe entdeckt, dass er Mitgefühl habe, sagte er zwischen zwei heftigen Tränenwellen. »Dieses Gefühl habe ich schon seit Jahren nicht mehr empfunden. Zuletzt als Kind oder Jugendlicher. Ich kann den Schmerz der anderen Teilnehmer mitfühlen, als sei es mein eigener Schmerz.« Wieder musste er weinen. »Ich fühle mich so sehr verbunden. In Beziehung. In Kontakt. Dazugehörig. Und nicht mehr einsam.« Während seine Tränen wieder flossen, blickte ich – auch mit Tränen in den Augen – in der Gruppe herum. Fast alle weinten mit ihm, waren ihm verbunden. Seelen berührten sich sanft und traurig. Martin Buber hat die seelische Verbindung zwischen Menschen das »Zwischen« genannt. Dieses »Zwischen« ist mehr als nur die Summe der anwesenden Personen. Das »Zwischen« hat eine eher spirituelle Qualität. Gerade in Gruppen, in denen Menschen sich vorbehaltlos und angstfrei in »Ich-Du-Beziehungen« treffen, bekommt dieser Kontakt, diese Seelenbegegnung eine besonders heilende Kraft.
Seit diesem Augenblick an jenem Morgen im Workshop auf Kreta hat sich Ralfs Leben grundlegend verändert. Einen Tag später sprach er von seiner Sehnsucht nach seiner Frau, seinen Töchtern und nach zuhause. Zurück in Deutschland fragte er telefonisch bei mir nach, ob er und seine Frau ab jetzt zusammen zur Therapie kommen könnten. Ich freute mich und sagte zu.
Tränen
Tränen sind also nicht gleich Tränen. Es gibt Tränen der Rührung. Tränen der Reinigung, etwa um Schmutzpartikel aus dem Auge zu waschen. Tränen der Trauer. Nicht gelebte Trauer lässt Menschen farblos und blass werden. Aktivität und Kreativität erlahmen. Soziale Kontakte schwinden. Und auch die berufliche Leistungsfähigkeit geht zurück. »Wenn ich jetzt weiterreden würde, dann müsste ich mit Sicherheit weinen, und dann befürchte ich, dass ich – in der nächsten Woche – nicht mehr in der Lage bin, meine vielfältigen beruflichen Anforderungen und Aufgaben zu erfüllen.« (So ein Teilnehmer, dem schon dann, wenn er die liebevolle Aufmerksamkeit der anderen teilnehmenden Männer auf sich ruhen spürte, gerührt die Tränen an den Wangen herabliefen.) Viele Männer, die – bedingt durch ihre Sozialisation – doch eher »Weltgestalter« denn »Innenarchitekten« sind, scheuen selbst vor einer bereits als notwendig anerkannten Therapie zurück, weil sie glauben, diese könne ihre Leistungsfähigkeit schmälern. Doch das Gegenteil ist der Fall. Erfahrungsgemäß kostet die Auseinandersetzung mit vorhandenen Problemen, Ängsten, Sorgen… weniger seelische Kraft, als die Vermeidung der Auseinandersetzung.
Manchmal erleichtert die Sorge um die berufliche Leistungsfähigkeit sogar den Zugang zu der eigenen Seele. Berufliche Supervision und Führungs-Coaching sind neue Aktionsbereiche der Psychotherapie. Immer mehr Menschen in verantwortlichen Positionen nehmen diese Möglichkeiten gern wahr, wenn sie beispielsweise entdecken, dass Trainings in Arbeitstechniken und Zeitmanagement ihnen nicht ausreichen. Wenn sie feststellen, dass für Veränderungen im Berufsalltag mehr erforderlich ist, nämlich auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Person.
Menschen in Therapie
Männer, die heute in die Psychotherapie kommen oder an einem Männerseminar teilnehmen, sind keine Exoten mehr. Eher Durchschnittsmänner, die das Gefühl haben, an ihre persönliche Wachstumsgrenze gestoßen zu sein. Nur selten sind es »männer-bewegte« Männer. Und wenn doch, so haben sie mit den alten Männergruppen meist nicht nur gute Erfahrungen gemacht.
Die Geschichte über Ralf erschien ursprünglich unter dem Titel »Männer in Therapie«. Er hätte genauso gut »Menschen in Therapie« heißen können. Also – Thema verfehlt? Vielleicht hätte ich mehr über spezifische Männerthemen schreiben sollen – das Verhältnis zum Vater, das Verhältnis zu Frauen, Mann und Arbeit, Mann und Leistung, Mann und Körper, Mann und