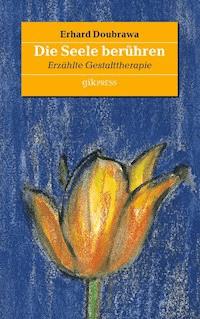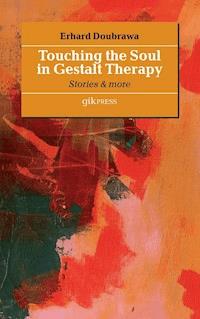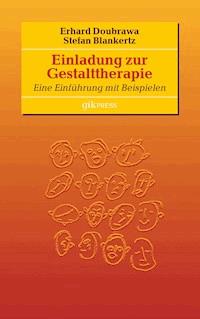
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch bietet eine leicht verständliche Einführung in die Gestalttherapie; es zeigt, wie Gestalttherapie heilt und für wen diese Therapieform gut ist. In einem erzählenden, sehr persönlichen Stil zeigen die Autoren, wie das humanistische Menschenbild der Gestalttherapie ihre Ziele bestimmt: Mündigkeit und seelisches Wachstum des Klienten. Zahlreiche Beispiele machen das Buch zu einer anschaulichen Einstiegslektüre. Ein Gestalt-Bestseller: Gesamtauflage mehr als 40.000!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: Hagen Willsch
Erhard Doubrawa (links), Stefan Blankertz, 2000
Erhard Doubrawa, 1955, arbeitet seit vielen Jahren als Gestalttherapeut. Er ist Gründer und Leiter der »Gestalt-Institute Köln und Kassel (GIK)« (gestalt.de). Private Praxen in Köln und Kassel. Herausgeber der Gestalttherapie-Zeitschrift »Gestaltkritik« (gestaltkritik.de) und einer Buchreihe zu Theorie und Praxis der Gestalttherapie (gikpress.de). Buchveröffentlichung in der gikPRESS u. a.: »Die Seele berühren: Erzählte Gestalttherapie«.
Stefan Blankertz, 1956, ist Sozialwissenschaftler und Schriftsteller (editiongpunkt.de). Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Paul Goodman, dem Mitbegründer der Gestalttherapie. In der gikPRESS erschien u. a.: »Gestalt begreifen: Ein Arbeitsbuch zur Theorie der Gestalttherapie«.
therapeutenadressen service
Praxisadressen von Gestalttherapeutinnen u. -therapeuten. Infos siehe letzte Buchseite
INHALT
Leserstimmen
Einladung
Zur Gestalttherapie
Fangen wir direkt schon mal an
Wer Ihnen das alles erzählt
Was Gestalttherapie nicht ist
Erhard über die Schulter geschaut
Aus der gestalttherapeutischen Arbeit
Der Gestaltbohrer
Drei Erinnerungen aus meinen Lehrjahren
Gitte: Das Sakrament der Ehe
Petra, vom Kleinmachen
Der Therapeut ist nur Steigbügelhalter
Paare
Reisen ist doch unser Hobby
Wenn ich in der Therapie einschlafe
Der Engel der Geschichte
Erzählte Gestalttherapie
Stichworte zur Gestalttherapie
Aus Erhards Zettelkasten
Sprache der Ehrfurcht
Dankbarkeit für das Wichtigste
»Wir sind doch nur die Opfer«
Wohlwollen
Heilung durch Erleben, nicht durch Verstehen
Die Begegnung
Existentielle Augenblicke
Kontakt
Das Recht des Klienten, in seinem Leben zu scheitern
Von der Figur zum Grund
Anarchie gibt’s nicht auf Krankenschein
Die gestalttherapeutische Theorie kurz skizziert
Wie psychische Probleme entstehen
Diagnostische Möglichkeiten
Das Selbst im Feld
Gestalttherapie und Psychoanalyse
Die politische Dimension
Klient eines Gestalttherapeuten werden
Gestalttherapeut werden
Kleine Geschichte der Gestalttherapie
Literaturhinweise
Literaturempfehlungen
Dem Gestalttherapeuten und -lehrer Erving Polster gewidmet.
LESERSTIMMEN
»Erhard Doubrawa und Stefan Blankertz ist ein wirklich hervorragendes Buch gelungen; beim Lesen dachte ich: das ist der Geist, in dem ich mir wünsche, dass Gestalttherapie ausgeübt wird. Erfrischend aufrichtig; Fokus auf Bewusstheit, nicht auf vorschnellem Machen; respektvoll und achtsam; und kritisch gegenüber Norm und Normalität, und Macht und Herrschaft. Ausgezeichnete Einführung für alle Gestalttherapie-Neulinge, egal ob professionell oder als Klient oder Interessent.«
Detlev Kranz, Hamburg, Gestalttherapeut
»[Die Autoren] wollten in leicht verständlicher Weise zeigen, was Gestalttherapie ist und wie sie arbeitet. Ein Anliegen, das gelungen ist. Ohne Einschränkung. Das Buch ist durch zahlreiche Fallbeispiele zu Therapieverläufen sehr anschaulich. Der erzählende, persönliche Stil erleichtert das Lesen und Verstehen erheblich.«
Monika Salchert, Buchbesprechung in der »Bergischen Post«
»Ich habe in den letzten Jahren selten einen Text gelesen, der einerseits die Gestalttherapie für Laien verständlich erklärt und gleichzeitig unterhaltend und frisch daherkommt. […] Danke auch für solche Überschriften (und dazugehörige Texte) wie ›Anarchie gibt’s nicht auf Krankenschein‹.«
Theo Schreiber, Aachen, Gestalttherapeut
»Wir möchten Euch unsere Freude über Euer neues Buch mitteilen: […] Endlich ein Text, den man auch weiterempfehlen kann, damit andere spüren, was Gestalt ist. Super.«
Barbara Smith, Köln, Gestalttherapeutin und Rainer Wetz, Köln, Organisationsberater
»Ich habe Euer Buch verschlungen! Mir hat der lockere Stil, die Herzlichkeit, das Wohlwollen, mit dem Du, Erhard, Deine Klienten und Dich selbst beschreibst, Einblicke in Deinen ›Zettelkasten‹ und Deine eigenen Erfahrungen gewährst, sehr gefallen – da waren viele Anregungen zum Weiterdenken und -fühlen, vieles was Lust macht auf mehr Gestalt – vielen Dank.«
Thomas Becher, Köln, Arzt
EINLADUNG
Provokative Einfühlsamkeit
Der Klinikseelsorger – selbst ein Gestalttherapeut – besucht die Station mit AIDS-Kranken. Der junge Mann, den er schon seit einigen Monaten begleitete, hat stark abgenommen. Sieht zum Herzzerreißen aus. Spindeldürr und klapprig. Der Seelsorger begrüßt ihn mit den Worten: »Bei der Auferstehung des Fleisches wirst du aber leer ausgehen.«
Einen Moment ist es mucksmäuschenstill im Krankenzimmer. Dann bricht schallendes Gelächter aus. Der junge Mann lacht am lautesten und schlägt sich klatschend auf seine dürren Beine.
Gestalttherapeutischer Schluss: Der Klient erwartet – mit Recht – Ehrlichkeit vom Therapeuten. Er erwartet, dass er das Augenscheinliche wahrnimmt und auch benennt. Nicht Verschweigen hilft, sondern nur ein – liebevolles – Benennen.
Was Sie erwartet
… wir laden Sie, lieber Leser, ein … ebenso zum Lachen wie zum Weinen … ebenso zum Durchdenken wie zum Nachfühlen … ebenso zum Beharren auf dem, was Sie sind, wie zum Loslassen und Verändern … ebenso zum harmonischen Eingliedern in Ihre Umgebung wie zum aggressiven Rebellieren.
Wenn Sie am Ende sagen können, was »Gestalttherapie« ist, umso besser. Wenn nicht, auch nicht schlimm: Es geht uns nicht darum, Ihnen Lehrbuchwissen zu vermitteln, sondern Sie in einen Prozess einzubinden, von dem wir hoffen, dass er für Sie erfreulich ist.
Manche sagen, »Gestalttherapie« ließe sich nicht beschreiben, sondern nur erleben. Da ist etwas Wahres dran. Darum haben wir, der erfahrene Gestalttherapeut Erhard und der beinharte Theoretiker Stefan, verabredet, dieses Wagnis zu beginnen: Ein Buch über Gestalttherapie, das die Gestalttherapie erlebbar macht und dennoch nicht auf die Tiefe der Einsichten verzichtet, die die Gestalttherapie hinsichtlich des Menschen, seiner Psyche und seiner Gesellschaft bereithält.
Wir geben Ihnen zunächst unter der Überschrift Zur Gestalttherapie einen groben Überblick, was wir unter Gestalttherapie verstehen, wer wir sind, und was wir unter Gestalttherapie nicht verstehen. (»Grenzen ziehen« ist aus gestalttherapeutischer Sicht eine wichtige Lebenstätigkeit!) Dann lassen wir Sie dem Erhard bei der gestalttherapeutischen Arbeit über die Schulter blicken. Auf diese Weise erhalten Sie einen kleinen Einblick in die Praxis der Gestalttherapie. Unter der Skizze der gestalttherapeutischen Theorie finden Sie zentrale Ideen kurz und knapp dargestellt. Es erschien uns lebendiger (wenn auch methodisch gesehen unsystematisch), die Praxis und die Ideen vor die Erläuterung der gestalttherapeutischen Grundbegriffe zu setzen: Wenn Sie schon einen Eindruck davon haben, wie die Gestalttherapie arbeitet, werden Ihnen die Begriffe hoffentlich nicht fremd und leblos erscheinen.
Ein paar Worte zur Geschichte der Gestalttherapie stehen am Ende, obwohl die meisten Einführungen mit ihr anfangen. Wir aber haben den Eindruck, dass es langweilig ist, Sie mit Namen, Daten und Entwicklungen zu konfrontieren, die sich auf eine Theorie und Praxis beziehen, von der Sie vielleicht noch nicht viel wissen. Falls Sie jedoch lieber mit der Geschichte beginnen – lesen Sie ruhig »von hinten nach vorn«.
Nur Sie können am Ende sagen, ob uns das Wagnis, Sie zur Gestalttherapie einzuladen, gelungen ist. Bis dahin: Viel Spaß.
Erhard Doubrawa und Stefan Blankertz, 2000
ZUR GESTALTTHERAPIE
Fangen wir direkt schon mal an…
Vergessen bitte Sie alles, was Sie eventuell schon über Gestalttherapie gehört haben. Sie haben noch nichts von ihr gehört? Umso besser.
Gestalttherapie ist eine Einladung. Eine Einladung, dass Sie sich in der Welt – neu? – orientieren. Neu? Muss nicht sein. Bestimmen Sie Ihren Standort. Schauen Sie sich genau um. Nehmen Sie wahr, wie Sie sitzen oder liegen, während Sie diese Zeilen lesen? Hart oder weich? Angenehm oder unbequem? Wie ist die Luft? Genügend Sauerstoff? Zu warm oder zu kalt? Genau richtig sollte es sein. Sie brauchen jetzt nicht gleich zum Fenster zu stürzen und es zum Lüften aufzureißen. Fragen Sie sich lieber, warum Sie es gern so stickig haben! Lernen Sie, Ihre Vorlieben zu schätzen. Verändern Sie sie nicht. Und wenn Sie das erreicht haben, werden Sie merken, dass sich alles um Sie herum verändert hat – ebenso wie Sie selbst mittendrin. Das nennen die Gestalttherapeuten das Paradox der Veränderung.
»Therapie« heißt ja bekanntlich so viel wie »Heilung«. Wenn Sie Husten haben, wissen Sie genau, worin die Heilung bestünde: keinen Husten mehr haben. Bei körperlichen Beschwerden besteht das Kriterium der Heilung in einer gewissen körperlichen »Normalfunktion«. Viele psychologische Richtungen gehen ähnlich vor: Man versucht, eine psychische »Norm« zu definieren, und alles, was da abweicht, wird »wegtherapiert«. Aber wollen Sie das? Sicherlich wollen Sie, dass Ihr Körper »normal« funktioniert und Sie keine Schmerzen oder Beeinträchtigungen haben. Das könnte jedoch tief innen in Ihrer Seele ganz anders sein: Sie wollen gar kein »Normalbürger« mit statistischen Durchschnittseigenschaften und mit Durchschnittsbedürfnissen sein. Wenn das so ist, sind Sie bei der Gestalttherapie richtig: Denn der Gestalttherapeut fragt nicht danach, wie Sie vom Durchschnitt abweichen. Er fragt danach, ob Sie sich mit sich wohlfühlen. Er möchte, dass Sie sich angemessen verhalten – angemessen Ihrer tatsächlichen Umwelt gegenüber und sich selbst gegenüber, so wie Sie nun einmal sind.
Das Kriterium für die Heilung in der Gestalttherapie ist kein äußerer Maßstab, sondern die innere Gestalt: Fügt sich alles, was Sie sind, zu einem guten Ganzen? Oder gibt es Brüche und Widersprüche, Ungereimtheiten und Selbstbehinderungen, die Ihnen das Leben unnötig schwer machen? (Wir sagen: unnötig, denn ein leichtes Leben verspricht die Gestalttherapie nicht. Das tun nur Scharlatane). Dann können wir mit Gestalttherapie schauen, was sich machen lässt, um das zu ändern.
Das wichtigste Instrument der Gestalttherapie, um herauszubekommen, was denn nun angemessen ist, heißt Wahrnehmung. Das sei ja simpel, denken Sie. Haben Sie schon einmal festgestellt, wie wenig Sie (und, unter uns gesagt, wir alle) wirklich wahrnehmen? Zu Beginn des Kapitels haben wir Sie gefragt, in welcher konkreten Umgebung Sie dieses Buch lesen. Wir haben bei den Fragen einiges vergessen: Farben zum Beispiel und Gerüche. Versuchen Sie einmal, Ihre nächste Umgebung ganz genau zu beschreiben. Das ist gar nicht so einfach und ziemlich langwierig. Vergessen Sie sich selbst dabei nicht: Was haben Sie an? Wie atmen Sie? Schmerzen vielleicht Ihre Augen? Wie geht es Ihrem großen Zeh? (Meiner ist kalt.)
Das meiste, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen könnten, geht an uns vorüber. Das ist übrigens auch gar nicht schlimm. Es ist im Normalfall sogar ein Glück. Denn wenn wir immer alles ganz genau wahrnehmen wollten, kämen wir nie dazu, irgendetwas zu tun (außer wahrzunehmen). Die menschliche Wahrnehmung ist so angelegt, dass immer nur das Wichtige in den Vordergrund rückt. Das andere wird beiläufig als Hintergrund wahrgenommen. So nehmen Sie nicht genau wahr, wie es Ihrem Fuß geht. Aber ist er »eingeschlafen«, tritt die Wahrnehmung des Fußes in den Vordergrund und die andere Tätigkeit, etwa das Lesen dieses Buches, tritt in den Hintergrund, und Sie schütteln Ihren Fuß aus. Diesen Vorgang nennt die Gestalttherapie Figur-und-Grund-Prozess.
In den Prozess von Figur und Grund braucht durch Therapie nur dann eingegriffen zu werden, wenn er nicht mehr so abläuft, dass Sie zufrieden sind. Beispielsweise sind Sie so darauf fixiert, dieses Buch zu lesen, dass Sie vergessen, etwas zu essen. Das ist schlecht. Also sollten Sie lernen, Ihrem Bauch und dessen Bedürfnissen mehr zuzuhören. Oder umgekehrt, Sie haben eine derartige Abneigung gegen das Lesen, dass Sie, sobald Sie dies Buch aufschlagen, Durst bekommen, das Buch weglegen und erst einmal etwas zu trinken holen. Auf diese Weise kommen Sie mit dem Lesen nicht weiter. Da sollten Sie dann lernen, wahrzunehmen, was Sie wirklich in einem Moment wollen.
Die therapeutische Arbeit an der Wahrnehmung ist eher mit dem Erleben als mit dem Verstehen verbunden. Wahrnehmung stellt immer eine enge Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer Umgebung (zu der auch Ihr Körper gehört) her. Sie nehmen Ihre Befindlichkeit und die Befindlichkeit Ihrer Umgebung wahr, und das meiste, was Sie wahrnehmen, hat auch einen Gefühlswert. Wahrnehmung ist nicht wertfrei. Bei vielen Gerüchen, die Sie wahrnehmen, kommen Ihnen Erinnerungen, gute oder schlechte. Auf jeden Fall wird fast jeder Geruch entweder angenehm oder unangenehm sein. Das gleiche gilt für Farben, Formen und dergleichen mehr.
In der Gestalttherapie wird darum mit Ihrem eigenen Erleben gearbeitet: Indem Sie Ihre Wahrnehmung schärfen, erleben Sie sich und Ihre Umwelt. Dadurch kommt eine Veränderung zustande, wenn es um eine solche geht. Ihnen wird nicht, wie in manchen anderen Psychotherapien »erklärt«, wie Sie in der Welt sind und wie die eventuell unheilvollen Verstrickungen zustande kommen. Nicht das Verstehen (aufgrund von Erklärung), sondern das Erleben (aufgrund von Wahrnehmung) heilt nach Ansicht von der Gestalttherapie.
Die Arbeit an der Wahrnehmung bringt noch ein zentrales Kennzeichen der Gestalttherapie mit sich: Die Gestalttherapie hat ihr Augenmerk auf der Gegenwart, auf, wie Gestalttherapeuten sagen, dem Hier-und-Jetzt. Wahrgenommen (und erlebt) wird immer in der Gegenwart. Natürlich kann die Wahrnehmung, zum Beispiel von Zimtduft, eine Erinnerung etwa an Weihnachten in der Kindheit wachrufen. Gleichwohl bleibt die Wahrnehmung in der Gegenwart. Es ist auch nur die Gegenwart, in der Sie handeln und eventuell etwas verändern können. Die Vergangenheit steht fest (jedenfalls von den Fakten her, nicht aber von der Beurteilung her), und die Zukunft steht noch nicht fest. Wenn Sie sich also zu stark auf die Vergangenheit fixieren, werden Sie nichts ändern können. Wenn Sie dagegen mit Ihren Gedanken stets versuchen, die Zukunft vorwegzunehmen, werden Sie immer nur daran denken, etwas zu tun, den Zeitpunkt des Handelns allerdings häufig verpassen.
Wahrnehmen heißt also auch: sich nicht durch Erinnerungen in der Vergangenheit festhalten oder durch Angst vor der Zukunft bewegungsunfähig machen zu lassen, sondern um sich zu schauen und nachzuspüren, was »wirklich Sache ist«. Auf diese Weise stärkt die genaue Wahrnehmung unsere Handlungsfähigkeit.
Wer Ihnen das alles erzählt
Wie kommen wir dazu, Ihnen das alles zu erzählen? Warum meinen wir, kompetent genug dazu zu sein, Ihnen zu sagen, was »Gestalttherapie« ist?
Erhard Doubrawa ist seit vielen Jahren als Gestalttherapeut und als Leiter des Gestalt-Instituts Köln (GIK; heute: Gestalt-Institute Köln und Kassel) tätig. Aber schon der alte Sokrates hat erfahren, dass man, wenn man einen Handwerker fragt, was er da tue, keine brauchbaren Antworten bekommt.
Stefan Blankertz ist seit vielen Jahren (unter anderem) als Autor sozialkritischer (und inzwischen auch literarischer) Bücher tätig. Eine Therapie hat er bis zum Jahr 2000, als dies Buch entstanden ist, noch nie mitgemacht. Aber der Volksmund sagt (vielleicht ja nicht ganz zu unrecht), dass man jemandem, der über etwas schreibt, das er bloß aus Büchern kennt, nicht trauen dürfe.
Also haben wir uns zusammen getan, um gemeinsam zu versuchen, was jeder für sich nicht optimal bewältigen kann: ein Buch über Gestalttherapie zu schreiben, das anschaulich ist, ohne es an Problembewusstsein mangeln zu lassen.
Zum ersten Mal begegneten wir uns Ende der 1980er Jahre. Damals war Erhard auf der Suche nach jemandem, der im Rahmen seines Instituts die theoretische, philosophische und politische Grundlegung der Gestalttherapie kompetent darzustellen vermochte. Wie kein anderer im deutschen Sprachraum hatte sich Stefan mit dem Leben und der Arbeit Paul Goodmans (1911-1972) befasst, der die politische und philosophische Dimension der Gestalttherapie von Anfang an entscheidend mitgeprägt hat. Aber Stefan war Soziologe, und Psychotherapie war für ihn vor allem ein Ärgernis und »kleinbürgerliches Vorurteil«.
Stefan hatte Erhard erklärt, dass der Mitbegründer der Gestalttherapie Paul Goodman1 Anarchist war – also das Zusammenleben unter staatlicher Herrschaft ablehnte. Stattdessen sollte das Zusammenleben von selbstbestimmten und für die Konsequenzen ihres Handelns selbst verantwortlichen Menschen organisiert werden. Der Begriff »Anarchismus« verunsicherte Erhard zunächst, da er damals unter (guter) Politik irgendetwas links von der SPD verstand, etwas, das mehr (nicht weniger) Staat wollte. Ihm leuchtete jedoch ein, dass das anarchistische gesellschaftliche Ideal Goodmans besser mit den individuellen Zielen der Gestalttherapie übereinstimmte: Wir sprechen ja von Verantwortung, die wir für unser eigenes Tun übernehmen sollen, und von »organismischer Selbstregulierung«. Da ist für Herrschaft und Staat offensichtlich kein Platz mehr.
Dass sich Gestalttherapie immer auch als eine Therapie in Gesellschaft versteht, hatte Erhard übrigens bereits von Lore Perls gehört: Menschen sollen fähiger werden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Lore sagte ihm, in »Gesellschaften, die mehr oder weniger autoritär sind« sei dies eine »politische Arbeit«. In der Wertschätzung von Spiritualität machte umgekehrt Stefan den Schritt auf Erhard zu: Als Erhard vor rund zwei Jahrzehnten sein Institut gründete, gab es dort neben anderen Bereichen wie Selbsterfahrung, Supervision usw. auch einen Bereich »Politische Theologie«. Zu der Zeit arbeitete Stefan als Werbetexter und Computergrafiker. So kam es, dass er Erhards alternativ angehauchte Institution auch in Sachen »Öffentlichkeitsarbeit« unterstützte. Immer wieder hatte Erhard mit ihm Auseinandersetzungen um jenen Bereich der Politischen Theologie oder andere spiritualistische Angebote wie Meditation. Damals wollte Stefan niemandem dabei helfen, solches »Opium fürs Volk« zu verbreiten.
Als Stefan, den Erhard immer irgendwie als »Heiden« eingestuft hatte (tatsächlich war er aus der protestantischen Kirche ausgetreten und »konfessionslos«, als Erhard ihn Ende der 1980er Jahre kennen lernte), überraschend zu seiner Firmung in die St. Hubertus Kirche von Sinnersdorf einlud, spürte Erhard etwas sehr seltsames: Beim Sakrament der heiligen Kommunion wurde ihm die tiefe spirituelle Bedeutung des Ritus erneut deutlich – denn er selbst war aus dem Studium der katholischen Theologie zu den Protestanten »geflüchtet«. Mit dem Abstand von den vielen Jahren konnte er wieder wahrnehmen, was das Geheimnis des christlichen Glaubens ausmacht, ohne dass er sich durch die unerfreuliche Auseinandersetzung mit reaktionären Positionen der katholischen Kirchenobrigkeit hatte ablenken lassen.
Mittlerweile sieht Stefan zwischen der mittelalterlichen katholischen Philosophie – besonders der des Thomas von Aquin – und der Gestalttherapie eine enge Verbindung.2
Die Art, in der Stefan jetzt Religiosität in sein Denken integriert hat, ist wohl verschieden von der Politischen Theologie, die Erhard damals verfochten hatte. Dennoch schließt sich so ein Kreis, der das unterstreicht, was das Gestalt-Institut Köln schon lange zum Motto hat – die Verbindung von Therapie, Politik und Spiritualität. Therapie ist sicherlich nötig, um den Menschen, die in unserer Gesellschaft an der Seele krank werden, zu helfen. Politik brauchen wir Therapeuten, um uns bewusst zu machen, dass eigentlich nicht die Menschen krank sind, sondern die Umstände, die sie krank machen. Aber ohne Spiritualität, die uns sagt, dass es zwischen Himmel und Erde mehr zu erfahren gibt, können wir auch keinen Seelenfrieden finden.
Bei der Integration von Therapie, Politik und Spiritualität stehen wir nach wie vor noch am Anfang. Das, was Erhard von Stefan gelernt hat, ist, mit Thomas von Aquin keinen unüberwindlichen Gegensatz zwischen Vernunft und Glauben, zwischen Denken und Erleben, zwischen ratio und Gefühl zu setzen. Es ist unsere Aufgabe, den Menschen wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen: Es ist die Utopie des christlichen Glaubens, dass es zwischen Vernunft und Leidenschaft Frieden geben kann. Die Erfahrung der Trennung von beidem darf uns nicht derart verzweifeln lassen, dass wir aufgeben und meinen, uns zwischen dem rationalen »kühlen Kopf« oder dem emotionalen »Leben aus dem Bauch heraus« entscheiden zu müssen. Eine Utopie, die uns alle zusammenbringt: Therapeuten, Theologen und diejenigen, die unter »Politik« verstehen, den Menschen mehr Macht über ihr Leben zu geben.
Was Gestalttherapie nicht ist
Gestalttherapie ist nicht unwissenschaftlich
Ach übrigens: warum Sie vergessen sollten, was Sie eventuell über Gestalttherapie schon gehört haben … es kursieren da einige Vorurteile, die zugegebenermaßen auch von manchen Gestalttherapeuten kräftig geschürt werden, von denen wir uns sehr scharf abgrenzen möchten.