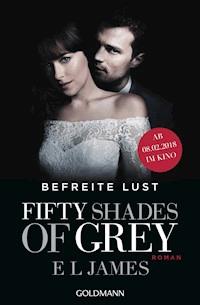Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein junger Immigrant wird mehr als zwei Jahre lang von seiner Scheinehefrau sowohl körperlich als auch seelisch misshandelt, bevor die junge Krankenschwester Jenny auf ihn aufmerksam wird und ihn rettet. Eine dramatische Geschichte nimmt ihren Anfang. Ein erotisches Drama
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonia Mattu
Die sprechenden Augen
Ein erotisches Drama
Imprint
Die sprechenden Augen Sonia Mattu published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de Copyright: © 2015 Sonia Mattu ISBN 978-3-7375-6059-7
Covergestaltung: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Kapitel 1
Jenny
Mein Name ist Jenny, ich bin siebenundzwanzig Jahre alt, von Beruf Krankenschwester und in der Hauskrankenpflege tätig. Das bedeutet, ich besuche Patienten in deren Wohnungen, betreue und pflege sie. Meist sind es sehr alte bettlägerige Menschen. Ich bevorzuge diese Art meiner Tätigkeit, da ich selbstständig arbeiten kann. Natürlich bin auch ich einem Team unterstellt, aber es ist doch anders als in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim.
Ich wohne in einer großen Stadt, in einem sogenannten „reichen Land“ in Mitteleuropa. Es ist eine schöne Stadt mit vielen Grünflächen.
Heute habe ich etwas entlegen am Stadtrand eine neue Patientin zugeteilt bekommen. Sie ist vierundneunzig Jahre alt, insulinpflichtige Diabetikerin und bettlägerig. Ich fuhr mit der Straßenbahn bis zur Endstation. Der Weg zu ihr führte durch einen Park. Nach wenigen Minuten erblickte ich ein Haus. Ich blieb stehen und atmete die frische kühle Morgenluft ein. Es war 6.50 Uhr.
Das Haus stand ziemlich weit hinten, mit einem großen, etwas verwilderten Garten davor, eingezäunt durch einen Holzlattenzaun. In der Einfahrt stand ein stattlicher Pkw. Es war ein kleines einstöckiges Haus. Die Fenster im Erdgeschoss waren vergittert, wahrscheinlich wegen Einbruchsgefahr. Was mich jedoch verwunderte, die Fenster im ersten Stock waren auch vergittert. Ein Fenster stand offen. Welch glückliche Menschen wohl hier wohnen? So still und friedlich. Es war Mitte Juli und laut Wetterbericht sollte es ein strahlend heißer Sommertag werden.
Die Stille wurde abrupt unterbrochen! Eine Frauenstimme klang aus dem geöffneten Fenster, eine schimpfende schrille Frauenstimme. Meine Güte, dachte ich, so ein schöner Morgen. Vermutlich eine keifende Ehefrau. Ich schmunzelte und setzte meinen Weg fort.
Auf dem Rückweg blieb ich wieder vor dem Haus stehen, meine Handyuhr zeigte 8.43 Uhr. Alle Fenster waren verschlossen, die Jalousien heruntergelassen. Ich ging zur Straßenbahn und fuhr zum nächsten Patienten. Abends, nach Dienstschluss, dachte ich wieder an dieses Haus.
Am nächsten Tag, 7.12 Uhr: Ich war spät dran und ging eilenden Schrittes. Mein Blick schweifte kurz zum Haus. Das gleiche obere Fenster stand offen, so wie gestern. Die schrille, keifende Frauenstimme …!
„Blöde Kuh“, sagte ich ärgerlich. Ein anderes Geräusch … Es klang wie ein Klatschen, ein surrendes Klatschen. Ich blieb stehen und starrte zu dem Fenster. Etwas stimmte hier nicht, meldete mein Gefühl.
Ein älterer Herr mit Hund kam mir entgegen, ich sprach ihn an: „Hören Sie das?“ Er blickte zum Fenster. „Ja, ja.“ Er erzählte mir, dass dort eine Frau wohnt, so um die vierzig Jahre alt. Ihren Namen wusste er nicht mehr, jedoch hätte er sich ein paar Mal mit ihr unterhalten. „Sie hat einen anstrengenden Beruf, ich glaube Immobilienmaklerin. Sie verkauft auch im Ausland und ist öfters auf Reisen.“ „Und dieses Gezeter, dieses Schimpfen, und was ist das für ein Klatschen?“, fragte ich. „Sie ist etwas sonderbar, ja, das stimmt. Zur Entspannung sieht sie sich gerne Horrorfilme an, hat sie mir erzählt.“ Er lachte: „Also zu meiner Entspannung gehe ich lieber mit meinem Hund spazieren. Schönen Tag noch.“ Er ging weiter.
Auf dem Rückweg, 9.17 Uhr: Alle Fenster verschlossen, die Jalousien heruntergelassen. Das Auto stand nicht mehr in der Einfahrt.
Abends zu Hause studierte ich meinen Dienstplan. Es war Dienstag. Ich hatte noch einen Arbeitstag vor mir, dann zwei Tage frei. Meine nächsten Dienste fielen auf den Samstag, Sonntag und Montag, wobei der Montag ein Feiertag sein würde. Ich mochte es, an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten. Die öffentlichen Verkehrsmittel waren nicht so überfüllt und ich verdiente das Doppelte.
Dann dachte ich an das Haus. Diesen Abend stellte ich meinen Wecker eine Stunde früher.
Mittwoch, 6.18 Uhr: Das Haus leuchtete im Sonnenaufgang, ich hörte Vögel zwitschern. Das Gartentor war angelehnt, das Auto stand in der Einfahrt. Seitlich gab es eine Terrasse. An einer anderen Ecke im Garten sah ich ein kleines Holzhaus, wahrscheinlich ein Geräteschuppen. Ich ging über den Rasen zum Haus und blickte nach oben. Die Fenster waren verschlossen. An der Haustür befand sich eine Glocke, aber kein Namensschild. Ich ging um die Hausecke und bemerkte einige tiefliegende Fenster. Das mussten Kellerfenster sein. Sechs quadratische Fenster. Das dritte war gekippt. Die Fenster waren undurchsichtig. Sie waren schwarz, als ob mit Teer bestrichen. Ich schaute durch das gekippte Fenster hinein, konnte aber nicht viel erkennen. Irgendwie schienen da ein WC und ein Waschbecken zu sein. In einer Ecke lag etwas am Boden. Ich strengte meine Augen an … eine Matratze – da lag eine Matratze!
Ich läutete an der Haustürglocke. „Wer ist da?“ Ich trat einige Schritte zurück und blickte nach oben. Am vergitterten offenen Fenster stand eine Frau mit schulterlangem blondgelocktem Haar. „Wer sind Sie? Was machen Sie auf meinem Grundstück?“ „Das Gartentor war offen. Entschuldigung, ich habe gestern so … so seltsame Geräusche gehört. Brauchen Sie Hilfe?“ „Ich? Ich brauche keine Hilfe, ich brauche meine Ruhe! Was erlauben Sie sich eigentlich? Das ist meine Privatsphäre! Verlassen Sie augenblicklich mein Grundstück oder ich rufe die Polizei!“ Sie sah mich wutentbrannt an, ihre Stimme klang schrill. Sie schlug das Fenster zu. Eilig ging ich.
Donnerstag – ich schreckte schweißgebadet auf, anscheinend aus einem Traum, einem Albtraum? Ich konnte mich nicht erinnern. Die Uhr zeigte Punkt 5.00 Uhr.
Ich hatte vor, heute ins Schwimmbad zu gehen. Es sollte ein sonniger, heißer Tag werden. Ich versuchte wieder einzuschlafen, es gelang mir nicht. Ich dachte an das Haus und an die blondgelockte Frau.
Um 6.35 Uhr stand ich wieder vor dem Haus. Was mache ich da nur? Das Fenster im ersten Stock stand offen. Ich öffnete das Gartentor, ging über den Rasen und stellte mich unter das Fenster. Ich hörte Stimmen. Die Frauenstimme – und ein Kind. Oder ein Mann? Ich konnte nicht alles verstehen, jedoch was ich zu hören bekam, ließ mich erschaudern.
„Los, beeil dich, du elende Kreatur. Vorbereiten! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit! Heute Flieder …!“, sie nannte den Namen eines Parfums. Nach einiger Zeit: „Trink! Zigarette! Feuer! Wehe, das elende, stinkende Gehänge wird nicht ordentlich hart!“ Die Frau schimpfte und keuchte irgendwie seltsam. Dann ein Schrei – ein durchdringender Schrei! „Bitte nein, Madam, bitte nicht, nein …!“ Ich wollte zur Haustür rennen und die Glocke läuten, doch ich war wie gelähmt.
Winseln wie von einem verletzten Tier … Wieder ein Aufschrei. Dann ein Klatschen, ein surrendes pfeifendes Klatschen. Ich hörte nur mehr die Frauenstimme. Ihre Stimme klang nun streng und befehlend, etwas gedämpfter. Die Worte habe ich nicht verstanden.
Ich muss die Polizei rufen, ich muss die Polizei anrufen, ging es mir durch den Kopf, doch ich konnte keinen Finger bewegen.
Dann hörte ich einen Knall. Die Frau hatte das Fenster zugeschlagen. Es war 7.43 Uhr. Langsam rührte ich mich. Ich sollte die Polizei anrufen … Ein anderes Geräusch, ein Heulen! Es kam irgendwie von unten. Ich rannte zu den Kellerfenstern. Ein Wimmern, ein Schluchzen? Ich blickte durch den gekippten Fensterspalt. „Hallo, ist da jemand? Hallo?“ Meine Augen passten sich langsam den unterschiedlichen Lichtverhältnissen an. Ich erkannte eine Gestalt, es war ein Mann. Er stand nackt vor einem Waschbecken. „Kann ich Ihnen helfen? Hören Sie mich? Kommen Sie her zum Fenster. Na los, kommen Sie!“ Der Mann drehte sich in Richtung Fenster. Er hielt die Hände schützend vor sein Glied, die Hände waren blutverschmiert.
Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch war, ich handelte nur mehr rein instinktiv. „Öffnen Sie das Fenster! Los, öffnen Sie das Fenster!“ Er starrte mich an. Ich erkannte, dass er kein Europäer war. „Verstehen Sie mich?“ Er nickte. „Öffnen Sie endlich das verdammte Fenster!“ „Kann man nicht öffnen“, antwortete er sehr leise. Ich versuchte, das Fenster hinunterzudrücken, es bewegte sich nicht. Ich rannte zu einem angeordneten Blumenbeet, nahm den größten Stein und hämmerte auf die Fensterscheiben. Keine bewegte sich. Der Geräteschuppen! „Los, ziehen Sie sich an! Ziehen Sie sich ein Gewand an, ich hole Sie hier raus!“
Der Schuppen war offen. Ich fand einen großen Schlaghammer, mit welchem man normalerweise Holzpfähle in die Erde schlägt. Mit dem Hammer schlug ich auf das gekippte Kellerfenster, bis es endlich herunterbrach.
Plötzlich die Frauenstimme: „Was ist los da unten? Wer ist da?“ Ich streckte eine Hand durch das Fenster. „Los, kommen Sie endlich!“, und zog ihn aus der Öffnung und rannte, ihn hinter mir herziehend, zum Gartentor.
Die Frau schrie: „Du Bastard! Was machst du? Bleib stehen!“ Der Mann stoppte. Ich schüttelte ihn. „Weiter, nicht stehenbleiben, weiter!“ Die Frau mit hysterischer Stimme: „Ich rufe die Polizei! Bleib stehen und dreh dich um, dreh dich um! Das wirst du mir büßen!“ Der Mann wollte sich umdrehen. „Los weiter, hören Sie nicht zu, da ist schon das Tor.“
Die Frau: „Tommy, Tommy! Na warte, wenn du wieder da bist! Tommy!“ Ich rannte so schnell ich konnte, hielt seine Hand und zerrte ihn hinter mir her. Endlich die Straßenbahnstation, die Haltestelle und eine Wartebank. Ich drückte ihn auf die Bank und sah auf die Uhr: 8.24 Uhr. Der nächste Wagon sollte in sechzehn Minuten eintreffen. Vor mir auf der Wartebank saß dieser Mann. Ich betrachtete ihn. Er war bekleidet mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt, welches am Rücken blutverschmiert war. In der Hose steckte ein Handtuch. An seinen Füßen trug er ausgelatschte Badeschlappen aus Gummi. Sein Haar war schulterlang, strähnig und leicht verfilzt. Seinen Kopf hielt er gesenkt und er zitterte. Ich nahm mein Handy und bestellte ein Taxi. Aus meinem Rucksack entnahm ich eine Regenjacke, welche ich immer bei mir trage. Für Notfälle, falls mich das Wetter überrascht. Nun, es regnete zwar nicht – es blutete … Ich legte ihm die Jacke über seine Schultern.
Taxifahrer: „Wohin?“ Ich nannte meine Adresse. „Aber den da nehme ich nicht mit. Ist er besoffen? Er wackelt ja.“ „Nein, er ist nicht besoffen. Bitte, es ist dringend, ich zahle Ihnen auch den doppelten Preis.“ „Na gut, aber dass der Penner ja nicht mein Auto versaut. Ich stelle Ihnen das in Rechnung.“
Ich öffnete meine Wohnungstür. Zum Glück hatte ich keine Nachbarn angetroffen, wie peinlich wäre das gewesen. Ich führte ihn in die Küche und bat ihn, Platz zu nehmen. Er reagierte nicht. „Setzen Sie sich, setzen Sie sich doch.“ Er setzte sich nicht. Ich reichte ihm ein Glas Wasser, welches er sofort austrank. „Haben Sie Schmerzen?“ Keine Reaktion. Er stand mit gesenktem Kopf vor mir und zitterte. Jenny, du musst die Rettung bestellen, sagte ich zu mir selbst. Ein anderes Gefühl in mir sagte: Nein!
Nun handelte ich wie eine professionelle Krankenschwester. „Kommen Sie mit!“ Ich führte ihn ins Badezimmer. „Stellen Sie sich vor das Waschbecken!“ Ich nahm eine Schere und schnitt sein blutiges T-Shirt entzwei. Er stöhnte vor Schmerzen. Sein Rücken hatte Striemen, blutige Striemen. Was war das? Das Klatschen, das surrende Klatschen! Oh mein Gott, das war eine Peitsche?! Ja, es sah nach Peitschenhieben aus.
„Ziehen Sie Ihre Hose aus.“ „Bitte, Madam, bitte nicht.“ Ich zog ihm die kurze Hose herunter. An seinem Glied klebte ein Handtuch, es war blutig. Sein Gesäß war überseht mit grauen Punkten, einer blutete. Ich zog meine Arzthandschuhe an, wusch ihn notdürftig und desinfizierte alle Wunden. Eine weitere Blutung entdeckte ich am After. „Drehen Sie sich um!“ Ich nahm sein Glied in die Hand, auch hier sah ich Blut. Eine offene kreisrunde Wunde an der linken Innenseite seines Penis’. Wundspray und ein Heilpflaster, das sollte vorerst genügen. Alle übrigen Verletzungen versorgte ich ebenso.
Nackt und zitternd stand er vor mir. Ich reichte ihm ein Handtuch, welches er sich rasch um seine Hüften band. Ich führte ihn in die Küche. „Nehmen Sie Platz, bitte“, und deutete auf einen Sessel. Er setzte sich, Kopf gesenkt, und zitterte am ganzen Leib. Ich kochte eine Kanne Kamillentee mit viel Honig. Vielleicht hatte er Hunger? Sein Körper war ausgemergelt. Viel hatte ich nicht anzubieten. So kochte ich einfach eine cremige Kürbissuppe aus der Tüte, welche ich mit dicker Sahne verfeinerte. Nachdem der Tee abgekühlt war, reichte ich ihm eine große Tasse. Er stand auf und trank den Tee hastig aus. „Setzen Sie sich doch.“ Er nahm Platz. Die Frau hatte ihn Tommy gerufen, das war wohl sein Name. „Bitte sehr, Tommy“, und bot ihm einen Teller Suppe an. Erneut stand er auf und leerte den Teller in hastigen Schlucken. Er stöhnte, beugte sich etwas vor und fasste sich an seinen Bauch. Vermutlich ein Magenkrampf. „Sie trinken und essen zu schnell, und bleiben Sie endlich sitzen! Haben Sie heute noch nichts gefrühstückt?“ Er schüttelte den Kopf. „Und gestern Abend?“ Kopfschütteln. „Wann haben Sie zuletzt etwas gegessen?“ „Vor zwei Tagen.“ „Vor zwei Tagen!? Ja wieso denn?“ „Sie ist drei Tage später gekommen. Brot und Käse waren aus.“ Ich verstand nicht, was er meinte.
Ich war genervt und brauchte etwas zur Beruhigung. 12.05 Uhr – zu früh, aber was soll’s, und ich schenkte mir ein Glas mit halb Wasser, halb Whisky ein. Ich zündete mir eine Zigarette an. Tommy sprang auf, wich zurück und starrte entsetzt auf Zigarette und Feuerzeug. „Bitte nicht, Madam, bitte nicht!“ Er schluchzte und zitterte am ganzen Körper. Mein Gott, schoss es mir in den Sinn. Die grauen Punkte, die kreisrunden Wunden … Sofort dämpfte ich die Zigarette aus und räumte den Aschenbecher weg. „Entschuldigung, Tommy. Bitte setzen Sie sich.“ Zitternd saß er mir gegenüber, in seinen Augen stand Panik. „Die Narben auf Ihrem Po, das waren Zigaretten?“ Er senkte den Blick und nickte. Ich reichte ihm einen zweiten Teller Suppe mit drei Scheiben Weißbrot. „Essen Sie noch, aber ganz langsam und im Sitzen. Guten Appetit.“
Ich nahm Whisky, Zigaretten und begab mich auf das WC. Während ich rauchte, bemerkte ich, dass mir Tränen über das Gesicht liefen. Sie hatte ihn ausgepeitscht und Zigaretten auf seinem Körper ausgedrückt! Was ist das nur für ein Mensch? Nein, das ist kein Mensch – sie ist eine Teufelin!!
Er löffelte ganz langsam seinen Teller Suppe leer. „Danke, Madam. Vielen Dank für den Tee, für die Brote und für die köstliche Suppe. Vielen herzlichen Dank.“ Mir wurde es ganz schwer ums Herz und ich war beschämt. Er bedankte sich für eine Tütensuppe, als hätte ich ihm ein Haus geschenkt. Das Haus, ich dachte an das kleine Haus mit den vergitterten Fenstern …
Ich legte meine Arme auf den Küchentisch, er tat es mir nach. Ich nahm seine Hände, erschrocken zog er sie zurück. Dann legte er sie wieder auf den Tisch. So saßen wir uns gegenüber und unsere Fingerspitzen berührten sich fast, aber nur fast. „Tommy, woher kommen Sie?“ Fragend blickte er mich an. „Ich meine, aus welchem Land stammen Sie?“ Sein Kopf senkte sich. Leise antwortete er: „Aus Indien.“ „Aus Indien? Das ist ein schönes Land.“ Ich hatte vor Jahren mit Freunden einen sehr langen Urlaub dort verbracht. Drei Monate lang. Wir bereisten fast ganz Indien.
Sein Blick hob sich, erstaunt sah er mich an. Tommy heißt er. Kein typisch indischer Name. Wahrscheinlich ist er Christ. Nur die christlichen Inder geben ihren Kindern Namen aus der Bibel. „Sind Sie Christ, Tommy?“ Er senkte den Kopf und verneinte. „Sind Sie Hindu?“ Kopfschütteln. „Moslem?“ Kopfschütteln. „Ohne Religionsbekenntnis?“ „Ich bin Sikh“, murmelte er. Sikh, das sind doch die Inder mit dem Turban? Ja genau. Sie leben hauptsächlich im Nordwesten Indiens und stammen ursprünglich aus Pakistan. „Sie sind Sikh und heißen Tommy?“ Er schaute mich an und flüsterte einen Namen. „Wie bitte? Ich habe nicht verstanden.“ Er hatte dunkelbraune Augen, umrahmt mit langen schwarzen Wimpern. Und dunkle Schatten lagen unter seinen Augen. Sein Blick war leer, ganz leer, fast wie tot. Ich erschauderte. „Mein Name ist Balraj (Das J wird im Indischen wie „dsch“ gesprochen; Balraj wird Balradsch ausgesprochen, Raju wie Radschu). Singh Sandhu, meistens werde ich Raju gerufen, das ist die Kurzform.“ „Warum hat diese Frau Sie dann Tommy genannt?“ Erneut senkte er den Kopf. „Sie mochte meinen Namen nicht.“ „Balraj Singh Sandhu“, wiederholte ich. „Das ist ein sehr schöner Name.“ Verwundert fragte er: „Ja?“ „Ja! Ein sehr schöner Name. Darf ich Sie Raju nennen?“ Das erste Mal blitzte ein Leuchten in seinen Augen auf. „Sehr gerne, Madam, sehr gerne. Vielen Dank, Madam.“ Ich selbst hatte mich noch gar nicht vorgestellt, fiel mir ein. „Mein Name lautet Jenny.“ „Jenny, das ist ein wunderschöner Name. Jenny, ein wunderschöner Name.“ „Wissen Sie was, warum duzen wir uns nicht einfach?“ Ich stand auf und reichte ihm meine Hand, diesmal nahm er sie. „Ich heiße Jenny, guten Tag, Raju.“ „Ich heiße Raju, guten Tag, Jenny.“
Ich betrachtete ihn. Sein schwarzes Haar hing ihm in die Stirn. Er hatte breite Schultern und einen breiten Brustkorb, bedeckt mit dichtem schwarz gekräuseltem Haar. Er war viel zu dünn, seine Rippen standen hervor, sein Bauch war eingefallen und er hatte kaum Muskeln.
Ich erschrak! Du meine Güte, sein Handtuch hatte sich erhoben, jetzt hatte er auch noch einen Ständer! Sofort ließ ich seine Hand los. „Sorry, Madam.“ Beschämt senkte er die Augen. Macht nichts, dachte ich. Viele meiner männlichen Patienten bekommen einen Ständer, wenn ich sie pflege, und diese Leute sind meistens schon sehr alt. Er ist jung und er steht sicherlich unter Schock. „Wie alt bist du, Raju?“ „Ich bin dreißig Jahre alt, Madam.“ „Nenne mich nicht Madam. Bitte, nenne mich ganz einfach Jenny.“ „Ich bin dreißig Jahre alt, Jenny.“ Er sah sehr erschöpft aus, er sollte sich ausruhen, er könnte auf dem Küchenboden schlafen.
Meine Wohnung ist klein, es ist jedoch eine Eigentumswohnung. Meine Eltern haben sie mir gekauft, als ich meinen ersten Job annahm. Ich brauche nur mehr die Betriebskosten und den Gas-, Strom- und Wasserverbrauch zu zahlen. Die Wohnung besteht aus Vorzimmer, einem geräumigen Badezimmer, einer Toilette, einer hübschen Küche mit Abstellraum und einem großen Zimmer mit Sitzgarnitur und einem Doppelbett nahe den Fenstern. Ich wohne im fünften Stock. Das Wohnhaus gegenüber besteht aus drei Stockwerken. So habe ich eine freie Aussicht. Am schönsten ist es, wenn ich im Bett liege. Ich sehe nur den Himmel, Wolken, Vögel und nachts die Sterne und den Mond.
In meinem Kellerabteil befindet sich neben allerlei Gerümpel auch eine Matratze. „Ich gehe kurz in den Keller, da ist eine Matratze …“ „Bitte nicht, bitte nicht in den Keller schicken!“ Raju zitterte, sein Penis erschlaffte augenblicklich. Keller, Matratze … Das Haus, das Kellerloch … Ich verstand. „Raju, bitte beruhige dich. Ich gehe in den Keller und hole eine Matratze. Du bist sicherlich müde. Ich werde hier in der Küche einen Schlafplatz für dich vorbereiten, in Ordnung?“ Wenig später war das provisorische Lager fertig.
„Jenny?“ „Ja?“ „Ich muss Sussu bitte.“ „Sussu?“ Er öffnete den Wasserhahn und deutete auf sein Glied. Er wollte urinieren! Harn lassen heißt anscheinend „Sussu“ in seiner Sprache. „Gleich rechts ist das WC“, sagte ich. Doch er ging ins Badezimmer und urinierte ins Waschbecken, als ob dies das Selbstverständlichste auf der Welt wäre.
„Leg dich jetzt schlafen, Raju. Ich bin nebenan im Zimmer. Wenn du irgendetwas brauchst, rufe mich bitte sofort.“ „Danke, Jenny, danke für alles.“ Tränen standen in seinen dunklen Augen.
Ich nahm ein Glas Whisky mit Wasser, setzte mich auf den Toilettendeckel und rauchte. Jenny, was machst du bloß?, dachte ich. Es ist nicht richtig, was du machst. Du kannst doch nicht einfach einen fremden Mann zu dir in die Wohnung bringen. Doch, ich kann schon, und dachte an verschiedene Affären. Aber doch nicht so Einen! Das ist verrückt, das ist nicht richtig! Ich hätte die Polizei verständigen sollen. Die hätten ihn befreien sollen, die hätten ihn ins Krankenhaus einliefern sollen. Wie soll das weitergehen? Jenny, was du machst, ist nicht richtig, es ist falsch, ganz einfach falsch.
Raju lag in der Küche, zugedeckt auf der Matratze. Gott sei Dank, er schlief. Ich hob die Decke und betrachtete ihn. Seitlich, mit eingezogenen Beinen und Kopf lag er da. Er erinnerte mich an ein Baby im Mutterleib, an einen Embryo. Das Handtuch um seine Hüften hatte sich gelöst. Eine Hand hielt seine Hoden, die andere seinen Penis. Die Haare bedeckten sein Gesicht. Er atmete gleichmäßig und ruhig.
Ich nahm ein Glas Whisky mit in mein Zimmer, rief meine Firma an und meldete mich krank. Wenig später läutete mein Handy. Es war Tanja, meine Arbeitskollegin und beste Freundin. „Jenny, was ist los? Die Firma hat mich gerade verständigt, ich muss deinen Wochenend- und Feiertagsdienst übernehmen.“ „Ich habe mich krankgemeldet, Tanja. Es tut mir leid, dass du einspringen musst.“ „Kein Problem, aber was fehlt dir denn?“ „Nichts, ich bin nicht krank. Ich brauche nur ein paar Tage, oder länger. Ich habe Wichtiges zu erledigen. Hör zu, ich rufe morgen an und erzähle dir alles.“
Ich setzte mich aufs Bett und schaltete den Fernseher ein. Es war 17.16 Uhr. Aus der Küche ertönten Geräusche. Raju stöhnte: „Bitte nicht, Madam, bitte nicht, auu, nein …“ Ich rüttelte ihn leicht an den Schultern. Mit panischen Augen starrte er mich an, sein ganzer Körper zitterte. „Raju, du hast geträumt, es war nur ein böser Traum. Es ist alles gut. Du bist hier bei mir, bei Jenny.“ Er setzte sich auf und überkreuzte seine Beine. Angst stand in seinen Augen, er zitterte noch immer. Morgen muss ich unbedingt Beruhigungsmittel besorgen, überlegte ich. „Hast du Schmerzen, Raju?“ „Ein wenig.“ Er deutete auf seine rechte Schulter, auf seinen Penis und auf seinen After. „Musst du vielleicht Stuhl absetzten?“ Er schaute auf den Küchenstuhl, dann fragend auf mich. Er verstand nicht. Ich zeigte auf mein Gesäß und machte Pressgeräusche. „Nein, ich muss nicht Toilet“, antwortete er. Urin heißt „Sussu“, Stuhl heißt „Toilet“. Na gut, wieder eine neue Sprache gelernt. Ich schmunzelte. „Hör zu, Raju, wenn du Toilet musst, sage es mir. Ich muss dir vorher das Pflaster entfernen. Komm, setze dich.“ Ich deutete auf den Küchenstuhl. Da saß er nun und zitterte noch immer. Ich nahm zwei Gläser und füllte sie mit halb Whisky, halb Wasser und reichte ihm eines. „Da, trink, zur Beruhigung!“ Er nahm das Glas und stand auf. „Raju!“ Erschrocken blickte er mich an. Er zitterte so stark, sodass etwas Whisky verschüttet wurde. „Raju, bitte setze dich und trink in Ruhe. Du musst dich nicht fürchten. Ich tue dir nichts. Ich bin Jenny und nicht diese … diese Teufelin.“ Er nahm Platz und trank einen Schluck, dann noch einen. Sein Gesicht verzerrte sich und er fasste sich an den Bauch. „Hast du Schmerzen?“ Kopfnicken. Seine Hand bildete eine Faust. Ich verstand. Er hatte einen Magenkrampf. Ich wollte eine Schmerztablette holen, doch er hatte Whisky getrunken, so lies ich es. Er nahm noch einen Schluck. „Besser“, sagte er, und dann: „Ich hasse Wodka.“ „Das ist kein Wodka, das ist Whisky.“ „Ich weiß, Jenny. Es ist ein guter Whisky.“ Dann wiederholte er: „Ich hasse Wodka!“ „Hast du Hunger, Raju?“ Er senkte seinen Kopf und antwortete nicht. Wahrscheinlich hat er Hunger. Er getraut es sich nur nicht zu sagen. Ich bereitete Käse-Schinkentoasts mit Paprika vor. Raju aß vier Stück. Besonders begeistert war er von dem frischen roten Paprika. Er stand auf und blickte auf meine Hände. Fragend sah er mich an. Ich streckte ihm meine Hände entgegen, er nahm sie und drückte sie sanft. „Danke, Jenny. Danke für das wundervolle warme Essen, danke für Alles!“ In seinen Augen standen Tränen. „Jenny? Schickst du mich wieder in das Haus? Muss ich wieder zurück?“ Jetzt stand Angst in seinen Augen, große Angst. „Nein, Raju, ich schicke dich nicht zurück. Du musst nicht mehr in dieses Haus und zu dieser Frau, dieser Teufelin.“ Seine Angst wechselte in große Erleichterung. Dann, mit fragendem ängstlichem Blick: „Jenny, darf ich bei dir bleiben? Darf ich für immer bei dir bleiben?“ „Einstweilen ja.“ „Bitte, Jenny, schick mich nicht fort, bitte. Ich möchte immer hier bleiben, in deinem schönen Badezimmer und deiner schönen Küche. Ich möchte für immer bei dir bleiben, Jenny. Bitte!“
Wie soll das alles weitergehen? Doch ich wollte ihn nicht verängstigen und nickte. Raju fing an zu weinen, die Tränen liefen über sein Gesicht und tropften auf seine schwarzen Brusthaare. Schluchzend stammelte er. „Ich danke dir, Jenny, ich, ich …“ Sanft drückte ich ihn auf den Sessel und schob ihm ein zweites Glas Whisky zu. Ich streichelte sein zerzaustes Haar. Er trank und beruhigte sich etwas. „Trink langsam, ich komme gleich.“
Ich saß am WC, rauchte, und auch mir liefen die Tränen über die Wangen. Was für ein Mann … So freundlich, dankbar und sensibel. Eingesperrt und misshandelt … Oh, wie hasse ich diese Frau!
„Raju, komm, ich zeige dir die ganze Wohnung.“ Sorgfältig schaute er sich in meinem Zimmer um. Lange stand er vor der Glasvitrine. Ich sammle leidenschaftlich gerne Elefanten, die Vitrine war voll davon. „Du magst Elefanten gerne, nicht wahr, Jenny?“ Ich bejahte. „Elefanten vergessen nicht“, flüsterte er. Dann sah er mich an. In seinen Augen las ich Wärme, Dankbarkeit und noch irgendein Gefühl. Was war das für ein Gefühl? Ich konnte es nicht zuordnen. „Ich vergesse auch nicht, Jenny. Ich werde dich nie vergessen, niemals!“ Er ging zum geöffneten Fenster und atmete tief ein. „Du wohnst sehr hoch, das ist schön. Deine ganze Wohnung ist sehr schön“, und er blickte lange auf mein Bett.
„Ich muss Sussu, Jenny, ich komme gleich.“ Nach zehn Minuten schaute ich nach. Vielleicht war ihm übel geworden? Er stand vor dem Waschbecken im Bad, nackt, und masturbierte. Unglaublich! Einfach unglaublich!
Raju
Ich streichelte meine Hoden und dachte an Jenny. Sanft streichelte ich mein erregtes Glied. Ein warmes Gefühl durchströmte meinen Körper. Ich fühlte die Sonne kommen. Sie kam von unten in Schüben. Es tat so gut. Ich streichelte meine Eichel und umkreiste mit den Fingern meinen Ring. Die Sonne stieg immer höher. Ich stöhnte und massierte zärtlich meine Hoden, meinen Penis, die Eichel, den Ring. Ich wollte, dass es lange andauert, dieses wundervolle Gefühl, die Sonne, in immer heißer werdenden Schüben. Ich stöhnte vor Lust. Hart und sehr steif war mein Penis. Bitte, lass es lange andauern. Immer heißer, immer schneller, die Sonne … Ich massierte fester, drückte die Hoden, es tat so gut, so gut, dann kam ich. Liebevoll hielt ich mein Glied und strich mit den Fingern durch den weißen Saft. Ich wartete, bis mein Penis schlief, dann wusch ich ihn sanft. Ich reinigte meine Hände, das Waschbecken und band mir das Handtuch um.
Ich blickte in den Spiegel. Ich blickte in meine Augen. Lange, sehr lange. Ich schloss meine Augen und strich mir über die Lider. Dann öffnete ich sie wieder. Ganz nah trat ich an den Spiegel heran und blickte tief in meine Augen. Es war weg! Abermals schloss und öffnete ich meine Augen. Es war weg! Tatsächlich, es war ganz einfach nicht mehr da. Es war weg! Die Leere, das Tote – weg! Es war verschwunden. Ruhig schauten sie mich an, meine Augen.
Sie hat mir mein Leben zurückgegeben. Sie hat mir meinen Namen zurückgegeben. Sie hat mir meine Augen zurückgegeben.
Was für eine Frau, was für eine wunderbare Frau sie ist. Wie sanft ihre Stimme klingt. Sie schimpft nicht. Sie schreit nicht. Sie lächelt. Sie hat mich angelächelt. Sie hat mich öfter angelächelt. Sie hat „bitte“ zu mir gesagt. „Bitte setzen Sie sich“, hat sie gesagt. Ihre Hände. Mit ihren Händen hat sie mich gewaschen. Mit ihren Händen hat sie meine Wunden versorgt. Sie hat mit ihren Händen meine Wunden verbunden. Keine neuen Wunden hat sie geschlagen. Mit ihren Händen hat sie mich berührt. Sie hat meine Hände gehalten. Ganz sanft und weich hat sie sie gedrückt. Sie hat mir warmes Trinken und warmes Essen gegeben. Mit ihren Händen … Nicht in den Keller hat sie mich geschickt. Die Matratze – eine saubere Matratze. Ein Leintuch hat sie daraufgelegt. Ein sauberes Leintuch. Die Decke, das Polster. Sie riechen so gut. Sie riechen nach ihr.
Ich danke dir von ganzem Herzen, Gott. Du hast mir diese wundervolle Frau geschickt. Danke! Bitte lass mich bei ihr bleiben. Bitte, sie soll mich nicht wegschicken, bitte! Lass mich wieder gesund werden und stark. Ich möchte für sie stark sein. Ich möchte sie beschützen.
Ruhig blickten meine Augen mich an. Etwas Glanz konnte ich erkennen. Und Glück …
Jenny
Nach ungefähr dreißig Minuten stand er im Zimmer. Der Fernseher lief. „Leg dich etwas hin, Raju. Versuche zu schlafen.“ Er blickte auf mein Bett, sah mich an, drehte sich um und ging. „Gute Nacht, Jenny.“
Nach einer Weile kam er zurück. Was ist denn jetzt schon wieder, dachte ich gereizt. „Jenny?“ „Jaaa!“ „Jenny.“ Er trat langsam an mein Bett. Er nahm meine Hände in die seinen. „Jenny, du hast mir mein Leben zurückgegeben. Du hast mir meinen Namen zurückgegeben. Du hast mir meine Augen zurückgegeben.“ Ich schaute in seine Augen. Ein schwaches Leuchten, Ruhe, Ernsthaftigkeit, Dankbarkeit las ich in ihnen. Warm blickten sie mich an. Und dieses andere Gefühl stand in seinen Augen. Was war das bloß? „Gute Nacht, Jenny.“
Bevor ich mich schlafen legte, sah ich nochmals nach ihm. Ich hob seine Bettdecke an. Raju lag auf der Seite. Das Handtuch hatte er abgelegt. Eine Hand lag auf seinem Bauch, die andere bedeckte sein Glied, als ob er es schützen wollte. Ich dachte an die Zigarette. – Ja, er beschützt sein Glied.
Es war Freitag. Ich erwachte und hatte Durst. Die Uhr zeigte 6.17 Uhr. Leise ging ich in die Küche, um Wasser zu trinken. Raju war wach. Er saß mit überkreuzten Beinen auf der Matratze, das Handtuch um die Lenden geschlungen. „Guten Morgen, Raju. Du bist schon wach?“ „Ja, seit fünf Uhr.“ „So lange schon? Konntest du nicht mehr schlafen?“ „Ich habe sehr gut geschlafen, Jenny.“ Ich schüttelte verwundert den Kopf. An meinen freien Tagen schlief ich oft bis in die Mittagszeit hinein.
„Möchtest du Tee trinken?“ „Darf ich den Tee kochen, Jenny? Ich möchte auch etwas für dich tun.“ „Ich bevorzuge Kaffee in der Früh.“ Er bereitete alles zu und wir saßen am Küchentisch und tranken, er Tee, ich Kaffee.
„Ich wechsle dir zuerst den Verband. Danach frühstücken wir, einverstanden?“ Er nickte. Nachdem ich meine Arzthandschuhe übergestreift hatte, entfernte ich alle Verbände. Nackt stand er vor mir. Sein Rücken war durchzogen von dunklen Linien, kreuz und quer bildeten sie ein makaberes Bild. Es erinnerte mich an abstrakte Kunst. Am schlimmsten war die rechte Schulter betroffen. Ein langer tiefer Riss verlief vom Nacken schräg über sein Schulterblatt hinab bis zu den unteren Rippen. Drei weitere Risse waren ebenso tief, jedoch etwas kürzer. Zum Glück waren die Blutungen gestoppt. Mit einer sterilen Lösung entfernte ich so gut als möglich das getrocknete Blut. Raju stöhnte. „Es sieht schon viel besser aus“, log ich. Auch die Wunde am Gesäß blutete nicht mehr, nur aus dem After tropfte ein wenig Blut. „Raju, bitte beuge dich etwas mehr nach vorne. Ich werde dein Popoloch untersuchen.“ Vorsichtig schob ich einen Finger in seinen After und tastete ihn ab. Ich fühlte Hämorrhoiden. Raju schrie laut auf: „Bitte nicht, Madam, bitte nein …!“ Ich wusste, er war in diesem Augenblick in dem Haus, in dem verfluchten Haus, bei dieser verfluchten Frau. „Raju, es ist vorbei. Ich bin es, Jenny! Raju, Raju, ich bin es. Sieh mich an, Raju!“ Er zitterte und schluchzte und schrie. Ich drehte ihn zu mir um und hob sein Kinn. „Raju, sieh mich an, sieh mich an!“ Blankes Entsetzen und Irrsinn standen in seinen Augen. „Raju, ich bin es, Jenny. Es ist vorbei, es ist alles gut.“ Langsam erkannte er mich. „Du hast Hämorrhoiden, das ist nicht so schlimm. Ich weiß, es tut sehr weh, aber das kann man operieren lassen.“ Er verstand kein Wort, aber er beruhigte sich etwas. „Jenny? Jenny, warum hast du mir wehgetan?“ Mit weit aufgerissenen Augen starrte er mich an. „Ich wollte dir nicht wehtun. Bitte glaube mir, Raju. Ich habe nur dein Popoloch untersucht. Das hat wehgetan, jedoch ich wollte dir nicht wehtun. Ich würde dir nie wehtun! Verstehst du, Raju?“ Er nickte und senkte seinen Blick. Ich ahnte, dass er mir nicht vertraute, noch nicht … Raju ist ein gebrochener Mann!
„Ich werde jetzt alle offenen Wunden versorgen, ja?“ Sein Kopf war gesenkt, die Haare hingen ihm ins Gesicht, er nickte nur. Ich zeigte ihm eine Tube. „Schau, Raju, das ist eine Heilsalbe. Diese werde ich dir jetzt am Rücken und Po auftragen, darf ich?“ Kopfnicken. Still ließ er die Prozedur über sich ergehen. „Stell dich bitte zum Waschbecken.“ Ich wechselte die Gummihandschuhe und begann seinen Rücken einzucremen. Er stöhnte. „Ich bin ganz vorsichtig, Raju. Es dauert nicht lange.“ Ein leichtes Zittern erfasste seinen Körper. Erneut stöhnte er. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so wehtat. Ich cremte ja nur seine Narben und keine offenen Wunden ein. „Tut es denn so weh?“ „Nein, Jenny, es tut nicht weh. Du streichelst so gut, es tut so gut.“ Ich lachte. „Raju, ich streichle nicht, ich trage eine Heilsalbe auf.“ „Du streichelst die Heilsalbe sehr gut auf.“ Er keuchte und ich wusste, es war kein Schmerz. Er stöhnte vor Lust. Ich sah nach unten. Oh Gott, er hatte schon wieder einen Steifen. Ich trat etwas zurück. „Bitte, Jenny, streichle weiter auf, auch den Popo, bitte, Jenny.“ Ich dachte, was soll’s. Sex hilft auch, Stress abzubauen und er hatte davon wahrlich genug. Sein Körper bebte. „Du streichelst wunderbar, bitte streichle lange, Jenny.“
– Was tue ich da nur? Ich sollte sofort aufhören. Das ist nicht normal, Jenny. Hör auf! Er ist ein Patient, behandle ihn wie einen Patienten! Mach die normale Pflege und aus! –
Und doch … ich genoss es und spürte ein Kribbeln in mir. Meine Vagina wurde feucht.
Er erschauderte. „Sie hat mich nie gestreichelt, nie hat sie mich gestreichelt. Sie hat mich nie angefasst.“ Ganz stark zitterte er und fing zu weinen an. „Nie hat sie mich gestreichelt …“ Und dann erbrach er ins Waschbecken. Ich öffnete den Wasserhahn und spülte das Erbrochene fort. „Sorry. Sorry“, weinte er. Hektisch und zitternd wischten seine Hände im Becken herum, er erbrach nochmals. „Tut mir leid, Jenny. Sorry!“ „Beruhige dich, Raju. Es ist nichts passiert, es macht nichts. Komm, setz dich, es ist nichts Schlimmes. Ich verstehe dich, Raju. Es ist nicht deine Schuld. Bitte hör auf zu weinen, es wird alles gut, weine nicht, Raju.“ Er wusch sich Gesicht und Hände und spülte seinen Mund. Mit wackeligen Knien setzte er sich auf den Badewannenrand. „Sieh mich an, Raju. Es ist nicht deine Schuld.“ Mit tränenüberströmtem Gesicht blickte er mich an. „Ich wollte das nicht, Jenny. Ich wollte nicht dein Waschbecken schmutzig machen – und das Essen, das gute Essen, ich habe es ausgekotzt. Mein Gott, ich habe dein Essen nicht mehr“, und er griff sich an den Bauch. „Du hast mich gestreichelt, so sanft. Und ich? Ich mache alles schmutzig!“ Ich reichte ihm eine Küchenrolle. „Trockne deine Tränen!“
In meinem Kopf wirbelten die Gedanken durcheinander. – Reiß dich zusammen, Jenny! So geht das nicht! Bewahre Distanz, Jenny! Warum habe ich ihn überhaupt zu mir nach Hause genommen? Ich muss verrückt sein. Handle logisch, denke nach, handle logisch!
Ich stand in der Küche und bereitete das Frühstück vor. Raju kam, das Handtuch um die Hüften gewickelt. „Kann ich dir helfen, Jenny?“ „Nein, lass mich einfach in Ruhe!“ „Es tut mir so leid, Jenny.“ „Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe!“ Er zuckte zusammen, setzte sich auf die Matratze und hielt den Kopf gesenkt.
Ich muss einen vernünftigen Plan fassen. Ich werde heute Tanja anrufen, ich brauche seelischen Beistand.
Normalerweise nahm ich meine Mahlzeiten im Bett ein, meistens vor dem Fernseher. Ich beschloss, dies ab sofort wieder zu tun. Soll er doch alleine in der Küche essen, mir egal. Soll er doch froh sein, dass er überhaupt etwas bekommt. Und seine ständige Heulerei. Weichei, dachte ich wütend. Augenblicklich hatte ich Lust auf ein weiches Ei. Ich schmunzelte … Weichei! Während die Eier kochten, legte ich ein Tischtuch auf mein Bett, ich nannte es Esstuch. Raju saß immer noch in gleicher Körperhaltung auf der Matratze. Ganz schwer wurde es mir ums Herz. Ich schämte mich. „Raju?“ Er hielt den Kopf gesenkt und fragte leise: „Ja?“ „Komm, Raju, lass uns frühstücken.“ Er wollte sich auf den Küchenstuhl setzen, ich nahm ihn bei der Hand und führte ihn ins Zimmer. „Heute essen wir hier“, und deutete auf mein Bett. Unglaublich sah er mich an, er fand keine Worte. „Setze dich bitte, Raju. Ich bringe das Frühstück.“ Er aß drei weichgekochte Eier und vier belegte Brote mit Aufstrich, Lachs, Schafkäse und eine Handvoll Nüsse und Mandeln. Dazu trank er drei Tassen Kräutertee mit Honig. Ganz langsam und bedächtig aß er. Zwischendurch blickte er mich immer wieder an oder streichelte seinen Bauch. In seinen Augen standen Freude, Dankbarkeit, Wärme und … Nun wusste ich dieses andere Gefühl zu deuten: Liebe! Aus seinen großen dunkelbraunen Augen strahlte Liebe. Tiefe, innige Liebe und ich wusste, sie galt mir.
Meine Güte, er hatte sich in mich verliebt! Das wird ja immer schlimmer! Bleib sachlich, Jenny. Bleib vernünftig!
„Raju, ich muss dann weggehen.“ „Du gehst weg?“ Abermals stand Furcht in seinen Augen. „Ich muss zu meinem Hausarzt und mich krankschreiben lassen.“ „Du bist krank? Was fehlt dir denn, Jenny?“ „Mir fehlt gar nichts, ich hätte morgen wieder Dienst, aber ich kann dich doch nicht alleine lassen. Es gibt so viel zu erledigen, deshalb nehme ich mir ein paar Tage frei und beantrage Krankenstand. Verstehst du?“ Er nickte. „Außerdem muss ich in die Apotheke und Lebensmittel einkaufen. Kann ich dich solange alleine lassen?“ Er bejahte. Zusammen räumten wir ab, er bestand darauf, das Geschirr zu waschen. Ich machte mich ausgehfertig. „Raju, ich gehe jetzt. Du kannst dich ausruhen oder was immer du willst“, und ich dachte an seinen Penis und an seine Erektionen.
Raju
Jenny ging und zog die Tür hinter sich zu. Kein Schlüssel drehte sich im Schloss. Sie hatte vergessen zuzusperren. Ich rannte zur Tür, öffnete sie. Gott sei Dank, sie war noch da und stand vor dem Aufzug. „Jenny, du hast vergessen zuzusperren.“ „Warum soll ich zusperren? Du bist ja da. Du wirst schon auf die Wohnung aufpassen und von außen kann eh keiner rein.“ Sie deutete auf den Türknopf, lächelte mich an und stieg in den Lift. Sie hat mich nicht eingesperrt. Was für eine Frau, was für eine wundervolle Frau! Ich durchquerte die ganze Wohnung und schaute mir alles noch einmal genau an. Ich fand keine Peitsche und keinen Stock. Nur einige Regenschirme standen im Vorzimmer. Zum Schluss stand ich vor ihrem Bett und strich mit der Hand über jene Bettseite, auf der sie saß und schlief. Es duftete nach Jenny. Tief sog ich ihren Duft in mich ein. Mein Penis stand auf, die warme Sonne kam in mich hinein. Ich dachte daran, wie sie mich gestreichelt hatte. Sie hatte mir mit ihren weichen Händen Salbe aufgestreichelt. Wie gut sie das konnte.
Im Bad stand ich vor dem Waschbecken und blickte in den Spiegel. Tiefe Schatten lagen unter meinen Augen. Doch die Augen selbst, sie sahen glücklich aus. Die Leere war nicht zurückgekommen. Ich streichelte meine Hoden und berührte mein Glied und dachte an Jennys Hände. Langsam streichelte ich meine Hoden und meinen Penis und schloss die Augen. Meine Eichel war feucht, ich strich über den Ring. Die Sonne wurde immer wärmer, sie strömte in Schüben durch meinen Körper. Es waren Jennys Hände, nicht meine. Es waren ihre Hände, die mich streichelten. „Bitte streichle lange, Jenny“, flüsterte ich. Sie streichelte so gut, sanft drückte sie meinen harten Penis. Ihre Finger liebkosten die Eichel und den Ring. Nun massierte sie. Die Sonne war heiß. Immer schneller und fester massierte sie. Oh, Jenny! Mein Saft spritzte in ihre Hände, sie lächelte.
Nach einer Weile öffnete ich die Augen. Zähflüssiger weißer Saft klebte in meiner Hand. Ich wusch und trocknete mich und wartete, bis mein Penis schlief. „Und es waren doch ihre Hände“, sagte ich liebevoll zu ihm.
Jenny
Ich hatte Glück und musste beim Arzt nicht lange warten, erhielt die Krankenbestätigung und ein Rezept für Schmerztabletten sowie für Beruhigungsmedikamente und Vitaminpräparate. Auf dem Weg zur Apotheke fiel mir ein, dass Raju ja nichts zum Anziehen hatte. So besuchte ich das Einkaufszentrum. Ich gehöre nicht zu den Frauen, die gerne shoppen gehen. Ich kaufe Kleidung nur, wenn ich unbedingt ein neues Stück brauche. Doch jetzt fiel ich in einen wahren Kaufrausch. Ich stellte mir vor, wie sehr er sich freuen würde, und mein Herz pochte wild. An der Kasse erschrak ich doch ein wenig und bekam ein mulmiges Gefühl bei dem Gedanken an mein Bankkonto. Ach egal! Mit zwei prall gefüllten Taschen verließ ich das Geschäft. Ich besorgte die nötigen Dinge aus der Apotheke und begab mich auf den Weg nach Hause. In den Supermarkt würde ich später gehen, mehr konnte ich wirklich nicht schleppen.
Leise öffnete ich die Wohnungstür, vielleicht schlief er ja. Aus meinem Zimmer hörte ich ihn reden. Ich stellte die Taschen ab. Im Türrahmen blieb ich überrascht stehen. Raju kniete an meiner Bettseite auf dem Parkettboden, er hatte die Hände gefaltet. Er betete. Er betete in seiner Heimatsprache. Ganz anders klang seine Stimme. Kraftvoll und flüssig kamen die Worte aus seinem Mund. Schön klangen die fremden Worte. Mehrmals vernahm ich meinen Namen – Jenny. Bis jetzt hatte ich ihn nur kurze verschüchterte Sätze in meiner Sprache sprechen hören, die er nicht ganz beherrschte. Wie verzaubert stand ich da und sah ihn an. Mit seinem um das Becken geschlungenen Handtuch, den Rücken vollgepflastert, betete er. Dreimal berührte er mit seiner Stirn den Boden. Ich schlich mich langsam zurück.
Im Vorzimmer rief ich: „Raju, ich bin wieder da!“ Er kam mir entgegen. „Ich habe dir etwas mitgebracht“, und deutete auf die Taschen. „Was ist das, Jenny?“ „Etwas Gewand, komm hilf mir!“ Ich öffnete den großen Kleiderschrank im Vorzimmer. „Ich werde dir ein Abteil für die Kleidung überlassen, welche ich dir besorgt habe. Du kannst ja nicht andauernd nur mit einem Handtuch um die Hüften herumlaufen.“ So räumten wir gemeinsam den Schrank aus. Die Kleiderbügel ließ ich hängen. Ich sollte sowieso mal ausmisten. „Bring die Taschen in mein Zimmer, Raju. Ich muss noch einmal weg, in den Supermarkt.“ Ich wollte auch endlich Tanja anrufen. „Einstweilen kannst du die Sachen auspacken und in den Kleiderschrank räumen. Schneide die Etiketten heraus, sie kratzen sonst deine Haut.“ Verdattert stand er da. Ich ließ ihn stehen, nahm meinen Einkaufswagen und ging.
Raju
Jenny ging, wieder verschloss sie die Eingangstür nicht. Ich begann die Taschen auszupacken und legte die Sachen auf ihr Bett. Fünf T-Shirts, zwei kurzärmelige Hemden, zwei langärmelige Hemden, zwei knielange Sommerhosen, eine schwarze und eine hellblaue Jeanshose, ein schwarzer Ledergürtel, fünf enge Unterhosen, fünf weite Unterhosen, fünf Paar Socken, ein Jogginganzug, ein leichter Wollpullover, eine Regenjacke, sowie ein Paar Sandalen und ein Paar Sportschuhe.
Jenny
Was soll ich heute kochen?, überlegte ich. Er braucht was leicht Verdauliches, wegen seiner Hämorrhoiden. Ich dachte an Spinat. In der Nähe gibt es ein indisches Lebensmittelgeschäft, in dem ich öfter einkaufe. So ging ich dort hin. Der Inder packte mir alles ein, was er für notwendig hielt, nachdem ich ihm die Sachlage erklärt hatte. Im Supermarkt kaufte ich das Restliche. Mein Einkaufswagen war voll.
Auf dem Weg nach Hause nahm ich einen Umweg durch einen nahegelegenen Park. Ich setzte mich auf eine Bank, rauchte eine Zigarette und rief Tanja an. „Hallo Tanja, ich bin es, Jenny.“ Ich erzählte ihr die ganze Geschichte. Ich hörte sie durchs Telefon schnaufen: „Bist du verrückt? Warum hast du nicht die Polizei gerufen und die Rettung? Die hätten ihn befreien sollen und ins Spital schicken können. Oder besser in eine psychiatrische Klinik.“ „Er gehört doch nicht in eine Klapsmühle!“ „Natürlich gehört er dorthin. So wie du ihn beschreibst, ist er ja nicht ganz dicht im Kopf. Außerdem hätte die Polizei gleich diese Frau verhaften können. Mensch, Jenny, warum hast du das getan?“ Ja, warum hatte ich das getan? Ich wusste darauf keine Antwort. „Jenny, ich komme nach Dienstschluss vorbei!“ „Nein, Tanja, bitte heute nicht. Er ist gestresst genug.“ „Ich will seine Wunden sehen. Hoffentlich hast du sie richtig versorgt! Was ist, wenn er eine Blutvergiftung bekommt!? Mensch, Jenny, dir kann eine Anzeige und sicherlich eine Strafe, vielleicht sogar eine Gefängnisstrafe drohen!“ „Wieso das denn?“ „Wieso? Entführung, Unterlassung ärztlicher Hilfe …“ „Tanja, ich bin eine erfahrene Krankenschwester, wie du ja sicher weißt. Außerdem habe ich ihn nicht entführt, sondern ihm zur Flucht verholfen. Verdrehe mir bitte nicht die Worte im Mund!“ „Schick ihn ins Krankenhaus, bitte, Jenny.“ „Er ist psychisch sehr belastet und nervlich am Ende. Im Krankenhaus, all die fremden Menschen, das würde er nicht verkraften.“ „Ich glaube, ihr gehört beide in die Klapsmühle, dort könnt ihr euch ja Händchen halten.“ „Tanja, bitte!“ „Ist ja wahr! Pass auf, ich rufe dich gleich zurück“, und sie legte auf. Ich dachte über ihre Worte nach. Eigentlich hatte sie recht. Es war nicht richtig, was ich tat und es war verantwortungslos. Trotzdem, ein Gefühl in mir sagte: Es ist richtig! Nach einigen Minuten klingelte das Handy. „Ich bin es wieder. Hör zu, ich habe morgen meine ersten beiden Frühdienste abgegeben. Um 7.30 Uhr bin ich bei dir. Keine Widerrede! Wenn du nicht öffnest, hole ich die Polizei!“ Widerwillig sagte ich zu. Ich kannte meine resolute Freundin. „Ruf mich am Abend an!“ Wir vereinbarten eine Uhrzeit. „Wenn du nicht anrufst, komme ich mit den Bullen!“
Zu Hause angekommen, fand ich Raju vor meinem Bett mit überkreuzten Beinen am Boden sitzend vor. „Was machst du da, Raju?“ Er deutete auf die Kleidungsstücke. „Ich kann sie nicht anziehen, Jenny.“ „Wieso denn nicht?“ „Sie sind alle neu und sicher sehr teuer.“ „Mach dir über den Preis keine Sorgen. Ich schenke sie dir, ich schenke sie dir sehr gerne, Raju.“ „Ich kann sie nicht anziehen, weil, weil …“ Er fing zu weinen an. Mein Gott, was für eine Heulsuse, dachte ich wütend. Ich ließ ihn sitzen, ging aufs WC und rauchte. Nach dem Gespräch mit Tanja war mein Nervenkostüm angekratzt genug. Als ich mich etwas beruhigt hatte, ging ich zurück zu ihm. Er saß auf dem Boden, den Kopf gesenkt. Wenigstens hatte er zu heulen aufgehört. „Jetzt sag mir bitte, warum du die Sachen nicht tragen willst. Sie sind ein Geschenk und es ist unhöflich, ein Geschenk abzulehnen.“ „Ich bin zu hässlich, Jenny.“ „Zu hässlich? Du bist doch nicht hässlich!“ „Ich bin schmutzig, Jenny“, und er deutete auf seinen Rücken. „Raju“, ich nahm seine Hände, „Raju, du bist nicht hässlich. Du bist sauber. Es sind Wunden und kein Schmutz und das ist auch nicht deine Schuld! Bitte sieh mich an.“ Ängstlich und verstört schaute er mich an. Was für ein gebrochener Mann. Ohne Selbstbewusstsein. Freundlich lächelte ich ihm zu. „Komm, Raju, steh jetzt auf und schneide die Etiketten heraus. Probiere doch ein paar Sachen.“
Ich räumte den Einkaufswagen leer und breitete alles auf dem Küchentisch aus. Danach verstaute ich die Arzneimittel.
Auf dem Bett lagen die Kleidungsstücke fein säuberlich zusammengelegt. Raju strich über die schwarze Jeans. „Zieh sie doch an, bitte.“ Vorsichtig schlüpfte er in die Jeans. Sie war etwas zu weit. Ich reichte ihm den Gürtel. „Normalerweise gehört auch eine Unterhose darunter“, schmunzelte ich. Er schnallte sich den Gürtel um. „Sehr fesch, Raju. Du schaust wirklich gut aus. Fehlt nur noch ein Oberteil.“ Er brauchte eine Ewigkeit, bis seine Wahl auf ein kurzärmeliges kariertes Leinenhemd fiel. Sorgsam steckte er sich das Hemd in die Hose. Fragend sah er mich an. „Komm, Raju.“ Ich ging mit ihm zum Aufzug und betätigte den Knopf. Im Lift gab es einen großen Spiegel, ich hatte nur einen kleinen und schmalen in der Wohnung. Die Aufzugtür öffnete sich. Raju trat erschrocken zurück. Vielleicht dachte er, ein Mann steht im Lift. Dann erkannte er den Spiegel und sein Abbild. Lange betrachtete er sich. Von vorne, von den Seiten und soweit es ging von hinten. Dann lächelte er. Mein Herz tat einen Sprung. Das erste Mal, dass ich ihn lächeln sah. „Raju, du lächelst. Du lächelst!“ Er berührte seine Lippen und lächelte. Er drehte sich zu mir um, lächelte mich an und seine Augen leuchteten vor Freude, obwohl auch Tränen in ihnen standen. Zurück in der Wohnung nahm er meine Hände und drückte sie sanft. „Jenny, jetzt hast du mir auch mein Lächeln zurückgegeben.“
„Es gibt noch zwei Überraschungen für dich.“ Ich ging ins Badezimmer: „Das ist eine Körperlotion, weil du eine sehr trockene Haut hast. Damit cremst du dir deinen Körper ein, ja? Hier, Gesichtscreme und Shampoo und eine Haarpackung und hier …“ Ich plapperte und plapperte und freute mich so sehr, dass er sein Lächeln wiedergefunden hatte. „Aber, du schaust ja gar nicht“, und zeigte auf die Pflegeprodukte. „Doch, Jenny, ich schaue. Ich schaue dich an“, und Dankbarkeit, Wärme und Liebe strahlten aus seinen Augen.
„Komm in die Küche, Raju. Hilf mir die Lebensmittel einzuräumen.“ Sein Blick fiel auf den Reis. „Jenny, das ist Basmati-Reis. Du hast Basmati-Reis gekauft? Saak, das ist Saak.“ Er zeigte auf die Senfblätter, den indischen Spinat. „Chili, Ingwer, Koriander, Hülsenfrüchte, roter Paprika …“ Er zählte alle Lebensmittel in seiner Sprache auf. Es war schön, der exotischen Sprache und seiner Stimme zuzuhören. Gemeinsam verstauten wir alles und auch die Sachen aus dem Supermarkt. „So viel gutes Essen hast du gekauft, Jenny. So viel Geld hast du ausgegeben.“ Abermals nahm er meine Hände in die seinen. „Es wird der Tag kommen, an dem ich dir alles zurückgeben kann, was du für mich getan hast“, sagte er mit ernstem Blick.
Mittlerweile war es früher Nachmittag geworden. „Raju, räume deinen Kleiderkasten ein. Dann ruhe dich aus. Du bist schon seit fünf Uhr munter.“ „Ich bin nicht müde, Jenny.“
Ich zog mich um, Leggins und T-Shirt. „Schau, Jenny.“ Raju stand vor dem Kleiderschrank. Er hatte sich wieder ein Handtuch um die Hüften geschlungen. Ordentlich sortiert lagen die Sachen im Schrank. „Möchtest du nicht eine kurze Hose oder den Jogginganzug anziehen?“ Kopfschütteln. „Zu Hause nicht.“ Zu Hause! Er hatte zu Hause gesagt. Mein Herz war tief berührt. Seit gestern war er hier und nannte es schon „zu Hause“. Ich betrachtete ihn. Seine breiten Schultern, seine breiten Hände mit den langen schlanken Fingern. Ich dachte an sein Glied, welches auch groß und stark war, ich dachte an seine prallen Hoden. Im Gegensatz dazu die hervorstehenden Rippen, die viel zu dünnen Arme und Beine. Er hatte keine Waden, seine Beine erinnerten mich an Holzpfähle. Es passte irgendwie nicht zusammen. Die ganze Erscheinung wirkte skurril. Seine Haare – strähnig, verfilzt, glanzlos und schlecht geschnitten. Seine Augen, unter denen tiefe Schatten lagen. Ständig wechselten sie. Die ganze Palette an Gefühlen spiegelte sich in ihnen. Man konnte in seinen Augen lesen wie in einem offenen Buch.
„Raju, bist du müde?“ „Nein, Jenny. Ich sagte doch, ich bin nicht müde.“ „Du könntest dir die Haare waschen.“ „Mit dem Haarshampoo?“ „Natürlich mit dem Shampoo.“ „Und mit warmen Wasser?“ Ich verstand nicht. „Wie wäscht du dir denn sonst die Haare?“ „Mit Seife und kaltem Wasser.“ „Mit kaltem Wasser?“ Beschämt senkte er den Blick. „Ich hatte kein warmes Wasser im Keller.“ Ich war sprachlos.
Ich stellte einen Küchenstuhl ins Bad vor das Waschbecken und drückte ihm das Shampoo in die Hand. „Jenny? Kannst du mir die Haare waschen?“ „Raju, das kannst du doch alleine.“ Sehnsüchtig schaute er auf meine Hände. „Bitte, nur das eine Mal. Nächstes Mal mache ich es selber.“ Der Mann sehnte sich nach Berührung wie ein Baby nach der Mutterbrust. Es war so traurig. Wenn ich ihm die Haare wasche, bekommt er möglicherweise wieder einen Ständer, überlegte ich. Doch mein Mitgefühl siegte. „Na gut, Raju, aber nur das eine Mal.“ „Vielen Dank, Jenny.“ So wusch ich ihm die Haare. „Schön ist das, Jenny. Es riecht so gut und das Wasser ist so warm. Du streichelst so schön, Jenny.“ „Ich streichle nicht, ich wasche dir die Haare.“ Er fing lustvoll zu stöhnen an. „Raju, höre auf damit, hör auf zu stöhnen.“ Ich blickte nach unten. Natürlich hatte er wieder einen Steifen, es war zum Verzweifeln. Hart presste er sein Glied unter den Waschbeckenrand. Ich spülte das Shampoo aus. „Bitte noch einmal Shampoo, bitte, Jenny.“ Ich massierte ein zweites Mal Shampoo in sein Haar. Lustvoll stöhnte er. „Sei still, oder ich höre auf!“ Sofort unterdrückte er sein Stöhnen. Beim Ausspülen konnte er sich nicht mehr beherrschen. Mit einem lauten „Uuuuh“ entleerte er sich. Erschrocken sprang er auf und wich zurück.
Ich streckte ihm ein Handtuch entgegen. Er bedeckte sofort seine Genitalien, sein Glied war noch steif. Mit Küchenkrepp wischte ich sein Sperma vom Fliesenboden. „Jenny, nein – was tust du da? Jenny, nein!“ Entgeistert starrte er mich und den Boden an. „Siehst du, schon sauber.“ Er zitterte, sein Penis erschlaffte. „Setz dich. Was hat dich denn diesmal so aus der Fassung gebracht?“ Ich schaute ihn an und erschrak. Seine Augen hatten den leeren Ausdruck angenommen. „Du hast meine ekelige, stinkende Soße gesehen.“
„Da, nimm“, und ich reichte ihm eine Beruhigungstablette mit Wasser. Endlich wirkte das Medikament. Er hielt den Kopf gesenkt. „Raju, warum sagst du so etwas?“ „Was meinst du?“ „Das ist deine Samenflüssigkeit, dein Sperma, das ist doch nicht ekelig und ich bin mir sicher, dass es auch nicht stinkt. Also ich habe nichts gerochen.“ Er hob den Kopf und sah mich verwundert an. „Nein?“ „Nein.“ „Dich hat es nicht gegraust?“ „Nein, mich hat es nicht gegraust.“ „Sie nannte es immer so. Stinkende, ekelige Soße.“ „Raju, denk nicht an sie. Sie ist böse, eine Teufelin“, und ich schätzte, dass er Sex mit ihr gehabt hatte. Aber wie, wenn sie ihn angeblich nie gestreichelt oder angefasst hat?
„Raju, du schaust erschöpft aus. Seit dem Frühstück hast du nichts gegessen. Wollen wir eine Kleinigkeit essen und dann schläfst du ein wenig?“ „Jenny, darf ich heute kochen? Ich möchte doch auch etwas für dich tun, bitte. Ich bin auch nicht müde.“ „Doch, du bist müde. Wieso willst du nicht schlafen?“ Sein Blick schweifte ins Leere. Ich verstand, er hatte Angst vor Albträumen.
„Jenny, darf ich die Körperlotion benutzen?“ „Ja. Du musst nicht immer fragen, aber du cremst dich selbst ein. Ich fasse dich heute bestimmt nicht mehr an“, und warf ihm einen grimmigen Blick zu. Er zuckte zusammen, doch dann sah er mein Lächeln und er wusste, ich meinte es nicht böse. Glücklich lächelte er zurück. „Was soll ich kochen, Jenny?“ „Ich lasse mich überraschen.“ „Gut, ich weiß auch schon was. Darf ich ein Glas Whisky haben?“ Er hatte soeben eine Tablette geschluckt, doch sein Körper und seine Psyche waren so durcheinander, da kam es auf eine weitere Mischung auch nicht mehr an. Wir saßen in der Küche und tranken Whisky. Raju wirkte entspannt und zufrieden.
Beim Rauchen am WC dachte ich nach. Ich kenne ihn eineinhalb Tage und mein Leben ist ein anderes geworden. Wie wird das alles weitergehen, wie wird das enden? „Zu Hause“ nennt er meine Wohnung. Ich weiß, er hat sich in mich verliebt. Ich kann ihn doch nicht als Mitbewohner auf einer Matratze schlafend bei mir aufnehmen. – Habe ich das nicht schon längst? Ich dachte an den Kleiderschrank, in dem nun seine Sachen liegen, die ich ihm gekauft habe. Verrückt, ich bin verrückt! Wenn ich ihn rauswerfe, wird es ihm das Herz brechen? Er könnte doch versuchen, alte Kontakte aufzunehmen. Es muss doch Menschen geben, die ihn kennen. Vielleicht hat er Familie? Ich weiß nichts über ihn, gar nichts. Außer, dass er ein gebrochener, geschundener Mann ohne Selbstbewusstsein und voll Angst ist. Und ich spüre – nein, ich weiß, dass er ein sehr höflicher, respektvoller, warmherziger, sensibler Mann ist. Ich war müde und erschöpft und wollte schlafen gehen. Zuvor schaute ich ins Bad, ob es ihm wohl gut ging.
Raju hatte ein Bein auf den Badewannenrand gestellt und massierte die Körperlotion ein. Er hatte schon wieder einen Steifen, es war unglaublich! Ich werde ihn „Dauerständer-Mann“ nennen. Ganz langsam, mit höchster Konzentration trug er die Lotion auf. Sanft streichelte er die Innenseiten seiner Oberschenkel. Er stöhnte leise und voll Lust. Und das bei offener Badezimmertür! Ich wollte mich sofort umdrehen und gehen, doch ich konnte meinen Blick nicht abwenden. Immer wieder nahm er reichlich Lotion und massierte sich ein. Streicheln, wie er es nannte. Er wühlte zärtlich in seinen Brusthaaren, als wären es die Haare einer Frau. Wellen begannen durch meinen Körper zu schlagen. Mir wurde ganz heiß. Mit reichlich Lotion massierte er ganz sachte seine Hoden. Er strich über sein großes steifes Glied, ganz langsam, auf und ab. Mit den Fingern fuhr er mehrmals um seinen Ring, dann streichelte er seine Eichel. Wieder und wieder begann er bei den Hoden bis zur Eichel. Die ganze Zeit sah er sich dabei zu, er hatte die Augen nicht geschlossen. Sein Stöhnen wurde schneller. Mit einer Hand drückte er sanft seine Hoden, die andere drückte und rieb sein Glied. Auf und ab, auf und ab, immer fester und schneller massierte und drückte er. Auf und ab. Mit einem genussvollen Seufzer floss der Saft in seine Hand. Ich drehte mich um und schlich mich leise auf das WC. Während ich rauchte, sah ich die ganze Szene noch einmal vor mir. Wenn er eine Frau so behandelt wie seinen eigenen Körper, dann muss das eine sehr, sehr glückliche Frau sein …
Ich brauchte jetzt einen Drink. Raju kam mit umbundenem Handtuch in die Küche. Ich schielte auf seine Lenden. Alles wieder im Normalzustand, sah ich erleichtert. „Na, alles in Ordnung?“, fragte ich etwas spöttisch. „Deine Körperlotion duftet wunderbar und die Haut wird glatt. Riech mal, Jenny“, und er hielt mir seinen Unterarm vor das Gesicht.
Wir saßen am Küchentisch und tranken Whisky. „Du siehst müde aus, Jenny. Möchtest du dich nicht etwas ausruhen?“ Da saß er mir gegenüber, mit schwarzen Augenringen, unterernährt, mit Narben und Wunden übersät, gestern noch halb tot – und er möchte, dass ich mich ausruhe?! Seine warmen dunkelbraunen Augen blickten mich zärtlich an. „Raju, darf ich dich etwas fragen?“ Kopfnicken. „Hast du dich eventuell in mich verliebt?“ Er errötete, doch er wandte seinen Blick nicht ab. „Nein, Jenny.“ „Gott sei Dank!“ Mir fiel ein Stein vom Herzen. „Das darfst du nämlich nicht, Raju. Wir kennen uns doch kaum.“ „Ich habe mich nicht in dich verliebt. Es ist mehr – ich liebe dich, Jenny.“ Es war zu viel für mich, ich stand auf und ging ins Bett.
Ich erwachte durch ein Klingeln. Es war 19.34 Uhr. Mein Handy läutete. Tanja! Ich hatte Tanja vergessen. Schnell hob ich ab. „Na endlich“, schnaubte sie ins Telefon. „Wir hatten 19.30 Uhr vereinbart!“ „Entschuldige, ich habe geschlafen.“ „Was macht er?“ „Wer macht was?“ „Na, der Psychopath.“ „Tanja, es ist alles in Ordnung. Wir sehen uns morgen.“ „Um 7.30 Uhr stehe ich bei dir auf der Matte!“
Ich war schlecht gelaunt. Die Nachrichten im Fernsehen würde ich wahrscheinlich versäumen, welchen Film spielen sie heute? Gestern und heute wären meine freien Tage gewesen. Ich wollte sie im Schwimmbad verbringen. Alles ist durcheinander. Hunger habe ich auch. Was bin ich nur für eine blöde Kuh. Hole mir einen Idioten ins Haus und schaue ihm noch beim Wichsen zu. Ich brauche etwas zum Essen.
Raju lag rücklings auf der Matratze und hatte seine Arme im Nacken verschränkt. Seine Augen waren geöffnet. Ein köstlicher Duft stieg in meine Nase, er hatte gekocht. Ich sagte kein Wort und ging mit einem Glas Wasser aufs WC. Als ich zurückkam, saß er in seiner typischen Haltung aufrecht. „Jenny, ich verstehe dich.“ „Was verstehst du schon!“ „Ich mache dir nur Sorgen und Probleme. Du hättest das alles nicht tun müssen. Wenn du willst, gehe ich.“ „Wohin willst du gehen?“ Er zuckte mit den Schultern. „Du hast kein Geld und keine Papiere. Wo sind deine Dokumente?“ „Im Haus, denke ich.“ „Denke ich?“ „Sie hat sie mir abgenommen.“ „Wir reden später in Ruhe darüber. Jetzt habe ich Hunger. Was hast du gekocht, es riecht sehr gut.“ Flink stand er auf und öffnete die Deckel. Ich nahm Teller und stellte sie auf den Küchentisch. „Jenny, ich weiß nicht, ob du mich heute oder morgen fortschickst. Können wir noch einmal auf deinem Bett essen?“
So aßen wir köstlichen Spinat mit Reis und Joghurt. Wir saßen uns auf meinem Bett gegenüber. Es war ruhig und friedlich. Ich vermisste den Fernseher überhaupt nicht. Nachdem wir alles weggeräumt hatten, legte er sich auf die Matratze und ich mich ins Bett.