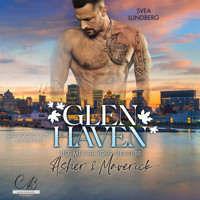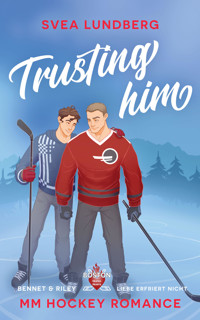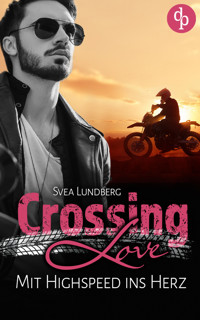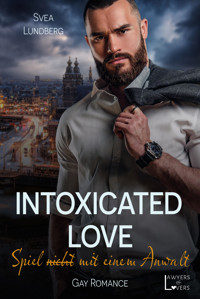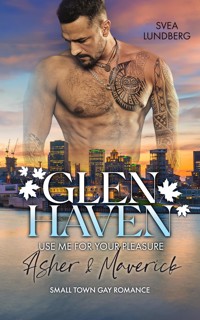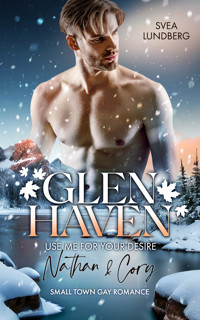4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Traumtänzer-Verlag Lysander Schretzlmeier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei einem Autounfall wird Valentins Hand zertrümmert und seine Karriere als aufgehender Stern am Pianistenhimmel abrupt beendet. Nach Wochen voller Operationen und Rehamaßnahmen verordnet seine Mutter ihm Erholungsurlaub an der Ostsee. Auf dem Reiterhof seiner Tante lernt er den gehörlosen Florian kennen. Zwischen Stallausmisten und Strandausritten kommen die beiden sich langsam näher, aber Missverständnisse sind vorprogrammiert. Denn während Valentin alles dafür tun würde, um wieder Klavier spielen zu können, scheint Florian sein vermeintliches Handicap einfach wegzulächeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Teil 1
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Teil 2
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Die stille Seite der Musik
Ein Roman von Julia Fränke
Impressum
Copyright © 2017 Traumtänzer-VerlagLysander Schretzlmeier
www.traumtaenzer-verlag.de
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte sind vorbehalten.
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und
Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden
oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht
beabsichtigt.
ISBN: 978-3-947031-00-9 (Taschenbuch)
ISBN: 978-3-947031-01-6 (E-Book mobi)
ISBN: 978-3-947031-02-3 (E-Book ePub)
Autorin: Svea Lundberg
Covergestaltung: Yvonne Less, Art4Artists
www.art4artists.com.au
Teil 1
Die Melodie von Hufschlägen
Prolog
Moll wird von den meisten Menschen als ›traurig‹ oder ›düster‹ empfunden, während sie Dur eher mit Attributen wie ›fröhlich‹ oder ›hell‹ beschreiben. Dabei gibt es durchaus fröhliche Moll-Lieder, wie zum Beispiel Larionows »Kalinka«, genauso wie es trübsinnig klingende Musikstücke in Dur gibt.
Die Wenigsten wissen, dass dieses Empfinden vor allem durch den geringen Klangwert des Molldreiklangs zustande kommt und außerdem Aspekte wie Melodieführung, Rhythmus und Tempo eine erhebliche Rolle spielen. Die unterschiedliche Färbung des Musikstückes obliegt allein dem Komponisten. Was sagt es wohl über einen Menschen aus, wenn er gerne – oder sogar ausschließlich – Stücke in Moll hören möchte? Was meint die Welt über einen Pianisten zu wissen, der sich weigert, Dur zu spielen?
Ich behaupte, die Leute wissen gar nichts. Sie verstehen nicht, was in einem jungen Mann vorgeht, der sich Tag um Tag dem Klang von Ludovico Einaudis »Oltremare« hingibt, der Nacht um Nacht Beethovens »Mondlicht Sonate« spielt. Weil er nicht schlafen kann – oder will.
Die Uhr auf meinem Handy zeigt neun Minuten nach vier und natürlich leuchten auch mehrere entgangene Anrufe auf dem Display. »Ach, Mum«, seufze ich lautlos und stecke das Smartphone zurück in meine Hosentasche. Ich habe ihr gesagt, dass ich erst weit nach Mitternacht zurückkommen werde, aber sie macht sich trotzdem Sorgen. Wie sie es immer tut, wenn ich sie alle paar Wochen mal dazu überreden kann, einen Abend mit Freunden verbringen zu dürfen. Mit Leuten, die eigentlich gar keine richtigen Freunde sind. Sie dulden mich vielmehr in ihrer Mitte und ich kann es ihnen nicht mal verübeln, dass ich für sie nicht mehr bin als ein toleriertes Anhängsel. Ich seile mich zu oft nach der Schule ab, mit der Erklärung, ich müsse üben, als dass sie mich wirklich als Mitglied ihrer Truppe ansehen könnten. Aber es stimmt nun mal: Ich muss üben. Mindestens vier Stunden am Tag. Und ich tue es gerne, nur manchmal – ganz selten – wird eine Stimme in mir laut, die mir zuraunt, ich müsse mal wieder unter Leute. Mal wieder raus. Mal wieder atmen. Lachen. Tanzen. Mit Mädels flirten. Andere Männer küssen.
Letzteres weiß meine Mutter nicht. Vielleicht ahnt sie, dass ihr einziger Sohn bisexuell ist, aber viel wahrscheinlicher ist es, dass sie annimmt, ich sei noch Jungfrau und an keinerlei Beziehung interessiert. Dass sie denkt, meine größte und einzige Liebe sei das Piano. Und in gewisser Weise stimmt das ja auch. Aber kein Klavierstückund mögen sich die Töne noch so tief in mein Innersten schneiden, können die Berührungen eines Liebhabers ersetzen. Nicht einmal meine Lieblingskomposition von Einaudi kann das.
In dieser Nacht ziehe ich die »Oltremare« jedoch Eddi und den anderen vor. Noch bevor ich ins Auto steige, krame ich meine Ohrstöpsel hervor und schalte die Playlist ein. Eddi mustert mich mit schiefem Blick.
»Du willst nicht ernsthaft dein Klassikgedöns während der Heimfahrt hören, oder?«
Ich steige auf der Beifahrerseite ein und lasse dabei lediglich ein knappes „doch“ hören. Ich habe keine Lust, mich zu rechtfertigen. Sie würden ohnehin nicht verstehen, dass ich nach fünf Stunden Dubstep-Beschallung des Clubs das melancholische Klavierspiel brauche, um runterzukommen.
Eddi zuckt mit den Schultern, wirft Ann-Kathrin und Marie einen vielsagenden Blick zu, ehe er auf dem Fahrersitz Platz nimmt. Ich lasse das Fenster auf der Beifahrerseite ein Stück hinunter, lehnte meinen Kopf an die Nackenstütze und schließe die Augen. Über die Musik hinweg höre ich die beiden Mädels schnattern und klicke die Lautstärke meines Handys drei Stufen höher. Das Starten des Motors höre ich nicht mehr, fühle es nur noch. Der V8-Motor vibriert unter mir und ich beschließe, mir doch irgendwann ein eigenes Auto zuzulegen, ganz egal, was meine Mutter dazu sagt. Als ob ich mir das vor eineinhalb Jahren, kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag, nicht auch schon eingeredet hätte …
Der Fahrtwind bläßt mir ins Gesicht, prickelte angenehm auf meiner vom Tanzen verschwitzten Haut. Ich blende Eddi und die beiden Mädels vollkommen aus, konzentriere mich nur noch auf die Klänge der »Oltremare«.
Ja, Molldreiklänge haben wirklich etwas Melancholisches, Düsteres an sich. Doch genau aus diesem Grund liebe ich sie bis heute. Ich genieße das fast schmerzliche Gefühl der Enge, welches sich in der Brust ausbreitet. Gebe mich dem sanften Anschwellen der Tonmelodie hin, bis die »Oltremare« in einem schwermütigen Ritardando gipfelt. Heute noch wie damals.
Auch in dieser Nacht, auf dem Beifahrersitz von Eddis BMW M4, vergesse ich alles um mich herum, während ich Einaudis Meisterstück lausche. Ich sitze reglos, nur meine Finger berühren sacht die unsichtbaren Tasten des imaginativen Klaviers vor meinen geschlossenen Augen. Gleich erreicht das Stück seinen dramatischen Höhepunkt, gleich wird es …
Wie aus dem Nichts wird mein Körper zur Seite gerissen. Mein Kopf prallt gegen das Seitenfenster. Ich reiße die Augen auf. Meine Finger verlassen die Tasten, suchen Halt. Doch vergeblich. Schon dreht sich mein Magen um. Oder nein? Das Auto dreht sich? Schleudert zur Seite. Ein Stöpsel gleitet aus meinem Ohr. Ich höre die Mädchen kreischen. Schreie ich auch? Die »Oltremare« verklingt auf ihrem Höhepunkt. Schmerz schießt durch meinen Arm und Rücken. Dann wird alles schwarz.
Kapitel 1
Die »Oltremare« hallt noch leise in meinen Ohren, als ich nach für mich unbestimmbarer Zeit langsam aus der Dunkelheit auftauche. Das Schwarz lichtet sich zu Grau. Ich blinzele, sehe gleißendes Weiß und schließe mit einem Aufstöhnen die Augen erneut, nicht nur, um die unangenehme Helligkeit, sondern auch den plötzlichen Schmerz auszublenden, der durch meinen linken Arm bis in die Hand hinunterrast.
Das Klavierstück in meinem Kopf verklingt in einem monotonen Piepsen, das in meinem pochenden Schädel widerhallt. Weit weniger quälend jedoch als der reißende Schmerz in meiner Hand.
»Fuck«, flüstere ich mit einer Stimme, die krächzig und so gar nicht nach meiner eigenen klingt. Bilder flackern vor meinen geschlossenen Augen und ich reiße sie auf, um den quälend-lebhaften Erinnerungen an den Unfall zu entgehen. Stattdessen starre ich an eine kahle weiße Decke, hinein in eine eklig helle Neonröhre. Wusste gar nicht, dass es noch Räume ohne schicke LED-Spots gibt.
Das Reißen in Hand und Arm verwandelt sich langsam zu einem gleichsam nervigen wie schmerzhaften Puckern. Und während ich so an die Decke starre, schließlich die medizinischen Geräte neben meinem Bett in Augenschein nehme, beginne ich zu begreifen, was der Schmerz bedeuten könnte. Was alles geschehen sein könnte, aber …
Ich hole zittrig Luft.
… aber ich komme nicht dazu, nachzudenken oder gar zu begreifen, denn in diesem Moment fliegt die Zimmertür auf. Meine Mutter stürmt herein, gefolgt von einer aufgeregt schnatternden Krankenschwester.
»… so beruhigen Sie sich doch! Es wird bestimmt …«
»Ach, was wissen Sie schon?«, fährt Mum der Dame über den Mund, ehe sie sich mir zuwendet und an mein Bett geeilt kommt.
»Valentin, du bist wach!«
Nach dieser lapidaren Feststellung steht sie wie versteinert neben mir. Ich brumme eine Zustimmung, bin zu träge, um etwas zu sagen. Und ich brauche Sekunden, ehe ich begreife, dass meine Mutter gar nicht wirklich mich mustert, sondern einen unbestimmten Fleck auf der Bettseite links neben mir.
Schwerfällig folge ich ihrem Blick und schaue zum ersten Mal auf meine Hand. Oder vielmehr auf einen weiß bandagierten Klumpen. Unter den dicken Verbänden ist nichts zu erkennen. Doch als ich den Kopf wieder drehe und in das bleiche Gesicht meiner Mutter schaue, brauche ich keine weiteren Blicke mehr. Ihr versteinerter Ausdruck, der überdeutlich davon zeugt, wie sehr sie sich zusammenreißen muss, um nicht zu heulen, spricht Bände. Mein Herz hämmert Stakkato in meiner Brust und im selben Takt, in dem meine Mutter krampfhaft beherrscht ein- und ausatmet, schnürt sich meine Kehle zu.
»Nein«, flüstere ich ganz leise und sehe gleich darauf meine Mutter nicken. Die Geste wandelt sich jedoch in ein Kopfschütteln.
»Valentin …« Sie streckt eine Hand nach mir aus, berührt meinen Arm. Ich will zurückweichen, aber liege wie hingegossen und kann nichts anderes tun, als mich stocksteif zu machen und den Atem anzuhalten.
»Bitte«, hauche ich meiner Mum entgegen, »bitte, nicht. Nein.«
Sie zieht ihre Hand zurück, als habe ich ihre Berührung mit meinen Worten gemeint. Oder vielleicht versteht sie auch, dass ich es jetzt nicht ertrage, von ihren Gliedern berührt zu werden. Weil ich die eigenen nicht regen kann.
Ich zwinge mich dazu, doch wieder auf den bandagierten Klumpen zu sehen. Nehme alle Willenskraft zusammen, um mir einzureden, ich könne die Finger nur aufgrund der Lagen an Verbandsmaterial nicht rühren. Genau das muss die einzig logische Erklärung sein, denn es ist schließlich unmöglich, dass meine Hand irgendeinen irreparablen Schaden davongetragen hat. Ich bin Pianist. Meine Hände sind mein Kapital. Es kann einfach nicht sein, dass meine Finger streiken, nur weil … weil …
»Valentin«, setzt Mum erneut an und reißt mich damit aus meinen Bemühungen, mir selbst Mut zuzureden, »deine Hand …«
Ich schüttle den Kopf, vergrabe das Gesicht so weit es geht im Kissen.
»Bitte … nicht …« Es fühlt sich wie Schreien an, dabei kommt kaum mehr als ein Flüstern über meine Lippen.
»Die Ärzte sagen …«
»Nein!« Dieses Mal schreie ich wirklich. Mein Kopf ruckt zurück zu meiner Mutter, ich starre sie an. Tränen rinnen haltlos über ihre blassen Wangen, lassen sie mehr denn je aussehen wie eine dieser russischen Porzellanpuppen. So zerbrechlich …
»Lass mich allein«, fordere ich mit plötzlich tonloser Stimme. Hinter meinen halb gesenkten Lidern brennt es verräterisch, aber noch kommen keine Tränen.
»In Ordnung.«
Ich sehe nicht einmal mehr auf, als meine Mutter so rasch zustimmt. Stattdessen vergrabe ich mich tief in mir drinnen und suche verzweifelt nach den Klängen von Ludovico Einaudis Klavierspiel. Doch über dem Klackern von Mums Absätzen finde ich keinen einzigen Ton.
»Ich gehe den Chefarzt suchen.« Sie ist bereits halb aus der Tür. »Vielleicht kann man noch …«
Ich verschließe Augen und Ohren fest. In einem nicht enden wollenden Ritardando prasselt die Erkenntnis auf mich ein: Nein, kann man nicht! Ich weiß es schon jetzt und sicher ahnt Mum es auch. Aber sie wird kämpfen für den Traum ihres Sohnes, eines Tages ein erfolgreicher Pianist zu sein und vor dem atemlosen Lauschen der Menge die »Oltremare« zu spielen. Auch auf meinen Wangen fühle ich die ersten Tränen und lausche weiter. Aber es ertönt kein Klavierspiel.
Kapitel 2
Als ich zitternd aus dem Schlaf hochfahre, brauche ich einen Moment und einige hastige Atemzüge, um einordnen zu können, wo ich bin. Kerzengerade sitze ich in meinem Bett. Ja, es ist tatsächlich mein Bett. Mein Zimmer. Gestern wurde ich aus der Reha entlassen, erinnere ich mich. Doch mit dieser Erkenntnis strömt augenblicklich ein anderer, bitterer Gedanke in meinen Kopf: Die Reha war für den Arsch. Ich bin noch immer ein Krüppel. Sitze zwar nicht im Rollstuhl, meine Wirbelsäule hat nur ein kleines Trauma erlitten, aber meine linke Hand ist zertrümmert. Und ein Pianist mit kaputter Hand ist verdammt nochmal ein beschissener Krüppel. Punkt. Aus. Traum zerplatzt.
Ich würge den Kloß in meinem Hals hinunter und schwinge die Beine aus dem Bett. Tappe zum Schreibtisch und greife zur Wasserflasche, will das eklige Gefühl der Erkenntnis runterspülen. Erst als ich die Flasche umständlich mit meiner kaputten Hand festgeklemmt habe und den Deckel aufdrehen möchte, registriere ich, dass dieser nur locker obenauf liegt.
»Gott, Mum …«, zische ich und knalle die Flasche zurück auf den Tisch, der Deckel klackert leise zu Boden. Innerlich schnaubend verkrieche ich mich wieder ins Bett. Ein Blick auf die Uhr zeigt, dass es bereits nach sechs Uhr ist und Mum schon auf den Beinen sein muss. Aber ich habe keine Lust, mein Zimmer zu verlassen und ihr über den Weg zu laufen. Nicht nachdem sie mich mit der halbgeöffneten Flasche schon wieder wie ein Kleinkind behandelt hat – auch wenn es sicher nur gut gemeint war.
Aber mir reicht schon der mitleidige Blick, wenn ich beim Frühstück die kaputte Hand unter dem Tisch verstecke oder doch einmal aus Versehen das Saftglas umstoße. Dieser Blick, der nicht nur Mitgefühl ausdrückt, sondern gleichzeitig eine verdammte Anklage ist. Weil ich mit dem Unfall in der Partynacht meinen Traum zerstört habe. Und nicht nur meinen …
Ich weiß ganz genau, wie sehr meine Mutter sich gewünscht hat, ich würde in die Fußstapfen meines Vaters treten. Wie er ein erfolgreicher Pianist werden. Und – zur Hölle nochmal – ich bin ein erfolgreicher Pianist gewesen. Vergangenheit, nicht Zukunft.
Ich drehe den Kopf und schaue das Foto an, welches seit Jahren – eigentlich schon immer – auf meinem Nachttisch steht. Auf dem Bild sitzt mein Vater an seinem Konzertflügel und auf seinem Schoß hockt ein kleiner Knirps und tatscht lachend auf den Tasten herum. Der Knirps bin ich, wer sonst. Damals, mit zwei Jahren, traf ich die Tasten besser, als ich es heute mit meiner verkrüppelten Hand tue. Bitter irgendwie. Genauso bitter wie die Ironie des Schicksals, dass mein Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und mich ein Autounfall die linke Hand gekostet hat. Oder zumindest deren Funktionsfähigkeit. Wenigstens muss mein Vater sich seitdem keine Gedanken mehr machen, ob er vielleicht einfach den Bus hätte nehmen sollen. Oder zu Fuß gehen. Aber ich sitze hier und stelle mir Tag für Tag diese beschissene Frage. Ob ich es hätte verhindern können. Ob ich Eddi vor dem auf die Straße laufenden Wildschwein hätte warnen können, wenn ich nicht mit geschlossenen Augen der »Oltremare« gelauscht hätte.
Seit der Unfallnacht habe ich das Musikstück nie wieder angehört. Im Krankenhaus, wenige Tage nach der zweiten OP an meiner Hand, habe ich es mal versucht. Habe den Player aber nach kläglichen zehn Sekunden wieder ausgeschaltet und danach zwei Stunden lang nur geheult.
Aus der Küche vernehme ich die Melodie der »Sarabande«. Das Lieblingsstück meiner Mum. Sorry, ich werd’s nie wieder für dich spielen können. Aber um ehrlich zu sein, hab ich’s auch nie gemocht.
Eddi mag überhaupt keine Klassik. Nur Dubstep und deutschen Hiphop. Die Lust aufs Tanzen und Feiern dürfte ihm aber seit dem Unfall und spätestens seit letzter Woche auch vergangen sein. Denn seitdem läuft unsere Klage gegen ihn, wegen schwerer Körperverletzung und mehreren tausend Euro Schmerzensgeld. Eigentlich ist es die Klage meiner Mum. Ich würde den Fall gerne auf sich beruhen lassen. Immerhin war Eddi mal sowas wie mein Kumpel. Er war nicht besoffen in der Unfallnacht. Es war einfach Pech. Und weder Geld noch ein gedrucktes Urteil machen meine Hand wieder intakt. Andererseits habe ich auch keinen Nerv, weiter mit meiner Mutter zu diskutieren, ob es ratsam ist, Eddi anzuzeigen oder nicht. Nun läuft die Klage und ich habe noch einen Freund weniger.
Seufzend schwinge ich die Beine zum wiederholten Male aus dem Bett. Mit dem Gedudel der »Sarabande« im Ohr, das aus dem unteren Stockwerk dringt, und den quälenden Gedanken im Kopf, werde ich ohnehin nicht mehr schlafen können.
So schnell es einhändig eben geht – ich vermeide es grundsätzlich, die linke Hand zu benutzen, wenn es nicht unbedingt sein muss – ziehe ich mir ein T-Shirt und eine Jogginghose an und tappe auf nackten Füßen aus meinem Zimmer und in die Küche. Meine Mum brät Spiegeleier und Speck, auf dem Tisch stehen Bauernbrot und Orangensaft bereit.
»Valentin, guten Morgen«, begrüßt sie mich mit strahlendem Lächeln. Einem gefakten Lächeln, das ihre Augen nicht mehr erreicht und somit wie eine aufgesetzte Maske wirkt. Seit meinem Unfall ist ihr Strahlen nie wieder echt gewesen.
»Ich mache Spiegeleier«, erklärt sie unnötigerweise. »Oder möchtest du lieber ein hartgekochtes Ei? Oder Rühreier mit Tomaten?«
Ich schüttle den Kopf und lasse mich auf einen Stuhl fallen.
»Spiegeleier sind okay, Mum.«
»Soll ich dir einen Saft einschenken oder möchtest du …«
»Nein«, wehre ich ab und bitte sie innerlich, endlich aufzuhören, mich wie ein kleines Kind zu behandeln. Doch dann scheitere ich ausgerechnet vor ihren Augen am Drehverschluss der Saftflasche und beiße mir hart auf die Unterlippe, als sie mit fürsorglichem Lächeln mein Glas füllt.
Wortlos würge ich Eier, Speck und Saft hinunter. Bemühe mich dabei, ausschließlich die rechte Hand zu benutzen und die linke unter dem Tisch zu verstecken. Weder meine Mutter noch ich sollen den Anblick der steifen Glieder öfter als unbedingt nötig ertragen müssen.
»Mum«, breche ich irgendwann die Stille, die sonst nur vom Klappern des Bestecks durchdrungen wird. »Ich würde gerne in Urlaub fahren.«
Über ihre Kaffeetasse hinweg schaut sie mich an, als hätte ich sie eben darum gebeten, Formel-1-Pilot werden zu dürfen. Herrgott nochmal, ich bin 19 Jahre alt, da kann ich doch mal alleine ein paar Tage wegfahren.
»Und die Schule?«
»Durch die OPs und die Reha hab ich ohnehin schon so viele Wochen verpasst. Das Abi ist wie du weißt vorbei. Ich werde die Klasse wiederholen müssen. Mache ich das Abi eben ein Jahr später.«
»Aber …«
»Mum! Bitte!« Ich schreie die Worte fast und setze leiser hinzu: »Ich muss mal raus hier. Abstand bekommen. Nachdenken, was ich jetzt mit mir anfangen soll, wo ich kein Pianist mehr sein kann. Ich möchte …«
Ich verstumme augenblicklich, als meiner Mutter Tränen in die Augen schießen. Habe ich in ihrer Gegenwart etwa zum ersten Mal die Wahrheit ausgesprochen?
»Tut mir leid«, murmle ich und frage mich im selben Moment, wofür ich mich eigentlich entschuldige. Zur Hölle nochmal, ich bin derjenige mit der kaputten Hand. Ich bin das Opfer. Mein Traum ist zerplatzt.
Ich schlucke.
Zumindest der letzte Punkt stimmt nicht ganz. Doch ich schiebe den Gedanken beiseite und setze nochmal neu an: »Ich dachte an Teneriffa. Oder vielleicht Gran Canaria. Einfach mal abschalten.«
»An der Ostsee ist es schön.«
Bitte? Ostsee?
»Tante Petra hat auf Fehmarn diesen Pferdehof. Da waren dein Vater und ich einmal mit dir, als du drei warst.«
Jetzt bin ich aber 19, verdammt!
»Mum, ich …«
»Ich rufe Petra an, ob du nächste Woche kommen kannst.«
»Aber Fehmarn ist …«
»Es wird dir gefallen, ganz bestimmt. Und wenn es Komplikationen mit deiner Hand gibt, bist du schnell wieder Zuhause und kannst …«
Ich schüttle resigniert den Kopf und blende ihre Stimme aus. Mit meiner Hand wird es keine Komplikationen mehr geben. Die ist sowieso am Arsch.
Meine Gabel ramme ich so fest in das Spiegelei, dass die Zinken wütend über den Teller knirschen. Ostsee. Herzlichen Glückwunsch!
*
»Nächster Halt: Gestüt Gut Sommerfeld!«, brüllt der Fahrer durch den Bus, mit einer Lautstärke, als müsse er eine ganze schnatternde Schulklasse übertönen. Total übertrieben, denn genau genommen bin nur ich im Bus. Innerlich schnaubend stehe ich auf und muss mich gleich darauf mit meiner gesunden Hand an einer Halteschlaufe festklammern, als das Gefährt schwankend zum Stehen kommt. Der Fahrer dreht sich zu mir um.
»Brauchst du Hilfe, Junge?«
»Nein«, knurre ich ihm entgegen und zerre meine Reisetasche unter dem Sitz hervor. Erstens bin ich kein Junge mehr und zweitens werde ich wohl gerade noch mein Gepäck alleine tragen können. Mache ich ja schließlich seit dem vergangenen Abend. Seit beschissenen elf Stunden bin ich schon unterwegs. Habe eine ruhelose Nacht im Schlafwagen hinter mir und tuckere seit über einer halben Stunde mit diesem klapprigen Bus durch die Gegend. Wo soll da bitte die Urlaubserholung sein?
»Schönen Aufenthalt und grüß die Petra von mir.«
Ich brumme irgendeine Zustimmung und frage mich unweigerlich, ob in diesem kleinen Kaff eigentlich jeder jeden kennt. Aber hey, zumindest hat das Gestüt meiner Tante eine eigene Bushaltestelle, die …
So weit vom Hof entfernt liegt? Ernsthaft jetzt?
Ich stehe neben dem Bus, an der Haltestelle, die nicht mal ein Wartehäuschen, sondern lediglich eine Eisenstange mit Schild und Mülleimer hat. Schaue mich suchend um und sehe … nichts! Keinen Reiterhof, nicht einmal Koppeln und ebenso wenig ein Haus. Nur einen Feldweg, der sich zwischen Dünen verliert. Irgendwo dahinter muss das Meer sein. Und wo ist der beknackte Hof? Ich bin zwar schon einmal hier gewesen, aber da war ich noch ein kleiner Steppke und fand die endlosen Dünen toll, weil man überall im Sand spielen konnte. Theoretisch, wenn einen die Mutter nicht davon abhielt, weil die Hose dreckig werden oder man sich einen Finger verstauchen könnte.
Hinter mir rumpelt der Bus davon. Kurz bin ich versucht, ihm nachzulaufen, um wenigstens zu erfragen, wo ich hin muss. Den Feldweg hinauf? Und wie lange bitte?
Ich kneife die Augen zusammen und starre den schmalen Weg entlang. Etwas regt sich zwischen den Dünen. Ich hoffe schon darauf, dass meine Tante mich mit einem coolen Ranchrover abholen kommt, doch dann biegt ein Pferdegespann um die Ecke. Ja, bin ich jetzt bei Bauer sucht Frau? Fehlen nur noch die Luftballons und ein kitschiges Willkommens-Schild.
Aber irgendwie ist es ja charmant, mit einer Kutsche abgeholt zu werden. Noch dazu, wenn sie von zwei solchen Prachtexemplaren gezogen wird. Ich bin als Kind eine Weile geritten und auch wenn das lange her ist, weiß ich doch genug über Pferde, um zu erkennen, dass es zwei stattliche Fjordpferde sind, die da vor dem Zweispänner laufen.
»Hallo, Valentin!« Meine Tante winkt mir vom Kutschbock aus zu. Ihre Worte klingen beinahe herzlich, aber in ihrem wettergegerbten Gesicht zeigt sich keine Regung. Wenn ich mich recht erinnere, war Petra schon immer etwas verstockt. Zumindest Menschen gegenüber. Soll mir aber Recht sein, dann quatscht sie mich in den drei Wochen Zwangsurlaub wenigstens nicht zu.
»Hi«, begrüße ich sie knapp, als sie den Zweispänner neben mir zum Stehen bringt. Vorsichtig trete ich näher und streichle dem einen Fjordpferd über den Nasenrücken, tätschle dann seinen Hals. Lustig sehen sie ja schon aus mit ihren kurz geschorenen Stehmähnen und dem cremefarbenen Fell. Außerdem sind sie mir von der Größe her deutlich lieber als diese Riesenviecher, die man in den Reitställen rund ums schicke München bewundern kann.
Das eine Tier schnuppert zutraulich an meinem Hals und prustet mir durchs Haar. Echt niedlich.
»Spring rauf!« Petra deutet neben sich auf den Kutschbock. Ich bin ganz froh, dass sie erst gar nicht fragt, wie die Fahrt war. Will einfach nur auf dem Hof ankommen und mich erst mal in mein Zimmer verziehen. Kurz die Augen zumachen.
Schnaufend hieve ich meine Tasche auf den Kutschbock. Meine Tante packt mit an und streckt mir eine Hand entgegen, aber ich wehre mit erzwungenem Lächeln ab und klettere ohne ihre Hilfe auf den Sitz hinauf, vergrabe sogleich die Linke in der Tasche meines Hoodies. Petra schnalzt mir der Zunge und die beiden Falben setzen sich brav in Bewegung. Meiner Tante schenke ich der Höflichkeit halber ein erzwungenes Lächeln, ehe ich den Blick abwende und über die Dünen schweifen lasse. Idyllisch ist es schon, aber eben auch der Arsch der Welt. Willkommen an der Ostsee, Tino!
*
Zu meiner Überraschung dauert die Kutschfahrt nur zwanzig Minuten, denn das Gehöft taucht schon nach wenigen langgezogenen Dünenwindungen vor meinen Augen auf. Unter lautem Hufgeklapper rollt das Gespann auf den Hof, wo Petra die beiden Fjordis zum Stehen bringt. Ein bisschen ungelenk klettere ich vom Kutschbock und sehe mich um. Rechter Hand liegen die Stallungen, ein Reitplatz und dahinter einige Koppeln, auf denen Pferde grasen. Auch ein paar Fohlen springen herum. Die muss ich mir später genauer ansehen. Zu meiner Linken – zu meiner Kaputten, könnte man auch sagen – thront das Haupthaus, in dem Petra wohnt. Schräg dahinter sind die Bungalows für die Feriengäste, die der Hof im Sommer beherbergt.
»Bring deine Tasche schon mal ins Haus«, tönt es hinter mir vom Kutschbock. »Ich gebe Flo Bescheid, dass er die Pferde ausspannen und auf die Koppel bringen soll. Dann zeige ich dir dein Zimmer.«
Ich zögere einen Moment, möchte meine mürrische Tante eigentlich nicht mit Extrawünschen nerven, aber dann spreche ich es doch aus: »Kann ich eventuell auch einen kleinen Bungalow haben? Nicht wegen des Platzes, nur …« Wie sagt man seiner Gastgeberin höflich, dass man seine Ruhe haben möchte?
Zum ersten Mal an diesem Tag spielt so etwas wie ein Lächeln um ihre Lippen.
»Du willst lieber für dich sein, hm? Kein Problem. Stell deinen Kram im Haupthaus ab und schau dich auf dem Hof um. Ich mache dir gleich einen Bungalow zurecht. Ich muss die Ferienwohnungen ohnehin noch einmal reinigen lassen, ehe die Sommergäste kommen.«
»Cool, danke!« Plötzlich finde ich meine Tante gar nicht mehr so mürrisch, auch wenn der Anflug des Lächelns schon wieder von ihrem Gesicht verschwunden ist. Rasch schnappe ich mir meine Tasche, schleppe sie zum Haupthaus hinüber und stelle sie in der Diele ab. Nur kurz schaue ich mich im angrenzenden Wohnzimmer um. Die dunklen Massivholzmöbel und der rötlich-braun-gemaserte Teppich sind ziemlich altbacken für meinen Geschmack, aber vielleicht sind die Bungalows ja moderner eingerichtet. Und selbst wenn nicht, ich bin schon froh, wenn ich morgens mal alleine frühstücken kann. Oder das Frühstück ausfallen lassen kann, ohne dass mir jemand erzählt, es sei die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Mein Blick streift das Klavier, das mit heruntergeklapptem Deckel und eingestaubt am einen Ende des Wohnzimmers steht. Rasch wende ich mich ab und eile aus dem Haus, quer über den Hof. Die Kutsche steht noch dort, doch die beiden Pferde sind verschwunden. Ein Blick über die Schulter zeigt, dass die Tür eines Bungalows offen steht. Sehr gut! Trotzdem gehe ich erst zum Stall hinüber. Mal sehen, ob dort drinnen ein paar Pferde sind oder ob die alle bei dem strahlenden Sonnenschein auf den Koppeln herumtollen.
Im Stall ist es ein wenig schummrig und ich muss zweimal blinzeln, ehe ich alles klar erkennen kann. Rechts und links der sauber gefegten Stallgasse reihen sich großzügige, ebenso ordentliche Boxen aneinander. Sie alle sind leer. Doch am anderen Ende der Gasse stehen die beiden Pferde, die mich eben noch durch die Gegend gezogen haben. Zumindest glaube ich, dass es dieselben sind. Ist auf die Entfernung und mit meinen nur mittelmäßigen Pferdekenntnissen nur schwer zu sagen. Außerdem sehen die Fjordis mit ihren Stehmähnen und dem cremefarbenen Fell alle so ähnlich aus.
Beide Tiere haben die Schnauzen in einem Eimer vergraben und mampfen zufrieden. Dem einen wird gerade noch eine Massage mit dem Striegel zuteil. Der Mann, der das Tier putzt, steht mit dem Rücken zu mir, ist schlank und ein wenig kleiner als ich. Unter einer Cap schauen dunkelblonde Wuschelhaare hervor. Eigentlich habe ich keine Lust auf Gesellschaft oder Smalltalk, aber zumindest Hallo sagen kann ich ja mal.
Ich setzte mich also in Bewegung und rufe ein »Hi« durch die Stallgasse, doch es kommt keine Reaktion. Dann eben noch mal lauter: »Hallo!«
Wieder nichts, dabei bin ich nur noch ein paar Schritte entfernt. Will der mich verarschen?
»Tino!«
Ich drehe mich um. Wenigstens ich reagiere, wenn man mich anspricht. Petra steht in der Stalltür und winkt mir.
»Dein Bungalow ist bezugsfertig. Der Schlüssel liegt unter der Fußmatte, da ich gleich nochmal weg muss.« Ihr Blick schweift zu dem Kerl, der noch immer das Pferd striegelt, ohne uns zu beachten.
»Wie ich sehe, hast du Flo schon kennen gelernt.«
Ich hebe die Schultern. »Kann man so nicht sagen. Ich hab Hallo gesagt, aber der redet nicht mit mir. Ist der taub oder was?«
Mit einem Mal tritt ein Ausdruck auf Petras Gesicht, der eine merkwürdige Mischung aus Betroffenheit und einem leichten Tadel sein könnte. Ich blick’s nicht …
»Ja.«
»Was ja?«
»Florian ist gehörlos.«
Upps! Voll ins Fettnäpfchen!
Kapitel 3
Ich kann regelrecht spüren, wie mir die Hitze ins Gesicht steigt. Das kann ja wieder nur mir und meiner schlechten Laune passieren.
»Oh«, murmle ich betreten, »das wusste ich nicht.«
Petras Miene wird milder. »Ich hätte es dir sagen sollen. Jetzt weißt du es und trampelst hoffentlich bei ihm nicht ins nächste Fettnäpfchen.«
Ich beiße mir beschämt auf die Unterlippe. Muss meine Tante eigentlich immer so direkt sein?
»Ich geb mir Mühe«, verspreche ich und schiebe noch hinterher: »Danke, dass ich im Bungalow wohnen kann.«
Petra winkt ab. »Wie gesagt, es macht keine großen Umstände. Also, ich bin zum Abendessen wieder zurück. Du kannst überlegen, ob du mit uns oder alleine essen möchtest.«
Mir liegt bereits die Frage auf der Zunge, ob sie mit »uns« diesen Pferdepfleger meint, aber ehe ich fragen kann, ist sie schon wieder aus dem Stall verschwunden. Einen langen Moment stehe ich reglos auf der Stelle, will am liebsten einfach wieder gehen. Doch das wäre ziemlich feige. Früher oder später werde ich diesem Florian, oder Flo, ja doch über den Weg laufen. Unentschlossen schiele ich zu ihm hinüber. Wie begrüßt man einen Gehörlosen? Einfach vor ihn hinstellen und winken? Hat was von Kindergarten, oder?
Gut, mir wird dann schon spontan etwas einfallen. Erst mal muss ich ihn auf mich aufmerksam machen, denn er ist immer noch ganz vertieft darin, den Fjordi zu striegeln. Da die Stallgasse so schmal ist, muss ich mich ihm von hinten nähern. Zögerlich schiebe ich mich neben ihm in sein Gesichtsfeld und tippe ihm gleichzeitig einmal kurz mit dem Zeigefinger auf den Oberarm. Wie zu befürchten gewesen war, zuckt er unter der Berührung zusammen, fährt herum und …
Oh wow! Damit hatte ich nicht gerechnet. Der Kerl ist süß. Echt süß. Nicht dieses niedliche Süß, wie das eines Hamsters, sondern mehr so … sexy-sweet. Er hat unglaublich strahlende Augen und ein fein geschnittenes Gesicht. Er scheint noch recht jung zu sein, jünger als ich zumindest. Die dunkelblonden Haare hängen ihm frech in die Stirn, die grünen Augen darunter sehen mich erschrocken und verwirrt an.
Ich öffne den Mund und stoße ein »Hi« hervor, ehe mir einfällt, dass er das ja nicht hören kann. Kann er Lippenlesen? Zur Sicherheit hebe ich die Hand, winke dann doch wie im Kindergarten und komme mir dabei dämlich vor. Noch verwunderlicher finde ich, dass er es mir gleichtut, allerdings in einer viel zu übertrieben wirkenden Geste. Dazu formt sein Mund – ebenfalls ziemlich deutlich – das Wort »Hallo«. Irgendwie strange.
Kurz stehen wir uns stumm gegenüber, sehen uns an.