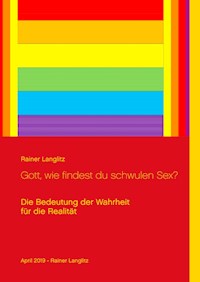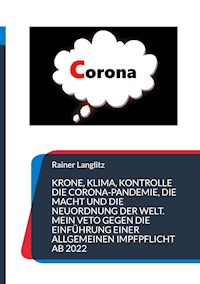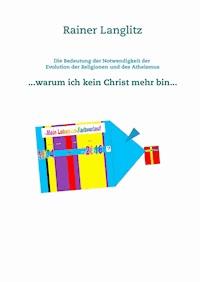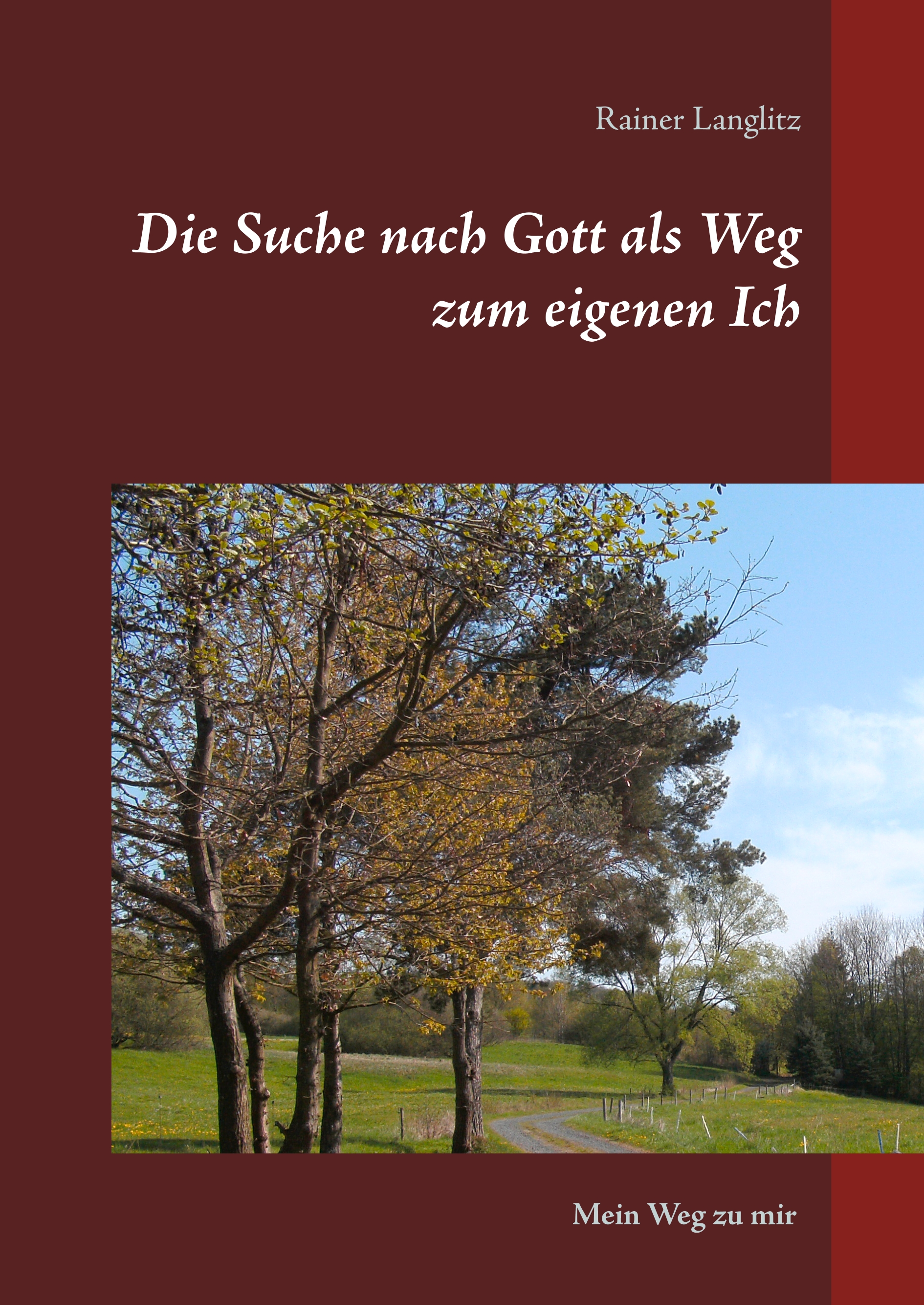
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im 21. Jahrhundert leben wir in einer Zeit der Digitalisierung und des Internets. Ist die Suche nach Gott dabei überflüssig geworden? Als überzeugter Deist beschreibt der Autor in seinem Buch ausführlich den Theismus der Bibel und zeigt auf, wie die Suche nach Gott-ausgehend von seinen biographischen Angaben-den Autor zu seinem eigenen Ich geführt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
„Ich suchte nach Gott
und
fand dabei mich selbst.“
(Rainer Langlitz)
Rainer Langlitz
Die Suche nach Gott als Weg zum eigenen Ich
-
Mein Weg zu mir
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Notwendigkeit von Theologie
Der Theismus der Bibel
2.1 Das Erste Testament
2.1.1 Die Schöpfung als Akt der Liebe Gottes
2.1.2 Der Sündenfall – die Trennung von Gott
2.1.3 Hiob und der leidende Mensch
2.1.4 Die Liebe Gottes
2.2 Die Liebe Gottes in Jesus
2.2.1 Das Reich Gottes als Raum der Liebe
2.2.2 Die Wunder als Zeichen der Liebe Gottes
2.2.3 Das Kreuz als Zeichen der Liebe Gottes
2.2.4 Die Auferstehung – ein Akt der Liebe Gottes
2.2.5 Auferstehungsberichte des Johannes
2.2.6 Die Auferweckung der Toten
2.2.7 Die Offenbarung des Johannes
2.2.8 Gemeinschaft als Zeichen der Liebe
2.2.9 Tod und Liebe
2.2.10 Gebete
Zu meiner Biographie
3.1 Kurzversion
3.2 Langversion
Das Studium der evangelischen Theologie
Mein Studium der evangelischen Theologie
Kants Frage nach Gott als Frage nach dem Menschen
Die Frage des Thomas (von A.) nach der Wahrheit
Wer oder was ist Gott?
Offen sein für das Geschehen in der Welt
Fazit
Fragen zum persönlichen Nachdenken
Literaturhinweise
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
es kann nicht oft genug betont werden, dass zwar die Frage nach Gott nicht nur theoretisch, sondern auch pragmatisch von Relevanz ist.
Wer bewusst nach Gott fragt, fragt unbewusst nach sich selbst.
Sinn dieses hier vorliegenden Buches ist es zu erkennen, warum es sinnvoll ist, sich vom Theismus der Bibel zu distanzieren, es gleichzeitig jedoch für die eigene Person und für alle Menschen sinnvoll ist, sich dem, was wir „Gott“ nennen, zuzuwenden.
Dazu beschreibe ich sehr wertschätzend den Theismus der Bibel, sage aber mit diesem fünften Buch von mir, dass alle Offenbarungsschriften (resp. Bibel) problematisch sind, weil sie…
zu Streiterei führen.
die aktuellen Fragen nicht beantworten.
von Menschen geschrieben wurden, die Gott etwas „in den Mund“ gelegt haben.
Die Enttäuschung über den Irrationalismus des Theismus ist notwendig, damit wir einen Schritt weiter kommen in unserer Entwicklung:
in der Frage nach der Theodizee (Gott und das Leid).
in der Frage nach der Moraltheologie (Gott und die Moral).
in der Frage nach der Wahrheit (Gott in der Vergangenheit, Gegenwart und in der Zukunft).
in der Frage nach dem Selbst (Gott und Individualisierung).
Wenn wir nun – wie ich sage - nichts über Gott wissen (können), sind wir dann eher Agnostiker?
Oder geht es stattdessen um das feste Postulat Gottes, um ganz im eigenen Selbst und ganz für die Realität offen sein zu können?
Aber wie bezeichnen wir uns dann, wenn wir den Theismus als überholt ansehen und dennoch an Gott glauben und ihn postulieren wollen?
Theologen sind gefragt in der Gesellschaft. Sie öffnen sich im festen Postulat Gottes der Realität und beschäftigen sich intensiv mit den vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Ereignissen in der Welt.
Dieses Buch reflektiert und erörtert die Frage nach Gott, damit wir uns ganz für die Realität öffnen und ganz bei uns selbst sein können.
Im Frühjahr 2020
Rainer Langlitz
1. Die Notwendigkeit von Theologie
Der Begriff "Theologie" setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, die aus dem Alt-Griechischen stammen:
theós ("Gott").
lógos ("Vernunft", "Wort", "Logos")
Theologie beschäftigt sich mit dem, was wir Gott nennen.
In der Entwicklung der Menschheit gibt es Zeiten des Polytheismus, des Monolatrismus bzw. Henotheismus, des Monotheismus und des Deismus inkl. des Atheismus und des Agnostizismus.
Auch der Begriff "Theismus" leitet sich vom griechischen Wort "theós" ab und weist auf Gott hin.
Deismus leitet sich vom lateinischen Wort "deus" ab und weist ebenfalls auf Gott hin.
Atheismus ist eine Wortzusammensetzung aus einem sog. "aprivativum" und dem Wort "Theismus". Atheismus ist demnach der Gegensatz zum Theismus.
Auch im Wort "Agnostizismus" steckt das "a-privativum". Gnosis ist das altgriechische Wort für "Wissen".
Polytheismus:
Glaube an die Existenz vieler Götter.
Monolatrismus / Henotheismus:
Anbetung eines einzigen Gottes, die Existenz anderer Götter wird nicht (!) verneint.
Monotheismus:
Glaube an einen einzigen, als Person gedachten Gott (Judentum, Christentum, Islam).
Gott hat sich offenbart, d. h. er hat sich zu erkennen gegeben.
Gott hat diese Welt erschaffen und greift in diese ggf. ein.
Gott hört und reagiert ggf. auf Gebete.
In durch Gott geistlich inspirierten Schriften kommt Gottes Wille zum Ausdruck (Hebräische Bibel, Altes- und Neues Testament, Koran).
Der (Mono-) Theismus steht dem Supranaturalismus nahe (Glaube an Wunder z. B.).
Deismus:
Glaube an einen einzigen, unpersönlich gedachten Gott.
Diese Glaubensrichtung entstand im 17. Jh. (Zeit der Aufklärung).
Die Frage nach Gott ist grundsätzlich offen zu diskutieren.
Gott ist Schöpfer dieser Welt.
Die Realität zeigt und deutet darauf hin, dass Gott nicht in diese Welt eingreift.
Es geht stattdessen um einen Einklang zwischen Wissenschaft, Realität und philosophischer Theologie.
Atheismus:
Es gibt verschiedene Bandbreiten des Atheismus, z. B. den strengen Atheismus.
Religion wird dabei grundsätzlich problematisiert und kritisiert.
Jegliche Gottesvorstellung wird abgelehnt, wodurch Religion als überflüssig angesehen wird.
Agnostizismus:
Die Frage nach der Existenz Gottes und nach einem Wissen darüber wird offengelassen, weil diese Frage nicht abschließend zu beantworten ist.
Demnach wird es mehr oder weniger als unbedeutend angesehen, ob es Gott bzw. Götter gibt oder eben nicht.
2. Der Theismus der Bibel
2.1 Das Erste Testament1
2.1.1 Die Schöpfung als Akt der Liebe Gottes2
Die Schöpfungslehre im Alten Testament ganz am Anfang beschreibt, dass Gott es war, der die ersten Menschen erschuf: Adam und Eva. Adam ist ein hebräisches Wort und heißt übersetzt „Mensch“. Adam ist der Mensch an sich. Gott hat, als er die Welt erschuf, auch den Menschen erschaffen. Ganz am Anbeginn der Welt. Gott hat diese Welt von Anfang an voller Liebe erschaffen. In der Dogmatik spricht man auch von der Schöpfung. Es kann kein Zweifel sein, dass die Welt prinzipiell einmal gut gemeint war. Sie sollte gut funktionieren. Es gibt Tiere, Menschen und Pflanzen auf dieser Erde. Es gibt Wasser, Luft und Sonne (Genesis 1). Wissenschaftler haben schon lange festgestellt, dass sich im Wasser Keime befinden, die sich entwickeln können. Aus dem wissenschaftlich erforschten Begriff der Photosynthese wissen wir, dass Pflanzen Wasser, Licht und Kohlendioxid benötigen, um existieren zu können. Dafür geben sie Sauerstoff an die Umwelt ab, was wiederum Menschen und Tiere zum Atmen und damit zum Existieren brauchen. Dieses grundsätzlich funktionierende System ist in sich schon genial. Dazu kommt die fast unglaubliche Komplexität menschlichen Lebens: ein überaus genial arbeitendes Gehirn, das wohl niemals von einem Computer nachgeahmt werden könnte, die Funktionen des Blutes mit seinen Blutbahnen, die Knochen, die Haut, die Organe.
Im Anfang hat Gott die Welt voller Liebe und Reichtum an Kreativität erschaffen. Das sollte man zunächst als Grundannahme bejahen. „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ (Genesis 1, 31).
2.1.2 Der Sündenfall – die Trennung von Gott
In Genesis 3 verkörpert die Schlange die Versuchung. Sie versucht Eva, indem sie sie dazu verführt, einen Apfel vom Baum der Erkenntnis zu essen. Sie verspricht Eva, wie Gott zu werden, wenn sie (Eva und Adam) von dem Baum der Erkenntnis essen. Gott hatte Adam und Eva davor ausdrücklich gewarnt, davon zu essen3 - nicht als Verbot, sondern als Warnung und Vorsorge. Jeder, der davon essen werde, werde erkennen, dass er sterblich ist. Adam und Eva essen davon. Adam erkennt, dass er nackt ist. Die Folge: Er wird zu einem Sterblichen, weil er Erkenntnis von gut und böse erlangt hat.
Adam und Eva sind nicht mehr im Paradies, sondern müssen sich der harten Realität des Lebens stellen. Damit nimmt das Böse seinen Lauf: Unter den Nachkommen Adams findet der erste Mord statt: Kain erschlägt aus Neid seinen Bruder Abel. Diese Erzählung will verdeutlichen, woher das Böse gekommen ist. Das Böse ist in der Welt mitten unter uns. Wir sind nicht mehr im Paradies. Von Anfang an hatte Gott zwar Vertrauen in den Menschen. Gott hat immer noch und immer wieder Vertrauen in die Menschen und lässt ihnen Freiheit zum eigenständigen Handeln in Selbstverantwortung. Aber der Mensch kommt immer wieder in Versuchung. Er neigt dazu, Neid und Hass zu entwickeln. Er weiß von gut und böse und gibt immer wieder dem Bösen nach.
2.1.3 Hiob und der leidende Mensch
In der alttestamentlichen Erzählung des Sündenfalls und der Vertreibung aus dem Paradies wird nicht erklärt, warum Gott das Böse nicht verhindert.
Durch die Entwicklung des Menschen sind viel Unheil und Ungerechtigkeit in diese Welt gekommen: Neid, Hass, Verbrechen, Morde, Kriege. Aber auch Rodung von Wäldern und die damit verbundene Entwicklung von Wüsten und damit die Unmöglichkeit von Ackerbau und Landwirtschaft wie z. B. in Afrika; Industrialisierung und damit der Anfang unserer heutigen Klimaveränderung und der zukünftigen Klimakatastrophe auf der ganzen Erdkugel; Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich: Menschen auf der Nord- und Südhalbkugel (z. B. Reichtum in Europa und Armut in Afrika) und selbst Ungerechtigkeit in westlich orientierten reichen Ländern (Armut durch Arbeitslosigkeit bei einer gleichzeitigen unverhältnismäßig, ungerecht und zum Himmel schreienden Vermögensansammlung mancher Berufsgruppen wie Manager, Showmaster und Sportler.
Viele Menschen klagen Gott an, warum er nicht persönlich in diese Welt eingreift und Leiden verhindert. Warum lässt du das Böse zu, wenn du doch allmächtig bist? Gott will nicht das Leid von Menschen. Aber er verhindert es auch nicht. Warum müssen unschuldige Menschen leiden durch Ereignisse wie dem Chemieunfall in Indien im 20. Jahrhundert (80er Jahre)? Bei dem Chemieunfall könnte man noch sagen: Ja, hätte der Mensch nicht solche gefährlichen Chemikalien entwickelt, hätten nicht so viele Menschen bis heute zu leiden unter gefährlichen Verätzungen. Viele Inder, die sich damals im Umkreis dieses schrecklichen Chemieunfalls aufhielten, sind so stark psychisch und physisch zerstört, dass sie nicht einmal mehr alleine leben können, sondern lebenslang auf fremde Hilfe angewiesen sind. Viele mussten vorzeitig sterben.
Wie verhält es sich aber mit Naturkatastrophen und unverschuldeten Schicksalsschlägen? Hier ist das menschliche Leid offensichtlich nicht durch den Menschen selbst verursacht. Wo ist also hier Gott? Wie kann Gott das zulassen? Wie kann sich Gott für dieses Leiden seiner Schöpfung rechtfertigen? Wo kommt das Böse her? Welche Bedeutung kann das Böse haben?
Das sind Fragen, die sich zu Recht Philosophen, Schriftsteller und Theologen immer wieder gestellt haben. Naturwissenschaftler erklären die Ursachen von Erdbeben rein objektiv und sachlich durch natürliche geologische Prozesse, wie z. B. Verschiebungen von Erdplatten.
Ein Versuch einer theologischen Antwort auf Fragen nach unverschuldetem Leiden wie z. B. bei Erdbeben, warum es das Böse in der Welt gibt, wo es herkommt und warum Unschuldige leiden müssen, ist bereits im alttestamentlichen Buch Hiob entwickelt. Die Geschichte des Hiob ist eine Geschichte über die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Warum des Leidens: Warum leide ich, warum werde ich krank? Wie kann Gott das zulassen? Sie thematisiert in prosaischer Erzählung die Frage nach der Möglichkeit und dem Grund des Leidens Unschuldiger. Zum Inhalt des Hiobbuches: Der vom Glück gesegnete Hiob wird nach einer Wette zwischen Gott und dem kritischen Ankläger Satan geprüft, ob Hiob weiterhin an Gott glaubt trotz des über ihn herein gebrochenen Unglücks und Leidens. Hiob erträgt zunächst sein Geschick geduldig („Gott hat’s gegeben, Gott hat’s genommen; gepriesen sei der Name des Herrn.“ Hiob 1, 21). Hiob fühlt sich jedoch unschuldig und fragt sich, warum er so leiden muss. Freunde führen mit Hiob lange Gespräche. Sie sind jedoch nicht in Hiobs Lage und versuchen, dem leidenden Hiob kluge Ratschläge zu erteilen und nach Erklärungen für seine Situation zu suchen.4 So richtet sich Hiobs Klage zunehmend an Gott, den er als Urheber seines Leidens ansieht. Hiob erwartet Gerechtigkeit von diesem Gott, und zwar noch in seinem jetzigen Leben. In den sogenannten Gottesreden spricht sich Gott gegen die Bestrafungstheorie der Freunde aus, weist aber auch Hiobs Klage als allzu egozentrisch zurück. Die Erzählung schließt mit der Wiederherstellung von Hiobs Glück und Gesundheit, ohne eine Antwort auf die Frage nach der Ursache des Bösen und des Leidens in der Welt zu geben. Das Leid wird damit als naturgegebener Bestandteil dieser Welt angesehen.5
Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Herkunft von Naturkatastrophen in Verbindung mit Gott ist in einer Elia-Erzählung in einem anderen alttestamentlichen Buch der Könige (1. Könige 19, 9-14) thematisiert. In dieser kurzen Erzählung sitzt der Prophet Elia aus Angst vor seinen Verfolgern in einer Höhle, um sich vor ihnen zu verstecken und sich so in Sicherheit zu bringen. Aber Gott befiehlt ihm, vor die Höhle zu treten, auf einen Berg zu steigen und zu warten, bis Gott zu ihm spricht. Gott möchte sich Elia offenbaren. Zuerst zieht ein heftiger Sturm auf, der so stark ist, dass er mehrere Gebirgsketten verwüstet. Doch Gott offenbart sich nicht in diesem Sturm, er ist nicht in diesem Sturm zu finden. Danach passieren ein Erdbeben und ein Feuersturm. Auch nach diesen zerstörerischen Naturkräften spricht Gott nicht zu Elia. Dann ist ein leiser Ton stillen Wehens zu vernehmen. Elia verhüllt sein Angesicht und hört in diesem säuselnden Lufthauch Gottes Stimme.
Auch in dieser Erzählung wird nicht die Frage nach dem Woher und dem Warum von zerstörerischen Stürmen und Erdbeben geklärt. Es wird nur gesagt, dass man Gott nicht darin findet, auch wenn sie immer wieder vorkommen.6
2.1.4 Die Liebe Gottes
Die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen ist im Alten Testament deutlich spürbar. Gott wird als zürnender Gott7 beschrieben, der aber immer wieder nach Versöhnung mit der Welt sucht und damit in Liebe seinen Geschöpfen gegenüber tritt.
Bereits zwei Kapitel nach der Erzählung des Brudermords des Kain an Abel wird im Alten Testament beschrieben, dass Gott beabsichtigt, die gesamte Menschheit durch eine Sintflut zu vernichten. Im Begriff „Sint“ kann etymologisch8 das Wort „Sünde“ als Abwesenheit von der Liebe Gottes gesehen werden:
„Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe.“ (Genesis 6, 5-7)
Dennoch geschieht immer wieder Versöhnung zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Gott lässt durch Noah die bekannte „Arche Noah“ bauen, die den Erhalt des Lebens auf diesem Planeten sichern soll (Gen. 7 und 8). Gott schließt sogar einen Bund mit Noah, dessen Zeichen im Symbol des Regenbogens vom Menschen erkannt werden soll:
„Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist.“ (Genesis 9, 16)
Dennoch handelt der Mensch immer wieder böse und versucht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen: er entwickelt Maschinen, das Automobil, die Raumfahrt, die Atombombe und die Gentechnik.
„Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen! – und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst verstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun.“9
In Abraham10 erkennt und erwählt Gott einen Menschen, der treu im Glauben ist. Abraham wird auch als der Vater des Glaubens bezeichnet.
„Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein.
Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte.“11 In Genesis 15, Vers 6 wird Abraham sogar als „gerecht im Glauben“12 bezeichnet, da Abraham immer wieder von neuem auf Gott vertraute. Abraham ist jedoch so streng gläubig, dass er seine Liebe zu seinem eigenen Sohn Isaak vergisst. Er ist so streng gläubig, dass Gott ihn versucht, um in ihm so eine Bewusstseinsänderung zu bewirken. Gott versucht Abraham darin, dass er Abraham befiehlt, seinen eigenen Sohn zu opfern, um so seine Glaubensstandhaftigkeit zu prüfen. Doch in letzter Minute redet Gott durch einen Engel auf Abraham ein und verhindert so das Schlimmste.
„Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham! Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.“ 13
In dieser Erzählung ist deutlich die Liebe Gottes zum Menschen spürbar, die nicht Tod, sondern Leben will.14 Auch in der Josephs-Erzählung steht symbolisch im Akt des Verzeihens Josephs gegenüber seinen Brüdern das Verzeihen Gottes gegenüber seinen Geschöpfen.
Ebenso kann die Befreiung der Israeliten aus der Knechtschaft der Israeliten unter ihrem Sklavendienst in Ägypten unter dem Aspekt der Liebe gesehen werden.
Die Psalmen stellen Gebete der Liebe dar. Menschen sehnen sich nach der Liebe Gottes. Es gibt Psalmen der Dankbarkeit als tief empfundene Liebe zu Gott und seinem Handeln am Menschen, aber auch Gebete in Angst als Gefühl der Abwesenheit der Liebe Gottes. Auch das Gebet der Bitte um Gerechtigkeit und der Rachsucht werden als tiefes Verlangen des Menschen nach Recht, Gerechtigkeit und damit nach der Liebe Gottes und der Wiederherstellung ursprünglichen Glückes formuliert.
Das Hohelied beschreibt die Liebe zwischen Mann und Frau, die in ihrer Auslegungsgeschichte oft auf die Liebe zwischen Gott und Mensch übertragen gesehen wurde.
In den Büchern der Propheten schließlich wird die Bemühung der Menschen beschrieben, die Stämme der Israeliten zu Gott zu bekehren. Sie verkünden damit die Liebe Gottes zu den Menschen, indem sie dem Volk neue Hoffnung verkünden in Zeiten der Kriege mit Nachbarvölkern oder der Verbannung des israelitischen Volkes.
2.2 Die Liebe Gottes in Jesus
2.2.1 Das Reich Gottes als Raum der Liebe
Jesus trat zuerst in Galiläa öffentlich auf. Im Alter von 30 Jahren15