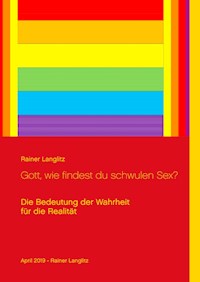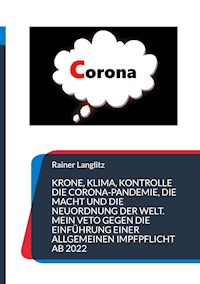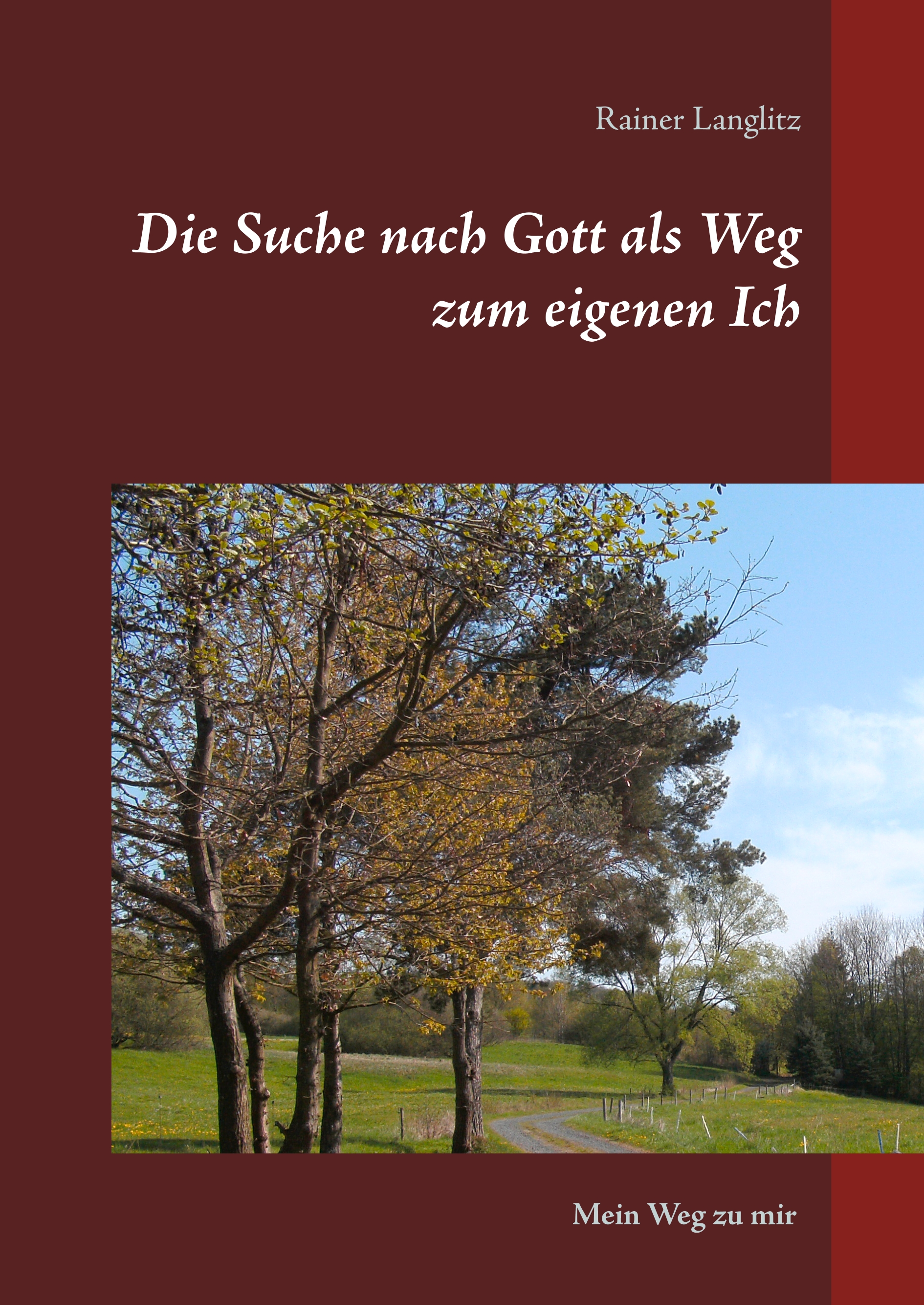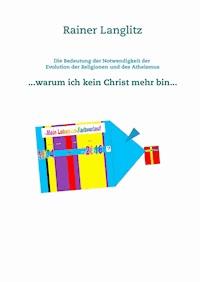Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Buch werden dem Leser unterschiedliche Aufsätze aus den Themenbereichen Gesellschaft, Gesundheit, Soziale Kompetenz, Philosophie & Theologie übermittelt. Alltagstauglich, von Theorie und Praxis geprägt, präsentiert der Autor Rainer Langlitz, geb. 1974 seinen Leserinnen und Lesern Lebensweisheiten zu den essentiellen Themen Gott, Mensch und Welt in Form von kurzen und auf den Punkt gebrachten Aufsätzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 5. Auflage
Vorwort zur 4. Auflage
Vorwort zur 3. Auflage
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort
Sympathie und Normal-Sein
Soziale Kompetenz
Das Böse in der Welt
Gott – wer oder was ist das eigentlich?
Angst versus Liebe
Die Auswirkungen unserer Gedanken
Probleme im 21. Jahrhundert
Wie verändert der Mensch die Welt?
leiblicher Vater – himmlischer Vater
Vom Leben im Jetzt und Heute
Was ist der Mensch?
Mai 2020 – Wer erlöst uns?
Ist Theologie eine Wissenschaft?
Kann man Gottes existenz Beweisen?
Unabhängige Theologie
Homosexualität und Kirche
Shutdown und Transformation
Corona – Viruswahn?
Person, Angst und Stress
Vom Genießen
Von der Kunst des Lebens
Sterben ins Nichts?
Dualismus vs. Monismus
Krankheit und Gesundheit
Ist die Ehe weiterhin ein Ideal?
Taizé – Unstimmigkeit als pars pro toto
Der Machthunger des Christentums
D. Trump und Ökologie
Kulturen, Religionen und Ideologien
Die Macht Gottes
Credo - Ich glaube an Gott...
Gott als Heiliges Geheimnis
Fratzen – Teufel – Exorzismus
Was ist wahr an der Bibel?
30 Jahre Deutsche Einheit - Wie einig sind wir?
Welche Zukunft haben die Kirchen?
Kain und Abel - Kritik und Aggression
Vom Monotheist zum Deist
Die Zahnräder der Politik
Straft uns Gott mit Krankheiten?
Die Widersprüche des 09. November
Rhythmisch leben und genießen
Die Bedeutung von Lukas 2, 21-24
Arbeit, Urlaub und Ewige Ruhe
Wie oft gehen Sie noch in die Kirche?
Gibt es Gott?
Liebe, Hass und Gewalt
Wie gehe ich mit „Machtspielchen“ um?
Depression und Depressiv-Sein
Fleisch essen am Karfreitag?
Ostern als Symbol für neues Leben
Aufstieg und Vom Abstieg des Christentums
Von der Bedeutung der Zahl 4
Das Phänomen der Bisexualität
Glück und der Sinn des Lebens
Sachwortverzeichnis
Literaturhinweise
VORWORT ZUR 5. AUFLAGE
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
mein Aufsatzband „Gott–Mensch–Welt“ erscheint nun in fünfter, überarbeiteter Auflage.
Es wurde bei dieser fünften Auflage eine innerliche und äußerliche Überarbeitung vorgenommen:
Inhaltlich ist die fünfte Auflage nun um 10 weitere Aufsätze erweitert worden, wobei die bisherigen Aufsätze 19 (Vom Sinn des Lebens) und 21 (Glück – Wie werden wir glücklich?) von mir zusammengelegt wurden.1
Inhaltlich wurden auch die Überschriften der einzelnen Aufsätze angepasst.
Weiterhin wurden zwei Bilder, die ich selbst entworfen habe, hinzugefügt.
Last but not least habe ich äußerlich eine Überarbeitung des Covers vorgenommen.
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen!
Frankfurt/M, Mai 2021
Rainer Langlitz
1 Siehe dazu nun den entsprechenden Aufsatz 55 am Ende dieses Aufsatzbandes).
VORWORT ZUR 4. AUFLAGE
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
ich freue mich, Ihnen zu Beginn der Advents- und Weihnachtszeit 2020 diese vierte Auflage meines Aufsatzbandes
„Gott-Mensch-Welt“
präsentieren zu dürfen. Diese vierte Auflage enthält nun 45 Aufsätze inkl. eines Sachwortverzeichnisses, so dass Sie sich nun leichter und themenorientiert innerhalb dieses Buches bewegen können.
Somit sind seit dem Erscheinen der ersten Auflage aus August 2020 vier Monate vergangen. Anfang Dezember 2020 wird die vierte Auflage vorliegen. Passend zur Zahl „vier“ hat innerhalb dieser vierten Auflage der 45. Aufsatz das Thema „Advent und Weihnachten“ zum Inhalt.
Bedanken möchte ich mich bereits jetzt bei allen meinen Leserinnen und Lesern für kritische Würdigungen und Feedbacks. Meinen Dank möchte ich besonders gegenüber dem BoD-Verlag zum Ausdruck bringen, der eine hervorragende Arbeit macht.
Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser, wünsche ich eine friedliche Zeit – geprägt von Glück und Gesundheit – sowie alles Gute und viel Freude bei der Lektüre.
Frankfurt/M, November 2020
Rainer Langlitz
VORWORT ZUR 3. AUFLAGE
Liebe Leserinnen und Leser,
diese dritte Auflage umfasst nun 39 Aufsätze. Die neuen Aufsätze 29 – 39 enthalten teilweise längere Passagen, die u. a. aus Wikipedia zitiert wurden. Es wurde versucht, diese Passagen mit einer kleineren Schriftgröße deutlich zu machen sowie die entsprechenden Quellen anzugeben.
Mit den besten Wünschen verbleibe ich
Frankfurt/M, Oktober 2020
Rainer Langlitz
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE
Liebe Leserinnen und Leser,
diese zweite Auflage wurde um sieben weitere Aufsätze erweitert.
Außerdem wurde in der zweiten Auflage meinerseits eine Überarbeitung in den Aufsätzen 1 bis 21 vorgenommen.
Mit den Wünschen einer guten, friedlichen und gelingenden Zeit für uns alle grüße ich Sie und wünsche Ihnen nun eine spannende Lektüre.
Frankfurt/M, September 2020
Rainer Langlitz
VORWORT
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
den Begriff Aufsatz kennen wir aus unserer Schulzeit.
In Aufsätzen bringen wir unser Denken zum Ausdruck.
„Ich denke, also bin ich“. René Descartes (1596 – 1650).
Denken ohne Tun ist wie Theorie ohne Praxis.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) soll gesagt haben:
„Denken und Tun, Tun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher geübt, nicht eingesehen von einem jeden. Beides muß wie Aus- und Einatmen sich im Leben ewig fort hin und wider bewegen; wie Frage und Antwort sollte eins ohne das andre nicht stattfinden. Wer sich zum Gesetz macht, was einem jeden Neugebornen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr flüstert, das Tun am Denken, das Denken am Tun zu prüfen, der kann nicht irren.“
Unser Leben geschieht nicht nur im Denken, sondern im Besonderen auch im Tun: in der Erfahrung des praktischen Lebens. Theorie („Denken“) ohne Praxis („Tun“) ist nichts. Tun ohne Denken ist allerdings auch nichts.
Denken und Tun gehören unabdingbar zusammen.
In meinen Aufsätzen („Essays“), die ich Ihnen hier zum Lesen präsentiere, kommt die Erfahrung von „Tun und Denken“ zum Ausdruck. Es geht in diesem Essayband um die Themenbereiche: Gott-Mensch-Welt.
Innerhalb dieser Bereiche spiegelt sich unser Leben, Tun und Denken.
Gedanken haben die Kraft der Verwirklichung und können sich damit auf unser Leben und Tun auswirken:
Aus Gedanken werden Worte geformt.
Aus Worten werden Handlungen.
Aus Handlungen werden Gewohnheiten.
Aus Gewohnheiten wird Charakter.
(Vgl. dazu den Talmud).
Unser Charakter ist Teil unserer Persönlichkeit und damit Teil unseres Menschseins. Wir Menschen wiederum prägen und gestalten die Welt.
Daraus wird deutlich, wie entscheidend und folgenreich es sein kann, wie (!) wir denken.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit sowie stets eine gute Zeit und nun eine gute und spannende Lektüre der nachfolgenden Aufsätze.
Frankfurt/M, August 2020
Rainer Langlitz
1. SYMPATHIE UND NORMAL-SEIN
Der Begriff „normal“ leitet sich ab von lat. „norma“ und meint im Deutschen: "Richtschnur, Maßstab, Regel, Vorschrift". Es gibt DIN-Normen. Eine Norm ist so etwas wie ein Durchschnitt, an dem wir uns orientieren können. Der Begriff „enorm“ meint in diesem Zusammenhang „außerhalb“ der Norm.
Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass es normal oder unnormal unter uns Menschen nicht (!) gibt. Ein Mensch ist ein unverwechselbares Individuum. Es gibt denselben Menschen nirgends auf der Welt. Jeder Mensch ist einzigartig.
Bei der Frage, ob eine Persönlichkeit normal ist, sollen folgende Fragen unterstützen:
Bin ich normal...
bei Bindungsunfähigkeit?
bei einem bestimmten Fetischismus?
bei aggressivem Verhalten (verbal oder physisch)?
bei sozialer Phobie?
bei erhöhter Internetpräsenz?
bei einem bestimmten Essverhalten?
bei einem bestimmten Tages-und Nachtrhythmus?
bei einer bestimmten Unsicherheit?
bei einer bestimmten Unfähigkeit, sich zu freuen oder bei fehlendem Sinn für Humor?
bei zu wenig oder zu viel gelebtem Sex?
bei einer bestimmten Form des "Aberglaubens"?
bei einer übertriebenen Form "Gesundheitsbewusstseins“?
wenn man keine oder nur wenig Freunde hat?
wenn man mit 30 noch im Elternhaus wohnt?
wenn man den vollen Mülleimer nach zwei Tagen immer noch nicht ausgeleert hat?
wenn ich regelmäßig morgens nicht aufstehen kann?
wenn ich ständig nur kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse habe?
wenn es einem schwer fällt "Nein" sagen zu können?
wenn ich mit 56 eine/n 20-jährige/n Partner/in suche?
wenn ich nicht kritikfähig bin?
wenn ich als Deutscher 1993 geboren bin und nicht englisch sprechen kann?
wenn ich jede Woche mehr als drei Flaschen Bier oder Wein trinke?
wenn ich ständig lachen muss und keine Trauer zulassen kann?
wenn ich Perfektionist sein will?
wenn ich permanent nach Erfolg strebe?
wenn ich dauernd jemandem helfen möchte?
wenn ich dieselbe Kleidung länger als zwei Tage trage?
wenn ich mehr als drei Zigaretten pro Tag rauche?
wenn ich schon länger als 1 Jahr nicht mehr beim Zahnarzt war?
wenn ich jeden Tag "Nudeln mit Ketchup" esse?
wenn man Angst hat in öffentlichen Toiletten das Urinal zu benutzen?
wenn ich mir mit 40 kein Auto leisten kann?
wenn ich "tuckig" bin?
wenn ich mich schon seit zwei Tagen nicht mehr geduscht habe?
wenn ich heute mit einem Mann, morgen mit einer Frau, übermorgen wieder mit einem Mann usw. schlafe?
Die Liste ist unbegrenzt! Was ist normal? Wer legt Normal-Sein fest? Wer kann von sich sagen, dass er/sie normal ist? Normal ist an und für sich ein mathematischer Begriff und heißt so viel wie "Durchschnitt". Bestimmte Gruppen von Menschen (z. B. die "Gesellschaft", aber auch z. B. die Familie) legen für sich fest, was für sie als "normal" gilt. Das ist in der Regel identitätsstiftend und gibt der jeweiligen Gruppe einen äußeren Rahmen. In der Regel legt diese Gruppe dann auch bestimmte Regeln fest, an die sich die Gruppe halten muss. Wir können andere besser annehmen und finden sie dementsprechend sympathischer, wenn wir das subjektive Gefühl haben: "Die oder der ist normal ("durchschnittlich"). Er/sie ist kein Exot und gehört keiner Randgruppe bzw. Minderheit an, die uns möglichweise suspekt ist und die in uns Panik auslösen könnte." Das Normale ist uns sympathisch, das "Unnormale" macht uns Angst. Wir haben Berührungsängste und damit Angst, Nähe zu diesem Gegenüber aufzubauen. Im Extremfall können paradoxe Ängste entstehen, die sich in Aggressionen ausdrücken und entladen können, die mitunter ein Symptom sein können für die unbewusste Unfähigkeit, die eigene Angst wahrnehmen, reflektieren und bearbeiten zu können, und gleichzeitig für den vorhandenen Wunsch nach Nähe, worin sich diese Paradoxie bemerkbar macht. Denn es ist leichter von der eigenen Angst abzulenken, nicht bei sich zu bleiben, sich nicht selbst in Frage stellen zu müssen bzw. sich selbst zu beobachten und zu reflektieren. Es ist eben menschlich, emotional zu werden und sich zu echauffieren, d. h. aus sich heraus zu fahren, aus sich heraus zu bewegen ("aus der Haut zu fahren") und aggressiv zu werden, d. h. an jemanden gewaltsam heranzutreten und dabei nicht bei sich bleiben zu können. Viele Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang auch davon, dass sich die häusliche Wohnung sehr oft mit der inneren seelischen Situation spiegelbildlich verhält / korrespondiert. Mit anderen Worten: Herrscht in meiner Wohnung und in meinem Lebensumfeld Unordnung, dann herrscht auch Unordnung in meiner Seele (Persönlichkeit) (und umgekehrt!).
Durch Angst kann weitere Angst und im Extremfall auch eine daraus resultierende Gewaltspirale entstehen. Je größer das innere und damit auch das äußere Chaos, desto höher ist oftmals auch die Gewaltbereitschaft. In der Geschichte der Menschheit ist das sog. "Unnormale" schon oft ausgegrenzt, diskriminiert, sabotiert, isoliert, vergast, erhängt, gesteinigt, verbrannt worden. Dieses Verhalten basiert jedoch immer auf Angst, die sich xenophobisch im Extremfall durch kalte und kalkulierte Aggression zu entladen versucht. Dies ist auch der Grund, warum bestimmte Minderheiten immer wieder zu "Sündenböcken" abgeurteilt werden. Dies ist im Grunde genommen nichts Anderes als die Darbringung eines Opfers ("Sündenbock"), um von der eigenen Angst abzulenken, die in dieser von der Angst heimgesuchten Person bzw. in dieser Gruppe wildwüchsig wie ein Krebsgeschwür wuchert. Ich lenke damit von meiner Angst ab. Und da diese/r Unnormale mir eben unsympathisch ist, versuche ich ihn/sie (Hexen, Juden, Behinderte, Schwule, Ausländer, Flüchtlinge, Kranke, Andersgläubige, ethnische Minderheiten etc.) eben zu beseitigen, denn es herrscht die Auffassung, dass nur das "Normale" das "Normale" sei (um ein kleines Wortspiel zu verwenden...). Personen übernehmen bzw. spielen oftmals eine Rolle. Damit ist gemeint, dass der jeweilige Mensch als Person von außen gesehen und betrachtet wird. Gerade in Gruppen werden Personen als sympathisch bzw. als unsympathisch wahrgenommen. Wir finden in der Regel unser Gegenüber dann sympathisch, ...
wenn wir uns in diesem Gegenüber "gespiegelt" fühlen, d. h. auch, wenn wir uns in ihm/ihr in irgendeiner Weise (wieder-) erkennen können - auch bekannt unter dem Sprichwort "Gleich und gleich gesellt sich gern!".
wenn wir in diesem Gegenüber keine Konkurrenz erkennen, denn wenn das Gegenüber eine Konkurrenz ("Mitläufer, Mitstreiter") darstellt, dann löst dies in einem schwachen Ego Angst aus (z. B. in Form von Minderwertigkeitsgefühlen). Das Ego fühlt sich dadurch an seinen inneren begrenzten Horizont erinnert und fühlt sich eingeengt.
wenn wir in diesem Gegenüber erkennen, dass er / sie auch nur ein bloßer Mensch ist mit Fehlern und Schwächen, der also kein Über-Mensch ist, sondern dem es auch mal schlecht gehen kann und der also auch mal in leidvolle Situationen geraten kann.
wenn er / sie ein positiver und fröhlicher und in gewissem Sinne erfolgreicher und möglichst auch ein gesunder und ausgeglichener Mensch ist. Das wiederum hat damit zu tun, dass wir mit kranken Menschen in der Regel nicht gut umgehen können. Wir wollen nicht mit ihnen mitleiden und uns deren Leid zu unserem eigenen Leid machen. Deswegen finden wir dementsprechend in der Regel fröhliche, erfolgreiche und gesunde Menschen sympathischer.
wenn wir in diesem Gegenüber erkennen, dass er/sie "normal" ist.
wenn wir in diesem Gegenüber einen gewissen "Nutzen" erkennen, denn so gut wie jeder Mensch neigt in gewisser Weise zum Egoismus. Das ist zum Teil auch wichtig und ein Zeichen von Gesundheit. Es gibt aber auch Menschen, die nutzen in ihrem "Egoismus" andere aus und missbrauchen sie damit. Die Sympathie ist dann ausbeuterisch intendiert.
wenn wir in diesem Gegenüber eine Ergänzung erkennen können. Viele Menschen verspüren einen inneren, seelischen und gefühlsmäßigen Mangel, unter dem sie mehr oder weniger leiden und den sie deswegen auszugleichen versuchen. Insofern wird dann ein solches Gegenüber als sympathisch empfunden, weil in diesem Gegenüber in diesem Fall dann die Ergänzung bzw. der Ausgleich des subjektiv empfundenen Mangels vorgenommen werden soll - auch bekannt unter dem Stichwort "Gegensätze ziehen sich an!"
Wir sollten den Begriff "normal" ggf. im Bereich der Statistik verwenden, um auszudrücken, wie bestimmte Verhaltensweisen von uns Menschen gehäuft vorkommen. Ein einzelnes Verhalten sollte jedoch nicht als "normal" oder als "unnormal" bezeichnet werden.
Wir leben als Individuen zumeist in einer Gemeinschaft bzw. in einer Gruppe:
Partnerschaft und Familie
Verein etc.
Staat(en)
Gruppen machen Regeln, Ordnungen und Gesetze notwendig. Innerhalb dieser Gruppe gilt es, diese Regeln einzuhalten. Es gibt immer wieder Abweichler von Regeln, was Ursachen hat. Manchen Menschen ist die Sympathie der Mitmenschen gar nicht wichtig. Sie verhalten sich wie der sprichwörtliche "Elephant im Porzellanladen" und ecken überall und ständig an. Dies führt in der Regel dazu, dass solche Menschen als unsympathisch angesehen werden, weil sie ständig für Unfrieden und für Störung sorgen. Menschen, die als unsympathisch gesehen werden, wäre geraten, soziale Kompetenz zu erlernen.
2. SOZIALE KOMPETENZ
Manche Menschen haben eine positive Ausstrahlung. Sie wirken zufrieden und haben in aller Regel wenig Konflikte mit ihren Mitmenschen.
Andere Menschen wiederum neigen zur Hysterie: sie fühlen sich ständig "persönlich angegriffen" und reagieren bei der kleinsten Kleinigkeit genervt, gereizt und sehen sich genötigt, emotional zu werden, sich zu echauffieren, zu explodieren und aus der Haut zu fahren.
Woran liegt das? Der eine so - der andere so...?
Soziale Interaktionen finden überall statt. Wir müssen sozial kompetent sein und werden.
Was bedeutet das?
Zum Umgang miteinander gehört zweifelsohne „soziale Kompetenz“. Soziale Kompetenz ist ein Komplex von Fähigkeiten, die dazu dienen, in Kommunikations- und Interaktionssituationen entsprechend den Bedürfnissen der Beteiligten Realitätskontrolle zu übernehmen und effektiv zu handeln. Mit "sozialer Kompetenz" ist die Fähigkeit gemeint, sich im gesellschaftlichen Rahmen in allen in Frage kommenden Situationen adäquat verhalten zu können.
Es gibt drei verschiedene Grundsituationen:
mein Recht durchsetzen.
die gleichgeordnete Beziehungsebene leben.
um Sympathie bei Dritten werben müssen.
Beispiele für sozial kompetentes Verhalten:
Konflikte nicht entstehen zu lassen, sie zu lösen bzw. auszuhalten.
um Sympathie werben zu können.
Kritik wertschätzend üben und Kritik annehmen zu können.
Nein sagen zu können, wenn ich etwas nicht will.
sich in den Anderen/die Andere empathisch hinein fühlen zu können und erspüren zu können: Wie geht es ihm/ihr gerade? Was könnte sie/er gerade brauchen?
eine Partnerschaft führen zu können.
in der Lage zu sein, für ein gutes Klima sorgen zu können.
eigene Bedürfnisse zur Sprache zu bringen und es zu schaffen, dass diese erfüllt werden.
zu wissen, wann ich im Recht bin und dieses durchsetzen zu können.
ein Gespräch am Laufen halten zu können.
jemanden auf der Straße ansprechen zu können und ihn/sie nach der Uhrzeit zu fragen.
sich teamorientiert verhalten zu können.
Im Rahmen der sozialen Kompetenz2 können wir drei Situationen3 von sozialen Interaktionen unterscheiden – bezogen auf „Du“ und „Ich“:
1.) Objektiv im Recht sein:
Das „Ich“ ist groß; das „Du“ ist klein.
2.) Um Sympathie werben müssen:
Das „Ich“ ist klein; das „Du“ ist groß.
3.) Die Beziehungsebene leben:
„Ich“ und „Du“ sind gleich groß.
Es gibt viele beispielhafte Situationen dafür. Für jede Situation sei ein Beispiel genannt:
zu 1.) Reklamation einer gekauften Hose, die einen Mangel hat. Innerhalb von 14 Tagen kann ich diese in aller Regel umtauschen bzw. ich habe ggf. das Recht, den Kaufpreis (sc. das Geld) für die Hose zurückzufordern. Das „Du“ wäre dann in dieser Situation eine Firma bzw. ein Verkäufer, bei dem ich etwas gekauft habe.
zu 2.) Wenn ich um eine Gehaltserhöhung bitte, bin ich nicht im Recht. Stattdessen muss ich um „Sympathie“ werben und mich um gute Argumente bemühen. Mein Chef ist das „Du“. Er sitzt in dieser Situation am „längeren Hebel“.
zu 3.) Unter Partnern in einer Liebesbeziehung, aber auch unter Kollegen, Bekannten und Freunden herrscht in aller Regel die Beziehungsebene.
Abschließende Aspekte:
1.) Oftmals übernehmen wir in beruflichen Situationen eine Rolle. Wir haben und sind zwar eine Persönlichkeit, die sich durch verschiedene Merkmale auszeichnet. Trotzdem stehen wir oftmals in einer Rolle. Im Wesentlichen lassen sich vier Extreme dabei unterscheiden (Fritz Riemann, Grundformen der Angst):
a) die schizoide Persönlichkeit:
der ruhige, distanzierte, schüchterne Typ.
b) die depressive Persönlichkeit:
der einfühlsame, Nähe-suchende und Näheaufbauende und harmoniebedürftige Typ.
c) die zwanghafte Persönlichkeit:
der wissenshungrige, ordentliche Typ, dem Regeln wichtig sind.
d) die hysterische Persönlichkeit:
der lockere, gesellige Typ, der gerne im Mittelpunkt steht und der gerne bewundert werden möchte.
Rolle meint hier auch: jeder spielt eine Rolle und hat eine Bedeutung und ist quasi für das Gruppengefüge wichtig. Fällt einer innerhalb dieses Gruppengefüges weg, so entsteht ein Gefälle: es ändert sich etwas innerhalb der Gruppendynamik.
2.) Zur sozialen Kompetenz gehören im Wesentlichen:
Teamfähigkeit.
Kritikfähigkeit.
Konfliktfähigkeit.
Zu a) Teamfähigkeit
Wir können unterscheiden zwischen „Gruppen“ und „Teams“. Ein Team ist auch eine Gruppe. Additiv im Vergleich zu einer Gruppe ist bei einem Team die „Lösung einer bestimmten Aufgabe oder die Erreichung eines bestimmten Zieles“. Teamfähigkeit bedeutet also in diesem Zusammenhang, alle Fähigkeiten zu besitzen bzw. anzuwenden, damit die jeweilige Gruppe eine bestimmte Aufgabe lösen kann bzw. ein bestimmtes Ziel erreicht.
Zu b) Kritikfähigkeit
Wir Menschen neigen dazu, nicht gerne kritisiert zu werden. Es fällt uns aber auch oft gleichermaßen schwer, andere Menschen zu kritisieren.
Viele Menschen sprechen in diesem Zusammenhang oft von „konstruktiver Kritik“. Sie meinen damit, dass die Art der Kritik nicht erniedrigend, verletzend oder demütigend erfolgen soll, sondern positiv: also vorteilhaft und dienlich.
Unsere Welt ist voll von Kritik. Wir sind oftmals sogar darauf angewiesen, kritisiert zu werden.
Warum ist das so?
Wir Menschen sind „animales socialia“. Dies bedeutet, dass wir quasi wie Tiere sind, die in einer Gemeinschaft leben. In einer Gemeinschaft gibt es Regeln, die beachtet werden sollen/müssen. Regeln wiederum dienen dazu, dass die Gemeinschaft weiß, welches Verhalten angemessen und erwünscht ist. Die Glieder der Gemeinschaft sollen diese Regeln befolgen. Tun sie dies nicht, erfolgen Kritik, Sanktionen (Maßregelungen) bis hin zu Bestrafungen. Bereits in der Schule werden wir von unseren Lehrern und Lehrerinnen in Form von Ermahnungen, Noten und Zeugnissen kritisiert. Natürlich werden Kinder auch von ihren Eltern kritisiert. Auch die Unternehmen holen Kritiken ein in Form von Marktumfragen und Kundenbefragungen. In sozialen Medien können wir z. B. Bilder oder Beiträge „liken“ wie z. B. in Facebook, Instagram etc.
Es ist auch denkbar und oftmals sinnvoll, selbstkritisch zu sein, d. h. die einzelne Person kann sich auch selbst kritisieren, beispielsweise, wenn sich die jeweilige Person in einem Bekleidungshaus vor einen Spiegel stellt und sich fragt, wie sie das entsprechende ausgesuchte Kleidungsstück findet.
Was bedeutet nun eigentlich das Wort „Kritik“ von seiner Wortbedeutung her?
Das Wort „Kritik“ wurde am Ende des 17. Jahrhunderts aus dem Französischen übernommen. Das französische Wort „critique“ wiederum geht auf Griechisch κριτική [τέχνη] (kritikē [téchnē], abgeleitet von κρίνειν krínein [unter-]scheiden‘, ‚trennen‘) zurück.
Mit anderen Worten: Kritik dient dazu etwas Gutes von etwas weniger Gutem zu unterscheiden: Gefällt mir "etwas" oder gefällt mir "etwas" nicht?
Die Welt befindet sich in einem stetigen Veränderungsprozess. Wollen wir uns zum Guten oder zum Schlechten verändern? Das war eine rhetorische Frage, die keiner Antwort bedarf. Die Veränderung zum Guten bedarf deshalb regelmäßig der Kritik.
Es geht bei der Kritik u. a. auch um die Förderung richtigen Verhaltens: Es geht bei der Kritik u. a. auch darum, soziale Kompetenz innerhalb einer Gemeinschaft zu fördern. Wer sich nicht gut verhält, wird kritisiert. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass Kritik nicht das Gegenteil von Lob ist. Wir empfinden lediglich Kritik als das Gegenteil von Lob oftmals, weil Kritik falsch angewandt wird. Deshalb lassen wir uns auch meistens nicht gerne kritisieren, weil wir darin meistens eine Art der "Herabsetzung" empfinden. "Das soll jetzt keine Kritik sein...!", sagt dann oft der, der die Kritik anwendet. Er/sie will damit zum Teil seine Worte, die eine Kritik darstellen sollten, quasi abmildern, damit der / die andere sich quasi nicht verletzt fühlt.
Mit anderen Worten: Ich kann etwas positiv und (!) negativ kritisieren. Sowohl beim positiven als auch beim negativen Kritisieren können wir Fehler machen.
Wir sprechen heutzutage auch von „Feedback-Geben“ und meinen damit prinzipiell dasselbe wie „Kritisieren“. Übersetzen lässt sich Feedback-Geben mit dem „Geben einer wertschätzenden Rückmeldung“.
Wie bereits oben erwähnt, machen wir beim Kritisieren oft erhebliche Fehler: wir verletzen oftmals andere Menschen mit unserer Art der Kritik, wenn wir die Kritik nicht wertschätzend praktizieren.
Bei der Kritik (Feedback bzw. Wertschätzende Rückmeldung) gibt es prinzipiell eine Person, die aktiv kritisiert (wertschätzende Rückmeldung geben) oder die passiv kritisiert wird (wertschätzende Rückmeldung annehmen).
Die bei der Kritik beteiligten Personen sollten beachten:
Rückmeldungs-Geber:
in der Ich-Form reden.
Verallgemeinerungen vermeiden (immer, man).
mit dem Positiven beginnen.
das eigene Erleben/die eigenen Gefühle beschreiben.
kurz, auf den Punkt, konkret.
Wünsche des Rückmelde-Nehmers beachten.
Rückmeldungs-Nehmer:
zuhören.
keine Rechtfertigung, stattdessen lieber bedanken.
er entscheidet, wie viel Kritik er will und zu welchem Aspekt.
Kritik als Chance sehen, um Infos über sich zu erhalten („Binder Fleck“).
Fremdwahrnehmung darf vom Selbstbild abweichen.
Kritik ist kein Aufruf zur Veränderung, sondern sie ist ein Anstoß zum Nachdenken über sich.
Zu c) Konfliktfähigkeit
Bei einem Konflikt gibt es eine „Berührung“ (ein „Aneinandergeraten“) von mindestens zwei Parteien. Konfliktfähigkeit4 bedeutet in diesem Zusammenhang:
Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen.
Konflikte aushalten und ausstehen zu können.
Konflikte lösen zu können.
3.) Soziale Kompetenz geht oftmals mit „Angst“ und „Unsicherheit“ einher. Auch hier unterscheiden wir vier Typen:
schizoid
depressiv
zwanghaft
hysterisch
Manchmal herrscht dabei die Angst vor Ablehnung oder die Angst, Fehler zu machen. Oftmals steht wiederum hinter dieser Angst die Angst vor Bestrafung, was tiefenpsychologisch auf Konflikte während unserer Kindheit zurückzuführen ist.
4.) Bei sozialen Interaktionen sind zwei Gruppen zu unterscheiden, die aus einem „Ich“ bzw. „Wir“ und einem „Du“ bzw. „Ihr“ zusammengesetzt sind. Beide Gruppen können in sich Störungen aufweisen in Form von aggressivem Verhalten. Auch hier können die vier bereits genannten Gruppen (schizoid, depressiv, zwanghaft und hysterisch) unterschieden werden.
Wie verhält sich in der Regel der schizoide Typus?
Antwort: distanziert, still, ruhig, in sich gekehrt.
Wie verhält sich in der Regel der depressive Typus?
Antwort: Er baut Nähe zu anderen auf, verhält sich empathisch und harmonisch und versucht, es allen recht zu machen.
Wie verhält sich in der Regel der zwanghafte Typus?
Antwort: Er benutzt in aller Regel Wissen, um Macht zu demonstrieren, verhält sich rechthaberisch und zeigt sich als „Besser-Wisser“.
Wie verhält sich in der Regel der hysterische Typus?
Antwort: Er agiert mehr mit Schein als mit wahrem Sein, d. h. er hat nicht viel Selbstbewusstsein und muss von daher oft mit der Lüge agieren, um nicht seine Unwissenheit preis zu geben. Er stellt sich gerne in den Mittelpunkt, um von anderen bewundert zu werden.
5.) Was bedeutet Aggression?
„Aggression ist eine feindselig angreifende Verhaltensweise eines Organismus. Einige Menschen sprechen oft von „persönlichen Angriffen“ gegen sie selbst. Wie ist das zu verstehen? Es geht eben um diese Konfliktsituationen, die oftmals mit Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Standpunkten einhergehen. Meinungsverschiedenheiten werden oftmals – wenn sie nicht gelöst werden – im direkten Kommunikationsverhalten als persönliche Angriffe gedeutet, bewertet und empfunden.
6.) Friedemann Schulz von Thun5 beschreibt innerhalb der Kommunikation von „Senden“ und „Empfangen“ vier Ebenen:
die Sachebene.
die Selbstoffenbarungsebene.
die Appellebene.
die Beziehungsebene.
7.) Handlungsmöglichkeiten im Umgang miteinander:
a) den / die Andere(n) ignorieren (Ignoranz) im Sinne von "nicht beachten" bzw. "keine Aufmerksamkeit" schenken.
b) kontrovers, sachlich bzw. aggressiv diskutieren.
c) tolerant sein (die Meinung des / der Anderen stehen lassen können).
d) zustimmen, die Meinung des / der Anderen gut finden, akzeptieren („liken“).
e) deeskalierend einwirken.
f) moderat sein und moderierend einwirken.
g) rausgehen aus der Situation und erstmal Abstand gewinnen.
h) gewaltfrei kommunizieren.
i) erkennen, dass der / die Andere(n) ein Problem hat bzw. haben (Neid, Aggression, Unsicherheit u. a.).
j) friedvoll sein und eine Aura des Friedens ausstrahlen und innehaben („Friede sei mit dir“).
k) Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis stärken uns in und bei Konfliktsituationen.
l) Erkenntnis: „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück.“: So, wie du andere behandelst, so wird man manchmal auch selbst behandelt.
m) nicht das „ius talionis“ (Talion) anwenden, sondern die Goldene Regel.
n) nicht „Öl ins Feuer gießen“, sondern sich zurücknehmen und deeskalierend agieren.
o) Eigene Bedürfnisse als Mangelerscheinungen erkennen.
Beispiele:
Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit kann ein Mangel an vorherigem Interesse seitens anderer Mitmenschen sein.
Das Bedürfnis nach Geltung kann ein Mangel an Selbstbewusstsein sein.
Das Bedürfnis nach Essen und Trinken ist in aller Regel ein Mangel an Sättigung.
p) Erkenntnis: Muss ich den/die Andere(n) immer verstehen? Wichtiger wäre zunächst, mich selbst verstanden und erkannt zu haben und dementsprechend zu achten, zu lieben und zu respektieren (Selbstliebe). Den/die Andere(n) verstehen zu wollen ist oftmals mit Spekulation verbunden.
q) sich bei dem/der/den Anderen entschuldigen bzw. um Entschuldigung bitten, wenn eigenes Fehlverhalten erkannt wurde. Die Gegenseite sollte dann diese Entschuldigung akzeptieren.
8.) Fazit: Zur Realität gehört das Verhalten von uns Menschen. Wir können uns nicht "nicht verhalten" (Paul Watzlawick).
Gemäß Fritz Riemann können wir vier Typen unterscheiden:
schizoide
depressive
zwanghafte
hysterische
Fritz Riemann hat untersucht, welche biographischen Hintergründe jeder dieser vier Typen hat. Weiterhin hat er untersucht, wie sich diese vier Typen in Bezug auf "Angst", "Aggression" und in Bezug auf "Liebe" verhalten. Konflikte bzw. Meinungsverschiedenheiten können in aller Regel nicht vermieden werden. Soziale Kompetenz ist wichtig, um im gesellschaftlichen Miteinander zurechtzukommen. Soziale Kompetenz beschreibt eine Fähigkeit, die zum Erfolg führt. Was im Einzelnen dabei unter Erfolg zu verstehen ist, wird separat zu diskutieren, zu analysieren und zu definieren sein.
Menschen haben bestimmte "Rollen" inne, übernehmen diese Rollen oder die Rollen werden ihnen zugetragen:
der Spaßvogel, Clown, Comedian
der Bequeme, Phlegmatiker, der träge und oberflächliche
die fleißige Biene, die Mutter Teresa, der/die Aufopfernde
der Querulant, Störenfried, die Nervensäge
der Schweiger, der Ruhepol
der Denker, Kritiker, der Wissbegierige
der Paragraphenreiter, der Pharisäer, der Perfektionist
der Lügner, Betrüger, Kriminelle
der Ästhet, Künstler, Schauspieler
der Angsthase, Hypochonder
der Leitende, Chef, Beschützer, Antreiber
Die Welt leidet u. a. darunter, dass ein Mangel an Teamfähigkeit besteht. Was macht ein gutes Team aus?
Zunächst die Erkenntnis:
„Wir sind ein Team mit gemeinsamen Zielen.“
Dann die Fähigkeit, …
dem anderen wertschätzend entgegen zu treten.
dem anderen zuhören zu können, um ihn zu verstehen.
sich selbst verstehen, regulieren und kontrollieren zu können (Selbstdisziplin, Selbstkritik, Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein).
ein hohes Maß an Eigenverantwortung zu übernehmen.
sich leiten zu lassen, sofern die Leitung gerecht und unterstützenswert ist.
Verbesserungen und Problemlösungen zu entwickeln.
Konflikte nicht entstehen zu lassen bzw. sie auszuhalten und sie nicht eskalieren zu lassen.
zu erkennen, was mich als Individuum glücklich macht.
mit dem Absoluten (Krankheit, Leiden, Tod) umzugehen.
auf den Menschen, der uns fremd ist, zuzugehen.
inklusiv zu denken und dennoch das Eigene zu betonen.
motiviert zu sein ohne den Anderen unter Druck zu setzen.
die eigene Intention zugunsten der Ziele des Teams zurückzustellen.
offen für Neues zu sein.
die „Wahrheit“ und nicht die Lüge im Augen zu behalten.
Immanuel Kant (1724 – 1804) war in der Lage, ein solches Verhalten mit dem sog. „kategorischen Imperativ“ zusammenfassen zu können. Er meinte damit:
„Handle so, dass die Maxime deines Handelns zu einem allgemeinen Gesetz werden könnte.“
Mit anderen Worten: Bemühe dich stets um ein ethisch richtiges Verhalten und suche stets nach der Wahrheit!6
2 Vgl. dazu auch Seite 459 dieses Aufsatzbandes.
3 Vgl. dazu Hinsch/Wittmann, Soziale Kompetenz kann man lernen.
4 Vgl. dazu A. Hugo-Becker/H. Becker, Psychologisches Konfliktmanagement. Menschenkenntnis. Konfliktfähigkeit. Kooperation, 4. Aufl. 1992.
5 Vgl. dazu Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden.
6 Zu meinem Wahrheitsverständnis vgl. mein Buch: „Gott, wie findest du schwulen Sex? Die Bedeutung der Wahrheit für die Realität.“
3. DAS BÖSE IN DER WELT
Eine aufschlussreiche Stelle innerhalb der Bibel zur Frage, wie mit dem Bösen in der Welt umzugehen sei, findet sich im Evangelium nach Matthäus im 13. Kapitel. In den Versen 24 - 30 lesen wir:
"24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. 25 Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. 26 Als aber die Saat aufsprosste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. 27 Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? 28 Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? 29 Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. 30 Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen, und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen aber sammelt in meine Scheune!"7
Der Evangelist Matthäus überliefert zugleich eine Deutung dieses "Gleichnisses". In den Versen 36 bis 43 lesen wir ebenfalls im 13. Kapitel:
"36 Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus; und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers! 37 Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, 38 der Acker aber ist die Welt; der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen; 39 der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. 40 Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. 41 Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, 42 und sie werden sie in den Feuerofen werfen; da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. 43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre!"
Nach Auffassung dieses Textes sollen wir demnach das Unkraut (= Söhne des Bösen) während der Existenz der Welt nicht ausreißen. Wir sollen es sogar wachsen lassen, d. h. das Böse und das Gute bleiben - solange es die Welt gibt - nebeneinander. Erst bei Vollendung der Welt - quasi bei Projektende - wird das Unkraut in den Feuerofen geworfen. Mit anderen Worten: wir selbst sollen nicht zum Schwert greifen und sollen nicht in Eigenregie und quasi in Selbstjustiz gegen das Böse vorgehen.
Ich würde diese Aussage aus Matthäus 13 als Aufruf zu Deeskalation bezeichnen.
Warum?
In der Tat geschieht viel Böses in dieser Welt. Wenn wir jedoch selbst wiederum gegen das Böse vorgehen, sind wir dann nicht auch "böse" und lassen uns quasi vom "Teufel" in Versuchung bringen?
Darf Böses mit Bösem vergolten werden?
Gibt es einen Krieg, der gerecht sein könnte?
Dürfen wir gemäß Matthäus 13 gegen das Böse in Form des Terrorismus beispielsweise militärisch vorgehen, indem wir damit wiederum andere Menschen (und Terroristen sind auch Menschen) töten?
Matthäus 13 sagt "nein": Wir sollen das Unkraut nicht selbst (!) ausreißen.
Wenn wir es trotzdem ausreißen, verhalten wir uns gemäß "ius talionis": Gleiches mit Gleichem vergelten. Dies führt in aller Regel zu einer Gewalteskalation.
Die Geschichte der Menschheit zeigt an vielen Stellen, dass versucht wurde, Unkraut aus dem Acker auszureißen.
Beispiele gibt es viele:
Wir führen Krieg in Syrien.
Wir streiten uns, wir schlagen uns, wir töten uns mit Messern, Schwertern, (Atom-) Bomben usw.
Wir machen nach einer Reformation im 16. Jahrhundert eine Gegenreformation.
Matthäus 13 sagt: STOP!
"Reißt das Unkraut nicht selbst (!) aus!"
Gott wird am Ende aller Tage dafür sorgen, dass mit dem Bösen, dem Unkraut, etwas passiert und gemacht wird.
Matthäus 13 ruft hier - wie gesagt - zur Deeskalation auf.
Die Welt zeigt sich. Sie besteht u. a. aus Pflanzen, Tieren und Menschen. Diese stehen in einem wechselseitigen Verhältnis aus quasi „Fressen und Gefressen-Werden“. Es herrscht in ihr quasi ein „Überlebenskampf“. Wir Menschen sind nicht per se „gut“ oder „böse“. Die Anteile an „gut“ und „böse“ sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Darüber hinaus beschreiben die Begriffe „gut“ und „böse“ moralische Wertmaßstäbe, die zwar einerseits verallgemeinerbar sind, die jedoch andererseits auch kultur- und zeitabhängig sind. Bereits mit den sog. „Zehn Geboten“ versucht der Mensch einen Verhaltenscodex aufzustellen, der Grundsätze menschlichen Zusammenlebens regeln soll. Mit der Entwicklung der Menschheit – ausgehend vom Affen bis hin in die Gegenwart – sieht sich der Mensch genötigt, Regeln aufzustellen, denn er erkennt, dass Menschen viele Fehler begehen können, die für das Zusammenleben schädlich sind bzw. sein können. Insofern liegt hier keine göttliche Offenbarung vor, sondern die Gesetzgebung ist immanent und vom Menschen erfolgt.
Der Mensch muss sich soziologisch ordnen.
Der Mensch sollte diese Welt, so lange es möglich ist, als lebensfähigen Raum schützen für nachkommende Generationen.
Der Mensch ist auf der einen Seite intelligent und auf der anderen Seite stupide: er erkennt vieles, jedoch bei weitem nicht alles.
Und: er neigt dazu, sich selbst zu Grunde zu richten
hinsichtlich seiner Zukunft.
hinsichtlich seiner Mitmenschen.
All dies macht eine Ethik und sogar Gesetzgebung, die niemals abgeschlossen sein wird, notwendig.
Der Mensch hat Verantwortung für diese Welt. Das Trachten bzw. die Absicht und das Verhalten des Menschen sind gem. Genesis 6, 5-7 stets bösartiger Natur.
Nun könnte man fragen: Hat Gott hier einen Fehler in seinem Schöpfungswerk „Mensch“ eingebaut?
Jedoch: Was ist besser? Alles zu steuern quasi mechanisch und den Menschen zu kontrollieren?
Oder stattdessen die Welt als Projekt laufen zu lassen mit offenem Ende, um zu schauen, wie es funktioniert mit der Möglichkeit (!), jederzeit eingreifen zu können, wenn der HERR es denn wollte?
Übernehmen wir also Verantwortung für unser eigenes Tun, Dulden und Unterlassen; für unser eigenes Reden und für unser Denken.
Wenn wir Gott anklagten, wo kommen - wo kämen wir hin?
Gott muss das moralisch Einwandfreie sein und bleiben.
Gott muss der Maßstab sein für Wahrheit und Verhalten. Klagen wir ihn an, so fallen wir in die Melancholie und in die Lethargie.
Es geht um unser Selbst in Abhängigkeit zu unseren Mitmenschen und zu Gott.
Wer ist der Richter?
Ist die Passivität Mahatma Gandhis und sein damit verbundener gewaltfreier Widerstand richtig, angemessen und vorbildlich?
Oder müssen wir uns letzten Endes doch gegen das Böse in der Welt zur Wehr setzen?
Manchmal ist Diplomatie entscheidend.
7 Elberfelder Übersetzung
4. GOTT – WER ODER WAS IST DAS EIGENTLICH?
Ist Gott...?
Mensch?
Gott?
Pflanze?
Tier?
Sonne?
Luft?
Erde?
Wasser?
Feuer?
Kreatur?
Geist, Wort, Kommunikation (System)?
Evolution / Entwicklung?
Alles?
Thot / tot?
Tat?
Das „Gute, Wahre, Schöne“?
Logos?
Kyrios / der Herr (auf dem Thron)?
Pastor (Hirte à la Psalm 23)?
Goldenes Kalb (Mammon/Götze)?
Abstraktion?
Lückenbüßer?
Prinzip?
Jahwe/Allah/Elohim/Adonai/Thor/Zeus?
Utopie?
Fiktion?
Droge?
Manipulation?
Trinität?
Hypostase?
Richter?
König?
Liebe / Erotik?
Monopol?
Dualist?
Endkämpfer?
Medium?
Zion?
A+O?
Unbewegter Beweger?
Wahrheit?
Rhythmus / Zyklus?
Buddha?
Essenz der Existenz?
Vergebung und Versöhnung?
Tod und Auferstehung?
Sehnsucht / Abhängigkeit?
Identität?
Authentizität?
Er / Sie / Es?
Ist Gott...?
Allmacht, die sich in Führung zeigt (Joh 10, 11.14).
Gott.
Anfang und Ende von Allem.
Brot und Wein.
Bund.
Einheit.
Eins in Allem und Alles im Einen.
Ewigkeit, die sich in der Form der Unendlichkeit des Universums manifestiert (Joh 11,25).
Frage und Antwort.
Freiheit.
Friede, der sich im Atem, in der Harmonie und in der Ruhe der Seele zeigt.
Gedanke.
Geschichte.
Glaube.
Glück.
Heiliger Geist.
Hirte.
Hoffnung.
Identität.
im Diesseits nie komplett erfahrbar.
Leben.
Licht, das in der reinsten Form von Energie existiert, die sich an Materie bindet (Joh 8,12).
Liebe, die sich bedingungslos in hingebungsvoller
Vollkommenheit in der Liebe des Vaters zum Sohn.
Offenbart (Joh 10, 11.14).
Logos.
Nahrung für Geist, Körper und Seele zum Erhalt des Lebens (Joh 6, 35.41).
Natur.
Person in Form von drei Hypostasen.
Quelle.
Religion.
Richter.
Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren kosmischen Welt und des Lebens.
Segen.
Sein.
Singularität.
Sonne.
Symbol.
Trost.
Tür.
Unendlichkeit
unerforschlich.
das Universum
Ursprung, Ziel und Heimat der Seele.
Vater-Sohn-Heiliger Geist.
Vergebung.
Wahrheit, die in der reinsten Form im Sinne der Singularität (Monotheismus) existiert (Joh 14, 6) und oberhalb der Dualität anzusiedeln ist.
Weisheit.
Wissen, das durch Erfahrung und durch Lernen in Form von Speichern von Informationen zugänglich ist (Joh 10, 7.9).
Zeitlosigkeit.
Wer oder was ist Gott?
Gott ist Gott.
Gott ist Gott
Gott ist...
Gott
5. ANGST VERSUS LIEBE
Jedes Verhalten, jedes Gefühl und jeder Gedanke ist entweder mehr von Liebe oder mehr von Angst geprägt.
Da, wo Liebe ist, ist keine Angst. Liebe öffnet sich - aus Angst verschließen wir uns. Liebe macht den Blick weit - Angst macht den Blick eng.
Angst und Liebe sind die zwei wesentlichen Gefühle, die wir spüren können. Sie resultieren aus der Bewertung des Geistes: der Geist bewertet unsere Gedanken, so dass jene Gefühle entstehen. Dazu ein Beispiel: Situation: Das Telefon klingelt. Wenn ich Angst davor habe, wer der Anrufer sein könnte, dann verschließe ich mich. Ich nehme eher nicht den Hörer ab. Mein Gefühl wird eng. Ich habe den Gedanken, wer mich anrufen könnte, negativ bewertet. Wenn ich jedoch aus Liebe heraus neugierig und mit Freude den Gedanken, wer mich anrufen könnte, bewerte, dann öffne ich mich. Ich bewerte jenen Gedanken, wer mich anrufen könnte, positiv, so dass auch das ganze Verhalten und die daraus entstehende Realität positiv verlaufen wird. Es gibt Gedankenmuster in uns, die immer wieder ablaufen, bis wir sie erkannt haben. Wenn wir sie erkannt haben, dann können wir versuchen, sie zu ändern. Aus Angst, dass etwas von unserer Persönlichkeit erkannt wird, engen wir uns ein. Es gelingt uns nicht, den Blick weit zu richten. Dies ist dann der Fall, wenn uns etwas peinlich ist oder wenn es um Versagensängste geht. Dazu gehört auch die Errötungsangst oder die Angst vor Ablehnung.
6. DIE AUSWIRKUNGEN UNSERER GEDANKEN
Gedanken sind mentale Erscheinungen. Sie erscheinen feiner als Äther als Medium der Elektrizität. Gedanken entstammen dem menschlichen Gehirn und sind als Kräfte wie Elektronen ohne materiellen Mantel. Man könnte sagen: Gedanken sind wie elektronische Lichtenergie, deren Energieteilchen sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Wie entstehen Gedanken?
Gedanken entstehen und entwickeln sich im Unterbewusstsein des Menschen selbst oder durch äußere Einflüsse. Wie wirken sich die Gedanken des Menschen aus? Gedanken sind lebendige dynamische Kräfte. Gedanken beeinflussen uns und andere Menschen. Die Gedanken als Wurzel aller mentalen Prozesse sind entweder schöpferisch oder zerstörerisch. Gedanken kontrollieren das Leben. Gedanken formen den Charakter. Gedanken beeinflussen die Zukunft ("die Bestimmung"). Damit ist die Welt ein Spiel(ball) des Bewusstseins. Der Geist erschafft mit seinen Gedanken die Welt. Sehr schön wird dieser Vorgang der Erschaffung in dem Buch von Michael Ende "Die unendliche Geschichte" beschrieben. Dieser Roman endet damit, wie eine Welt durch die Kraft der Gedanken des Geistes entsteht. Jeder Gedanke trägt in sich Schöpferkraft.
Jeder Gedanke hat die Kraft der Verwirklichung:
Aus Gedanken werden Worte geformt.
Aus Worten werden Handlungen.
Aus Handlungen werden Gewohnheiten.
Aus Gewohnheiten wird Charakter.
Unser Charakter ist Teil unserer Persönlichkeit und damit
Teil unseres Seinswesens. (Vgl. dazu den Talmud).
Sind liebevolle und positive Gedanken Mittel (Instrument) und Zweck (Finalität) der zukünftigen Welt?
Ja! Mit jedem guten Gedanken zieht man das Gute an. Umgekehrt gilt das Gleiche: Mit jedem schlechten Gedanken ziehen wir das Schlechte an. Worte sind hörbare Gedanken. Diese können bei uns und anderen eine kränkende oder motivierende Kettenreaktion auslösen. Durch unsere Sprache werden Gedanken hörbar und erlebbar. Die Sprache gibt unseren Gedanken Leben. Durch die Kraft der Sprache gewinnen die Gedanken Realisierungskraft. Durch die Macht unserer Sprache verändern wir unser Leben und die Welt.
Damit wird klar, welche Auswirkungen und welchen Einfluss unsere Gedanken auf uns und die Welt haben.
7. PROBLEME IM 21. JAHRHUNDERT
Die problematische Realität des Einzelnen
Angst, Depression und Orientierungslosigkeit
Stressfaktoren und Stresskrankheiten als Phänomen der Gegenwart
Zunahme psychopathologischer Krankheitsbilder
allgemeine Probleme bei der Lebensbewältigung in Alltag und Beruf
Fragen nach dem Sinn des Lebens
Probleme der Langeweile, Lustlosigkeit und Trägheit (Probleme der Motivation)
Alkoholismus und Drogenkonsum
Beziehungsprobleme, Probleme innerhalb der Familie
Fragen der Identität und Identitätskrisen
Probleme der Akzeptanz des Einzelnen in der Gesellschaft
Fragen bezüglich des Alt-Werdens
Existenzbedrohung (Problem der Finanzierung der eigenen Wohnung, Verlust der Wohnung und Obdachlosigkeit)
persönliche Schicksalsschläge
die Frage nach dem Grund von bedrohlichen Krankheiten
Fragen zu Sterben und Tod
Sterbebegleitung
Freitod und Euthanasie
Existenzbedrohungen wie Verlust des Arbeitsplatzes
Mobbing am Arbeitsplatz und psychosoziale Ausgrenzung des Einzelnen
Vereinsamung des Einzelnen aufgrund fehlender familiärer Bindungen und fehlender Integration in der Gesellschaft
Die problematische Realität in der Gesellschaft
1.) Ökonomie und Politik
Probleme im Wirtschaftssystem des Kapitalismus (Wirtschafts- und Finanzkrise)
Staatsverschuldung
Probleme der Kommunen
Generationenkonflikt
Gesundheitsreform, Rentenreform und die Verschiebung der Alterspyramide
Steuervereinfachung, Steuerreform und Steuerhinterziehung
Hartz IV – Diskussionen und Gerechtigkeitsdebatten der Zumutbarkeit von Arbeit
Regierungskrise und Stillstand der Politik, Politikverdrossenheit
Arbeitslosigkeit
Afghanistan – Einsatz und Fragen des Terrors (Tod deutscher Soldaten eingeschlossen)
2.) Ökologie
Treibhaus-Effekt, Luft- und Wasserverschmutzung, Klimaveränderung
Klimakatastrophe
Öl-Tanker-Unfälle und die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Vielfalt der Tierwelt
Bedrohung der Sicherheit der Menschen durch Atomreaktoren, durch Strahlung und die Entsorgung des Atom-Mülls
Müllentsorgung, Müllvermeidung, Verpackungsproblematik
3.) Theologie und Kirche
Kirchenaustritte
Abendmahlsverständnis und Ökumene
Säkularisierung
Kinderschändungsskandale
Zölibat in der katholischen Kirche
Probleme im Dialog zwischen der Amtskirche und den anderen Religionen
Probleme zwischen der Amtskirche und der Kirche von unten
Zulassung der Frauen zum Priesteramt in der katholischen Kirche
Probleme der Moraltheologie
Die problematische Realität in der Welt
Abrüstung und die Gefahr einer atomaren Bedrohung durch Nuklearanschläge
Nahostkonflikt
Israel und die Siedlungspolitik
Palästinenser-Konflikt
Irak-Problematik
Terrorismus und die Unkalkulierbarkeit von Terroranschlägen
Iran-Konflikt
Diktatorische Regime
Illegaler Waffenhandel
Unterdrückung von Menschenrechten
Probleme der Erniedrigung von Frauen
Afghanistan-Problematik
Weltwirtschaftskrise und Probleme der Weltkonjunktur
Probleme in den Entwicklungsländern
Armut in der Dritten Welt
Schwellenländer
Rodung des Regenwaldes
Bedrohung der Biodiversität von Leben (Artensterben)
Abschmelzen der Polkappen
Auswirkungen des Kalten Krieges
Nord-Süd-Korea-Konflikt
Ungerechtigkeit zwischen Nord- und Südhalbkugel
Erdbeben und Naturkatastrophen
Probleme der Euro-Stabilität in den EU-Ländern und des Staatsbankrottes
Seuchen und Pandemien
Problem der Möglichkeit zukünftigen menschlichen Lebens auf dem Planet Erde
Demokratie in der arabischen Welt
Flüchtlingsproblematik
8. WIE VERÄNDERT DER MENSCH DIE WELT?
Wie verändert der Mensch die Welt?
Wir Menschen verändern die Welt: Schritt für Schritt. Wohin sich die Welt entwickelt und wie sie einmal in 50 oder 100 Jahren aussehen wird, weiß niemand vorauszusagen. Und das ist auch gut so! Wüssten wir heute, was in 10 oder mehr Jahren passieren würde, wären wir dann wie Gott? Und wie sollte selbst Gott wissen, wie die Welt unter Zugrundelegung aller menschlicher Freiheit im Willen in 10, 50 oder 100 Jahren aussehen wird bzw. könnte? Gott ist kein Marionettenspieler. Wir Menschen sind keine Marionetten. Wir sind frei in Wille und Entscheidung. Unser Denken, Reden und Handeln hat konkrete Auswirkungen auf uns und unsere Umwelt.
Wir Menschen sind Wesen mit/aus Körper, Geist und Seele. Wir wollen uns körperlich, geistig und seelisch wohlfühlen.
Wir befinden uns als Individuen in einem sozialen Raum von Beziehungen und Systemen innerhalb von
Partnerschaft
Familie
Gesellschaft
Wir unterliegen Einflüssen von Umwelt (Sonne, Luft, Wasser, Boden, Bakterien, Viren u. a.), Unfällen, Ermüdung, A-busus, schlechter Ernährung, ständiger Anspannung und externem Druck. So clever, begabt, kulturell und human der Mensch in seinem Dasein, seinen Erfindungen, Errungenschaften und in seinem Wissen auch ist, so ist dennoch die Realität seines Daseins geprägt von Polarität, Dualität, Antinomie und Ambivalenz.
Realität besteht immer auch aus Polarität und Dualität.
Realität besteht immer auch aus Hass.
Realität besteht immer auch aus Aggression.
homo homini lupus est – Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wir leben in einer Welt des „Behauptens“ quasi in einem Kampf ums Überleben. Dabei gilt einerseits der Satz „leben und leben lassen“ und andererseits „fressen und gefressen werden“. Spricht der erste Satz von Toleranz, so der zweite von einem Kampf. Wenn ich mir die Geschichte der Menschheit betrachte, so ging es bisher in der Menschheitsgeschichte neben allem Positiven um
die Anfänge des Menschen als Steinzeitmensch mit dem Jagen von Büffeln und dem zur Wehrsetzen gegen größere, bedrohliche Tiere.
Hochkulturen mit Entwicklung von Religionen.
territoriales Machtstreben nach außen, Absicherung nach innen gegen Feinde von außen, Systemaufrechterhaltung einer Herrschaftsstruktur nach innen durch eine elitäre Gruppe und Kampf der Kulturen und Religionen unter Ägyptern, Assyrern, Hebräern, Babyloniern, Persern, Griechen, Römern, Christen, Muslime, Schwarz und Weiß, Weiß und Rot, Deutschen, Russen, Franzosen, Engländern, Amis, Japanern, Nazis und Holocaust, Afghanen und Sowjets, Taliban und Amerikanern, Irakern und Kuwaitern, Syrern, Ukrainern, Israelis und Palästinensern etc.
Der Mensch greift ein und versucht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen: er entwickelt Maschinen, das Automobil, die Raumfahrt, die Atombombe und die Gentechnik. Wie lange werden wir in der Lage sein, „uns über Wasser zu halten“? Wann werden wir Menschen untergegangen sein? Erkennen wir die wahren Probleme? Inwiefern bemühen wir uns um Nachhaltigkeit? Wie wollen wir Probleme angehen und lösen, wenn zu viele Gegenkräfte die Lösung blockieren? Sind wir zu Veränderungen bereit? Haben wir überhaupt Konzepte zur Problemlösung? Welche Menschen sollten in diesen Zeiten die Regierung übernehmen? Ich wünsche mir, dass sich Welt zugunsten von mehr Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung und zugunsten von einem gemeinsamen Werteverständnis entwickeln wird. Möge sich die Menschheit zukünftig als ein Team mit gemeinsamen Zielen verstehen!
Die Welt ist m. E. ein Projekt (Gottes), in dem wir die Freiheit haben zu planen und zu entscheiden:
Wie clever und wie intelligent wir Menschen wirklich sind, wird sich irgendwann herausstellen. Angeblich befinden wir uns nun nach einer jahrtausend-langen Entwicklung in einem Transformationsprozess, der von Aspekten der Liebe geprägt ist. Angeblich setzt sich die Liebe immer mehr durch; so sagen es manche Menschen jedenfalls. Die Liebe wird quasi mehr und mehr zum Bewertungsmaßstab unseres Verhaltens. Wer nicht in der Lage ist zu lieben, fällt negativ auf; fällt durch ein Raster; fällt quasi von einer Klippe herunter; fällt hart auf den Boden. Wer in der Lage ist zu lieben im sozialen-zwischen-menschlichen Bereich, wird unbewusst positiv gesehen und ist damit der Entwicklung der Menschheit dienlich. Genau das ist mein Gefühl: auch innerhalb der gegenwärtigen Corona-Krise sind wir durch distanziertes Verhalten höflicher geworden. Wir haben uns etwas entspannt, entschleunigt; und wir entfachen und entfalten dadurch zusätzlich jenen angedeuteten Transformationsprozess. Wir haben die Welt kulturell, technisch, territorial und imperial verändert. Wir haben viele Ressourcen wie Öl und Kohle genutzt und mehr oder weniger ausgebeutet. Wir haben es in kritischer Weise leider Gottes geschafft, das Klima so zu verändern, dass es zukünftige Generationen extrem schwer haben werden, und wir können die Folgen dessen noch gar nicht absehen. So viel scheint jedoch sicher: viele Gebiete dieses Planeten werden nicht mehr bewohnbar sein: sei es wegen Überschwemmung - sei es wegen Hitze - sei es wegen Dürre und Unmöglichkeit von Ackerbau und Landwirtschaft (Saat und Ernte) - sei es wegen Naturkatastrophen wie Tsunamis und / oder Hurrikans und / oder Tornados. Ich persönlich glaube daran, dass wir irgendwann vor einer Art "Richter" stehen werden. Meiner Ansicht nach werden wir am Ende aller Tage in einem Gericht sein, in dem wir ggf. gefragt werden:
Wie hast du dich für die Wahrheit eingesetzt?
Erkennst du die Fehler, die du getan hast?
Das wäre doch mehr als gerecht, oder etwa nicht?
9. LEIBLICHER VATER – HIMMLISCHER VATER
Das Verhältnis zwischen Sohn und Vater bedingt oftmals in unserer Biographie Konflikte, jedoch auch viele positive Erfahrungen. Konflikte aus unserer Kindheit begleiten uns unser Leben lang. Sie müssen verdaut, verarbeitet und verstanden werden. Weiterhin interessant ist in diesem Zusammenhang in jedem Fall auch folgende Erkenntnis: Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) war Sohn eines protestantischen Pfarrers. Bereits im jungen Alter von fünf Jahren verliert der Junge Friedrich seinen Vater. Ich sehe in diesem traumatischen Ereignis einen Zusammenhang zur Biographie Nietzsches. Inwiefern? In seinem Werk „Die fröhliche Wissenschaft – Also sprach Zarathustra“ lässt Nietzsche einen Menschen ausrufen: „Gott ist tot!“ Ich sehe hierin einen Zusammenhang zwischen dem traumatischen Verlust seines leiblichen Vaters und diesem Ausruf „Gott ist tot“ als Tod Gottes. Auch hier ist eine Kopplung (Verbindung) zwischen leiblichem Vater und himmlischem Vater zu erkennen. Ja, in der Tat ist es so, dass das Verhältnis zwischen Sohn und Vater einen direkten Einfluss auf unser Gottesbild hat. Das Verhältnis zwischen leiblichem Vater und Sohn hat direkten Einfluss auf das Bild vom himmlischen Vater. Es gibt genügend Beispiele und Argumente, die diese These stützen. Doch nicht nur das Verhältnis zwischen Sohn und leiblichem Vater prägt unser Gottesbild, sondern auch unsere gesamte Sozialisation (Erziehung, Schulbildung, Aufwachsen in Jugend und Pubertät etc.) wirkt sich auf unser Gottesbild aus.
Wurde unser „Über-Ich“ stark angesprochen während unserer Sozialisation, so kann zweierlei passieren:
Wir prolongieren diese Prägung unseres Über-Ichs und entwickeln ebenfalls ein Bild von einem strafenden Gott, vor dem man Angst haben muss.
8
Wir emanzipieren uns von dieser Prägung unseres Über-Ichs und entwickeln ein nahes, liebevolles Gottesbild.
In jedem Fall hat das Nähe-Distanz-Verhältnis zwischen Sohn und leiblichem Vater Auswirkungen auf unser Gottesbild: Die Erfahrung der Ferne kann entweder bleiben oder sie kann kompensiert werden. Die Erfahrung der positiven Nähe bleibt meistens erhalten. Jesus nannte Gott in vielen Situationen „Abba“ (= lieber Vater, Papa).
Ich kann an dieser Stelle auch von mir sagen, dass der Wunsch, evangelische Theologie studieren zu wollen bzw. sich mit Gott und dem Glauben zu beschäftigen, eine Auseinandersetzung mit meinem leiblichen Vater darstellt.
Wir haben ein Bild von unserem leiblichen Vater:
distanziert
gerecht
streng
liebevoll
beschützend
sorgend (der, der das Geld nach Hause bringt etc.)
jähzornig
der nahe und gegenwärtige Vater
Väter meinen es in aller Regel gut mit ihren Kindern. Es gibt jedoch auch das Phänomen der Homophobie: der Vater verhält sich extrem distanziert zu seinem Sohn, weil in ihm bei Annäherung zu seinem Sohn der Verdacht der Homophilie ("Homosexualität") unbewusst aufkommt und deswegen sofort verdrängt, ja verboten wird. Sigmund Freud erkannte von daher in Sophokles Werk „König Ödipus“ den sogenannten Ödipuskomplex. Wir können das oft nicht steuern. Es ist, wie es ist. Wir müssen die Dinge oftmals sich entwickeln lassen. Wir können nicht alles steuern. Wir können vieles falsch machen in Sachen Erziehung. In aller Regel dürfen wir jedoch stolz sein, wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kindern einigermaßen gelingt. Was dabei gelingen heißen mag, müsste im Einzelnen diskutiert werden.
Abschließend sei an den Psychoanalytiker Erik H. Erikson (1902 – 1994) und dessen Phasenmodell erinnert: In diesem Phasenmodell wird jede Krise durch Polaritäten charakterisiert:
Urvertrauen
–
Urmisstrauen
Autonomie
–
Scham/Zweifel
Initiative
–
Schuldgefühl
Leistung
–
Minderwertigkeitsgefühl
Identität
–
Identitätsdiffusion
Intimität
–
Isolation
Generativität
–
Stagnation
Ich-Integrität
–
Verzweiflung
Wir durchlaufen in unserem Leben Krisen, durchleben Konflikte und müssen uns Problemen stellen.
Wir erkennen etwas. Je mehr wir erkennen, desto besser wird es uns ergehen, denn: Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung! Erkenne dich selbst! Erkenntnis ist wichtig. Sich selbst erkennen zu können, ist Ausdruck des Menschlichen und unterscheidet uns in aller Regel vom Tier. Selbsterkenntnis ist die Voraussetzung für Selbstachtung und für Selbstliebe. Nur wer sich selbst liebt bzw. sich selbst erkennt, kann andere Menschen annehmen, achten und akzeptieren. Das Gegenteil trifft auch zu: Wer sich selbst nicht liebt, kann andere Menschen nicht annehmen, achten und akzeptieren.9
8 Vgl. dazu Tilman Moser, Gottesvergiftung.
9 Vgl. dazu Alice Miller, Das Drama des begabten Kindes.
10. VOM LEBEN IM JETZT UND HEUTE
"Heute ist mein bester Tag" – "Heute ist mein letzter Tag"
Aus Psalm 90, 9b.10:
„Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind siebzig Jahre, und, wenn in Kraft, achtzig Jahre, und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin.“
Aus dem Evangelium nach Matthäus 6, 34:
"So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag! Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. [...]."
Wann leben wir? Gestern? Morgen?
Nein! Wir leben jetzt. Und deswegen müssen wir „das Jetzt“ genießen.
Wenn wir montags zur Arbeit fahren, verspüren wir oftmals Unbehagen, Unmut, Unlust. Die ganze Woche liegt noch vor uns. Wir wünschen uns den Freitag herbei, wo wir wieder Ruhe haben oder das tun können, was wir wollen.
Haben wir drei Monate am Stück gearbeitet, fühlen wir uns reif für die Insel. Nichts wünschen wir in diesem Moment sehnlicher herbei als den „wohl verdienten“ Urlaub.
Wenn wir doch erst Rentner wären, dann hätten wir alle Freiheit der Welt und müssten nicht mehr arbeiten!
So oder so ähnlich denken viele Menschen.
Wir sind in diesen Tagen und in diesen Zeiten gestresste Menschen. Das Marktangebot mit seinen vielfältigen Verlockungen und diversen Werbestrategien der Wirtschaft verlockt uns zum Konsum. Hindert uns die tägliche Arbeit eher als dass sie uns ein Vorteil wäre? Hindert uns die Arbeit an der Entfaltung und nimmt sie uns Freiheit und Genuss? Arbeit erscheint vielen Menschen als Klotz am Bein.
Wenn wir so oder so ähnlich denken, sind wir in aller Regel unzufriedene Menschen. Wenn wir so denken, sind wir in aller Regel Menschen, die den jeweiligen Augenblick und das Jetzt nicht genießen (können).
Und: Wenn wir so denken – wie oben beschrieben – werden wir früher oder später krank. Warum? Unser Körper ist – wie oben beschrieben – gar nicht bei sich in seinem Inneren. Er ist nicht im Gleichgewicht, nicht in der Balance. Dies führt früher oder später zur Krankheit mit Unwohlsein, Kopfschmerzen, Burnout, Entzündungen bis hin zum frühen Tod. Gegen Unzufriedenheit und gegen das "Burn-Out-Gefühl" helfen zweierlei Dinge:
Positives Denken
Work-Life-Balance
Es gibt massenhaft Literatur über diese beiden Themen.
Und dennoch: Unser Leben währt nicht ewig – so viel ist klar. Sollten wir nicht vielmehr die 70 bis 90 Jahre, die wir in aller Regel maximal verleben dürfen, genießen, und zwar nicht erst mit Beginn des Rentenalters, sondern in jedem Augenblick? Wenn wir montags mit Grummeln im Bauch zur Arbeit fahren wegen Belastung, unangenehmen Gefühlen, Gedanken oder Angst, schlimmen Erwartungen, dann stimmt etwas nicht! Wir leben in einer Zeit, die einerseits bequem ist, die jedoch andererseits von Rauheit, Aggression und Gewalt und nicht zuletzt von dem Gebrauch des Ellenbogens („Ellenbogengesellschaft“) geprägt ist. Diese Rauheit, Aggression und Gewalt auf der einen Seite und die angedeutete Vielfalt an Marktmöglichkeiten auf der anderen Seite machen uns das Leben oftmals schwer. Wir wünschen uns zwar Teilhabe am Konsumleben, um unsere Bedürfnisse befriedigen zu können. Wenn wir jedoch die Erfahrung der rauen, aggressiven und gewaltbereiten Welt gemacht haben und immer wieder machen, dann kann es passieren, dass wir dem Druck dieser Arbeitswelt nicht mehr Stand halten können. Aber deswegen müssen wir nicht unzufrieden werden. Und schon gar nicht müssen wir deswegen sterben. Viele Staaten sollten sich ein Vorbild nehmen am Sozialsystem und der Sozialen Marktwirtschaft Deutschlands. Darauf können wir Deutsche wirklich stolz sein: wer von Arbeitslosigkeit aus welchen Gründen auch immer bedroht ist und der deswegen Einkommensausfälle hat, muss zwar Einschränkungen in Kauf nehmen. Dennoch ist derjenige nicht bedroht in seinen Existenzbedürfnissen nach Hunger, Kleidung und Unterkunft. Wir befinden uns in Deutschland in aller Regel in einem sozialen Netz, in dem Bedürftige aufgefangen sind und werden. Ich kann nur sagen: Wägen Sie ab! Was ist Ihnen wichtiger?
das Quantum an Gehalt und Einkommen?
Lebensqualität und Zufriedenheit?
Beides ist oftmals nicht möglich und meistens nicht vereinbar: Wenn wir viel Einkommen in Form von Verdienst, Gehalt und Lohn haben wollen, ist das in aller Regel mit hoher Anstrengung verbunden. Hohe Anstrengung und Luxus sind jedoch mit Kräfteverzehr und Stress verbunden und fordern ihren Preis: Ständiger Stress und ständige Unzufriedenheit führen zur Krankheit.
Alles Verhalten basiert auf Anspannung und Entspannung. Zu starke Anspannung ist ein Symptom für Überforderung - zu starke Entspannung für Unterforderung. Beides - sowohl Unterforderung als auch Überforderung - ist Stress und von daher ungesund! Es gilt stattdessen die optimale Belastung und Wohlbefinden für sich selbst zu finden.
Signale der Unterforderung sind:
Langeweile
Müdigkeit
Ungeduld
Signale der Überforderung sind:
Schlafstörungen (nicht durchschlafen)
Vergesslichkeit
Reizbarkeit
Teilnahmelosigkeit
Schlafbedürfnis
Panikattacken
Mangel an Konzentration
Unsicherheit
Signale für optimale Belastung und Wohlbefinden:
gute Laune
Beweglichkeit
energiegeladen
geduldig
gelassen
zufrieden
entspannt
glücklich
fröhlich
aufnahmefähig
leistungsfähig
lustvoll
ausdauernd
guter Schlaf
gesellig
unternehmungslustig
Was können wir tun, wenn wir uns überfordert fühlen?
schlafen
das Gespräch suchen
Spaziergang machen an der frischen Luft
Sport und Bewegung
Atemübungen
Gedanken ordnen und anders bewerten
Entspannungsübungen machen
lachen, weinen
Musik hören und für Ablenkung sorgen
Was können wir tun, wenn wir uns unterfordert fühlen?
Körperpflege
ein gutes Buch, eine Zeitung/Zeitschrift lesen
einen Spaziergang machen
fernsehen oder Radio hören
telefonieren
einen Brief schreiben
ein Café besuchen
eine Tasse Kaffee zubereiten und genießen
etwas kochen oder backen
sich mit Freunden treffen
laut singen
Tagebuch schreiben
Musik hören
(Wohnung) aufräumen
ins Kino gehen
etwas naschen
die Natur beobachten
Gymnastikübungen machen
Wie erhalten wir unsere Gesundheit?
durch einen Wechsel von Anspannung und Entspannung
durch Bewegung und Schwingungsfähigkeit
durch gute Ernährung
durch gelebte Dankbarkeit
durch Respekt vor dem Leben
durch Selbstliebe
durch genügend Schlaf
Ein Mensch, der nicht mehr in seiner Mitte ist, wirkt gestört, gestresst und macht Fehler. Ein Mensch, der nicht mehr in seiner Mitte ist, ist auffällig und wird zum Gespött der Anderen, was wiederum krankmacht. Ein Mensch, der nicht mehr in seiner Mitte ist, wird krank und stirbt vorzeitig.