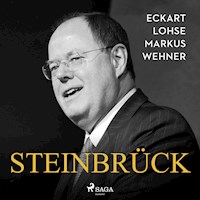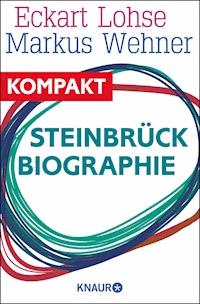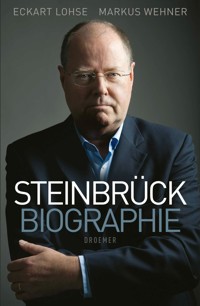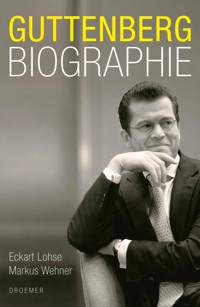Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Versäumnisse aus 16 Jahren Merkel werfen Fragen auf. Hier ist die Antwort. Deutschland ist enttäuscht und Merkels Politik auf vielen Feldern gescheitert: Russland, Energieversorgung, Verteidigung, Integration. Der klimafreundliche Umbau der viertgrößten Volkswirtschaft ist steckengeblieben. Was wie Stabilität aussah und wofür Deutschland international beneidet wurde, war vielfach auf Kante genäht. Eckart Lohse begleitet Merkel seit ihren Bonner Jahren journalistisch. Für dieses Buch hat er mit zahlreichen Politikern über das gesprochen, was Merkel angetrieben und gebremst hat. Seine Erkenntnis: Anpassung um des Machterhalts willen hat das Regierungshandeln der Ostdeutschen geprägt. Ihr fehlten die Ideen, das Land in die Zukunft zu führen. - In der Ära Merkel hat Deutschland Teile seiner Zukunft verschlafen. Dieser investigative Report zeigt, wie und warum - Eckart Lohse beobachtet die Bundespolitik und Angela Merkel seit 30 Jahren für die FAZ - Ernüchternd aber fair. Für alle, denen die Autobiographie Merkels nicht genügt - Exklusive Interviews: Merkels politisches Umfeld offen wie selten zuvor »Zum Ende Ihrer Kanzlerschaft hat Merkel den russischen Präsidenten Putin als sehr gefährlich eingeschätzt. Aber in den zwanzig Jahren davor habe ich das nie von ihr gehört.« Horst Seehofer »Merkel wollte beweisen, dass die Ostdeutschen es genauso gut können wie die Westdeutschen.« Reiner Haseloff »Merkel hat sich ein charismatisches Image zugelegt aus nicht charismatischen Bestandteilen. Angela Merkel hat Grundsätze, hat sich aber dafür entschieden, pragmatische Politik zu machen, statt Überzeugungen durchzusetzen.« Roland Koch »Dass sie in der Flüchtlingskrise die Grenzen nicht geschlossen hat, war in der Akutsituation 2015 nachvollziehbar. Sie hat danach aber nicht Sorge dafür getragen, dass es bei vielen den Eindruck erweckt hat, alle könnten kommen – ganz nach dem Motto ›Germany is open‹ .« Wolfgang Schäuble »Nord Stream 2 nicht auszubauen, wäre eine leichtere Entscheidung gewesen als etwa das Durchsetzen der Agenda 2010. Ich denke, dass der Einfluss der Wirtschaft größer war als alles andere.« Joachim Gauck
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Eine messerscharfe, aber unpolemische Abrechnung mit Merkel.«
Aachener Zeitung
Angela Merkels Politik ist auf vielen Feldern gescheitert: Russland, Energieversorgung, Verteidigung, Migration und Integration. Was wie Stabilität aussah und wofür Deutschland international beneidet wurde, war vielfach auf Kante genäht. Eckart Lohse analysiert das 16 Jahre dauernde Regierungshandeln Merkels. Seine Erkenntnis: Anpassung um des Machterhalts willen. Ihr fehlten die Ideen, das Land in die Zukunft zu führen.
»Ein wichtiges Buch in der Aufarbeitung der Merkel-Ära, aus deren Zeit sich viele aktuelle Krisen entwickelt haben. (…) anschaulich und plastisch, tief recherchiert, zugespitzt, aber nicht polemisch.« Deutschlandfunk
Eckart Lohse
Die Täuschung
Angela Merkel und ihre Deutschen
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Einleitung
1. Merkel trifft auf Deutschland
Das neue Jahrtausend und das Ende alter Gewissheiten
Das Dogma: die schwarze Null
Von der Bahn abgekommen
Entrüstung — die kleingesparte Bundeswehr
2. Die Kanzlerin
Die »Rede ihres Lebens«
Merkels Ehemann ist dabei
Die Kanzlerin ist aufgeregt
Erinnerung an Joschka Fischer
Merkels Klage: Für die Westdeutschen hat sich wenig geändert
»Ihr Ostdeutschen seid doch auch bloß Migranten«
Ostdeutsche Kanzlerin aller Deutschen
Merkel nennt die DDR »verkommen«
Aus Opportunismus in der FDJ
Schröder verhöhnt Merkel
Der unterdrückte Teil ihres Lebens
Die »Zonenwachtel« zitiert sie nicht
»Mein Land«
Kohl und Schröder hätten die Frage nie gestellt
Israel oder die bessere Bundesdeutsche
Merkel will eine lupenreine Bundesrepublikanerin sein
Helmut Schmidt sagt Angela Merkel, wie Deutschland funktioniert
3. Machtgewinn und Machterhalt
Ankommen im fremden System
Merkel muss das Abtreibungsrecht neu regeln
Keine Feministin
Kein Verständnis für DDR-Nostalgie
»Merkel Kanzlerin? Nö!«
Merkel hat Schröder schon 1997 im Visier
Aufstieg in der CDU — und gegen die CDU
»Taktisch geschickt« einen Weg überlegen
Das hohe Risiko zu scheitern
Macht als einzige Währung
Doppelte Illoyalität
Nur ein Viertel der CDU-Mitglieder sind Frauen
Eine Ostkanzlerin wollte sie nicht sein
Merkel verliert fast gegen Schröder
Wenig Frauen, fast keine Ossis — die Personalpolitik
Das Frühwarnsystem Beate Baumann
Merkel umgibt sich mit Westdeutschen
Einen Frauenbonus gibt es nicht
4. Gegen die eigene Überzeugung: der Atomausstieg
Gute Kernkraft
»Beim Backen geht mal etwas Pulver daneben«
Geburtstagsgruß für die Atomlobby
Böse Kernkraft
Söder gegen Röttgen
Merkels programmatische Wende
Zaghafter Widerstand
Wäre eine andere Entscheidung als der Ausstieg möglich gewesen?
Ein neues Narrativ muss her
Die Gefahr eines Blackouts
»Ich habe Merkel eher als Begleiterin erlebt«
5. Auf halbem Wege stecken geblieben: die Energiewende
Merkel und die Erneuerbaren
Merkel gegen niedrige Strompreise
Merkel hängt Schröder ab
Teurer Ökostrom
Röttgens zweitschönster Tag
Auf den Spuren von Bertha Benz
Alles viel zu teuer
Merkel so stark wie nie zuvor
Die Belastung für die Verbraucher steigt und steigt
Die Wirtschaft ist skeptisch
6. Putin
»Heute sind die Russenkeine Gefahr mehr«
Mehr Russengas
»Merkel wollte das Volk nicht mit zu hohen Energiepreisen belasten«
Hat Merkel Putin falsch eingeschätzt?
Russlands Rolle in Merkels DDR-Leben
Auch in der Union gibt es eine Nähe zu Russland
»Putin war auch nach 2014 kein beherrschendes Thema«
7. Die Täuschung
Die Flüchtlingskrise entzweit die Union und rettet die AfD
Im Juli 2015 kann Merkel noch einmal hoffen
Merkel hat die Partei nicht von unten kennengelernt
Die Flüchtlinge machen sich auf den Weg
Der unterschiedliche Blick auf Grenzen
Die »sagenumwobene« Nacht
Merkels hässlicher Deal zeigt Wirkung
Merkels Denken in Lagerkategorien
»Von Berlin kam da nichts«
Geordnete Abläufe in Rosenheim
Merkel war nicht von Gutmenschentum getrieben
Als »Volksverräterin« beschimpft
Wagnis und Ende
Merkel droht mit ihrer Richtlinienkompetenz
»Das ist ein Wagnis, keine Frage«
8. Wie es euch gefällt — eine Bilanz
Ein Land voll unerledigter Aufgaben
Der Vormarsch der Rechtsextremen
Kanzlerin des Bewahrens
Dank
Verwendete Literatur und Gesprächspartner
Für Andrea, Juliane und Jasper
Einleitung
Für einen Wimpernschlag der Zeitgeschichte kann Angela Merkel mit dem Ausscheiden aus dem Amt im Dezember 2021 hoffen. Hoffen, dass es bei dem Nachruf bleibt, man werde sie vermissen. Dieser Wimpernschlag dauert zweieinhalb Monate und endet am 24. Februar 2022. An dem Tag, an dem Wladimir Putin tut, was er seit Langem vorhat, was sich seit Jahren durch Aufrüstung und große Manöver abzeichnet, was man aber in Berlin wie in anderen Hauptstädten der westlichen Welt nicht wirklich wahrhaben will: Er überfällt die Ukraine mit dem Ziel, sie auszulöschen. Das ist der Moment, an dem auch Merkel-Anhänger anfangen zu fragen, was in ihrer Kanzlerschaft schiefgelaufen ist.
Der erste Einschlag im noch unfertigen Merkel-Denkmal erfolgt unmittelbar durch den Kriegsbeginn. Wie konnte die Frau, die so engen Zugang zu Putin hatte, die ihn so oft gesprochen hat, die sein Land länger und besser kennt als jeder deutsche Spitzenpolitiker, das übersehen haben? War man wirklich ahnungslos in Berlin? Oder wollte man nicht ans Schlimmste glauben?
Schnell folgt die nächste Frage: Warum hat sich Deutschland in Merkels Amtszeit so abhängig gemacht von russischen Gaslieferungen? Nach anfänglichem Rufen im Wald, es werde nicht so schlimm werden, weil Moskau doch in allen großen Krisen der zurückliegenden Jahrzehnte weiter Energie geliefert habe, kommen Zweifel auf. Sie erweisen sich als berechtigt. Putin dreht Deutschland den Gashahn zu. Und wieder richtet sich der ratlose Blick auf Merkel: Wieso hat die Kanzlerin so unbeirrt daran festgehalten, neben der bestehenden Ostseepipeline von Russland nach Deutschland eine zweite bauen zu lassen, und behauptet, dass es sich dabei keinesfalls um ein politisches, sondern um ein privatwirtschaftliches Projekt handelt? Warum wurden alle Warnungen und Mahnungen der Polen, der Balten, aber auch der Amerikaner, die Leitung nicht zu bauen, in den Wind geschlagen?
In der Folge geht es schon nicht mehr nur darum, in welchem Umfang die Fabriken in Deutschland ohne russisches Gas betrieben werden können und ob die Menschen in kalten Wohnungen durch den Winter kommen müssen. Es wird existenziell für das Land, denn wenn Putin militärisch nach Westen ausgreift, wo macht er halt? Kann Deutschland sich verteidigen, wenn russische Raketen Richtung Berlin fliegen oder Panzer über die Grenze rollen? Noch am ersten Tag des Überfalls gibt einer der ranghöchsten Bundeswehrsoldaten, der Generalleutnant und Heeresinspekteur Alfons Mais, eine ebenso klare wie niederschmetternde Antwort. Die Bundeswehr stehe »mehr oder weniger blank« da. »Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen«, schildert er die zurückliegende Militärpolitik des größten Mitgliedslandes der Europäischen Union.
Schon die Auslandseinsätze der Bundeswehr auf dem Balkan und in Afghanistan waren ohne amerikanische Führung und Unterstützung undenkbar. Jetzt aber führt Wladimir Putin den Deutschen vor, dass sie ohne Washington nicht in der Lage sind, ihr in Gefahr geratenes Land zu verteidigen. Der Jubelschrei nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, man sei von Freunden umzingelt, ist von Angela Merkel und ihren Landsleuten weder durch Putins Annexion der Krim 2014 noch durch die Wahl des europakritischen Republikaners Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten 2016 wirklich infrage gestellt worden.
Wo infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine über Abhängigkeit diskutiert wird, weitet sich die Debatte. Die Erkenntnis ist zwar nicht neu, dass die hinter vielen anderen Staaten zurückliegende Digitalisierung in Deutschland ohne chinesische Technologie nicht möglich wäre. Nur wenige Stimmen, vor allem die des Merkel-Kritikers Norbert Röttgen, haben während der Amtszeit der Kanzlerin gemahnt, man dürfe sich nicht vollständig vom chinesischen Konzern Huawei abhängig machen. Das hat aber nichts daran geändert, dass es bei dieser Abhängigkeit geblieben, ja, dass sie immer größer geworden ist.
Die Bilanz kurz nach dem Machtwechsel in Berlin bedeutet ein böses Erwachen. Deutschland hat es sich zu lange bequem gemacht mit billiger Energie aus Russland, billiger Hochtechnologie aus China und der unerschütterlichen Annahme, Amerika werde weiterhin für die Sicherheit der wirtschafts- und exportstarken Nation im Herzen Europas sorgen. Die Deutschen haben diese saturierte Geborgenheit in einer hässlichen Welt genossen. Sie haben es ihrer Kanzlerin mit viermaliger Wahl gedankt, dass sie sie in dem Glauben gelassen hat, dieses Modell sei auch weiterhin alltagstauglich. In der Hinsicht freilich hat Merkel die Menschen getäuscht, und sie haben sich gerne täuschen lassen. Es wäre unfair, Merkel vorzuwerfen, sie habe gegen den Willen der Wähler gehandelt. Auch nicht gegen den ihrer eigenen Partei oder den der CSU oder den der SPD. Im Gegenteil: Sie tat, was man ihrer Wahrnehmung nach von ihr erwartete. Was also Zustimmung versprach. Und was politisches Überleben versprach in einer für sie von Anfang an unwirtlichen, feindlichen Umgebung. In der CDU.
Das Ziel, ihren 80 Millionen Schutzbefohlenen möglichst wenig zuzumuten, versucht Angela Merkel nicht nur im Zusammenwirken mit diesen drei großen Themen und Staaten zu erreichen. Auch im Inland gilt dieses Prinzip. Besonders schwerwiegende Folgen hat das für die Infrastruktur. Obwohl sich längst abzeichnet, dass Straßen, vor allem Brücken und Autobahnen, sanierungsbedürftig sind, wird in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts im Namen der Sparsamkeit viel von der Substanz gelebt. Das führt zu einem enormen Stau bei den Reparaturen. Zu Beginn der 2020er Jahre sind Gleise, Weichen, Bahnhöfe und Züge der Bahn in einem so verheerenden Zustand, dass Passagiere nicht besondere Verspätungen oder Zugausfälle zum Gegenstand von Anekdoten machen, sondern pünktliche Fahrten in einem funktionierenden Zug mit verfügbarer Toilette und geöffnetem Bordbistro. Was der Regelfall sein soll, ist zur Ausnahme geworden. Auf den Straßen sieht es nicht anders aus. Vor allem in den Ballungsgebieten der Republik sorgen Sanierungsarbeiten an Brücken und Autobahnen dafür, dass Stop-and-go zum hässlichen Standard für Millionen von Autofahrern wird. Doch es fehlt noch an vielen anderen Stellen. Der klimafreundliche Umbau von Wirtschaft und privater Welt ist auf halbem Weg ins Stocken geraten, die Digitalisierung zum Teil erst auf lächerlich niedrigem Niveau.
Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort ist mehrschichtig. Erst einmal liegt es an den Deutschen selbst, die gelernt haben, Widersprüche zu ignorieren oder damit zu rechnen, dass Wunder immer wieder geschehen. Ihr Blick auf Russland ist nicht nur in Ostdeutschland viel weniger kritisch als der auf Amerika. Billiges russisches Gas, das durch eine Leitung direkt zu ihnen strömt, ist sympathischer als das Fracking-Gas aus Amerika oder gar aus dem heimatlichen Untergrund in Niedersachsen. Dass die Amerikaner dennoch für die Sicherheit Deutschlands sorgen, wird auch im frühen 21. Jahrhundert noch als Selbstverständlichkeit angesehen, da militärische Zurückhaltung, die man auch als zivilistische Behaglichkeit deuten kann, in Deutschland angesichts der eigenen Geschichte nach wie vor als Tugend gilt. Die Arglosigkeit China gegenüber wurzelt in der verloren gegangenen Bereitschaft, internationale Zusammenhänge als Kampf nationaler Interessen zu sehen. China wird als Markt wahrgenommen, der es Deutschland möglich macht, bei der Exportweltmeisterschaft vorn mitzuspielen. Dabei wird ignoriert, dass Peking seine Wirtschaftspolitik als Machtpolitik versteht.
Die Deutschen haben sich in eine liberale Spielart des Biedermeier zurückgezogen und fühlen sich wohl dabei, dass eine sich als schwäbische Hausfrau gebende Kanzlerin ihnen den Eindruck vermittelt, es sei alles in Ordnung, wie es ist. Das neue Jahrtausend hat schließlich wild und bedrohlich begonnen mit den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001. In einer Zeit, da die Gewissheiten fallen wie die Dominosteine, da die Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers eine Weltfinanzkrise auslösen kann, die die deutschen Sparguthaben bedroht, da ein kleines Mitglied der Europäischen Union wie Griechenland die Eurozone in ein Erdbebengebiet verwandelt, ist die Sehnsucht groß, sich in der Wärmekammer der Weltgemeinschaft zu verschanzen und sich von der Kanzlerin in Sicherheit wiegen zu lassen.
Der andere Teil der Erklärung für die Entwicklung des Landes im beginnenden 21. Jahrhundert ist Angela Merkel selbst. Zum ersten Mal seit 1949 ist der Kanzler nicht ein Mann, der seine Macht in einer der Volksparteien der Bundesrepublik aufgebaut hat und aus dieser Tatsache das natürliche Selbstbewusstsein zieht, Anspruch auf die Führung des Landes zu haben. Zwar lebt Merkel schon eineinhalb Jahrzehnte in der Bundesrepublik, als sie Kanzlerin wird, hatte zwei Ministerämter inne und führt die CDU seit fünf Jahren. Aber die Selbstsicherheit eines Helmut Kohl oder Gerhard Schröder vor dem Sprung nach ganz oben hat sie nicht. Ihre westdeutschen Unterstützer wie Konkurrenten sehen nicht, was sie wiederum mit eiserner Disziplin verbirgt: die aus ihrer DDR-Vergangenheit gespeiste Unsicherheit.
Noch im Juli 2021, bei ihrer letzten Sommerpressekonferenz vor den Berliner Journalisten, behauptet Merkel, sie sei mit sich und ihrer ostdeutschen Vergangenheit im Reinen. Diese Darstellung hält allerdings nur bis zum 3. Oktober desselben Jahres, als sie zum letzten Mal eine Rede als Regierungschefin am Tag der deutschen Einheit hält. Da lässt sie ihre Zuhörer tief wie nie zuvor in ihre Seele blicken und verrät, dass sie sich aufgrund ihrer ostdeutschen Vita als Bürgerin zweiter Klasse in der Bundesrepublik gefühlt hat und noch fremder offenbar in ihrer eigenen Partei. Ostdeutsche Zuhörer spüren die Sensation sofort. Westdeutsche wundern sich äußerstenfalls oder begreifen die Dimension der Äußerung nicht. Am Ende ihrer 16 Jahre währenden Kanzlerschaft ist Angela Merkels kritischer Blick auf das Verhältnis zwischen Ost und West der prominenteste Beleg dafür, dass Deutschland eine Generation nach dem Mauerfall viel weniger zusammengewachsen ist, als vor allem die Westdeutschen bis dahin geglaubt haben. Die Amtszeit einer ostdeutschen Kanzlerin endet nicht mit der Vollendung der Einheit, sondern macht die Kluft zwischen beiden Teilen des Landes deutlicher denn zuvor. Die große Zustimmung zur AfD gerade im Osten hat neben anderem ihren Grund auch in dieser Entfremdung.
Doch sind die Menschen im ganzen Land verunsichert durch die wilden Zeiten mit Kriegen, Terroranschlägen, Brexit und der Wahl Donald Trumps. Die durch die sozialen Medien vollkommen veränderte Kommunikationsstruktur tut ein Übriges. Über 16 Jahre klammern sich viele Deutsche an eine Kanzlerin, die weniger in sich ruht, als es äußerlich wahrnehmbar ist. Merkel dankt den Wählern für das viermal hintereinander in sie gesetzte Vertrauen damit, dass sie diesen keine großen Veränderungen zumutet, sondern die Herausforderungen minimalinvasiv bewältigt. Die Wirtschaft läuft über weite Strecken ihrer Amtszeit auf Hochtouren, der Staatshaushalt wird Jahr für Jahr stabiler, das Ziel der schwarzen Null wird erreicht und die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Beginn ihrer Kanzlerschaft etwa halbiert. Die Eurozone hält sie mit aller Kraft zusammen, die Europäische Union übersteht sogar den Austritt Großbritanniens ohne allzu große Erschütterungen. Viele Deutsche verehren ihre Kanzlerin. Im Ausland wird oft mit Bewunderung oder gar Neid auf das unter ihrer Führung stabile Land im Herzen Europas geblickt. Nur in der Flüchtlingskrise kann Merkel weder Deutschland noch Europa einen und verliert damit im Inland wie im Ausland einen erheblichen Teil des in sie gesetzten Vertrauens.
Die Schicksalsgemeinschaft, bestehend aus Merkel und ihren Deutschen, kommt auf diese Weise durch vier Legislaturperioden. Wo reagiert werden muss, wie bei den von außen aufgezwungenen großen Krisen, wird reagiert. Was durch Wegsehen noch eine Weile aufgeschoben werden kann, wird aufgeschoben. Roland Koch, der in Merkels erstem bundespolitischen Jahrzehnt ihr ur-christdemokratischer westdeutscher Gegenentwurf und Gegenspieler ist, beschreibt Merkels Regierungsstil im Gespräch mit dem Autor aus dem Rückblick des Jahres 2023 so: »Man kann nicht sagen, dass sie nicht sehen würde, wo sie Fehler gemacht hat. Ihre Haltung war, das Volk nicht mit Herausforderungen und Veränderungen zu konfrontieren, sondern stattdessen lieber ruhig an der Macht zu bleiben. Das würde sie weiter für richtig halten.«[1] Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender, bringt es im Gespräch auf die knappe Formel: »Der Wunsch nach progressiver Veränderung wird von den wenigsten Menschen geteilt.«[2]
Dass man auch einen anderen Blick auf Merkels Beweglichkeit haben kann als Koch, zeigt die Einschätzung eines ihrer treuesten Vertrauten und Weggefährten. »Als führender Politiker können Sie Politik nur dann über längere Zeit erfolgreich gestalten, wenn Sie klare Überzeugungen und Prioritäten mit dem Gespür für die Notwendigkeit flexiblen Vorgehens und konstruktiver Kompromisse verbinden. Sonst laufen Sie sehr schnell vor die Wand«, sagt Peter Altmaier. Er war Merkels dritter Kanzleramtschef, zudem Umwelt- und am Ende Wirtschaftsminister. »Kein Politiker hat jemals völlig freie Hand in dem, was er tut.« Merkel habe das erkannt und gerade deshalb enorm viel bewegt, sagt Altmaier und stellt das Wirken der Kanzlerin neben das ihrer Vorgänger Konrad Adenauer und Helmut Kohl.[3]
Merkel hat sich schon früh darauf festgelegt, dass sie weder vom Wähler, viel weniger aber noch von ihrer Partei vom Hof gejagt werden will, so wie es ihren Vorgängern erging. Daher scheidet sie selbstbestimmt aus dem Amt, was keinem der bisherigen Kanzler gelungen ist. Zum Willen, selbst Regie zu führen, kommt die Erschöpfung nach 16 Jahren im kräftezehrendsten politischen Amt, das Deutschland zu bieten hat. Schon vor der Wahl 2017 überlegt Merkel intensiv, ob sie auf eine vierte Kandidatur nicht besser verzichten soll.
So selbstverständlich, wie der ewige Frieden und der ewige Wohlstand mithilfe von Amerikanern, Russen und Chinesen genommen wird, für so selbstverständlich scheinen die meisten Deutschen die ewige Demokratie zu halten. Als Angela Merkel 2005 als erste Frau Bundeskanzlerin wird, gilt das als Beleg dafür, dass Deutschland zu einer modernen und vitalen Demokratie geworden ist, die mit einer Regierungschefin den meisten anderen westlichen Staaten einiges voraus hat. Mit Ausnahme der britischen Premierministerin Margaret Thatcher haben die großen Demokratien Europas und Nordamerikas noch keine Frau an der Spitze einer Regierung vorzuweisen.
Allerdings sieht es auch hier am Ende der Ära Merkel weniger rosig aus als zu deren Beginn. Die Zustimmung zur Demokratie schwindet auch in Deutschland, das nach zwei Diktaturen im 20. Jahrhundert stolz sein sollte, stabil auf diese Weise regiert zu werden. Genau zur Hälfte ihrer 16 Jahre währenden Kanzlerschaft, bei der Bundestagswahl 2013, ist Merkel auf der Höhe ihrer Macht, hat in ihrer zweiten Koalition mit den Sozialdemokraten 80 Prozent der Stimmen im Bundestag und nur Grüne und Linkspartei als Opposition. Doch ist die erst wenige Monate zuvor gegründete Alternative für Deutschland nur knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und steht vor den gerade noch einmal zugesperrten Toren des Reichstags. Dass aus der von Kritikern der Euro-Währung gegründeten Partei schnell ein Schreckgespenst am rechten Rand des Parteienspektrums wird, mag mancher befürchtet haben. Schon bald wird die rechte Partei in einen Landtag nach dem anderen einziehen, bei der Wahl 2017 auch in den Bundestag.
Als Angela Merkel geht, hat sich zum ersten Mal seit 1949 eine konsequent rechte Partei, die sich immer mehr in Richtung Rechtsextremismus entwickelt, in den deutschen Parlamenten festgesetzt. Angesichts von Umfrage- und Wahlergebnissen von mehr als 20, zum Teil über 30 Prozent stellt sich zumindest in ostdeutschen Ländern bald die bange Frage, ob und wie noch dauerhaft ohne die AfD Regierungen gebildet werden können. Die äußerst rechte Partei sieht sich nicht nur als Konkurrenz zu anderen Parteien, die sie als »Altparteien« verunglimpft. Sie will das System dieser »Altparteien« überwinden.
Der Blick in andere Demokratien, in denen es längst populistische und extreme Parteien und Bewegungen gibt, zeigt, dass Deutschland spät dran ist. Als die Alternative für Deutschland 2013 gegründet wird, ist es schon elf Jahre her, dass der Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen in die Stichwahl kommt. Eine Partei am äußersten rechten Rand, wie die AfD, wäre vermutlich auch ohne Angela Merkel entstanden. Dass sie jedoch mit dem Slogan »Merkel muss weg« und dem aggressiven Anrennen gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin erheblich an Zustimmung gewinnt und sich dadurch im politischen System der Bundesrepublik festsetzt, ist unbestreitbar.
Dieses Buch will an den zentralen Themen zeigen, wie durch das Zusammentreffen einer Gesellschaft, die sich weigert, die Herausforderungen des neuen Jahrhunderts mit der nötigen Schärfe zu sehen, und einer Politikerin, die im Bemühen um die Unterstützung durch die westdeutsch geprägte Mehrheitsgesellschaft deren tatsächliche oder auch nur vermeintliche Wünsche erfüllt, die Veränderung auf Gebieten ausbleibt, auf denen sie dringend geboten wäre. Im Rückblick wird betrachtet, wie sich Deutschland in den Merkel-Jahren entwickelt hat, was gelungen ist und was nicht. Zweitens soll erklärt werden, warum Merkel das eine tat und das andere unterließ. Mit ihrem Bekenntnis wenige Wochen vor dem Auszug aus dem Kanzleramt, als Ostdeutsche nicht wirklich in der Bundesrepublik angekommen zu sein, liefert Merkel den Schlüssel zur Erklärung ihres Handelns. Wenn ein einstiger Vertrauter Merkels sagt, sie habe schon viel damit zu tun gehabt, politisch zu überleben, und damit begründet, dass große Würfe wie die Westintegration unter Adenauer, die Ostpolitik unter Brandt, die NATO-Nachrüstung unter Schmidt und die Schaffung des Euro unter Helmut Kohl ausgeblieben sind, so ist das eine zutreffende Beschreibung.
Der Autor dieses Buches will gleich zu Beginn eine grundsätzliche Bemerkung in eigener Sache machen. Auch er hat als journalistischer Beobachter angesichts der Geschwindigkeit der Ereignisse manche Dinge nicht in der Schärfe erkannt und benannt, die sich aus dem Rückblick ergibt. Auch er war auf manchen Feldern im beschriebenen Sinne einer von Merkels Deutschen, die bestimmte Entwicklungen nicht gesehen, etwa die selbstzerstörerische Aggressivität des vom Diktator Putin geführten Russlands unterschätzt haben. Das sei gesagt, um den Eindruck zu vermeiden, es gehe um wohlfeile Besserwisserei, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Einsichten und Erkenntnisse mit ein paar Jahren Abstand sind dennoch zulässig. Angela Merkel selbst lässt das zwingend erscheinen, weil sie es zumindest lange Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt hat vermissen lassen, ihre Politik selbstkritisch zu reflektieren und Fehler einzugestehen.
1.Merkel trifft auf Deutschland
Das neue Jahrtausend und das Ende alter Gewissheiten
Als sich das 20. Jahrhundert allmählich seinem Ende entgegenneigt, haben die Deutschen allen Grund, glücklich zu sein. Die Westdeutschen halten Frieden, Demokratie und Wohlstand für selbstverständlich. Millionen von Babyboomern zwischen Bonn und Braunschweig, Sylt und München gehen auf die 30 zu, kaufen ihren ersten BMW und erobern langsam die Anwaltskanzleien, die Arztpraxen, die Unternehmen, die Lehrerzimmer und die politischen Parteien. Ein bisschen Geduld noch, und die Welt wird ihnen gehören. Sie sind viele, sie sind gesund, sie sind gut ausgebildet, wohlhabend und selbstverständlich gewillt, die Führung im Land zu übernehmen. Krieg und Hunger kennen sie nur aus den Erzählungen ihrer Eltern oder Großeltern, Auschwitz immerhin aus dem Geschichtsunterricht, dem Film oder als Chiffre. Dem einen oder der anderen mag es ein bisschen langweilig sein, weil politisch so wenig passiert in diesem Leben. Aber Sonnenbaden auf Teneriffa und Skilaufen in Kitzbühel sind auch nicht schlecht.
Dann kommt der 9. November 1989, die Mauer fällt. Für die Westdeutschen wird aus einer ruhigen Wohlstandsdemokratie ein wiedervereinigtes Land. Der Warschauer Pakt ist in die Knie gezwungen, die Sowjetunion haucht bald ihr Leben aus, übrig bleibt ein geschwächtes Russland. Die Geschichte hat einen Sieger und der glaubt, dass sein Sieg endgültig ist. Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama veröffentlicht sein Buch »Das Ende der Geschichte«, in dem er die These vertritt, dass Liberalismus, Demokratie und Marktwirtschaft sich endgültig durchsetzen werden. In der westlichen Welt, auch in Deutschland, hat die Einschätzung Hochkonjunktur, man sei »von Freunden umzingelt«. Man wähnt sich nicht nur im Glück, sondern erwartet Sicherheit, Frieden, Demokratie und Wohlstand bis ans Ende aller Tage.
Plötzlich sind nicht nur Italien und Spanien leicht zu erreichende Reiseziele, sondern auch osteuropäische Nachbarländer wie Polen, Tschechien, Ungarn, aber auch die Nachfolgestaaten der Sowjetunion – Russland, das Baltikum, Georgien. Wer neugierig ist, reist dorthin, wer es nicht ist, kann getrost im Münsterland weiter Rad fahren oder von Stuttgart aus nach Frankreich reisen. Alles geht, nichts muss. Aus westdeutscher Sicht ist das Leben ein Paradies.
Für die Schwestern und Brüder in der ehemaligen DDR sieht es erst mal auch gut aus. Die Mauer ist weg, die Freiheit da. Wer genug Geld hat, kann nach San Francisco fliegen, wer nicht ganz so liquide ist, nach Mallorca, mindestens aber ist ein Ausflug nach München drin mit einem der Gebrauchtwagen, die ihren Dienst im Westen getan haben und nun im Osten des Landes ein zweites Leben finden. Allerdings bringen die Veränderungen für die Ostdeutschen weit mehr Herausforderungen mit sich als für die Alt-Bundesrepublikaner. Neben neuer Freiheit, neuen Autos und neuen Reisezielen gibt es neue Gesetze, neue Geldscheine, eine neue Regierung. Vor allem aber verlieren viele ihren Arbeitsplatz und damit die Gewissheit, ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Und auch die Mehrheitsgesellschaft ist eine neue. Das Ende von Diktatur und Stasi, die neue Freiheit und neue materielle Möglichkeiten lassen das Gefühl, der Verlierer zu sein, erst einmal nicht aufkommen. Jedenfalls nicht massenhaft. Aber mancher, der Freiheit und Leben riskiert hat, um die zweite Diktatur auf deutschem Boden niederzuringen, ist enttäuscht, dass nicht viel übrig bleibt von den Reformideen, die einige am Ende der Deutschen Demokratischen Republik hatten. Überhaupt bleibt nicht viel von ihr übrig außer der Band »Karat« und dem grünen Rechtsabbiegerpfeil an der Verkehrsampel.
Viele Westdeutsche übersehen, dass sie die Sieger im eigenen Land sind und jeder Sieg Verlierer mit sich bringt. Das sind zumindest diejenigen Ostdeutschen, die sich nicht mit Begeisterung in die neue gesamtdeutsche Wirklichkeit stürzen und darin erfolgreich sind. Der Begriff »Jammer-Ossi« wird vielfach benutzt von Menschen, die durch die Wiedervereinigung nichts ändern müssen. Wenn sie es tun, dann weil sie sich einen Vorteil davon versprechen. Schließlich mag der ein oder andere Wessi in Rostock doch leichter in eine Führungsposition kommen als in Köln.
Von weit größerer Bedeutung sind aber andere blinde Flecken in den Augen der zufriedenen Westdeutschen. Der nächstliegende ist Russland. Nicht nur die DDR hat schließlich den Systemwettbewerb verloren und das Kräftemessen mit dem Westen. Viel mehr noch die Vormacht des Sowjetimperiums. Die Westdeutschen, vor allem die zur Boomer-Generation gehörenden, sind nicht nur überzeugt, dass sie selbst ihre Lektion in Sachen eigener Geschichte gründlich gelernt haben, sondern hängen dem Irrglauben an, dass auch andere die Konsequenz aus den deutschen Verbrechen und ihren Folgen gezogen haben. Dass nämlich der Zweite Weltkrieg die letzte Erfahrung dieser Art war, die die Menschheit mindestens auf der nördlichen Halbkugel brauchten, um auf ewig in Frieden zu leben. Die Welt soll nicht nur im Schlechten, sondern auch im Guten am deutschen Wesen genesen.
Dass man das in Moskau anders sehen könnte, will niemand wahrhaben. Und Wladimir Putin tut zunächst alles, damit dieser Trugschluss weiterleben kann. So spricht der russische Präsident am 25. September 2001 vor dem Bundestag. »Für unser Land, das ein Jahrhundert der Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel«, sagt der Mann, der diesen Frieden 13 Jahre später mit der Besetzung der Krim ins Wanken bringen wird und weitere acht Jahre später durch den Überfall auf die gesamte Ukraine zerstört. Die Deutschen wollen ihm 2001 nur zu gerne glauben. Hätte man damals die Abgeordneten gefragt, ob sie Putins Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 für möglich hielten, wäre die Antwort ein überzeugtes Nein gewesen.
Schon deswegen wollen die Deutschen an die Friedfertigkeit Putins glauben, weil ihr Weltbild zwei Wochen vor dessen Rede in Berlin in einer Weise einen Riss bekommen hat, wie seit Gründung der Bundesrepublik nicht mehr. Islamistische Terroristen, von denen einige sogar in Hamburg gelebt haben, verüben den spektakulärsten Terroranschlag der Geschichte, indem sie Passagierflugzeuge kapern und ins World Trade Center in Manhattan steuern. Wie der Rest der Welt erleben die Deutschen den Zusammenbruch dieser Kathedrale der westlich-kapitalistischen Welt mit Tausenden Toten live vor dem Fernseher. Dass Islamisten schon acht Jahre zuvor versucht haben, dieses Wahrzeichen amerikanischer Größe zum Einsturz zu bringen, indem sie in der Tiefgarage des World Trade Centers 700 Kilogramm Harnstoffnitrat zur Explosion brachten, hat zumindest in der Breite der deutschen Gesellschaft und Politik nicht dazu geführt, den islamistischen Terrorismus als Bedrohung zu betrachten. Wie die Besetzung der Krim im Jahr 2014 nicht ausreichen wird, die Deutschen in Alarmstimmung zu versetzen, so ist es auch mit dem ersten Anschlag in New York 1993.
Der Terror des 11. September ist ein Weckruf für die friedensverwöhnten Bundesbürger, die überhaupt erst durch den Kosovokrieg gelernt haben, dass Krieg auf europäischem Boden wieder möglich ist. Aber die Ereignisse in New York lösen einen viel größeren Schrecken aus als die Waffengänge auf dem Balkan. Es ist ein Sozialdemokrat, der gleich zwei Tabus bricht. Bundeskanzler Gerhard Schröder verspricht dem angegriffenen NATO-Partner USA »uneingeschränkte Solidarität«. Die Bilder aus New York und Washington, wo das Pentagon getroffen wird, machen diesen Satz erträglich auch für die vor allem auf der Linken beheimateten Deutschen, die Amerika gegenüber zumindest kritisch eingestellt sind. Auch der zweite Tabubruch wird durch den Schock erleichtert. Als die Amerikaner beschließen, als Reaktion auf die Anschläge in Afghanistan einzumarschieren, ist die Bundeswehr ab Januar 2002 dabei. Wie wenig das mit einem neuen Amerikabild in Deutschland zu tun hat, zeigt sich daran, dass Schröder im selben Jahr einen erfolgreichen Wahlkampf in erheblichem Maße auf lautstarken Widerstand gegen den Irak-Feldzug Washingtons aufbauen wird. Mit Kritik an den »Amis« kann man auch im frühen 21. Jahrhundert noch eine Bundestagswahl gewinnen.
Die Methode, unschöne Wahrheiten zu übersehen, wenden die Deutschen auch im Umgang mit China an. Zwar wird bei China-Reisen der politischen Prominenz brav darauf hingewiesen, dass man die Menschenrechtsverletzungen in dem Einparteienstaat stets im Blick hat. Doch sind wirtschaftliche Interessen wichtiger als politische Rücksichten. Kein Kanzlerflugzeug, das nicht mit den Bossen der deutschen Wirtschaft vollgepackt wäre. Auch als längst erkennbar ist, dass das System in Peking nicht nur autoritärer, ja diktatorisch wird, sondern in sehr langen Linien denkt und weit nach Europa und Deutschland ausgreift, tut man in Berlin so, als sei China nichts als ein großer Markt. Vor allem beim Aufbau einer digitalen Infrastruktur setzt die Bundesrepublik viel zu sehr auf die preiswerten chinesischen Produkte, statt eigene, europäische zu entwickeln.
Das ist die Lage zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als Angela Merkel CDU-Vorsitzende wird und damit den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur verbindet. Die Welt und auch Deutschland befinden sich in einem ungeheuren Umbruch, auf vielen Ebenen.
Europa bekommt eine einheitliche Währung, den Euro. Die Westdeutschen konnten fünf Jahrzehnte mit der D-Mark leben, bis sie sich an neue Scheine und Münzen gewöhnen müssen, die Ostdeutschen haben gerade seit einem Jahrzehnt die ersehnte Westwährung im Portemonnaie und müssen sich schon wieder umstellen. Der Euro bedeutet eine Umgewöhnung auf mehreren Ebenen. Das Umrechnen, verbunden mit dem Gefühl, plötzlich weniger Geld zu haben, ist das eine. Die Sorgen, die Währung könnte im weltweiten Wettbewerb nicht stabil sein, ist das andere, das sowohl Banken als auch Unternehmen, aber ebenso Privatpersonen beschäftigt. Dann gibt es aber noch eine emotionale Herausforderung. Die Währung ist eines der wichtigen nationalen Identitätsmerkmale. Da mag die Aufgabe für die an den Wechsel gewöhnten Deutschen sogar noch eine geringere sein als die für Franzosen, Italiener oder andere, deren Währungen über mehr als 100 oder gar 200 Jahre selbstverständlicher Teil ihres Lebens waren.
Doch die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen bedeuten für das Alltagsleben der Menschheit wenig im Vergleich zu der technischen Revolution, die an der Jahrtausendwende mit noch nie da gewesener Geschwindigkeit eindringt: das Internet. Von der Erfindung des Rades bis zu dem Moment, an dem es ein Großteil der Menschen zur täglichen Fortbewegung nutzt, vergehen Jahrtausende. Der Buchdruck wird im 15. Jahrhundert erfunden, noch heute gibt es selbst in hoch entwickelten Gesellschaften wie der deutschen Millionen Menschen, denen diese Weltsensation fremd bleibt, weil sie des Lesens nicht mächtig sind.
Die Kommunikation über das Internet wird dagegen innerhalb weniger Jahre selbstverständlicher Bestandteil des Lebens weitester Teile der Menschheit. Als Merkel 2005 Kanzlerin wird, nutzen 55 Prozent der mehr als 14 Jahre alten Deutschen das Internet. Als sie abtritt, sind es 91 Prozent. Findet diese Art des Austauschs von Nachrichten in den 1990er Jahren zunächst nur über fest installierte Computer auf einzelnen Schreibtischen in Büros und Wohnungen statt, gehört sie schon wenige Jahre nach der Jahrtausendwende zum beruflichen und privaten Alltag einer schnell steigenden Zahl von Menschen. Doch das ist nur der Anfang der Revolution. Richtig Fahrt nimmt diese Entwicklung auf, als Merkel bereits seit zwei Jahren Bundeskanzlerin ist.
Unter den zahlreichen 9. Novembern, an denen die deutsche Geschichte positive und negative Einschnitte erlebt, gilt der des Jahres 1989 als der wichtigste für Angela Merkel. Tatsächlich wäre sie ohne den Mauerfall nicht die erste Kanzlerin eines wiedervereinigten Deutschlands geworden. Doch ist für ihre Arbeit als Regierungschefin der 9. November 2007 von noch größerer Bedeutung. Das ist der Tag, von dem an das iPhone in Deutschland verkauft wird. Es kostet 399 Euro. Nun dauert es nicht mehr lange, bis die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok von immer mehr Menschen zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt werden.
Das Motto ihres Vorgängers Schröder, er brauche zum Regieren nur »Bild, BamS und Glotze«, also die Boulevardblätter des Springer-Verlags und das Fernsehen, klingt mit der immer weiter verbreiteten Nutzung der sozialen Netzwerke wie der Nachhall aus einer alten Welt. Angela Merkel ist nicht nur die erste Frau und die erste Ostdeutsche im Kanzleramt, sie ist auch die Erste, die Deutschland unter völlig neuen und weitgehend anarchischen Kommunikationsbedingungen führen muss. Bis zum Jahr 2007 brauchen Politiker den Zugang zu etablierten Medien, um ihre Botschaften unters Volk zu bringen. Das geschieht mithilfe von Pressesprechern. Bei den Absendern wie bei den Empfängern gibt es also professionelle Überprüfungen der Nachrichten, die in Umlauf gebracht werden.
Mit der zunehmenden Nutzung sozialer Netzwerke ändert sich das. Jede und jeder – Abgeordneter, Minister oder Kanzlerin, Erika Mustermann ebenso wie Otto Wutbürger, Aktivistin und Terrorist – kann allein verantwortlich verbreiten, was sie beziehungsweise er will, verschlüsselt oder nicht, von Blase zu Blase. Stimmungen können geschürt werden und wachsen, bevor es eine größere Öffentlichkeit erfährt. Wenn sie dann vermeintlich aus dem Nichts auftauchen, ist das Erstaunen oder Erschrecken oft groß. Das wird nicht erst problematisch, wenn es sich um Rechtswidriges handelt. Auch politische Meinungsbildung entzieht sich dem bisherigen Regelwerk.
In Merkels Regierungszeit wird die massenhafte Kommunikation über die sozialen Netzwerke in zwei Fällen besonders wichtig. Die in ihrer Zeit entstehende Alternative für Deutschland hat durch ihre bald hart rechte und sogar rechtsextreme Ausrichtung schnell Schwierigkeiten, ihre Ideen in den etablierten Medien zu platzieren. Das kompensiert sie durch professionelle Nutzung der sozialen Netzwerke. Auch hier nach dem Motto: von Blase zu Blase. Der andere Fall ist der Flüchtlingszustrom seit 2015. Zweifellos hätten weniger Menschen den Weg nach Deutschland eingeschlagen, wenn das Bild vom gelobten Land nicht derart intensiv über das Netz verbreitet und die Navigation dorthin erleichtert worden wäre.
Die Menschen, die in Deutschland ankommen, haben oft nicht viel mehr als ihre Kleidung am Leib und eine Tasche dabei. Viele kommen ohne Pass, was nicht unbedingt heißt, dass sie ihn verloren haben. Wer keine Papiere dabeihat, kann weniger leicht identifiziert und damit auch nicht zurückgeschickt werden. Aber eines haben fast alle Migranten dabei: ihr Smartphone. Mit diesem können sie bezahlen und sich orientieren, sie können Bilder und Videos aufnehmen, nach Hause schicken und damit nicht nur Kontakt zu ihren Familien und Freunden halten, sondern Hoffnungen und Sehnsüchte wecken. Für den Verlauf des Flüchtlingszustroms Richtung Deutschland seit dem Jahr 2015 ist das Smartphone von elementarer Bedeutung. Zum Sinnbild eines freundlichen Empfangs in Deutschland ist das Foto geworden, das der aus Syrien geflohene Anas Modamani 2015 mit Merkel in einer Flüchtlingsunterkunft in Spandau macht.
Um die Jahrtausendwende finden auch erhebliche gesellschaftspolitische Veränderungen statt. Bisherige Werte verlieren ihre Allgemeingültigkeit, neue erfahren zunehmend Akzeptanz. Ein Beispiel ist der Umgang mit Homosexualität. In der ersten Hälfte der 1980er Jahre reichte die – falsche – Behauptung, der Bundeswehrgeneral Günter Kießling sei homosexuell, dafür aus, ihn als Sicherheitsrisiko einzustufen, weil er damit erpressbar sei. Die Krise nahm große Ausmaße an und beschäftigte nicht nur die Bundeswehr, sondern auch den Bundestag und Kanzler Helmut Kohl. Kießling wurde vorzeitig in den Ruhestand geschickt. Weil sich die Mutmaßungen nicht beweisen ließen, beendete Kohl die Kontroverse um den hochrangigen Offizier. Der wurde schließlich zurück in den Dienst geholt und gleich darauf ehrenhaft mit einem Großen Zapfenstreich entlassen. Dennoch war sein Ruf dauerhaft beschädigt.
Die Angelegenheit sagt viel über die gesellschaftspolitische Wirklichkeit aus, kurz bevor Angela Merkel in Bonn Ministerin wird. Erst 1994 wird der Paragraf 175, der sogenannte Schwulen-Paragraf, aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Homosexuell zu sein, ist von da an zwar nicht mehr strafbar. Aber sich öffentlich dazu zu bekennen, ist nicht selbstverständlich. Weitere sieben Jahre später sorgt der Berliner Sozialdemokrat Klaus Wowereit für großes Aufsehen, als er den zu Berühmtheit gelangten Satz sagt: »Ich bin schwul, und das ist gut so.« Das geschieht wenige Tage vor seiner Wahl zum Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt. Ein Zeichen entspannten Umgangs mit dem Thema durch Spitzenpolitiker ist das allerdings nicht. Vielmehr geht Wowereit in die Offensive, weil er befürchten muss, dass die Boulevardpresse aus seiner Homosexualität eine Skandalgeschichte macht. Dem will er zuvorkommen. Von da an ist es leichter, mit Homosexualität umzugehen, nicht nur, aber eben auch für Prominente. Kurz bevor Angela Merkel Bundeskanzlerin wird, nutzt der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle ihre Geburtstagsfeier, um seinen Lebensgefährten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Entwicklung in diesen beiden Jahrzehnten bedeutet zwar nicht das Ende der Homophobie. Aber immerhin muss ein Politiker nicht mehr um sein Amt fürchten, wenn er schwul ist und das bekannt wird.
Was viele Menschen als einen großen gesellschaftlichen Fortschritt betrachten, seien sie nun homosexuell oder nicht, ist zugleich die Beschleunigung einer Entwicklung, die nicht alle gleichermaßen begrüßen. Als Merkels Nachfolger eineinhalb Jahrzehnte später ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringt, das es trans-, intergeschlechtlichen und nichtbinären Personen erleichtern soll, ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen, führt das zu einer politischen und gesellschaftlichen Kontroverse. Manch einem scheint die Entwicklung weg von der bisher für normal gehaltenen Welt allzu schnell zu gehen.
Auch für weniger tief in den Emotionshaushalt eindringende Themen trifft das zu: Sind Flugreisen in ferne Länder, Autos mit PS-starken Verbrennungsmotoren oder große Steaks auf dem Grill in den 1990er Jahren noch Statussymbole eines erfolgreichen Bürgertums, so muss man sich nach der Jahrtausendwende immer mehr dafür erklären oder sogar entschuldigen. Stellen einen die eigenen Kinder zur Rede, mag das noch gehen. Aber viele Menschen fühlen sich bevormundet von der Politik. Um die Jahrtausendwende ist diese an der Spitze des Landes rot-grün.
Zu dieser Zeit geschehen drei wichtige Dinge in kurzer Zeit. Erstens beschließt die linke Bundesregierung unter dem sozialdemokratischen Kanzler Gerhard Schröder und dem grünen Außenminister Joschka Fischer die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft. Das soll gut integriert in Deutschland lebenden Ausländern die Möglichkeit geben, mit einem zweiten, dem deutschen, Pass am öffentlichen Leben besser teilzuhaben, indem sie zur Wahl gehen. Noch 20 Jahre später feiert die SPD-Parteizeitung »Vorwärts« den Beschluss: »Damit wurde das Bild vom Deutschsein grundlegend verändert.«[4]
Doch was in der politischen Linken als Fortschritt angesehen wird, empfinden nicht nur die konservativen Mitglieder und Anhänger der CDU als Bedrohung der deutschen Identität. Als Reaktion auf das rot-grüne Vorhaben startet die hessische CDU vor der Landtagswahl 1999 eine Unterschriftenkampagne gegen das Gesetz. Diese sieht sich schon bald dem Vorwurf ausgesetzt, es gehe darum, wo man »gegen Ausländer« unterschreiben könne. Das nehmen die Organisatoren billigend in Kauf. Machtpolitisch ist die Kampagne erfolgreich für die CDU. Deren Spitzenkandidat Roland Koch geht als Ministerpräsident aus der Wahl hervor.
Schaut man sich Aufnahmen aus dem hessischen CDU-Wahlkampf damals an, so wird deutlich, warum AfD-Anhänger sich heute mit dem Argument verteidigen, sie hätten sich überhaupt nicht verändert und sagten einfach nur das, was sie früher schon gesagt haben. Da wird selbstverständlich »Deutschland den Deutschen« gefordert von jemandem, der nicht mit hasserfülltem Gesicht einen Galgen zeigt oder mit schwarzer Kapuze auf einer Demonstration brüllt. Vielmehr ist es eine ältere Dame, die an einer CDU-Versammlung teilnimmt.
Zwar wird im aufgeheizten öffentlichen Streit über den Doppelpass eine solche Äußerung in den Medien thematisiert. Aber niemand würde auf die Idee kommen, die Frau wahrzunehmen als Anhängerin einer extremistischen Partei, die verboten werden muss. 14 Jahre später, als die AfD gegründet ist, würde man sie nur aufgrund einer solchen Äußerung vermutlich dieser neuen Partei mit alten Inhalten zuordnen. Ohne dass das 1999 schon klar ist, wird der Streit um das neue Staatsangehörigkeitsgesetz im endenden 20. Jahrhundert zu einer der letzten großen Polarisierungen zwischen den beiden Volksparteien CDU und SPD. Diese Polarisierung hat immer wieder hässliche Auswüchse gehabt. Aber sie hat seit 1949 dazu beigetragen, zu verhindern, dass eine rechtsextreme Partei in Deutschland dauerhaft groß wird.
Das zweite Ereignis hat nichts mit der Auseinandersetzung um den Doppelpass zu tun. Kurz nach dem Ende der Ära Kohl wird bekannt, dass die CDU – Bundespartei wie hessische Landespartei – in großem Umfang illegale Spenden angenommen hat. Die Affäre stürzt die Partei in die schwerste Krise ihrer Geschichte. Der ehemalige Bundeskanzler Kohl ist ebenso belastet wie sein Nachfolger im Parteivorsitz, Wolfgang Schäuble, und Roland Koch, der eben noch strahlende Wahlsieger in Hessen.
Das ist der Moment, an dem die junge, ostdeutsche CDU-Generalsekretärin zeigt, dass sie in zehn Jahren bundespolitischer Lehrzeit die Machtmechanismen der Parteiendemokratie erlernt hat. Angela Merkel veröffentlicht in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« einen Brief, in dem sie die CDU aufruft, sich von Helmut Kohl zu trennen. Wenige Monate später wird sie zur Vorsitzenden gewählt. Sie steht nun an der Spitze einer Partei, in der es Mitglieder und Meinungen gibt, wie sie der Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann vertritt. Hohmann sagt etwa über das Gesetz zur doppelten Staatsbürgerschaft, wenn man Rot-Grün das durchgehen lasse, werde die Bundestagswahl im September 1998 die letzte freie Wahl in Deutschland gewesen sein. Von ihm kommt auch die Aufforderung, sich vom »Schuldwahn« zu befreien. Die Deutschen seien im 20. Jahrhundert »mindestens ebenso Opfer wie Täter« gewesen. Er begründet seine Haltung damit, dass es neben der CDU keine »demokratische rechte Partei« geben dürfe. Merkel schaut sich das eine Weile an. Dann aber sorgt die Vorsitzende der Unionsfraktion des Bundestages dafür, dass Hohmann 2003 aus dieser ausgeschlossen wird, später auch aus der CDU. 2017 kehrt er als AfD-Abgeordneter ins höchste deutsche Parlament zurück.
Wenn Überzeugungen sich derart rasch wandeln wie an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert, ist es für Politiker doppelt hilfreich, die bisherigen Gewohnheiten und Einstellungen genau zu kennen und zu wissen oder doch zu ahnen, welche Änderungen möglich und welche schwierig sind. Für Merkel ist das eine besondere Herausforderung. Als die Mauer fällt und sie fast ohne Vorlaufzeit auf die höchste Ebene der westdeutschen Politik gespült wird, muss sie erst mal erhebliche Teile ihrer inneren Festplatte löschen. Anschließend muss sie lernen, wie ein konservatives Mitglied der hessischen CDU denkt und fühlt. Auch die Mechanismen, die erforderlich sind, um sich in einer sozialistischen Diktatur zu bewegen, unterscheiden sich fundamental von denjenigen in Bonn. Musste sie in der DDR eigene Überzeugungen, sofern sie nicht zufällig und punktgenau der herrschenden Linie im Einparteienstaat entsprachen, möglichst verbergen, so gilt es in der westdeutschen Parteiendemokratie, Mehrheiten zu suchen und zu organisieren, um sich durchzusetzen. Diejenigen, die sich von Jugend an in ihrer Partei bewegen und dort einen festen Stand haben, können dabei größere Risiken eingehen, ohne gleich befürchten zu müssen, kaltgestellt zu werden. Wer jedoch ohne dieses Fundament daherkommt, wie Merkel, muss vorsichtiger sein und ständig darauf achten, auf der Seite der Mehrheit zu stehen.
Als Merkel erstmals das Kanzleramt ansteuert, glaubt sie, die Unterstützung ihrer Partei nur durch einen wirtschaftsliberalen Kurs sichern zu können. Dafür bekommt sie auf dem Leipziger CDU-Parteitag 2003 viel Beifall. Doch sie verschätzt sich fundamental. Nicht nur die Sozialdemokraten, auch wichtige Mitglieder ihrer Partei sind skeptisch, wenn es um radikale Reformen geht. Symptomatisch für die Fehleinschätzung ist die Auswahl des Heidelberger Hochschullehrers Paul Kirchhof für das Schattenkabinett im Wahlkampf. Der Wissenschaftler will einen harten Kampf gegen Steuermissbrauch führen, statt die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Auch in der Rentenpolitik strebt er radikale Reformen an. Dass Volksparteien – ob SPD oder CDU – immer die soziale Gerechtigkeit im Auge haben müssen, ist ihm offenkundig nicht klar genug. Der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder nimmt den Elfmeter, den Merkel ihm auf diese Weise verschafft, gerne an. Er wirft Kirchhof vor, die Rente wie eine KFZ-Versicherung zu behandeln. Das sei ein Menschenbild, das bekämpft werden müsse. Als Schröder Kirchhof den Titel der »Professor aus Heidelberg« gibt, drückt er Merkel und der von ihr geführten CDU damit den Stempel der sozialen Kälte auf. Am Ende kann Merkel die vorgezogene Wahl 2005 gegen den wegen der Hartz-Reformen angeschlagenen Schröder nur um Haaresbreite gewinnen. Dieser Schock prägt ihre gesamte Regierungszeit. Es trifft sich, dass sie gezwungen ist, eine große Koalition mit der SPD zu bilden. Sie versucht, eine möglichst breite Mehrheit in der Mitte zu finden.
Das Dogma: die schwarze Null
Als Angela Merkel 2005 das Kanzleramt übernimmt und ihre erste große Koalition zusammenführt, stehen zwei Dinge oben auf ihrer Prioritätenliste. Die zentralen Begriffe des Koalitionsvertrages lauten Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung. Der Abbau von Arbeitslosigkeit wird als »zentrale Verpflichtung« der Regierungspolitik von Schwarz-Rot bezeichnet. Nur wenige Zeilen weiter heißt es: »Das hohe strukturelle Defizit des Staatshaushalts und der Schuldendienst begrenzen die Handlungsfähigkeit des Staates.« Um Deutschlands öffentliche Finanzen auf eine solide Basis zu stellen, seien die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden »in einer gemeinsamen Anstrengung« zu konsolidieren. »Wir werden: sanieren, reformieren und investieren und dabei die Lasten gerecht auf alle Schultern verteilen.« Und weiter: »Wir werden mutig sparen und Subventionen abbauen. Das hat Vorrang.« Ohne Steuererhöhung sei die für das Land wichtige Konsolidierung allerdings nicht zu schaffen. Man merkt: Der angestammte Koalitionspartner der Union, die FDP, ist nicht an Bord.
Was diese Regierung sich unter Führung der ersten Frau im Kanzleramt als Programm gegeben hat, klingt nicht nach Gestaltung, sondern nach Reparatur. Das liegt zum einen an den Umständen. Der Grund, aus dem Angela Merkel sich schon 2005, ein Jahr vor dem regulären Termin, bei den Wählern um das Kanzleramt bewerben kann, ist vor allem die Arbeitslosigkeit. Merkels Entdecker und Lehrmeister hat viel für das Land getan. Aber eine solide Arbeitsmarktreform ist Helmut Kohl den Deutschen schuldig geblieben. Sein sozialdemokratischer Nachfolger Gerhard Schröder muss in seiner ersten Legislaturperiode eine Beteiligung Deutschlands am Krieg auf dem Balkan begründen. Das ist schon eine große Kröte, die seine Genossen zu schlucken haben, mehr aber noch sein grüner Koalitionspartner. Spätestens zu Beginn seiner zweiten Legislaturperiode kann Schröder aber am dringenden Reformbedarf in der deutschen Arbeitsmarktpolitik nicht mehr vorbeischauen. Die Zahl der Arbeitslosen liegt zum Jahrtausendbeginn bei 3,8 Millionen Menschen. 2002, in dem Jahr, in dem Schröder zum ersten Mal wiedergewählt werden will, hat sie die Vier-Millionen-Marke übersprungen.
Der drohende Horrorwert von fünf Millionen Menschen ohne Arbeit erinnert fatal an die frühen 1930er Jahre. Schröder tut das, was beim Pokern »All in« genannt wird. Er ist der richtige Typ dafür. Die SPD kennt er lange genug, um zu wissen, dass seine Agenda 2010, die den Menschen etwas abverlangt, bevor sie Sozialleistungen bekommen, auf großen Widerstand stoßen wird. So wie für die damaligen Grünen beim Krieg hört für die Sozialdemokraten der Spaß beim Sozialstaat auf.
Der Widerstand in der SPD gegen die Arbeitsmarktreformen des eigenen Kanzlers baut sich in einem solchen Maße auf, dass der Kanzler nicht bis zum regulären Wahldatum im Herbst 2006 warten will, um für eine dritte Amtszeit anzutreten. In einem Hals-über-Kopf-Manöver holt er die Deutschen ein Jahr früher in die Wahllokale. Das ist noch viel mehr »All in« als seine Arbeitsmarktreform selbst. Das Manöver scheitert nur um Haaresbreite. Wäre es gelungen, hätte Schröder die Früchte seines Mutes selbst ernten können. So aber kann das seine Nachfolgerin tun, der er noch am Wahlabend 2005 auf den Kopf zusagt, sie werde nicht Kanzlerin werden. Er irrt.
Angela Merkel hat eine sehr hohe Lernfähigkeit. In den ersten Jahren in Bonn hat sie vor allem von Kohl gelernt, wie die Bundespolitik funktioniert. Doch nach dem Ende Kohls hört sie nicht auf mit dem Lernen. Sie sieht sich genau an, in welcher Lage Schröder was gemacht und welche Folgen das hat. Die Erkenntnis ist eine zweifache. Erstens: Eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt darf es nicht zulassen, dass von ihren 80 Millionen Einwohnern fünf Millionen im arbeitsfähigen Alter keinen Job haben. Sonst entsteht Unruhe. Zweitens: Sich in einer zentralen Frage gegen die Interessen der eigenen Partei zu stellen, ist gefährlich und kann einen Kanzler die Macht kosten.
Später wird Merkel Schröder ausdrücklich danken. Er hat nicht nur das drängendste Problem Deutschlands zu Beginn des neuen Jahrtausends angepackt und einer Lösung zugeführt. Er hat ihr noch dazu den Weg ins Kanzleramt geebnet. Es ist Angela Merkels wertvollstes Erbe. Sie hütet es. Als sie ihr Büro in der siebten Etage des Kanzleramts bezieht, gibt es in Deutschland 4,86 Millionen Arbeitslose. Fortan fällt die Zahl von Jahr zu Jahr kontinuierlich. Nur zweimal, 2009 und 2013, steigt sie minimal gegenüber dem Vorjahr. Ansonsten hält die erfreuliche Talfahrt bis 2019 an. Nur noch 2,27 Millionen Deutsche sind ohne Arbeit. Die Pandemie führt zu einer leichten Erhöhung auf 2,7 Millionen Arbeitslose im Jahr 2020. Doch als Merkel ihren Schreibtisch ein Jahr später räumt, ist sie schon wieder gesunken auf 2,61 Millionen.
So wichtig wie der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ist derjenige gegen die Schulden. Die Passage zu den Staatsfinanzen in Angela Merkels erstem Koalitionsvertrag ist nicht nur konkret. Sie liest sich dramatisch. Die Lage der Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen habe sich seit Mitte der 1990er Jahre ständig verschlechtert. »Die öffentlichen Haushalte befinden sich derzeit in einer außerordentlich ernsten Lage.« Die laufenden Ausgaben lägen zum Teil dramatisch über den regelmäßig fließenden Einnahmen. »Der daraus erwachsende Konsolidierungsbedarf ist enorm und kurzfristig nicht zu bewältigen«, schreiben Schwarze und Rote auf und bauen damit schon mal für den Fall vor, dass es mit dem Konsolidieren nicht so schnell klappt wie gewollt.
Der Hintergrund der Bemühungen um solide Staatsfinanzen ist klar. Es geht der Kanzlerin darum, das »gesamtwirtschaftliche Wachstum zu steigern«, wie es in der Vereinbarung der Koalitionäre heißt. »The economy, stupid«, sagte James Carville, Wahlkampfstratege von Bill Clinton, im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 1992, also: Die Wirtschaft ist entscheidend. Clinton gewann die Wahl. Für Merkel ist das Thema nicht nur beherrschend, weil die deutsche Wirtschaft dringend wieder in Schwung kommen muss. Die CDU-Vorsitzende, die viele ihrer Unionsfreunde – vor allem aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern – noch 2002 nicht als Kanzlerkandidatin haben wollten, hat sich zwar als machtbewusst und zielstrebig erwiesen, hat sich als Umweltministerin profiliert. Doch dass sie wirtschaftlich kompetent ist, hat die in einem sozialistischen System aufgewachsene Frau noch nicht unter Beweis gestellt.
Angela Merkels ökonomischer Kompetenznachweis findet vor einem Hintergrund statt, der für viele politische Entscheidungsträger im Deutschland des beginnenden 21. Jahrhunderts fast religiöse Dimensionen hat. Vor allem ihre eigene Partei und die FDP, aber zu Beginn des Jahrtausends auch viele Sozialdemokraten sehen die schwarze Null, also einen schuldenfreien Staatshaushalt, der Überschüsse erwirtschaftet, als Goldenes Kalb an. Anders jedoch als Moses in der biblischen Erzählung zerstört Merkel dieses Kalb nicht, sondern tanzt von Anfang an und bis zum Ende ihrer Kanzlerschaft eifrig mit den anderen drumherum.
Der Ökonom und Politikwissenschaftler Lukas Haffert hat die Sehnsucht nach ausgeglichenen Haushalten gründlich untersucht. Um die Jahrtausendwende hätten einige westliche Demokratien mehrjährige Haushaltsüberschüsse erzielt. Im Durchschnitt der zurückliegenden Jahrzehnte hätten die westlichen Industrienationen »etwa ein Fünftel« der Zeit Haushalte mit Überschüssen gehabt. Regierungen, die ein Defizit in einen Überschuss verwandelt hätten, würden fast immer wiedergewählt, hat Haffert herausgefunden. Finanzminister, denen ein solcher Wandel gelungen sei, hätten damit häufig den Grundstein für den späteren Aufstieg an die Regierungsspitze gelegt.[5]
Doch sieht Haffert besondere deutsche Gründe für das Festhalten am ausgeglichenen Haushalt, den Angela Merkel geadelt hat mit dem Begriff der »schwäbischen Hausfrau«, die schließlich auch nicht dauerhaft über ihre Verhältnisse leben könne, so wie auch der Staat nicht. Wie so oft finden sich tiefere Ursachen für die Haltung der Deutschen in ihrer Geschichte im Ende und Untergang der Weimarer Republik. »Im historisch nicht sehr präzisen Erinnerungsvermögen vieler Deutscher vermengt sich die Erinnerung an die Hyperinflation mit der Massenarbeitslosigkeit der Weltwirtschaftskrise in den frühen 1930er Jahren zu einer einzigen, allumfassenden Weimarer Krisenerzählung«, schreibt Haffert. Dabei werde jedoch übersehen, dass die Weltwirtschaftskrise keine Inflations-, sondern eine Deflationskrise gewesen sei, angetrieben von der Politik des Reichskanzlers Heinrich Brüning. Gerade die Sparpolitik Brünings habe den Aufstieg der NSDAP unterstützt.[6]
Aber Erzählungen, die sich einmal festgesetzt haben, sind in der Regel nicht so leicht durch historische Aufklärung zu korrigieren. Das gilt besonders für das Weimar-Trauma der Deutschen, das die politische Instabilität der scheiternden jungen Demokratie mit ökonomischer Instabilität – also einem zu hoch verschuldeten Staat – zu verbinden pflegt. Angela Merkel, die aus einem nicht zuletzt ökonomisch gescheiterten Staat kommt und den Westdeutschen zeigen will, dass sie die Lehren aus der gesamten deutschen Geschichte gelernt hat, ist nicht geeignet, diese Erzählung infrage zu stellen.
Doch neben diesen begründeten oder eben nicht begründeten Lehren aus dem tiefen Dunkel der deutschen Geschichte kommt für sie etwas anderes hinzu. Lange vor der Einführung der Schuldenbremse, die der staatlichen Kreditaufnahme enge Grenzen setzt, aber auch Ausnahmen zulässt, kann der Staat über die gesetzlich festgeschriebenen Grenzen hinaus nur dann Schulden machen, wenn eine »Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts« festgestellt wird. Von Merkels Eintritt in die deutsche Spitzenpolitik 1990 bis zum Beginn ihrer Kanzlerschaft im Jahr 2005 werden acht Haushalte, also die Hälfte aller Etats, nur mithilfe dieser Ausnahme verfassungskonform. Merkel hat zwar in ihren beiden Ministerämtern ebenso wie als CDU-Vorsitzende und Oppositionsführerin fast nichts mit dieser Entwicklung zu tun. Sie kann aber aus der Nähe beobachten, wie schwierig es ist, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.[7]