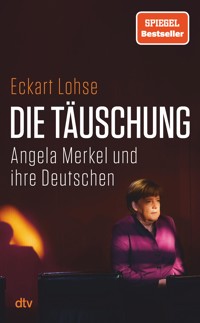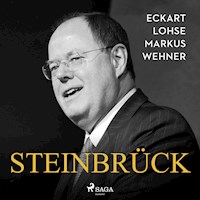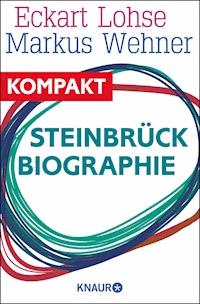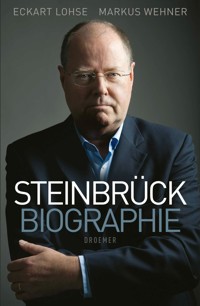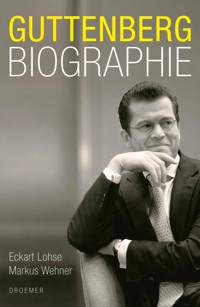
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das eBook zum Phänomen Guttenberg, das den Rücktritt verstehen lässt. "Eine Karriere scheinbar aus dem Nichts. Der erste deutsche Spitzenpolitiker der Twitter- und Facebook-Generation. Diese sehr gut geschriebene, lesenswerte Biographie macht einen klüger, was das Rätsel Guttenberg betrifft." Joschka Fischer Aufstieg und Fall Karl-Theodor zu Guttenbergs sind beispiellos in der bundesdeutschen Politik. Gerade einmal zwei Jahre lang war er zunächst Wirtschafts-, dann Verteidigungsminister, war der mit Abstand beliebteste Politiker, war Shootingstar, Kanzlerkandidat der Herzen, und unglaubwürdiger Plagiator seiner Doktorarbeit. Er hat die Deutschen für Politik begeistert wie kein Zweiter – und lässt ein Land zurück, tief gespalten, konsterniert, erleichtert. Doch eine Frage eint es: Wer ist das? Wer ist dieser Karl-Theodor zu Guttenberg? Einzigartig im Aufstieg. Einzig im Fall. Er schien alles zu haben, was ein Held braucht: Charisma, Stammbaum, Reichtum, eine schöne Frau und ein großes Amt. Seine Popularitätswerte übertrafen die der Kanzlerin bei weitem, viele sahen in ihm schon ihren Nachfolger. Aber war Karl-Theodor zu Guttenberg ein guter Politiker? Als Wirtschaftsminister ließ er markigen Worten, etwa in der Opel-Krise, keine Taten folgen. Kaum war er Verteidigungsminister, vollzog er in der Kundus-Affäre einen atemberaubenden Meinungswechsel. In der Affäre um seine Doktorarbeit wies er die Anschuldigungen zunächst als "abstrus" zurück, um wenige Tage später "schwere Fehler" einzugestehen und um Rücknahme des Titels zu bitten. Eckart Lohse und Markus Wehner erzählen das private und politische Leben dieses Instinktpolitikers. Viele bislang unbekannte Rechercheergebnisse ermöglichen, ein wesentlich genaueres Bild von Herkunft, Charakter und politischem Handeln Guttenbergs zu zeichnen. "Wenn man diese Biografie nicht aus der Hand legen will, dann liegt es daran, dass sie die eigentümliche Volksnähe dieses fränkischen Freiherrn besser zu verstehen hilft." Die Zeit "Alles in allem liest sich diese famos recherchierte, gut geschriebene Biographie wie die Vorlage für ein Filmdrehbuch". Süddeutsche Zeitung "Man sollte den Leuten raten, einfach dieses Buch zu lesen. Das Buch erklärt den Menschen Guttenberg." Stern.de "Man lernt viel über die Familie und den Menschen Guttenberg und versteht, wie er wurde, was er heute ist." Handelsblatt "Die Fähigkeiten des talentierten Herrn Guttenberg zu beschreiben, ohne dessen Verführungspotenzial zu erliegen: Das ist das Verdienst dieser Biografie." Frankfurter Rundschau
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Eckart Lohse / Markus Wehner
Guttenberg
Biographie
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Buch zum Phänomen Guttenberg, das den Rücktritt verstehen lässt.
»Eine Karriere scheinbar aus dem Nichts. Der erste deutsche Spitzenpolitiker der Twitter- und Facebook-Generation. Diese sehr gut geschriebene, lesenswerte Biographie macht einen klüger, was das Rätsel Guttenberg betrifft.« Joschka Fischer
Aufstieg und Fall Karl-Theodor zu Guttenbergs sind beispiellos in der bundesdeutschen Politik. Gerade einmal zwei Jahre lang war er zunächst Wirtschafts-, dann Verteidigungsminister, war der mit Abstand beliebteste Politiker, war Shootingstar, Kanzlerkandidat der Herzen, und unglaubwürdiger Plagiator seiner Doktorarbeit. Er hat die Deutschen für Politik begeistert wie kein Zweiter – und lässt ein Land zurück, tief gespalten, konsterniert, erleichtert. Doch eine Frage eint es: Wer ist das? Wer ist dieser Karl-Theodor zu Guttenberg? Einzigartig im Aufstieg. Einzig im Fall.
Er schien alles zu haben, was ein Held braucht: Charisma, Stammbaum, Reichtum, eine schöne Frau und ein großes Amt. Seine Popularitätswerte übertrafen die der Kanzlerin bei weitem, viele sahen in ihm schon ihren Nachfolger. Aber war Karl-Theodor zu Guttenberg ein guter Politiker? Als Wirtschaftsminister ließ er markigen Worten, etwa in der Opel-Krise, keine Taten folgen. Kaum war er Verteidigungsminister, vollzog er in der Kundus-Affäre einen atemberaubenden Meinungswechsel. In der Affäre um seine Doktorarbeit wies er die Anschuldigungen zunächst als »abstrus« zurück, um wenige Tage später »schwere Fehler« einzugestehen und um Rücknahme des Titels zu bitten.
Eckart Lohse und Markus Wehner erzählen das private und politische Leben dieses Instinktpolitikers. Viele bislang unbekannte Rechercheergebnisse ermöglichen, ein wesentlich genaueres Bild von Herkunft, Charakter und politischem Handeln Guttenbergs zu zeichnen.
Inhaltsübersicht
Widmung
EIN GESPALTENES LAND Vorwort zur dritten Auflage
Einleitung: Deutschland findet den Superstar
Vorbei an der Kanzlerin
Die CDU jubelt
Beliebtheit ist noch keine Macht
Rücktrittsdrohungen »to go«
Bundeskanzler Guttenberg?
1 Die Guttenbergs
Das Erbe: Adel, Politik, Widerstand
Stammhalter
Mythos Adel
Ein uraltes Geschlecht
Vorbild Großvater: Ein CSU-Politiker
Die Guttenbergs und der Widerstand
Mit dem Leben gezahlt: Karl Ludwig zu Guttenberg
Guttenbergs, Stauffenbergs und Tom Cruise
Väter und Mütter
Der Vater: Enoch zu Guttenberg
Die unsichtbare Mutter: Christiane Gräfin zu Eltz
Die annullierte Ehe
Der Stiefvater: Patensohn des Führers
Die Stiefmutter: Tochter eines italienischen Kommunisten
Eine katholische Familie
Der junge Guttenberg
Eine Kindheit im Schloss und vor allem anderswo
Ein Vagabundenleben
Bei den Gebirgsjägern
Studienjahre: Bayreuth, München und ein bisschen New York
Der Bruder
Das Vermögen
Liebe und Hochzeit
2 Aufstieg
In der CSU
Ortsverband Guttenberg
Exkurs: Die Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
Auf dem Weg nach Berlin
In Deutschland und der Welt: Außenpolitiker
CSU-Chef in Oberfranken
Hundert Tage Generalsekretär
Plötzlich Wirtschaftsminister
Seehofer in Not
Opel-Nächte im Kanzleramt
Der gefeierte Verlierer
3 Ein Bild von einem Mann: Guttenberg und die Öffentlichkeit
Adel auf dem Radl
Guttenbergs Bildergeschichte
Für die Kamera geboren
Alles nur eine große Show?
Lieblingsbühne Afghanistan
Bildteil
4 Ein Bild von einer Frau: Stephanie zu Guttenberg
»Schaut nicht weg!«
Der Minister im Abendkleid
Eine schwedisch-deutsche Familie
Die Bismarcks
Unschuld in Gefahr
»Tatort Internet«
Zu Hause in der Glitzerwelt
5 Kriegsminister
Kriegsähnliche Zustände
Trauerfeiern im neuen Stil
Deutschland im Krieg
Achtmal am Hindukusch
Ein Mann räumt auf
Ernstfall am Kundus-Fluss
Guttenberg reißt die Kundus-Affäre an sich
Die geheimen Chefs: Schneiderhan und Wichert
»Der Luftschlag musste sein«
Ein folgenreiches Gespräch
Der neue Herr im Haus
Rausschmiss im Ruck-zuck-Verfahren
Ein bisschen Lüge
Die Kehrtwende
Es fehlt das starke Argument
Das Ende der Wehrpflicht
Paukenschlag in Hamburg
Exkurs: Die Union und die Wehrpflicht
»Eine Nase, aber keinen Plan«
Das Tabu fällt
Aussetzen, nicht abschaffen
Ein Werbefeldzug
»Die beste Rede seit Franz Josef Strauß«
Auf der Zielgeraden
6 Absturz
Die Affäre um die »Gorch Fock«
Der Plagiator
Schluss: Warum Guttenberg?
Karl-Theodor zu Guttenberg war [...]
Klarheit und Wahrheit
Der Anti-Politiker
Dank
Bildnachweis
Für Andrea und Christiane, für Fanny, Juliane, Jasper, Theodor und Martha
EIN GESPALTENES LAND Vorwort zur dritten Auflage
CSU-Parteitag in München. Samstag, der 30. Oktober 2010. Karl-Theodor zu Guttenberg geht durch die Reihen, ein kurzer Halt an der Pressebank, wo die Journalisten arbeiten. Eine Zufallsbegegnung. Was das Buch mache, erkundigt sich der Bundesminister der Verteidigung, höflich und freundlich wie stets, und hört sich an, dass es gut vorangehe. Dann schiebt er, lapidar wie eine Bemerkung über das Wetter, den Satz hinterher, vielleicht werde das Buch ja ohnehin gegenstandslos werden. Wie er das meine? Nun, man müsse solch einen Job ja nicht ewig machen, bedeutet Guttenberg. Wenigstens bis zum März des nächsten Jahres? fragt der Angesprochene. Da solle nämlich das Buch erscheinen.
Der Mann also, der zu jenem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seines Ansehens in Deutschland ist, vermutlich aus dem Stand eine Mehrheit bekommen könnte, wenn er Anspruch auf den CSU-Vorsitz erhöbe, dem im Herbst 2010 die baldige Eroberung der bayerischen Staatskanzlei ebenso zugetraut wird wie diejenige des Kanzleramtes, spielt gegenüber Journalisten mit dem Gedanken an das Ende seiner politischen Laufbahn. Abstrus! Immerhin stellt er anschließend in Aussicht, dass er bis März jedenfalls durchhalten werde. Schließlich stehe er wegen der angefangenen Reform der Bundeswehr in der Verantwortung. Wir halten das Ganze für eine weitere seiner zahlreichen koketten Anspielungen, dass er auch ohne die Politik leben könne.
Vier Monate später, der März des Jahres 2011 ist nicht einmal zwölf Stunden alt, lässt Guttenberg eine Pressemitteilung verschicken. Der Minister werde eine Stellungnahme abgeben. So aufgeheizt ist mittlerweile die Diskussion über Guttenberg, über seine schweren Verfehlungen bei der Abfassung seiner Dissertation, über die alles verniedlichende Reaktion der Bundeskanzlerin ihrem Minister gegenüber, dass das nur noch eines bedeuten kann: Karl-Theodor zu Guttenberg tritt diesmal wirklich zurück. So kommt es. Deutschlands politischer Superstar legt am 1. März 2011 alle politischen Ämter nieder. Am Vorabend ist im Berliner Hotel »Adlon« die erste Auflage seiner Biographie, dieses Buches also, präsentiert worden.
Biographien über aktive Politiker zu schreiben, ist immer eine riskante Sache. Wichtige Dinge können kurz nach dem Redaktionsschluss passieren, während das Buch gedruckt wird und die Autoren hilflos auf sein Erscheinen warten. Ein Rücktritt ist naturgemäß das einschneidendste Ereignis. Aber auf den Spuren des Hochgeschwindigkeitspolitikers Karl-Theodor zu Guttenberg musste das ja so kommen. Ein normales Ende eines solchen Abenteuers wäre für ihn nicht angemessen gewesen. Als die Staubwolken, die das Rennen nebst seinem spektakulären Ausgang aufgewirbelt haben, sich legen, schauen die Biographen auf ihr Werk. Ist noch alles in Ordnung, stimmt alles? Oder ist der Rahmen verzogen? Muss nach der Enthüllung, dass seine Doktorarbeit ein großes Plagiat ist, das ihn am Ende das Amt gekostet hat, der Blick auf Guttenberg ein anderer sein? Zwei Tage nach dem Rücktritt erscheint in der »Zeit« eine Rezension unseres Buches. Aus ihr sei an dieser Stelle zitiert: »Die Biografie von Wehner und Lohse muss von morgen an nicht umgeschrieben, nur fortgesetzt werden, und den Autoren nimmt man es ab, wenn sie nun sagen: Die Entzauberung des Märchenprinzen überrasche sie nicht. Die Spuren eines Mannes, der seinen Lebenslauf schönt, durchziehen dieses Buch, ein bisschen Hochstapelei, etwas Lüge, manche Legende, fingerdick Blattgold und Pomade.«
Tatsächlich sind wir bei der langen und intensiven Beobachtung Karl-Theodor zu Guttenbergs bald auf jene Spuren gestoßen, die zeigen, dass er gerne möglichst viel äußeren Glanz in seinen Lebenslauf bringt und es dabei mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nimmt. Er hübscht ein Praktikum zu einer freien Mitarbeit auf, führt für die Zeit vor seinem Abgeordnetendasein ein Engagement im Familienunternehmen auf, das sich nicht recht präzisieren lässt, zeigt große Neigung zu spektakulären Fotoposen und zu politischen Schüssen gegen die eigene Mannschaft, die die eigene Person in ein besonders helles Licht rücken sollen. Das eigene Fehlverhalten in der Bewältigung der Kundus-Affäre gibt Guttenberg dagegen erst unter dem Druck eines Untersuchungsausschusses mit monatelanger Verzögerung zu, während er einstige Schutzbefohlene innerhalb von Stunden fallen lässt und anschließend im grellen Scheinwerferlicht der Talkshows mit Schuldzuweisungen überzieht. Das alles lässt das Bild einer Persönlichkeit entstehen, die neben ihren politischen Fähigkeiten genügend Schillerndes vorhält.
Aber eine angeblich über Jahre entstandene juristische Doktorarbeit, die eine gigantische Ansammlung von Plagiaten ist? Ein Mann, der behauptet, dieses alles selbst gemacht zu haben und zwar ohne jede böse Absicht und das zu einem Zeitpunkt, da er hauptberuflich als Bundestagsabgeordneter an der Entstehung jener Gesetze mitwirkte, mit denen das Land regiert wird? Ein Mann, der nach der Aufdeckung dieses Riesenschwindels erst alle Vorwürfe als »abstrus« zurückweist, um wenig später seinen Doktortitel unter dem Beifall seiner Fans von sich zu schleudern mit dem Kommentar, er habe »Blödsinn« geschrieben? Das ist neu. Das steht nun neben seinen Talenten, die in diesem Buch natürlich auch ausführlich beschrieben werden.
Wie oft hatten wir gerungen mit dem Objekt unserer Beobachtung, hatten diskutiert, uns gefragt, ob er ein großer Politiker oder doch mehr ein begabter Schauspieler sei. Jetzt also noch einmal. Dabei sind wir nicht allein, sondern in der Gesellschaft des restlichen Deutschlands. Spätestens seitdem Mitte Februar die Plagiatsaffäre begonnen hat, ist Deutschland zweigeteilt: Guttenberg-Fans gegen Guttenberg-Kritiker. Es scheint kein Grau, kein Einerseits-Andererseits, sondern nur noch Schwarz und Weiß zu geben. Seit wir kurz nach dem Beginn der Plagiatsaffäre Auszüge aus dem Buch in der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« veröffentlichten, die Guttenbergs Neigung zum Polieren seines Lebenslaufs beschreiben und seine Bereitschaft, es bei der Aufarbeitung der Kundus-Affäre mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen, hat uns eine Welle der Empörung überrollt. Leser mailen, schreiben Briefe, rufen an. Die überwältigende Mehrheit schimpft aus Leibeskräften, nicht etwa, weil irgendeine unserer Darstellungen der Wahrheit nicht entspreche, sondern weil wir Guttenberg kritisierten. Auch wenn es dem üblichen Ablauf solcher Reaktionen entspricht, dass sich schnell (und oft genug ausschließlich) Kritiker melden, so ist die Wucht von deren Auftreten diesmal ungewöhnlich. Erst nach und nach wenden sich jene Leser an uns, die einen weniger positiven Blick auf den Politiker Guttenberg haben.
Spätestens mit dem jähen Einsetzen seines politischen Todeskampfes – Wiederauferstehung nicht ausgeschlossen – hat Karl-Theodor zu Guttenberg Deutschland gespalten. Seine Anhänger finden sich vor allem im großen Kreis derjenigen, die mit einem gerüttelt Maß an Verachtung auf die etablierte Politik schauen; auf Parteien, die sich ihrer Meinung nach das Land zur Beute gemacht haben, die nicht nur die Herrschaft über die Gesetzgebung entlang der Parteigrenzen untereinander aufteilen, sondern über den Parteienproporz tief in das gesellschaftliche Alltagsleben vordringen, die Verwaltungsapparate von den Bundesministerien bis hinab zu den Rathäusern mit ihren Leuten so besetzen, dass sie ihre Macht möglichst dauerhaft etablieren, die die Herrschaft über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausüben, indem sie sich die Führungspositionen dort aufteilen. Es ist die Wahrnehmung einer politischen Klasse als graue, aber mächtige Schicht, die ihr Wirken oft zum Lebenszweck, mindestens zum Beruf gemacht hat.
Dass Karl-Theodor zu Guttenberg gerade in Bayern so beliebt ist, mag nicht nur daran liegen, dass er dort geboren wurde und viele Jahre seines Lebens dort verbracht hat, wenngleich er keineswegs als »Bayer« wahrgenommen wird wie etwa Franz Josef. Es dürfte seinen Grund auch darin haben, dass in keinem Bundesland eine Partei so selbstverständlich seit Jahrzehnten die Alleinherrschaft nicht nur über die politischen Institutionen, sondern über das ganze Land hat wie die CSU in Bayern. Die Wahrnehmung, dass »die da oben« sich das Land Untertan gemacht haben, kann vor einem solchen Hintergrund besonders gut entstehen.
Gegen diese – so wahrgenommene – Form von Politik rennen viele Anhänger Guttenbergs im Februar 2011 mit umso größerer Wucht und Verzweiflung an, je mehr sie sehen, dass ihr Held in Bedrängnis gerät. Dass er die rasant wachsenden Schwierigkeiten für sich und sein Amt auch noch selbst zu verantworten hat, die Schuld am Zustandekommen seines Dissertationsplagiats keinem Staatssekretär, Generalinspekteur oder Schiffskapitän in die Schuhe schieben kann, das verstärkt den Ärger vieler Menschen. Manche rasen geradezu vor Wut, bellen in Telefone, drohen das Ende ihres Zeitungsabonnements an. Guttenbergs Vergehen wird kleingeredet. Er habe das nicht bewusst gemacht. Oder: »Haben Sie früher in der Schule etwa nie abgeschrieben?« Ganz so, als ob das mit jahrelangem Diebstahl geistigen Eigentums zu vergleichen wäre, der die Erlangung eines Doktortitels mit höchster Auszeichnung zum Ziel hat.
Selbst diejenigen seiner Fans, die sein Fehlverhalten als Doktorand erkennen, wollen kein Problem für den Politiker Guttenberg sehen. Ein Minister brauche keinen Doktortitel und im Übrigen liege die Angelegenheit ja schon eine Weile zurück. Dass es nur fünf Jahre sind und Guttenberg kein junger Heißsporn, sondern Abgeordneter des höchsten deutschen Parlaments war, wird dabei unterschlagen. »Die Menschen verzeihen Herrn Guttenberg diesen Fehler, die Medien müssen es auch tun«, ist eine der Forderungen aus dem Kreis der Guttenberg-Anhänger. Es entsteht der Eindruck, dass viele nicht nur zum Schönreden und Verzeihen bereit sind, sondern ihr Held durch seine Fehlerhaftigkeit in ihren Augen sogar noch wächst. Nur wer schon Fehltritte hinter sich hat, kann zu wahrer Größe aufsteigen.
Wer die Bösen sind, haben die Guttenberg-Fans schnell ausgemacht: die linke Opposition und die Medien, die diese »linke Kampagne« mitmachen. Dass Medien Zustände und Missstände aufdecken und beschreiben, scheint im Verständnis vieler Menschen nicht vorzukommen. Wer nicht für Guttenberg ist, ist gegen ihn. Das Wort von der »Menschenjagd« ist schnell bei der Hand. Guttenberg wird vom Schuldigen zum Opfer umdeklariert. Das macht er selber gerne. Wenn alle nur noch auf die Fußnoten in seiner Doktorarbeit schauten statt auf die gefallenen Soldaten in Afghanistan, dann sei ihm als Verteidigungsminister das angemessene Ausüben seines Amtes nicht mehr möglich, argumentiert er in seiner Rücktrittserklärung. Wer diese Argumentation durchgehen lässt, macht den Verteidigungsminister (aber ebenso die auch für die Auslandseinsätze zuständige Bundeskanzlerin, den Außenminister, ja das ganze Kabinett, letztlich den ganzen Bundestag!) auf ewig unantastbar. Denn immer sterben irgendwo deutsche Soldaten. Soldatenblut würde so zum Drachenblut für die Politiker.
Bei manchen der glühenden Anhänger Karl-Theodor zu Guttenbergs treten annähernd religiöse Züge auf. Ein Mann, der so spreche wie er, könne nicht absichtlich seine Doktorarbeit fälschen. Gegenargumente werden abgetan mit dem Hinweis: »Sie werden mich nicht bekehren!« Am Ende des Gesprächs wird auf die Bedeutung des Christentums hingewiesen. Plötzlich entsteht der Verdacht, nicht für alle ist der Gedanke, Guttenberg könne über Wasser laufen, bloß ein Scherz. Seine Verehrung als Führungsfigur, als Heilsbringer nimmt zum Teil kultische Züge an. Deswegen tun manche Mitglieder der CDU- und vor allem der CSU-Führung auch so, als könnten sie den Verlust Guttenbergs gar nicht fassen und dächten von früh bis spät an dessen Rückkehr. Keiner will vor Guttenbergs Jüngern als derjenige dastehen, der ihn verraten hat.
Die härteste Drohung der Anhänger ist zugleich diejenige, die vermutlich am häufigsten wahrgemacht wird. Wenn ein solches Talent »kaputtgemacht« werde, dann würden sie künftig der Politik den Rücken kehren. Sollte diese Reaktion massenhaft eintreten, was angesichts einer verbreiteten Demokratie- und Wahlmüdigkeit nicht unwahrscheinlich ist, wäre Guttenbergs Rücktritt auch ein Schaden für das demokratische Gemeinwesen. Hätte das alles vermieden werden können? Hätte das Bedürfnis vieler Menschen nach einer Führungsfigur, die anders ist als die grauen Machtorganisatoren in ihren Berliner Büros, gestillt werden können? Schwerlich. Die Dreistigkeit, mit der Guttenberg nicht nur seine Doktorarbeit erstellt, sondern auch auf die Entdeckung des Plagiats reagiert hat, wirft ein bezeichnendes Licht auf ihn. Er mutet Menschen und Institutionen, mit denen er zu tun hat, so viel Rücksichtnahme auf sein Ego zu, dass er mit Systemen wie Universitäten, Parteien, Regierungen nicht kompatibel ist. Wäre er anpassungsfähiger, hätte er zwar durch eine starke Führungskraft wie Angela Merkel im Zaum gehalten werden können. Doch wäre er dann nicht so populär geworden. Seine Beliebtheit gründet ja wesentlich auf seiner Inkompatibilität, auf seinem Anderssein, seiner Kühnheit auf Kosten des politischen Establishments. Über kurz oder lang musste diese Fehlkonstruktion zerbrechen. Die abgeschriebene Doktorarbeit ist der Auslöser, nicht der Grund für das Scheitern Guttenbergs als Teil der etablierten Parteiendemokratie.
Trefflich aufzeigen lässt sich das am Beispiel seines Vorgehens bei der Bundeswehrreform. Um den seit Jahren gepflegten Selbstbetrug der politischen Szene, die Wehrpflicht funktioniere noch, zu beenden, bedurfte es eines Politikers mit überdurchschnittlicher Beherztheit und Risikofreude. Guttenberg hat gewagt und gewonnen. Doch hat er dabei die Belastbarkeit und Toleranz seiner Regierung und seiner Partei, der CSU, auf das Äußerste strapaziert. Noch dazu hielt er kein schlüssiges Konzept bereit, wie nach dem Ende der Wehrpflicht und mit einer stark verkleinerten Armee deren Funktionsfähigkeit zu gewährleisten wäre. Mit seinem Schwert zerschlug der kühne Ritter Karl-Theodor nicht nur den Gordischen Knoten einer dahin siechenden Wehrpflicht, sondern die Säulen geordneten Regierungshandelns gleich mit.
Und die Kritiker des Freiherrn aus Oberfranken? Sie brauchen etwas länger, um ihre Stimme zu erheben, in der Union wie in der Öffentlichkeit. Bei soviel Glück und Jubel in CDU und CSU, die glaubten, einen Supermann als Wahlkämpfer zu haben, bei so viel öffentlicher Beliebtheit Guttenbergs und seiner Frau droht ja der Kritiker auch allzu leicht zum Spielverderber oder Nörgler zu werden. Letztlich hat Angela Merkel höchstpersönlich den letzten Ausschlag für Guttenbergs Rücktritt von allen politischen Ämtern gegeben. Nichts hat die Wählerschaft der Union derart provoziert wie Merkels Formulierung, sie habe Guttenberg nicht als wissenschaftlichen Assistenten, sondern als Minister ausgesucht. Nach außen hat sie sich damit augenzwinkernd auf die Seite der Guttenberg-Fans geschlagen. Nach innen hat sie aber eine Welle der Wut ausgelöst unter all jenen, die ihre wissenschaftlichen oder auch andere Meriten unter Anstrengung und mit dem von Guttenberg gern zitierten Anstand erworben haben. Diese Empörung ließ am Ende solch einen Druck in den eigenen Reihen entstehen, dass Guttenberg nicht mehr zu halten war.
Und nun? Was aus jenem Mann wird, der vielen schon ganz selbstverständlich als nächster, spätestens übernächster Bundeskanzler erschien, ist gänzlich ungewiss. Karl-Theodor zu Guttenberg steht vor der vermutlich wichtigsten Prüfung seines beruflichen Lebens. Er wird jetzt etwas herausfinden (müssen): Hat seine beispiellose Popularität aus sich selbst heraus Bestand, hat er nicht nur als Minister solch ungeheuren Beifall bekommen, sondern als Karl-Theodor zu Guttenberg? Oder war er nur im richtigen Moment an der richtigen Wegekreuzung der Zeitläufte, als nach grauen Jahren der großen Koalition ein glänzendes, aristokratisches Politikerpaar mit ungewöhnlichem Selbstbewusstsein und Instinkt für den richtigen Augenblick gesucht wurde? Das bleibt eine spannende Frage. Der folgende Versuch zu erklären, wer dieser Karl-Theodor zu Guttenberg ist, wo er herkommt, was er bisher gemacht hat, mag auch helfen, Licht auf seine Zukunft zu werfen.
Eckart Lohse und Markus Wehner
Berlin, im März 2011
Einleitung: Deutschland findet den Superstar
Am 2. Oktober 2010 dröhnen in der Berliner Parteizentrale der CDU die Glocken.
Alarm?
Es sind die Glocken der Hölle.
Halleluja!
Während im Rest Deutschlands an dessen Wiedervereinigung erinnert wird, die sich am Tag darauf zum 20. Mal jährt, während viele Helmut Kohl lauschen oder Angela Merkel zuhören, schlägt im Konrad-Adenauer-Haus die Zukunft an die Tore. Aus den Lautsprechern schrillt »Hell’s Bells« der australischen Hardrock-Band AC/DC. Seit dem Frühjahr 2009 weiß jeder politisch Interessierte, was es bedeutet, wenn auf einer Veranstaltung von CSU oder CDU diese Musik gespielt wird.
Karl-Theodor zu Guttenberg tritt auf.
Unter dem hämmernden Rhythmus teilt sich die Schar der vielleicht 200 von der Jungen Union geladenen Gäste wie einst das Rote Meer beim Auszug Mose aus Ägypten, und hindurch schreitet der Bundesminister der Verteidigung. Philipp Mißfelder, der Vorsitzende der Jungen Union, ist an seiner Seite und freut sich über den Coup. Nicht Helmut Kohl, nicht Angela Merkel, sondern Deutschlands Top-Promi hat er an Land gezogen. Zusätzlich zu den Deutschlandfahnen, die die jungen Gäste schwenken, sind einige blaue Pappschilder mit den Lettern KT zu sehen, den Initialen des Vornamens von Guttenberg.
Mißfelder begrüßt den Gast. Begrüßt ihn jedoch nicht als Verteidigungsminister, sondern als Ausdruck der Hoffnung, dass konservative Werte in der Union künftig wieder stärker vertreten würden. Und das mitten im Haus der gerade von den Konservativen in der Union so gescholtenen CDU-Vorsitzenden Merkel. Guttenberg weiß, dass sein Auftritt Fragen aufwirft. Warum steht er hier, ein Mann, der am Tag des Mauerfalls 17 Jahre alt war und kaum gewichtige Erinnerungen präsentieren kann? Warum er als CSU-Mann in der CDU-Zentrale, noch dazu in Abwesenheit der Vorsitzenden? Will er die Aufmerksamkeit, die der 20. Jahrestag der Einheit mit sich bringt, nutzen, um sich in den Vordergrund zu spielen? Will er seine Beliebtheit, die in der CDU ohnehin längst ähnliche Ausmaße hat wie in seiner eigenen Partei, weiter steigern?
Guttenberg kennt diese Fragen. Wie es seine Art ist, greift er sie gleich zu Beginn auf. Er sei gewarnt worden, hier zu sprechen. Der Ort, der Tag, das Thema seien falsch. Aber: »Alle Verschwörungstheoretiker sind bisher im Praxistest durchgefallen.« Und an die Journalisten im Saal: Da jetzt wieder alle mitschrieben, wie oft er Kanzlerin Merkel und den CSU-Vorsitzenden Seehofer erwähne, werde er das gleich zu Beginn tun. Es folgt eine höfliche Nennung der beiden Parteivorsitzenden. »Das war die Erwähnung.« Nun würden die Namen im Rest der Rede »nicht mehr inflationär« vorkommen. Das ist weit untertrieben. Sie kommen so gut wie gar nicht mehr vor in der folgenden knappen Stunde. Am Ende wird Guttenberg den Namen der Brauerei Löwenbräu, die die anschließende Einheits-Party sponsert, häufiger genannt haben als die seiner Chefin in der Regierung und seines Chefs in der Partei.
Seit Guttenberg angekündigt hat, er werde die Wehrpflicht aussetzen, hält er überwiegend Reden zu diesem Gegenstand. Oder er beginnt mit einem anderen Thema, schwenkt dann aber schnell auf die Bundeswehrreform um. An diesem Samstag hat er sich vorgenommen zu zeigen, dass sein Spektrum breiter ist. Passend zum Jahrestag geht es mit der deutschen Einheit los. Die Begriffe »Ossi« und »Wessi« seien überholt und würden nur noch mit einem humorvollen Augenzwinkern benutzt. Wenn einer heute noch von »Anschluss« statt von »Wiedervereinigung« spreche, so fehle ihm, Guttenberg, jedes Verständnis dafür. Als Beleg für die Erfolge des Ostens erwähnt er den hohen Bildungsstandard in Sachsen. Dieses lasse etwa Rheinland-Pfalz links liegen.
Das Beispiel nutzt er als Sprungbrett, um von der bedeutungsschweren Betrachtung der deutschen Geschichte mit einem Hopser zur Polemik zu wechseln. Angesichts der Regierung in Mainz seien die Ergebnisse der Bildungspolitik ja auch kein Wunder. Mit Blick auf den sozialdemokratischen Regierungschef Beck sagt Guttenberg, es gebe neben Fidel Castro keinen Bartträger, der ihn so ermüde wie Kurt Beck. Diese – zumindest partielle – Gleichsetzung eines Diktators und eines deutschen Ministerpräsidenten hebt er postwendend wieder auf, indem er erklärt, er habe keinen Vergleich zwischen Beck und Castro angestellt. Guttenberg tut so, als könne er definieren, was ein Vergleich sei und was nicht. So wie er zu Beginn der Rede behauptet hat, sein Auftritt habe mit einer Verschwörung gegen Merkel oder Seehofer nichts zu tun.
Vielleicht hat er damit sogar recht. Denn was sich am Nachmittag jenes 2. Oktober 2010 in der Berliner CDU-Zentrale abspielt, ist keine heimliche Verschwörung. Es ist ein offener Angriff: »Was wir uns heute im politischen Geschäft wünschen, ist etwas mehr Leidenschaft.« Guttenberg fordert »Bekenntnisse« zur politischen »Gestaltung auf der Grundlage eines christlichen Selbstverständnisses«.
Er schwitzt. Er kämpft.
Das ist keine seiner routinierten Reden zur Bundeswehrreform mit ein paar Späßchen fürs Publikum. Dann fährt er die ganz große Kanone auf. Zum 20. Jahrestag der Einheit macht er Adenauer und Kohl zu seinen Kronzeugen, ohne die nach dem Mauerfall so machtvoll gewordene Angela Merkel auch nur zu erwähnen. »Konrad Adenauer und Helmut Kohl stehen dafür, dass man sich zu etwas bekennt.« Von ihnen könne man die Leidenschaft lernen, die Politik brauche. War der Beifall bislang schon stark, so gibt es jetzt Versuche, ihn rhythmisch werden zu lassen.
Als wolle er zeigen, welche Palette von politischen Themen er bereithält, folgt ein Ausflug zum Thema Rente. Er warnt vor einer Politik, die nur auf Wahlerfolge blicke: Die »Leute draußen haben die Schnauze voll davon«, wenn man sich nur in Versprechensspiralen von Wahltag zu Wahltag drehe, donnert er. Kaum ein Satz, ohne dass er ausladend mit den Armen gestikuliert, auf den Füßen wippt, den Oberkörper vor und zurück pendelt oder ruckartig den Kopf zur Seite dreht.
Guttenberg lebt, Guttenberg bebt. »Wer in die Politik geht, der will gestalten. Wer gestalten will, der braucht die Fähigkeit zur Führung. Führung heißt, unbequeme Wahrheiten vorgeben, auch mal eine Richtung vorgeben.«
Erst wenige Tage zuvor hatte der Merkel-Vertraute und Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder von der CDU, mit leichter Bewunderung in der Stimme gesagt, Guttenbergs Umgang mit der Bundeswehrreform sei ein »klassischer Fall von Führung in der Demokratie«. Ist es aber nicht genau das, was in der Union auf immer mehr Unzufriedenheit stößt: dass es Angela Merkel an Leidenschaft, am Willen zur Gestaltung und schließlich zur Führung fehlt? Dass sie mit ihrer Handvoll Vertrauter nur noch darauf achtet, ihre Politik auf den nächsten Wahltag auszurichten?
Guttenberg muss den Namen Merkel gar nicht erwähnen, es geht unausgesprochen ständig um die Kanzlerin. Er fordert nun schon fast aggressiv eine Politik, die sich nicht nur danach ausrichtet, wohin gerade die vermeintliche Mehrheitsmeinung wabere, sondern die selbst Maßstäbe setze. Es gebe »nichts Grauenvolleres« als die Worte, man müsse die Menschen »mitnehmen«. Es spielt Guttenberg in die Hände, dass just an jenem Samstag der niederländische Rechtspopulist und Islamkritiker Geert Wilders in Berlin eine Rede hält. Guttenberg warnt davor, dass »irgendwann die Stunde der Rechtspopulisten« schlage. Die Botschaft, die mitschwingt, könnte eindeutiger nicht sein: Wenn die Volksparteien in Deutschland nicht bald wieder zu einer klaren, an Werten und Bedürfnissen der Menschen statt an Meinungsumfragen über das Wahlverhalten ausgerichteten Politik kommen, dann hat auch hier ein Populist eine Chance. Seine knapp einstündige Rede in der CDU-Parteizentrale darf als Bewerbung verstanden werden, für eine solche Politik die Führung zu übernehmen.
Nein, eine Verschwörung ist das wirklich nicht. Alles geschieht auf offener Bühne.
Als kleinen Test darauf, wie sehr er als Feldherr taugt, kommt Guttenberg zum Schluss noch auf Afghanistan zu sprechen. Er könne beurteilen, was es heißt, dort die Augen zu verschließen. Wer kann damit gemeint sein, außer der Regierung Merkel, die den Einsatz seit fünf Jahren verantwortet und sich lange so schwer tat mit klaren Worten? »Es war bitter geboten, endlich dort von Krieg zu sprechen!«, donnert Guttenberg den jungen Leuten entgegen, und der Applaus donnert zurück. Die von ihm selbst vor einem knappen Jahr geprägte rhetorische Zwischenlösung »kriegsähnliche Zustände« ist schon Geschichte. Das Wort Krieg geht ihm inzwischen selbstverständlich über die Lippen. Und auch sein Fotoshooting an der vordersten Front in Afghanistan, wo er sich einige Wochen zuvor im Kampfdress mit Sonnenbrille filmreif ablichten ließ, verkauft er dem Publikum geradezu als Pflichtübung: »Es gehört sich für einen Minister«, sagt dieser, an die Front zu gehen, um Sachen zu erleben, »die man an seinem Schreibtisch nicht erlebt«. Riesenjubel. Der Parteijugend gefällt der Minister in der Pose des Feldherrn.
Vorbei an der Kanzlerin
Als er diese Rede hält, ist Guttenberg gerade 20 Monate Bundesminister. In dieser Zeit hat er das Ressort bereits einmal gewechselt, wurde vom Wirtschafts- zum Verteidigungsminister, hat als solcher die beiden höchsten Mitarbeiter seines Hauses mit einem Riesenknall vor die Tür gesetzt, dabei als Kollateralschaden den Bundesarbeitsminister in den politischen Abgrund gestoßen, anschließend einen Untersuchungsausschuss des Bundestages ausgelöst, den er allerdings schon bald als eine harmlose Episode seines jungen Lebens abhaken kann. Suchen andere Neulinge im Ministeramt zunächst nach Orientierung und Themen für einen ersten kleinen inhaltlichen Vorstoß, so lässt Guttenberg die Kanzlerin wissen, er gedenke, die Wehrpflicht abzuschaffen. Ein halbes Jahr später ist auch dieser Tagesordnungspunkt politisch durchgesetzt. Dass es ihm in dieser Zeit gelungen ist, nicht nur den Außenminister in allen Beliebtheitsumfragen hinter sich zu lassen, sondern sogar die Bundeskanzlerin, ist im Oktober 2010 nach Guttenberg’schen Maßstäben schon derart lange her, dass die wiederkehrende Bestätigung durch die Umfrageinstitute fast langweilt.
Wann und wie hat dieses politische Hochgeschwindigkeitsrennen angefangen?
Im Februar 2009 ist Guttenberg gerade seit drei Monaten Generalsekretär seiner Partei. Als solcher ist er in Deutschland so bekannt, wie es Generalsekretäre der CSU nach 100 Tagen nun mal sind. In Bayern und natürlich in der CSU kennt man ihn. In Berlin nimmt ihn ein kleiner Kreis außenpolitisch Interessierter wahr, denn Guttenberg ist seit 2002 als Bundestagsabgeordneter in der internationalen Politik unterwegs.
Für die breite Öffentlichkeit in Deutschland ist der Enddreißiger ein unbeschriebenes Blatt. Dass er einem jahrhundertealten Adelsgeschlecht entstammt, das verwandtschaftliche Verbindungen zur Familie Stauffenberg hat, selbst im Widerstand gegen Hitler aktiv war, schon in den sechziger Jahren einen Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeskanzleramt in seinen Reihen hatte und zudem ein Schloss in der Nähe der oberfränkischen Stadt Kulmbach besitzt – all das ist weitgehend unbekannt. Die Vorstellung, dass dieser Mann schon bald ein Millionenpublikum vor die Fernseher ziehen würde, wenn er in Talkshows auftritt, dass seine Frau wenig später ähnlich populär wie der Gatte sein wird, potenzielle Kinderschänder mit Hilfe von RTL II vor laufender Kamera jagt, bei Günther Jauch mit einem Glas Bier in der Hand der Frage »Wer wird Millionär …?« nachgeht, obwohl die in ihrem Falle angesichts des Familienvermögens längst beantwortet ist, all das ahnt im Februar 2009 kein Mensch.
Denn Guttenbergs Name wird zwar genannt, wenn über den Nachwuchs der Union gesprochen wird. Doch sind die Dinge in der CSU in jenen Monaten derart in Bewegung, dass ein Aufstieg zum Generalsekretär nicht als zwingender Schritt nach ganz oben gewertet werden kann. Guttenberg ist schließlich Parteimanager von Gnaden des Vorsitzenden Horst Seehofer, und ob der eine große Zeit an der Spitze der CSU vor sich hat, ist zu Beginn des Jahres 2009 völlig ungewiss. Viele wetten auf das Gegenteil. Bis zum Februar 2009 hätte es auch sein können, dass Guttenberg eine Episode in der CSU-Geschichte bleibt, dass er in der so bewegten Nach-Stoiber-Phase nach oben gespült und von einem der innerparteilichen Strudel wieder nach unten gerissen wird. Verschwunden für lange oder gar ewig, ein junges Talent, das den Unbilden seiner Zeit zum Opfer gefallen ist. Ausgerechnet Seehofer wird mit der Benennung Guttenbergs als Wirtschaftsminister dafür sorgen, dass es anders kommt. Er drückt den Knopf an jenem Karrierekatapult, das Guttenberg in den deutschen Politikhimmel schießen wird. Geplant hat er das so nicht.
Es gibt ein Kinderspiel für Geburtstagsfeiern, das Schokoladenwettessen heißt. Die Kinder am Tisch würfeln reihum, und wer eine Sechs wirft, darf so viel Schokolade essen, wie er kann, bevor der Nächste eine Sechs hat. Seit zwei Jahren kriegt der kleine Karl-Theodor die ganze Schokolade, und die anderen werfen partout keine Sechs. Guttenberg startet ins neue Amt, als die Wirtschaftskrise, die auf das Erdbeben an den Finanzmärkten folgt, Deutschland überzieht. Ohne jeden Vorlauf und ausgestattet mit nur etwas Erfahrung aus dem Familienunternehmen muss der bisherige Außenpolitiker Position beziehen zu der Frage, ob der Autobauer Opel mit den Geldern des deutschen Steuerzahlers gerettet werden soll oder nicht. Im Gegensatz zur Kanzlerin, dem Finanzminister und weiten Teilen des politischen Establishments sagt er nein. Damit trifft er den Nerv der Bevölkerung. Es ist sein erster und auf Anhieb geglückter Versuch mit der Methode, die ihm später noch so viel Ansehen eintragen soll und die heißt: Endlich sagt es mal jemand! Ein Großteil der Menschen in Deutschland will anscheinend nicht, dass die Politik Staatsgeld für Opel ausgibt.
Bis zum 10. Februar 2009 ist die deutsche Politik- und Umfragewelt noch in Ordnung. Über die Jahre und Jahrzehnte waren die Bundeskanzler beliebt, die Außenminister erst recht, da sie selten etwas tun mussten, womit sie sich unbeliebt machten, die Verteidigungsminister genossen dagegen einen mittelmäßigen Ruf beim Volk. Jedenfalls konnten sie Kanzler und Außenminister nicht überflügeln. Auch Wirtschaftsminister gehörten nicht in die Spitzenkategorien der Beliebtheitsumfragen. Das galt auch für den CSU-Mann Michael Glos, Guttenbergs Amtsvorgänger im Wirtschaftsressort. Dem über Jahrzehnte erfahrenen und erfolgreichen Parlamentarier wollte das Ministeramt am Ende seiner politischen Karriere partout keinen Ruhm eintragen.
Dann wird alles anders. Gerade mal ein Vierteljahr nach seinem Amtsantritt, im Mai 2009, ist Guttenberg in den Beliebtheitsumfragen auf Platz zwei hinter der Bundeskanzlerin gelandet.1 Und das nur wenige Monate bevor Angela Merkel sich beim Wähler um eine zweite Amtszeit bewerben wird und somit besonders viel Aufmerksamkeit genießt. Auch der SPD muss die Sache zu denken geben, denn der CSU-Minister steht in den Umfragewerten sogar vor ihrem Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier. Ende Juli 2009 ist es dann so weit: Die Forschungsgruppe Wahlen meldet, dass Guttenberg in der Beliebtheitsumfrage erstmals vor Merkel liegt. Erst mit deutlichem Abstand auf die Kanzlerin folgen die Sozialdemokraten Peer Steinbrück und Steinmeier. Guttenbergs Parteichef Seehofer findet sich auf Platz acht und damit noch hinter dem FDP-Vorsitzenden Westerwelle.2
Die CDU jubelt
In der Union können viele ihr Glück gar nicht fassen. In einer Phase, da die CDU an Zustimmung einbüßt und die CSU immer noch in einer der tiefsten Krisen ihrer Geschichte steckt, kommt einer daher, der die Leute zum Jubeln bringt, die Hallen und die Festzelte füllt. Es ist die Zeit, da der Wahlkampf vorbereitet wird. Wer wird plakatiert? Wer tritt wo auf? Wer bekommt welchen Prominenten für seinen Wahlkreis?
Es ist schnell erkennbar, dass es ein großes Interesse in der CDU gibt, sich den Bundeswirtschaftsminister von der Schwesterpartei »auszuleihen«. Von Guttenberg erhoffen sie sich alle etwas. Sein Konterfei wird auch außerhalb Bayerns großzügig plakatiert. Zwar stimmt die Behauptung nicht, die CDU plakatiere erstmals seit den Kanzlerkandidaturen von Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber wieder einen CSU-Politiker in ihren Breitengraden. Es wurden immer wieder auch CSU-Minister auf die Plakatwände geklebt. Aber eine solche optische Präsenz wie Guttenberg hatte in der Tat noch kein CSU-Bundesminister in den Wahlkreisen der Schwesterpartei.
Diejenigen der CDU-Kandidaten für den Bundestag, die es schaffen, nicht nur Plakate Guttenbergs zu bekommen, sondern ihn leibhaftig begrüßen zu können, sind überglücklich. Es ist der 30. Juli 2009, der CDU-Bundestagsabgeordnete Jochen-Konrad Fromme ist einer der Auserwählten. Mitten in der Woche sind seiner Einladung Hunderte Anhänger gefolgt, die Lindenhalle in Wolfenbüttel ist am helllichten Tag randvoll, denn angekündigt ist Karl-Theodor zu Guttenberg. »Ich bin dankbar, dass du heute in diese Stadt gekommen bist«, begrüßt Fromme den Minister. Jetzt habe Wirtschaftspolitik in der Union »wieder ein Gesicht: Karl-Theodor zu Guttenberg«. Das ist weder für Guttenbergs Vorgänger Glos noch für die Wirtschaftspolitiker der CDU schmeichelhaft. Wer wolle, so fährt Fromme fort, dass »solche Leute wie Karl-Theodor zu Guttenberg« weiterregierten, der müsse die Union wählen. Eine bemerkenswerte Botschaft: Wegen der CSU muss die CDU gewählt werden.
Guttenbergs Auftritte enthalten in dieser frühen Phase seiner Superpopularität schon alle Elemente, die man später oft erleben wird. Er eilt durch die Halle nach vorne, besteigt und verlässt die Bühne springend, macht Scherze über das Trinken von Bier während seiner Reden. Auch rhetorisch ist der Mann im Wahlkampf 2009 nach nur wenigen Monaten als Wirtschaftsminister schon eine weitgehend komplette, fertige Erscheinung, als habe er sich über Jahre darauf vorbereitet und gewartet, dass endlich der Startschuss für die große Guttenberg-Show falle. Sein Lieblingswort ist Demut. In dieses Thema führt er in Wolfenbüttel mit einem Auftakt ein, den er oft wiederholen wird. Der vielbeschäftigte Star ist zwar nur einen kleinen Moment später als angekündigt in der mit vielleicht 500 Menschen voll besetzten Halle. Dennoch bittet er um Nachsicht dafür, dass er zu spät sei. Das ist ein Hinweis auf sein Verständnis von Erziehung und Benehmen, zu dem es nun mal gehört, stets exakt pünktlich zu sein. Es folgt ein kleiner Witz, mit dem er auf die sozialdemokratische Gesundheitsministerin Ulla Schmidt zielt, die in jenen Tagen für Aufsehen sorgt, weil sie ihren Dienstwagen nebst Fahrer mit in den Spanienurlaub genommen hat, wo ihr das Auto gestohlen wurde. Er sei nicht verspätet, weil er seinen Dienstwagen nicht gefunden habe – erste Heiterkeit im Saal –, sondern weil er in Baden-Württemberg einen Mittelständler besucht habe. In wenigen Minuten ist schon alles für einen gelungenen Auftakt getan: leichte Verbeugung vorm Publikum, Ohrfeige für den politischen Gegner, Arbeitsnachweis als Wirtschaftsminister. Der Saal gehört ihm.
Ein gutes Wort des jungen Ministers über den nicht mehr ganz jungen Bundestagsabgeordneten Fromme rundet die Sache ab: Da breche auch dem Jüngeren »kein Zacken aus der wohlpolierten Krone«, wenn er den Älteren lobe. Die Sorge, dass ihm seine aristokratische Herkunft irgendwann auf die Füße fallen könnte, bewegt Guttenberg von Anfang an. Schließlich sind viele Mitglieder der Union ähnlich stolz wie die Genossen von der SPD darauf, sich aus einfachen Verhältnissen nach oben gekämpft zu haben. Guttenberg will nicht als reich geborener Schnösel dastehen, der nur aus Langeweile mal ein bisschen politisiert. Vor den Menschen in Wolfenbüttel erklärt er, was er unter Demut versteht, und fügt hinzu, dieser Begriff werde nicht immer mit den Guttenbergs in Verbindung gebracht. Das sagt mehr über sein eigenes Empfinden aus als über tatsächliche Bedenken seines Publikums. Denn die meisten im Saal dürften den Namen Guttenberg noch nicht lange kennen und gar nicht die Gelegenheit gehabt haben, die Familie für nicht demütig oder gar für hochmütig zu halten.
Bevor der Wirtschaftsminister auf sein Thema zu sprechen kommt, geht es weiter um seine Person. Rankings von Politikern seien nur »Momentaufnahmen, Wimpernschläge«, versucht er sich in Bescheidenheit. Ein Politiker solle sein Handeln nicht danach ausrichten, ob er in irgendwelchen Popularitätskurven oben auftauche. Es gelte, die Arbeit zu machen und nicht nach der nächsten Stufe auf der Karriereleiter zu schauen, man dürfe sich nicht immer nur im Lichte der Sonne sehen, dürfe beim persönlichen Fortkommen nicht nur an den kommenden Wahltag denken und so weiter, und so weiter. Zehn Minuten spricht Guttenberg nur über Guttenberg, versucht, sich nach unten zu schrauben vor einem Publikum, das offenbar nur eines will: dass er oben bleibt und noch höher aufsteigt.
Beliebtheit ist noch keine Macht
Jemand, der zwischen 2002 und 2009 in der CSU nach oben kommt und politische Erfahrungen sammelt, wie es Guttenberg tut, weiß, wie vergänglich die Macht ist. Er hat erlebt, wie Edmund Stoiber um Haaresbreite als erster CSU-Politiker Kanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden wäre, wie er wenig später die Sensation vollbrachte, für die CSU die Zweidrittelmehrheit im Bayerischen Landtag zu erkämpfen, wie er anschließend den Zug nach Berlin verpasste, seinen Parteifreunden damit die politische Zukunft vermasselte, von ihnen gejagt, gehetzt und schließlich zur Strecke gebracht wurde. Das alles in wenigen Jahren. Guttenberg weiß zudem, dass Stoiber echte Macht besaß, erkämpft im Laufe vieler Jahre und Jahrzehnte, verbunden mit Niederlagen und neuen Anläufen – so, wie nachhaltige Macht nun mal entsteht. Und er ist sich in jenen Jahren 2009 und 2010, als sein Aufstieg an die Spitze stattfindet, bewusst, dass er zwar beliebt, aber noch nicht mächtig ist.
Auf seinem Weg nach oben hat Guttenberg nicht über die Jahre ein belastbares Netz aus politischen Freunden oder Abhängigen geknüpft. Er braucht das zunächst ja nicht, ihm fallen schließlich alle Ämter in den Schoß. Er muss sie nur annehmen und ausfüllen, so gut das geht. Trotzdem lässt er in kurzer Zeit so viele Konkurrenten hinter sich, dass, wenn schon keine Feindschaften, so doch Neid entstehen muss. Immer ist er der Überraschungskandidat: 2002, als er sein Bundestagsmandat erobert, 2007, als er Bezirksvorsitzender der CSU wird, 2008 als Generalsekretär und dann 2009 als Wirtschaftsminister. Nur der Wechsel ins Verteidigungsministerium ist nicht mehr überraschend. Immer bedeutet so etwas zugleich, dass die Anwartschaft eines anderen auf ein Amt, häufig über Jahre aufgebaut, übergangen wird.
Alles in allem befindet sich Karl-Theodor zu Guttenberg also seit dem Jahr 2009 in einer instabilen und politisch gefährlichen Situation. Im Grunde hat er nur einen wirklich starken Verbündeten: seine Beliebtheit in der Bevölkerung. Aber auf die kann man sich dauerhaft nicht verlassen. Was so schnell kommt wie die Superwerte für den jungen Minister, kann ebenso rasch wieder verschwinden. Das gilt zwar für andere Politiker auch, aber wer über Jahrzehnte ein tragfähiges Netz aus persönlichen Beziehungen geknüpft hat, kann gelegentliche Durchhänger in den Beliebtheitswerten leichter überstehen. Vor diesem Hintergrund sind Guttenbergs Beteuerungen der eigenen Demut und seine Behauptung, er wisse um die relative Bedeutung von Umfragen, nicht nur eitles Gerede.
Je mehr Guttenberg allerdings merkt, dass es sich bei seiner Beliebtheit nicht um eine politische Eintagsfliege handelt, sondern sie auch schwierige Phasen wie die Kundus-Affäre und den Beginn der Wehrpflichtdebatte übersteht, desto selbstbewusster wird er. Schon früh wird er nach den Gründen für seine Popularität gefragt. Im August 2009, er ist gerade ein halbes Jahr Minister, will die »Bunte« von ihm wissen, ob er auch über Wasser laufen könne. Guttenberg nimmt die Frage ernst, antwortet, dass er »mit dem ersten Schritt erbärmlich baden« gehen würde. Natürlich sagt er, dass er sich seine Beliebtheit selbst nicht erklären könne, um im folgenden Satz seine eigenen Vorzüge noch einmal aufzuzählen: »Ich versuche mich einfach nur so zu verhalten, wie ich bin, und mir das zu bewahren, was ich immer schon hatte. Ein hohes Maß an Geradlinigkeit und Berechenbarkeit, damit gelegentlich auch Unbequemlichkeit.«
Dass ihn nicht immer nur die Demut leitet, zeigen auch andere Stellungnahmen, etwa wenn er danach gefragt wird, wie man es lerne, so druckreif zu reden, wie er es tue. Guttenberg schafft es, in einem Satz gleich zweimal sein Lieblingswort »Herz« in unterschiedlichen Wendungen unterzubringen: »Indem man aus seinem Herzen keine Mördergrube macht und im Zweifel das Herz sprechen lässt.« Als dann der Vergleich mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama fällt, weist Guttenberg ihn nicht etwa zurück, weil er sich mit dem amerikanischen Präsidenten nicht auf eine Stufe stellen möchte, sondern nennt einen politischen Unterschied: »Obama ist dem linksliberalen Spektrum zuzuordnen, ich würde mich als modern-konservativen Kopf bezeichnen.« Zudem sei der amerikanische Politikbetrieb mit dem deutschen nicht ansatzweise zu vergleichen.3
Nicht zu vergleichen? Guttenbergs Auftritte und Inszenierungen scheinen zu einem Gutteil der amerikanischen Politikvermarktung entlehnt. Als Schüler, junger Berufstätiger und Bundestagsabgeordneter war er so oft in den Vereinigten Staaten unterwegs, dass er eine genaue Vorstellung davon bekommen hat, wie ein moderner Politikerauftritt im Medien- und Unterhaltungszeitalter in Amerika funktioniert. Die zarten Nachahmungsversuche durch die Parteien in Deutschland, die seit ein paar Jahren auch Musik spielen, wenn ihre Matadoren die Parteitagshalle betreten, wirken dagegen halbherzig, ja ängstlich. Guttenberg huldigt der Devise, dass nur das große Kaliber durchschlägt. Für ihn wird der Fleetwood-Mac-Song »Don’t stop« schon gespielt, wenn er an einem Samstagmorgen in einer Stadthalle zu einer kleineren Konferenz erscheint. Und das war immerhin die Hymne in Bill Clintons Wahlkampf, aus dem jener als amerikanischer Präsident hervorging. Nein, klein, verzagt und allzu bürgerlich-deutsch geht es nicht zu beim Freiherrn zu Guttenberg.
Schon bald nach dem Beginn des großen Aufhebens um seine Person ist nicht mehr exakt zu unterscheiden, wie viel davon der Sehnsucht des durch große Koalition, Merkel und Steinmeier gelangweilten Publikums geschuldet ist und wie viel die aktive Inszenierung durch den Hauptdarsteller beiträgt. Wie meistens im Leben ist es eine Mischung. Deren nicht sehr geheimes Rezept heißt: Guttenberg und seine Truppe, zu der von Anfang an seine Frau gehört, zielen auf ein Publikum, das Politiker in erster Linie über Fernseh-Talkshows, Hochglanzzeitschriften oder höchstens noch Boulevardzeitungen wahrnimmt. Dass diese Methode in den Kommentarspalten der seriösen Zeitungen auch auf Kritik stößt, nimmt Guttenberg in Kauf.
Doch wie ist das eigentlich mit der Inszenierung des fränkischen Shootingstars? Treibt er es wirklich für einen Politiker zu toll? Will ihm jemand vorwerfen, dass er in einer Wahlkampfhalle oder einem bayerischen Festzelt gut ankommt? Das versuchen die anderen schließlich auch alle, die meisten kriegen es nur nicht so gut hin. Eine hohe Dosis an Talkshow-Auftritten Guttenbergs ist nicht zu bestreiten, und wenn sie – wie im Dezember 2010 – mit Johannes B. Kerner in Afghanistan bei einem Truppenbesuch stattfinden, dann ist die Frage erlaubt, wie wichtig dem Minister bei einem solchen Besuch die sicherheitspolitischen Inhalte sind und ob es nicht vielmehr um die Showeinlage geht.
Doch seine Inszenierungen sind weitestgehend auf die Politik beschränkt. Die Kinder? Das Schloss? Sportliche Aktivitäten oder andere Freizeitvergnügungen? Es gibt kaum Home-Storys, bloß einen größeren Film im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über die Familie samt Schloss in Guttenberg, aber inflationär ist das nicht.
Andere Politiker haben in dieser Hinsicht lange vor Guttenberg ganz anders hingelangt. Joschka Fischer, der prominenteste aller Grünen-Politiker, schrieb ein Buch über sein innerstes Befinden, über das Joggen, seinen »langen Lauf« zu sich selbst. Zeitweise lockte er mit seinen sportlichen Betätigungen mindestens so viele Kameras an wie mit seinen politischen Auftritten. Gerhard Schröder posierte in modischen Anzügen eines italienischen Edelschneiders und inszenierte sich als Zigarrenraucher. Guido Westerwelle zog in den RTL-Container bei »Big Brother« ein. Alles das hatte nicht das Geringste mit Politik zu tun, sondern war der Versuch, auf fachfremdem Gebiet Sympathien zu sammeln, in der Hoffnung, dass diese sich auf die politische Zustimmung positiv auswirken würden.
Da aber Karl-Theodor weiß, wie schwer es ist, das Wohlwollen der Menschen nur mit verteidigungspolitischen Themen zu erwerben, hat er für die breite gesellschaftliche Akzeptanz der Marke Guttenberg von Anfang an eine enge Mitarbeiterin: seine Frau Stephanie. Sie ist dafür zuständig, die harten politischen Themen ihres Mannes – Krieg, Wehrpflicht, Leute rausschmeißen, Ministerium halbieren – zu ergänzen. Ist sein Part in Afghanistan der Frontbesuch (Männer unter sich), spricht sie mit den Soldatinnen »von Frau zu Frau«. Doch hat sie ein ebenfalls hartes Thema, und das schon aus einer Zeit, da ihr Mann noch nicht Minister war: den Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch.
Immer wieder wird der Minister angesprochen auf den Hype um seine Person. Er versucht, ihn herunterzureden. Etwa bei der Verleihung des Deutschen Kulturförderpreises am 9. September 2010, wo er die Festrede hält, stellt ihn die ZDF-Moderatorin als ein echtes »Phänomen« dar: »Egal ob bei ›Wetten, dass …?‹ oder im afghanischen Kampfgebiet, er glänzt – und das kann nicht immer nur an seiner Frau liegen.« Guttenberg antwortet mit einem Scherz, den er in ähnlichen Variationen häufiger macht: »Wenn man mir die Möglichkeit zum Glänzen nehmen will, dann muss man mir nur das Haargel wegnehmen.« Drei Tage später nimmt er das Thema bei »Beckmann« wieder auf, benutzt dann, wie so oft, die unpersönliche man-Form: »Man ist genauso fehlerhaft wie jeder andere auch.« Zu seiner Popularität sagt er: »Ich kann mir all das nicht erklären, das kann an einem Tag weg sein.«
Immer wieder bemüht Guttenberg sich, den Eindruck zu erwecken, er sei Realist, was die Dauer seiner Superpopularität angeht. Im Dezember 2010 versucht er das »ungeschriebene, aber stets bewiesene Gesetz des politischen Lebens« ins Positive zu wenden: »Wenn man sich bewusst ist, dass jeden Tag mit einem unglaublichen Lärm plötzlich auch eine solche Karriere zu Ende gehen könnte, kann man unbefangener arbeiten.«4 Ihm wohlgesinnte, erfahrene Kollegen aus der Union haben Guttenberg auf die griechische Sage von Ikaros hingewiesen. Der flog bekanntlich mit seinen Flügeln so hoch, dass die Sonne das Wachs, das die Federn zusammenhielt, zum Schmelzen brachte und der Jüngling ins Meer stürzte.
Rücktrittsdrohungen »to go«
An »einem Tag« oder »jeden Tag« wird das Ende nicht kommen. Aber ein Weg, der so steil bergauf führt, enthält natürlich das Risiko, dass er ebenso steil in die Tiefe geht. Deutschlands beliebtester Politiker hat sich einen kleinen Trick angeeignet, um den Schmerz nach dem Absturz lindern zu können, falls der Ernstfall eintreten sollte. Wie kein Politiker in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik vor ihm kokettiert er unablässig mit der Möglichkeit, aus der Politik auszusteigen und etwas ganz anderes im Leben zu machen. Gerhard Schröder setzte die Rücktrittsdrohung als Kanzler so oft ein, dass sie sich irgendwann abnutzte. Aber gegen das Ich-kann-auch-anders-Stakkato von Karl-Theodor zu Guttenberg legte sich Schröder geradezu strenge Zurückhaltung auf.
Schon in der berühmten Opel-Nacht im Kanzleramt im Frühjahr 2009 stellt Guttenberg nach wenigen Monaten im Amt dieses zur Verfügung. Die Kanzlerin nimmt das Angebot nicht an. Wenig später schwadroniert er von »Sabbaticals«, also Auszeiten, in der Politik, die sinnvoll wären. Als er im Sommer 2010 das Kabinett auf einer Klausurtagung mit seinem Vorstoß überrollt, die Wehrpflicht abzuschaffen, verbindet er auch das mit Rücktrittsdrohungen. Kurz darauf erregt Guttenberg sich maßlos, weil im Kanzleramt ohne sein Wissen ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde, in dem es um Einzelheiten seiner Vernehmung vor dem Kundus-Untersuchungsausschuss zur Bombardierung zweier Tanklaster im September 2009 geht. Vor Freunden und Vertrauten stellt er Erwägungen an, sein Amt niederzulegen. Gleichsam sprachlos vor Zorn sagt er damals: »Solche Vorgänge lassen sich kaum kommentieren.«5 Er fühle sich isoliert, keiner rede mit ihm, das Vertrauen sei »total zerrüttet«. Er streitet mit Kanzleramtsminister Ronald Pofalla, aus dessen Haus der Auftrag für das Gutachten kam, sagt der Kanzlerin am Handy die Meinung. Dabei geht es um eine Unachtsamkeit auf der Referatsleiterebene, schlimmstenfalls um eine kleine Boshaftigkeit des Kanzleramtschefs gegen den Verteidigungsminister. Aber nachgewiesen ist das nicht. Während man in Guttenbergs Ministerium eine Intrige wittert, heißt es im Kanzleramt, es handele sich um einen ganz normalen Vorgang.
Das wirkt etwas mimosenhaft von Guttenberg. Wer mit dem goldenen Umfragelöffel im Mund politisch groß geworden ist, mag eben zur Empfindlichkeit neigen. Doch steckt noch etwas anderes hinter der Dauerdrohung. Zumindest so lange, wie die Zuneigung des Volkes groß ist, kann es diese noch verfestigen, wenn jemand mit Hinweis auf die bösen anderen sagt, er könne ja auch gehen, wenn er nicht mehr gewollt sei. Riskant wird das erst, wenn die Beliebtheitswerte einmal nicht mehr gut sind. Dann könnte Guttenberg ein Jonglieren mit dem Rücktritt als Eitelkeit und Unernst ausgelegt werden nach dem Motto: Da hat es einer nicht nötig, sich für einige lächerliche 100 000 Euro im Jahr als Minister zu schinden. Fürs Erste freilich bleibt Guttenberg bei seinem Kurs. Es kann sogar passieren, dass er bei einer Zufallsbegegnung mit einem Journalisten von 20 Minuten Länge einfließen lässt, er könne sich auch etwas anderes als die Politik vorstellen. Eine Rücktrittsdrohung »to go« sozusagen.
Die Umfragen bleiben stabil für Guttenberg. Im Bundestagswahlkampf 2009 gelingt es der Kanzlerin noch einmal, ihn auf Platz zwei in den Beliebtheitswerten zu verdrängen, aber das bleiben Momentaufnahmen. Während Merkel zwischendurch auch mal auf Position fünf absackt und nur noch einen Platz vor dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel steht, ist Guttenberg fast durchgängig die Nummer eins, weitgehend unabhängig davon, was er politisch gerade macht. Je populärer Guttenberg wird, desto absurder werden die Fragen, die sich die Institute ausdenken. So können sich angeblich sogar viele Deutsche vorstellen, mit ihm in den Urlaub zu fahren, oder hielten seine Gattin für eine gute Ministerin, obwohl die gar keine Politikerin ist.
Ende des Jahres 2010 veröffentlicht die Zeitschrift »Superillu« die Umfrage eines Leipziger Instituts unter 1002 Ostdeutschen. Gefragt wird nicht nach dem beliebtesten Politiker, sondern nach dem beliebtesten Deutschen des Jahres 2010. Das Rennen macht mit weitem Abstand Karl-Theodor zu Guttenberg, ein westdeutscher Adliger, der noch dazu dem Berufsstand der Politiker angehört und einer Partei, deren Führungspersonal in der Vergangenheit nicht selten versucht hat, auf dem Rücken der Ostdeutschen Wahlkampf zu machen. Guttenberg, der bei der gleichen Umfrage im Vorjahr noch mit 27 Prozent Zustimmung auf Platz vier lag, bekommt dieses Mal 39 Prozent. Damit rangiert er 14 Punkte vor Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel, 17 Punkte vor Talkmaster Günther Jauch und 19 Punkte vor Fußballnationaltrainer Jogi Löw und dem Ex-Bundesbankvorstand und Bestsellerautor Thilo Sarrazin. Kein anderer aktiver Politiker weit und breit. Das verstärkt den Eindruck, dass auch Guttenberg nicht als Politiker so beliebt ist, sondern als Prominenter – mit Geld, Gel und einer Geschichte –, der zufällig in der Politik tätig ist. Die Bundeskanzlerin und der Vizekanzler tauchen nur in der Rubrik »weitere Plazierungen« auf. Merkel ist von 34 Prozent im Wahljahr 2009 auf 13 Prozent abgerutscht. Guido Westerwelle steht wie schon 2009 bei einem Prozent und damit deutlich hinter Lena Meyer-Landrut, Mesut Özil und Dieter Bohlen.6
Bundeskanzler Guttenberg?
Dass früh eine Debatte darüber beginnt, ob Guttenberg nicht der Richtige als Bundeskanzler wäre, ist angesichts solcher Umfragewerte wenig erstaunlich. Interessant daran ist vielmehr, dass sie nicht in erster Linie von den ansonsten für solche Spielchen zuständigen Journalisten geführt wird. Von Anfang an beteiligen sich Politiker an dieser Form der Glorifizierung, die Umfrageinstitute stehen nicht lange beiseite, sondern machen mit. Im Juli 2009, Guttenberg weiß gerade mal, wer im Wirtschaftsministerium den Kaffee kocht, sagt der erfahrene und gut beleumundete CSU-Bundestagsabgeordnete Norbert Geis über Guttenberg: »Wenn er lange genug Dienste getan hat als Minister, warum sollte er dann nicht mal für die CSU als Bundeskanzler antreten?« Sein Parteifreund Hans-Peter Uhl lobt den Wirtschaftsminister, greift zwei Monate vor der Bundestagswahl schon mal der Kabinettsbildung vor mit der Bemerkung, Guttenberg solle auch nach dieser als Minister weitermachen, und antwortet schließlich auf die Frage nach der Kanzlerschaft: »Jeder Katholik kann auch Papst werden.«7 Auch Emnid-Chef Klaus-Peter Schöppner gibt sich in jenem Sommer beeindruckt. Kein Politiker habe es je geschafft, so schnell akzeptiert zu werden.8
Ein Jahr später, als Bundespräsident Horst Köhler völlig überraschend sein Amt hinschmeißt, nur ein Jahr nach seiner Wiederwahl, und ein Nachfolger gewählt werden muss, bringt das große Unruhe in die Koalition. Der Unionskandidat Christian Wulff hat mit dem Bewerber von SPD und Grünen, Joachim Gauck, einen unerwartet starken Gegner. Gedankenspiele machen im politischen Berlin die Runde, wie stabil die Zukunft von Kanzlerin Merkel noch wäre, sollte ihr Kandidat Wulff es nicht schaffen. Prompt wird zu diesem Szenario eine Umfrage in Auftrag gegeben, wer ihr nachfolgen könnte, sollte sie zurücktreten. Das erwartbare Ergebnis: Die meisten wollen Karl-Theodor zu Guttenberg in diesem Amt sehen, 34 Prozent der Befragten. Platz zwei belegt mit nur 19 Prozent Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen von der CDU.9
Wulff wird im dritten Durchgang zum Bundespräsidenten gewählt, die Sache ist gerade noch gutgegangen für Angela Merkel. Doch der Zustand der Koalition, der ständige Streit, die schlechten Umfragen für Union und FDP lassen die Mutmaßungen nicht enden. Je unsicherer es im Herbst wird, ob die CDU bei der Landtagswahl im nächsten Frühjahr ihre Macht in Baden-Württemberg behaupten kann, desto intensiver wird über Merkels Zukunft spekuliert – und über die Guttenbergs. In einem Bericht der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« wird im Oktober 2010 die Stimmung in der Union so beschrieben, dass eine schwere Niederlage der CDU in Baden-Württemberg Guttenberg den Weg ins Kanzleramt ebnen könnte, wenn auch vermutlich nicht sofort.10 Der Artikel belebt eine ohnehin schon hochnervöse Diskussion über den Franken. Wenige Wochen später wird sich in München die CSU zu ihrem Parteitag treffen. Sprach im Sommer noch alles dafür, dass dort eine spannende Entscheidung zu erwarten ist, ob der Verteidigungsminister sich gegen seinen Parteichef Seehofer mit den Plänen für eine Aussetzung der Wehrpflicht durchsetzen kann, so sind die Ereignisse längst darüber hinweggerollt. Seehofer musste schon lange vor dem Parteitag zerknirscht einsehen, dass Guttenberg wieder mal den Nerv der Menschen getroffen hatte und die CSU das Ende der Wehrpflicht mittragen würde – anders, als der Vorsitzende zunächst dachte.
Nun geht es vielmehr um seinen, Seehofers, Stuhl. Denn es wird nicht nur über Guttenbergs Chancen gesprochen, Kanzler zu werden, sondern auch über die Möglichkeit, ihm den CSU-Vorsitz zu geben. In den Wochen vor dem Treffen in München sagen hinter vorgehaltener Hand viele CSU-Leute, darauf laufe es über kurz oder lang ohnehin hinaus. So aufgeheizt ist die Stimmung mittlerweile, dass nicht nur die Bundeskanzlerin, der Verteidigungsminister selbst und zahlreiche andere Unions-Politiker versuchen, die Sache abzukühlen und es in keinem Falle zu einem Showdown zwischen Seehofer und Guttenberg kommen zu lassen. Auch die Parteitagsregie tut alles, um das zu vermeiden. Guttenbergs Redezeit in der Wehrpflichtdebatte wird auf etwa zehn Minuten begrenzt, nachdem er monatelang immer etwa eine Stunde zu diesem Thema ausgeführt hatte. Der gesamte Tagesordnungspunkt Wehrreform landet auf dem späteren Freitagabend in der Hoffnung, dass da die Aufmerksamkeit nicht mehr so groß ist.
Guttenberg selbst hält sich zurück, verkneift sich jeden Triumph wegen seines Sieges in der Wehrpflichtfrage und springt Seehofer sogar bei im Kampf um die Durchsetzung einer innerparteilichen Frauenquote. Er bemüht sich aber, dieses nicht so heftig zu tun, dass es gleich wieder heißt, er habe Seehofer retten müssen. Der Eindruck entsteht trotzdem, denn Guttenberg spricht als vorletzter Redner vor dem Parteichef, sozusagen als die Nummer zwei, und die Entscheidung fällt knapp aus.
Nach nicht einmal zwei Jahren hat der bis dahin einmalige Hype um einen deutschen Spitzenpolitiker ein Ausmaß angenommen, das nur noch eingeschränkt kontrollierbar ist. Die Hauptperson in diesem wundersamen Stück aus dem Politiktheater behauptet zwar, die ganze Aufregung um seine Person nicht verstehen zu können und immer nur demütig den Aufgaben eines Ministers nachzugehen. Tatsächlich findet er aber immer wieder einen neuen Dreh, um von sich reden zu machen. Kurz vor Weihnachten löst er in Politik und Medien abermals eine heftige Debatte aus, als er zum siebten Mal im Jahr 2010 die deutschen Truppen in Afghanistan besucht, in Mazar-i-Sharif mit dem Talkmaster Johannes B. Kerner eine Sendung produziert und zur großen Überraschung fast aller einen besonderen Gast mit an den Hindukusch bringt: seine Frau Stephanie. Im Rückblick wird deutlich werden, dass das der Auftakt zu Monaten voller Krisen in Guttenbergs Karriere sein wird.
Eines jedenfalls ist unbestritten: Karl-Theodor zu Guttenberg hält Deutschland seit zwei Jahren in Atem und macht nicht den Eindruck, als wolle er damit so bald aufhören. Wie war das mit den Glocken der Hölle? Vier Kernbotschaften enthält der Text des AC/DC-Songs:
»Ich komme wie ein Hurrikan.«
»Ich nehme dich mit in die Hölle.«
»Ich werde keine Gefangenen machen.«
»Keiner legt sich mit mir an.«
1Die Guttenbergs
Das Erbe: Adel, Politik, Widerstand
Stammhalter
Es ist ein grauer Wintertag, die Temperatur liegt um drei Grad über null, als das Leben jenes Mannes beginnt, der fast 40 Jahre später viele Deutsche so begeistern sollte, wie wenige Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik es vor ihm geschafft haben. Am Sonntag, dem 5. Dezember 1971, geschieht etwas sehr Wichtiges im Leben der traditionsbewussten fränkischen Familie von und zu Guttenberg: Der Stammhalter wird geboren. Es ist das erste Kind des Enoch Freiherr von und zu Guttenberg und seiner jungen Ehefrau Christiane. Just acht Tage vor der Geburt des Kindes hat Dani, wie Christiane zu Guttenberg seit ihrer Kindheit genannt wird, ihren 20. Geburtstag gefeiert. Ihr Mann, von Beruf Musiker und Dirigent, ist gerade 25 Jahre alt. Am 14. Februar 1971 hatten die beiden in Eltville im Rheingau geheiratet, dem Heimatort Christiane zu Guttenbergs, einer geborenen Gräfin zu Eltz. Zehn Monate später wird in einem Münchner Krankenhaus das erste Kind des Paares geboren. Karl-Theodor soll es heißen, zu Ehren des Großvaters väterlicherseits.
Diese Art der Namensgebung ist Familientradition. Der Vater des kleinen Karl-Theodor heißt Georg Enoch, und so hieß auch schon dessen Großvater. Die auch in anderen Familien adliger Abstammung übliche Sitte, die Namen des Großvaters auf den ersten männlichen Enkel zu vererben, bleibt also gewahrt – nur der Bindestrich zwischen Karl und Theodor unterscheidet den Namen des Neugeborenen von dem seines Großvaters. Beim alten Guttenberg, Karl Theodor dem Älteren, wie er hier der Eindeutigkeit halber ab und an genannt werden soll, löst die Nachricht, dass ein Stammhalter geboren wurde, Freude und Erleichterung aus. Karl Theodor zu Guttenberg hatte mit seiner Frau Rosa Sophie, geborene Prinzessin von Arenberg, im Laufe von zwölf Jahren fünf Kinder bekommen: die vier Mädchen Elisabeth, Michaela, Benedikta und Praxedis – Benedikta starb schon wenige Wochen nach ihrer Geburt – und den Jungen Georg Enoch, geboren 1946, das zweite der vier Kinder. Dass Enoch, der einzige Sohn, nun wieder einen Sohn bekommen hat, bedeutet: Der Name Guttenberg wird in direkter Linie fortleben, ein weiterer zukünftiger Schlossherr ist geboren. Das ist wichtig für eine Familie, deren erste urkundliche Erwähnung auf das Jahr 1158 datiert. Und die auf einem Schloss in einem 600 Einwohner zählenden Dorf wohnt, das den gleichen Namen trägt wie sie selbst: Guttenberg. Es ist eine Familie, die etwas darauf hält, von Adel zu sein.
Mythos Adel
Die Faszination, die vom Adel auch in Deutschland ausgeht, ist ungebrochen. Die Hochzeiten von Kronprinzen und Kronprinzessinnen europäischer Königshäuser werden zu den besten Sendezeiten im Fernsehen live übertragen, Adelsserien haben Konjunktur, und der Klatsch und Tratsch über Liebschaften, Ehekrisen und Schwangerschaften, über Zerwürfnisse, Versöhnungen und Erbstreitigkeiten aus den berühmten Adelshäusern dieser Welt ist der Stoff, aus dem sich eine ganze Industrie, die Regenbogenpresse, speist. Adel ist bei großen Teilen der Deutschen nach wie vor »in« – sie verbinden ihn mit Glanz und Glamour, er steht für etwas Dauerhaftes, Außergewöhnliches und Märchengleiches, und die Kabale und Liebe der großen europäischen Königs- und Adelshäuser lassen sich verfolgen wie eine Reality-Seifenoper. Das Interesse ist besonders stark an den Adelsfamilien in denjenigen Ländern, in denen die Königshäuser noch eine politische, wenn auch größtenteils repräsentative Funktion haben, wie etwa in Großbritannien und in Schweden. Ein inniges Verhältnis zu ihrem eigenen verflossenen Hochadel, etwa zum Haus Hohenzollern, haben die Deutschen nicht. Und auch eine Monarchie wünscht sich die große Mehrheit der Deutschen nicht. Auf die Frage, ob der Adel wieder eine größere Rolle in politischen Spitzenpositionen spielen sollte, antworteten 89 Prozent der Befragten im Oktober 2010 mit Nein und nur acht Prozent mit Ja.11
Streng genommen ist die Frage nach der Bedeutung des Adels falsch gestellt. Denn den Adel gibt es in Deutschland schon gut 90 Jahre nicht mehr. Mit der Weimarer Reichsverfassung wurden am 14. August 1919