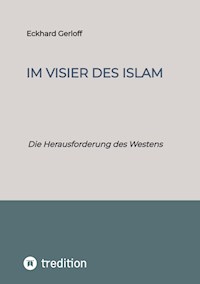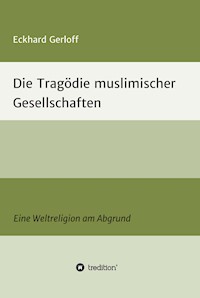
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Politische Islam scheint unaufhaltsam auf dem Vormarsch zu sein. Vielen Menschen - insbesondere auf dem von muslimischer Migration besonders betroffenen Kontinent Europa - gilt er als eine ernstzunehmende gesellschaftliche Bedrohung. Islamistischer Terror, muslimische Migration und erkennbare Probleme im Zusammenhang mit Integration und täglichem zwischenmenschlichen Umgang schaffen ein Klima gesellschaftlicher Verunsicherung. Doch Verunsicherung oder gar Angst entstehen immer dann, wenn Wissen über die Gefährdung fehlt. Das vorliegende Buch will helfen, Lücken im Wissen über muslimische Gesellschaften zu schließen - in einer einfachen und verständlichen Sprache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eckhard Gerloff
Die Tragödie muslimischer Gesellschaften
„Ihr seid die beste Gemeinschaft,
die für die Menschen hervorgebracht worden ist.“
Koran, Sure 3, Vers 110
Eckhard Gerloff
Die Tragödie muslimischer Gesellschaften
Eine Religion am Abgrund
Impressum
© 2021 Eckhard Gerloff
Autor: Eckhard Gerloff
Umschlaggestaltung, Lektorat und Korrektorat: Eckhard Gerloff
Verlag und Druck tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN (Paperback): 978-3-347-34417-4
ISBN (Hardcover): 978-3-347-34418-1
ISBN (e-Book): 978-3-347-34419-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Christentum und Islam – und „Welten“ dazwischen
1.1 Gottes- und Menschenbilder
1.2 Religiöse Kerne und Spiritualität
1.3 Weltbilder
1.4 Recht und Normen-Systeme
2. Die Rückständigkeit islamischer Gesellschaften
2.1 „Kulturelle“ und gesellschaftliche Bedingungen
2.2 Demografische und ökonomische Falten
2.3 Religiöse und ökonomische Ursachen
2.4 Politische und soziologische Gründe
3. Islamische Deutungen eigener Rückständigkeit
3.1 Kreuzzüge, Mongolensturm und Kolonialismus
3.2 Abendländische Importe: Kapitalismus und Sozialismus
3.3 Islamischer Imperialismus und Kolonialismus
3.4 Reflexe einer schamgeprägten Kultur
4. Vergleich westlicher und islamischer Gesellschaften
4.1 Recht und Staatlichkeit
4.2 Stabilität islamischer Staaten: Autokraten und Despoten
4.3 Sozialisation und Bildung
4.4 Wettbewerb und Wettbewerbsmentalität
5. Islamische Staaten zwischen Utopien und Realität
5.1 Herausforderungen: Globalisierung und Digitalisierung
5.2 Das zivilisatorische Scheitern des Islam
5.3 Migration: Die Abstimmung mit den Füßen
5.4 Terror: Die Antwort islamischer Psychopathen
6. Unser Umgang mit dem Islam
6.1 Das Vorleben „abendländischer“ Werte
6.2 Durchbrechen „gelernter“ Opfer- und Tätermuster
6.3 Toleranz inhaltlich neu justieren
6.4 Dialog? Mit wem – über was – und wie?
Schlussbetrachtungen
Verwendete Literatur
Einleitung
„Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist.“1 Dieses Zitat aus dem Koran, dem „heiligen Buch“ der Muslime, klingt nach einer großartigen „Verheißung“, versteht sich als ein gewaltiges „Versprechen“. In der Tat signalisiert dieser Koran-Vers muslimischen Gesellschaften eine besondere Position – herausgehoben gegenüber allen anderen existierenden Gesellschaften und allen nur denkbaren Gesellschaftsformen. Die mit dem zitierten Koran-Vers ausgesprochene Exklusivität erinnert an die Verheißungs-These des jüdischen Volkes im Alten Testament, das im Bund Gottes mit Abraham auserwählte Volk zu sein. Doch ist diese These rein theologisch zu deuten und bedeutet für die gläubigen Juden keine Bevorzugung gegenüber anderen Menschen.2 Muslime und muslimische Gesellschaften dagegen zögern keinen Augenblick, aus der koranischen Verheißung einen Überlegenheitsdünkel abzuleiten und sich unter Berufung auf die Ausführungen des Koran über andere Menschen und deren Lebensweisen, Gesellschaftsformen, Rechtssysteme, Religionen und Kulturen zu erheben.
Doch der Schein trügt. Die Wirklichkeit muslimischer Gesellschaften sieht im Verhältnis zu den „Verheißungen“ völlig anders aus. Abgesehen vom Prunk, dem Glanz und Glamour der reichen arabischen Golf-Staaten, der ausnahmslos aus dem Export des Rohstoffes „Öl“ resultiert und sich nicht auf einer eigenen erbrachten Leistungsfähigkeit begründet, liegen die allermeisten muslimischen Staaten am Boden. Die Menschen in zahlreichen muslimischen Ländern3 leben in Armut, in täglicher Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, teilweise liegen ihre Länder bedingt durch Kriege und Unruhen in Schutt und Asche.
So zeigt sich in dem „göttlichen“ Versprechen, die beste für die Menschen hervorgebrachte Gesellschaft zu sein, die ganze Tragödie und das grauenvolle Dilemma der muslimischen Welt. Es ist daher kein Wunder, dass die täglich erlebte und erfahrene Diskrepanz zwischen Exklusivität und materieller Misere in einen stark ausgeprägten psychologischen Druck mündet, der sich schlussendlich nur in Gewalt entladen kann. Und diese Nähe und Affinität zu Gewalt und Gewaltbereitschaft ist einzigartig unter den Religionen, denn „die massenhafte Begeisterung für Gewalt im Namen einer Religion gibt es gegenwärtig ausschließlich im Islam.“4
Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte Karl Marx auf einen Zusammenhang zwischen dem wirklichen und dem religiösen Elend hingewiesen: „Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüth einer herzlosen Welt, wie sie derGeist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.“5 Diese Marx’sche Analyse trifft das Dilemma der muslimischen Welt im Kern. „Und in der Welt des … islamischen Fundamentalismus ist die Religion mittlerweile wohl weniger Opium für das Volk als Crack für die Masse.“6
In den zurückliegenden Jahren ist eine Vielzahl an Veröffentlichungen zum Thema Islam erschienen. Und es hat den Anschein, als ob das Thema Islam ganz oben auf der politischen und wissenschaftlichen Agenda stünde; doch gemessen an seiner politischen und ökonomischen Bedeutung erscheint dieses Thema in der öffentlichen Aufmerksamkeit als deutlich überrepräsentiert; denn ginge es allein um seine politische und ökonomische Bedeutung, wäre das es kaum geeignet, einen dermaßen großen Raum im politischen und gesellschaftlichen Diskurs einzunehmen. Es ist vielmehr auf die im Namen des Islam ausgeführten Gewalttaten zurückzuführen, dass dieses Thema in der wahrgenommenen Breite und Tiefe in die öffentlich und wissenschaftlich geführte Diskussion geraten ist.7
Allein die im deutschsprachigen Raum publizierten Monografien und Fachartikel zum Thema Islam haben eine erstaunliche Fülle angenommen; sie lassen sich im Wesentlichen in drei Kategorien gliedern und einordnen: erstens in Publikationen, die sich mit Fragen und Problemen der Integration von Muslimen in westliche Gesellschaften ergeben8. Zweitens erschienen vielfältige Beiträge, die sich mit den Erscheinungen des „Islamismus“, des „Politischen Islam“9 auseinandersetzen und drittens Publikationen, deren Anliegen es ist, sich mit der Religion des Islam in ihrem eigentlichen und wesentlichen Kern10 „kritisch“ auseinander zu setzen.
Warum also nun mit dieser Veröffentlichung ein weiteres Buch zur Thematik Islam? Ist dieses Thema denn nicht bereits hinreichend und erschöpfend behandelt worden? Hätte der Autor diese Frage mit Ja beantwortet, so wäre dieses Buch naturgemäß nicht geschrieben worden. Denn bei einer intensiven Auseinandersetzung mit den aktuellen und historischen Publikationen zum und über den Islam bleibt doch eine Reihe wesentlicher Fragen unbeantwortet. Und mit diesen Fragen möchte sich dieses Buch auseinandersetzen. Ausgangspunkt ist die Frage, warum real existierende muslimische Gesellschaften dem Gegenteil der im Koran versprochenen Vorrangstellung gegenüber allen anderen Gesellschaften ökonomisch, kulturell und politisch-gesellschaftlich in einem eklatanten Maße in den Rückstand geraten sind. Dafür muss es Gründe geben. Über die Rückständigkeits-These muslimischer Gesellschaften ist zwar vielfach geschrieben worden, eine wirklich befriedigende Antwort gibt es bisher jedoch nicht.
Sind es allein ökonomische Ursachen, die das Auseinanderklaffen westlicher und muslimischer Volkswirtschaften erklären können? Sind es religiöse und kulturelle Gründe, die die empirisch nachweisbaren Differenzen erklären können? Oder sind es vielmehr soziologische, gesellschaftliche und politische Strukturen, die für die Erklärung des erheblichen und unüberbrückbar erscheinenden Abstandes zu westlichen Gesellschaften herangezogen werden müssen? Und wie greifen diese möglichen Erklärungsmuster ineinander, wie sind sie miteinander verknüpft? Diesen Fragen widmet sich dieses Buch. Gleichzeitig aber wird ein neuer Aspekt aufgeworfen, denn wenn so vehement für den Islam als der besten aller Gemeinschaften geworben wird, so muss die Klärung der Frage von größtem Interesse sein, welche Normen den Islam im Vergleich zu westlichen Gesellschaften prägen und welche erstrebenswerten Lebensentwürfe und Existenzmodelle die islamische Lebensweise für Menschen anbietet? Worauf lässt man sich also konkret ein bei einer Hinwendung zum Islam?
Dieses Buch wendet sich insbesondere an politisch interessierte Menschen, um deren Bedürfnis nach Information über das Thema des Islam zu bedienen, auch an Menschen, denen eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen oder einer fremden Religion ein Anliegen ist, aber auch an ein Fachpublikum, das sich wissenschaftlich mit der vorliegenden Thematik beschäftigt. Bewusst wird eine verständliche Sprache gewählt, wenn möglich wird auf vermeidbare Fremdworte und komplizierte Begriffe ebenso verzichtet wie auf strapazierende Formulierungen. Eine klare Darstellung von Hintergründen, Fakten und Argumenten und die leserliche Formulierung sollen im Vordergrund stehen.
Dieses Buch gliedert sich in sechs Hauptteile. Im ersten Hauptteil dieses Buches geht es um eine „Annäherung“ an die beiden großen kultur-prägenden Religionen: das Christentum und den Islam. Es werden wesentliche Facetten der beiden Welt-Religionen dargelegt: so sollen die unterschiedlichen Menschen-, Gottes- und Weltbilder beschrieben werden, auch weil sie für das Verständnis der beiden betrachteten Religionen und insbesondere für das Verständnis der Probleme muslimischer Gesellschaften von erheblicher Bedeutung sind. Ebenfalls im ersten Teil erfolgt eine Betrachtung dessen, was den spirituellen Kern der beiden in den Mittelpunkt gerückten Religionen im Wesentlichen ausmacht. Weiterhin soll die Frage behandelt werden, welche rechtlichen und gesellschaftlichen Normen-Systeme aus den beiden Religionen folgen und mit diesen quasi untrennbar verbunden sind.
Der zweite Hauptteil setzt sich kritisch mit den empirischen Evidenzen der Rückständigkeit muslimischer Gesellschaften auseinander, mit den religiösen, soziologischen, demografischen und ökonomischen Differenzen und Diskrepanzen, wie diese in einem direkten Vergleich gegenüber westlichen Gesellschaften festzustellen sind. Der Darstellung dieser empirischen Analyse folgt ein Versuch, die Ursachen für die aufgezeigte und schier hoffnungslose Rückständigkeit muslimischer Gesellschaften abzuleiten.
Den Fragen, wie die islamische Welt mit ihren Gesellschaften mit dem Phänomen der eklatanten Rückständigkeit umgeht, wie sie diese überhaupt einschätzt und bewertet, welche Ursachen sie hierfür als verantwortlich ansieht und welche Maßnahmen vorgebracht werden, um die vielfältigen Missstände abzustellen, widmet sich der dritte Hauptteil dieses Buches. Er soll überdies verdeutlichen, welches Selbstverständnis in der muslimischen Welt bei der Bewältigung der fundamentalen Aufgaben vorhanden ist und welche Rolle die westlichen Gesellschaften bei der Problemlösung spielen können.
Im vierten Hauptteil wird die unterschiedliche Verfasstheit westlicher und islamischer Gesellschaften dargestellt und einer vergleichenden Betrachtung unterzogen. Hierbei stehen das Recht und Rechtssystem, die Ökonomie und die Bildung im Fokus. Mit Blick auf die Ökonomie wird in diesem Hauptteil ein besonderes Augenmerk auf die strukturellen und individuellen Fähigkeiten zum Wettbewerb und der Wettbewerbs-mentalität gerichtet.
Der fünfte Hauptteil nimmt Anleihen aus zwei literarisch behandelten gesellschaftlichen Dystopien11 auf: einerseits aus dem hinlänglich bekannten Roman von George Orwell121984 und dem in der Öffentlichkeit weniger bekannten Roman von Boualem Sansal132084, in dem beschrieben wird, wie die Welt nach einer islamischen Übernahme aussähe. Vor dem Hintergrund dieser Dystopien wird die Realität gespiegelt und der Versuch unternommen, die besonderen Herausforderungen von Globalisierung und Digitalisierung auf die westlichen und muslimischen Gesellschaften zu betrachten und zu bewerten.
Der sechste und abschließende Hauptteil beschäftigt sich mit Fragen, die alle angehen – Muslime wie auch Menschen anderer Religionen und Atheisten. Wie kann der Umgang mit dem Islam und somit auch mit Muslimen gestaltet werden. Wie gehen wir mit unseren westlichen Werten um, die wir häufig genug Anderen zur Kopie empfehlen? Wie ernsthaft leben wir diese Werte? Und mit Blick auf die restriktiven Elemente des Islam müssen wir fragen, wie in den westlichen Gesellschaften der Begriff der Toleranz zu fassen ist. Muss im Zusammenleben mit Muslimen die Toleranz anders gefasst und neu definiert werden. Wie treten wir mit Muslimen und deren Vertretern in einen Dialog? Mit wem genau und mit welchen Zielsetzungen?
In den Schlussbetrachtungen werden die wesentlichen Erkenntnisse dieser Publikation zusammengefasst – und es wird eine Prognose gewagt: wohin werden sich die westlichen und die muslimisch geprägten Gesellschaften entwickeln? Wie wird er aussehen, der von Samuel Huntington prognostizierte Kampf der Kulturen.14 Wird dieser kriegerisch ausgetragen oder doch mit zivilisierten, friedlichen Mitteln? Welche Bedeutung kommt Religion in dieser Auseinandersetzung zu und welche Bedeutung wird Religion künftig überhaupt haben? Werden muslimische Gesellschaften an den aufgezeigten Widersprüchen zerrieben, werden muslimische Staaten gar zerbrechen und die in ihnen lebenden Menschen in ein Chaos stürzen? Ist ein Dialog zwischen den Kulturen überhaupt möglich und wenn ja, wie könnte dieser aussehen?
Und: ein konstruktiver Dialog zwischen diesen unterschiedlichen Kulturen erscheint unausweichlich und dringender geboten denn je. Denn wie heißt es in Johann Wolfgang von Goethes berühmter Gedichtsammlung West-östlicher Divan, die vor 200 Jahren, im August 1819, erstmalig erschien: „Wer sich selbst und andre kennt, wird auch hier erkennen: Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.“15
1 Koran, Sure 3, Vers 110.
2 Für die Juden bedeutet die These des „auserwählten Volkes“ mehr eine Verpflichtung zu gottgewolltem Handeln, als eine Bevorzugung, ein Privileg im weltlichen Sinn.
3 Im Rahmen dieser Publikation sollen die vorwiegend muslimisch geprägten Länder des Mittleren und Nahen Ostens sowie Nord-Afrikas unter dem Begriff MENA (MENA-Staaten oder MENA-Region) zusammengefasst werden. Das Akronym MENA steht für Middle-East and North-Africa.
4 Schröter, Susanne (2019); Politischer Islam. Stresstest für Deutschland., Gütersloh 2019: Gütersloher Verlagshaus. Vgl. hierzu auch Koopmans, Ruud (2019); Das verfallene Haus des Islam. Die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation und Gewalt, München: Verlag C.H.Beck
5 Marx, Karl (1844); Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: Deutsch-Französische Jahrbücher 1844, hrsg. von Karl Marx und Arnold Ruge, S. 71f.
6 Eagleton, Terry (2008); Der Sinn des Lebens, Sonderausgabe für die Süddeutsche Zeitung Edition 2018, München 2018, S. 44.
7 Vgl. Schenk, Susan (2009); Das Islambild im internationalen Fernsehen. Ein Vergleich der Nachrichtensender Al Jazeera English, BBC World und CNN International, Berlin, 2009: Frank & Timme Verlag
8 Vgl. hierzu insbesondere die Veröffentlichungen von Abdel-Samad, Hamed (2010); Der Untergang der islamischen Welt. Eine Prognose, München, 2010: Droemer Knaur Verlag; Derselbe (2015); Der islamische Faschismus. Eine Analyse, München: Verlag Droemer, Derselbe (2018); Integration. Ein Protokoll des Scheiterns, München: Verlag Droemer, Kelek, Necla (2015); Chaos der Kulturen. Die Debatte um Islam und Integration, Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 3. Auflage, Sarrazin, Thilo (2018); Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht , München: Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe.
9 Schröter, Susanne (2019); Politischer Islam. Stresstest für Deutschland. Abdel-Samad, Hamed (2016); Der Koran. Botschaft der Liebe - Botschaft des Hasses, München: Verlag Droemer. Vgl. auch Theveßen, Elmar (2016); Terror in Deutschland. Die tödliche Strategie der Islamisten, München/Berlin: Verlag Piper.
10 Abdel-Samad, Hamed (2016); Der Koran. Botschaft der Liebe - Botschaft des Hasses, München: Verlag Droemer, Derselbe (2015); Mohamed. Eine Abrechnung, München: Verlag Droemer; vgl. auch Diner, Dan (2016); Versiegelte Zeit. Über den Stillstand in der islamischen Welt, Berlin: List bei Ullstein Buchverlage, 5. Auflage. Vgl. auch Blume, Michael (2017); Islam in der Krise. Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug, Ostfildern 2017: Verlag Patmos
11 Eine Dystopie ist üblicherweise eine in der Zukunft spielende Erzählung, in der eine erschreckende oder nicht wünschenswerte Gesellschaftsordnung dargestellt wird.
12 Orwell, George (1994); 1984, Berlin, 1994: Ullstein Buchverlage, 47. Auflage.
13 Sansal, Boualem (2016); 2084. Das Ende der Welt., Gifkendorf: Verlag Merlin
14 Huntington, Samuel (1997); Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München-Wien: Europaverlag, 6. Auflage.
15 Goethe, Johann Wolfgang von (2005); Werke, Kommentare und Register, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Band 2, Gedichte und Epen II, München, 1981: Verlag C.H.Beck, 17. Auflage. Aus: Westöstlicher Divan, Aus dem Nachlass, S. 121.